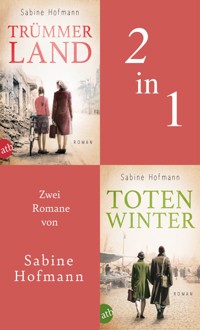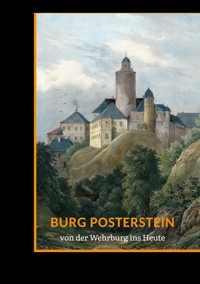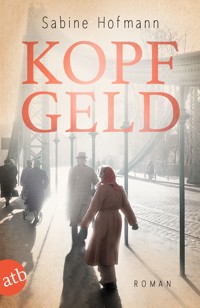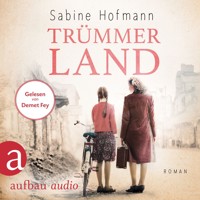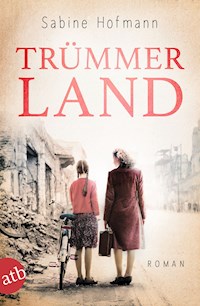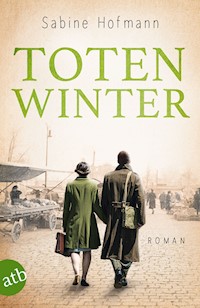
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edith - Eine Frau geht ihren Weg
- Sprache: Deutsch
Eine Frau in den Wirren der Nachkriegszeit.
Das Ruhrgebiet im Winter 1947. Die junge Edith, aus Ostpreußen nach Bochum geflüchtet, hat endlich eine Anstellung gefunden - bei Pohlmann, einem Rechtsanwalt, der allerdings offenbar in Schwarzmarktgeschäfte verwickelt ist. Als ein ehemaliger KZ-Häftling, der bei den Arbeitern der Region ein hohes Ansehen genießt, ermordet in einem Eisenbahnwaggon aufgefunden wird, deutet einiges daraufhin, dass Pohlmann in diesen Mordfall verwickelt ist. Edith beschließt der Sache nachzugehen – ohne zu ahnen, worauf sie sich einlässt ...
Deutschland unmittelbar nach dem Krieg – eindringlich und authentisch geschildert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Bochum im Hungerwinter 1947. Edith ist in den letzten Kriegstagen aus Ostpreußen geflüchtet und im Ruhrgebiet gestrandet. Man schlägt sich mühsam durch: Ediths Freundin Lilli verkauft als Hellseherin Hoffnung; Hella, die Tochter von Ediths Vermieterin, stiehlt Kohlen am Güterbahnhof, und Edith selbst arbeitet bei dem zwielichtigen Anwalt Pollmann. Als in einem verlassenen Eisenbahnwaggon die Leiche von Hannes Birkner, einem Arbeiterführer und ehemaligen KZ-Häftling, gefunden wird, führt eine Spur plötzlich auch zu Pollmann. Edith wird misstrauisch und versucht, mehr über den Mord an Birkner herauszufinden. Ein Journalist scheint einiges über Pollmanns undurchsichtige Geschäfte zu wissen: Leo Mantler flirtet hartnäckig mit ihr, doch kann sie ihm vertrauen?
Über Sabine Hofmann
Sabine Hofmann wurde 1964 in Bochum geboren, studierte Romanistik und Germanistik und ist promovierte Sprachwissenschaftlerin. Gemeinsam mit Rosa Ribas schrieb sie drei Romane über die Nachkriegszeit in Spanien. Heute lebt sie in Erbach im Odenwald.
Im Aufbau Taschenbuch erschien von ihr bisher: „Trümmerland“.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Sabine Hofmann
Totenwinter
Roman
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Dienstag, 28. Januar 1947, sechs Tage vor Birkners Tod
Kapitel 1
Freitag, 31. Januar 1947, drei Tage vor Birkners Tod
Kapitel 2
Kapitel 3
Nacht vom 1. auf den 2. Februar 1947, eine Nacht vor Birkners Tod
Kapitel 4
Montag, 3. Februar 1947, der erste Tag nach Birkners Tod
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Dienstag, 4. Februar 1947, der zweite Tag nach Birkners Tod
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Mittwoch, 5. Februar 1947, der dritte Tag nach Birkners Tod
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Donnerstag, 6. Februar 1947, der vierte Tag nach Birkners Tod
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Freitag, 7. Februar 1947, der fünfte Tag nach Birkners Tod
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Samstag, 8. Februar 1947, der sechste Tag nach Birkners Tod
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Sonntag, 9. Februar 1947, der siebte Tag nach Birkners Tod
Kapitel 36
Kapitel 37
Montag, 10. Februar 1947, der achte Tag nach Birkners Tod
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Donnerstag, 13. Februar 1947, der elfte Tag nach Birkners Tod
Kapitel 41
Kapitel 42
Freitag, 14. Februar 1947, der zwölfte Tag nach Birkners Tod
Kapitel 43
Kapitel 44
Donnerstag, 20. Februar 1947, der achtzehnte Tag nach Birkners Tod
Kapitel 45
Kapitel 46
Donnerstag, 3. April 1947, zwei Monate nach Birkners Tod
Kapitel 47
Nachwort
Danksagung
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Prolog
Hannes Birkner wurde zweimal erschossen. Das erste Mal in Berlin, das zweite in Bochum.
In Berlin erschießt man ihn zwischen den Ruinen eines Häuserblocks. Die Erde ist feucht, er spürt die Nässe durch den Stoff seiner Hose, als er sich steifbeinig auf die Knie sinken lässt, die Hände hinter dem Rücken zusammengebunden. Aus den Augenwinkeln sieht er seine Nachbarn, links sind es fünf, auf seiner Rechten zwei. Nebeneinander knien sie in einer Reihe. Auch kurz vor Schluss herrscht noch Ordnung.
Er lauscht auf den Geschützlärm. Vor zwei Tagen haben Schukows Truppen in Marzahn die Stadtgrenze überschritten. Die Rote Armee nimmt die Stadt in die Zange und rückt von Norden, Osten und Süden durch die Außenbezirke vor, hieß es heute Morgen im Flurfunk. Die Genossen befreien Straße für Straße, Stadtteil für Stadtteil. Nicht mehr lange, dann sind sie auch hier. Nicht mehr lange, aber wahrscheinlich zu lange für ihn. Und zu lange für die, die neben ihm knien.
Er versucht, in dem Getöse einzelne Geräusche auszumachen, zu erlauschen, ob sie sich dem zerstörten Häuserblock in Moabit nähern, in den ihre Bewacher sie geführt haben. Er kann das Knattern der Katjuschas erkennen, Stalinorgeln, die gleich mehrere Raketen abfeuern, hört Granatwerfer und in nicht allzu weiter Ferne Panzergeschütze. Rollen die Panzer schon durch die Straßen auf sie zu? Oder täuscht er sich, weil er es sich so sehr wünscht?
Er schaut zu einem Schuttberg. Meint, darauf einen Rotarmisten in seiner lehmfarbenen Uniform zu sehen, doch auch das ist Wunschdenken.
Ihre Bewacher sind zu neunt, einer für jeden Gefangenen und ein Obersturmführer, den er aus den Verhören kennt. Die Mühe, ihnen die Augen zu verbinden, haben sie sich nicht mehr gemacht. Die acht Bewacher haben hinter den Gefangenen Stellung bezogen, der Obersturmführer steht neben ihnen und gibt den ersten Befehl.
»Entsichern.«
Metallisches Knacken, achtfach. Nah, sehr nah, tausendmal näher als die Geschütze. Eine Handbreit hinter seinem Kopf.
»Feuer.«
Der Befehl kommt in demselben Moment, in dem er drüben auf dem Schutthaufen wieder eine Bewegung zu sehen meint. Er dreht den Kopf. Die Fata Morgana rettet ihm das Leben. Die Kugel streift sein Ohr und schlägt ein Stück Knochen aus seinem Kiefer. Der Stoß wirft ihn um. Als er auf dem feuchten Boden liegt und spürt, wie das Blut aus ihm herauspulst, wird ihm klar, worauf es jetzt ankommt. Er muss liegen bleiben, reglos. Ein Stück totes Fleisch zwischen anderen Stücken totem Fleisch.
Der Obersturmführer erteilt den nächsten Befehl.
»Kontrolle.«
Zwei der Männer gehen um sie herum. Er atmet möglichst flach. Doch die Männer sparen es sich, sich zu ihnen hinunterzubeugen und auf ihren Atem zu lauschen. Stattdessen treten sie zu. Wer noch nicht tot ist, wird schreien und sich krümmen. Er bleibt still, als die Stiefelspitze in seine Flanke tritt. Still und reglos. Ein Stück totes Fleisch.
Er lauscht. Die Geschütze sind schon ein Stück näher herangekommen. Dann wird er ohnmächtig.
Dienstag, 28. Januar 1947, sechs Tage vor Birkners Tod
1
Die oberste Decke war steifgefroren, sie zerknickte wie ein Stück Pappe, als Edith sie zurückschlug und sich unter dem Deckenhaufen hervorwand. Das Oberlicht in der Kammer, ein gutes Stück über ihrem Kopf, war dick mit Eis überzogen; trübe Schichten, in den vergangenen Wochen waren sie Stück für Stück zu einem buckligen Eispanzer gewachsen.
Spärliches Morgenlicht sickerte hindurch, gerade genug, dass sie die milchigen Atemwölkchen vor ihrem Mund sehen konnte.
Edith warf sich ihren Wintermantel über, denn die Kälte war schon dabei, sich durch die zwei Winterpullover, die lange Hose und das doppelte Sockenpaar zu beißen. Sie sah zu, dass sie möglichst schnell in die Wohnküche kam, in der sie zumindest ab und an heizten.
Tatsächlich brannte im Herd ein Feuer. Eine graue unförmige Gestalt stand davor und stocherte mit dem Schürhaken im Kohlenfach herum. Martha, eingehüllt in einen Wehrmachtsmantel, der ihr bis zu den Füßen reichte, um den Kopf einen dicken Schal geschlungen. Sie musste sie gehört haben, doch drehte sie sich nicht um, sondern beugte sich schwerfällig in ihren dicken Hüllen zu der Herdklappe hinunter und blies in die Glut.
Bis vor zwei Wochen hatte Martha noch kräftig über die Kälte geflucht. »Wir werden alle als Eisklumpen in einer Kiste landen, wenn es nicht bald wärmer wird. Das haben die Idioten von ihrem Heil-Hitler-Geschreie. Wir sitzen auf einem Trümmerhaufen und kriegen Eiszapfen am Hintern. Wenn die nicht endlich mehr Kohle rausrücken, gucken wir uns Ostern alle die Radieschen von unten an.«
Jetzt reichten ihre Lebensgeister nicht einmal mehr zum Fluchen. Wortlos schlug sie die Herdklappe zu und schlurfte zum Spülbecken. Das Metallgewinde des Wasserhahns quietschte, als sie daran drehte, ansonsten blieb es enttäuschend still. Kein Wasserstrahl ergoss sich freundlich plätschernd in das Becken. Irgendwo mussten die Leitungen wieder eingefroren sein.
Aber das war nichts Neues, und Martha hatte vorgesorgt, wie sie immer vorsorgte. Sie hievte einen Wassereimer auf den Küchentisch, durchstieß die Eisschicht mit einem Kochlöffel und füllte den Kessel auf dem Herd. Sie rückte beiseite, um Edith etwas Platz zu machen.
Einträchtig streckten sie die Hände aus, um sie zu wärmen. Edith betrachtete die beiden Händepaare über dem blank gewienerten Kochfeld. Marthas Finger waren rot, die Haut war rau, die Nägel waren eckig und kurz geschnitten, stumme Zeugen von Marthas Arbeit. Martha war Chefin einer Putzkolonne in einem Krankenhaus, oft packte sie selbst mit an. Am rechten Ringfinger steckte ein Ehering. Den Mann, der dazugehörte, hatte Edith noch nie gesehen. Er war in Russland verschollen, und Martha sprach so gut wie nie über ihn.
Ihre eigenen Hände waren hell und blank, die Fingernägel zu kleinen Mandeln gefeilt. Ihnen war die Arbeit ebenfalls anzusehen. »Eine feine Arbeit«, hatte Martha voller Hochachtung gesagt, als sie die Stelle bekommen hatte. Edith hingegen war der Ansicht gewesen, dass es keinen Grund gab, stolz darauf zu sein. Die Stelle war ihr mehr oder weniger vor die Füße gefallen, und sie hatte danach gegriffen, wie sie seit ihrer Flucht aus Ostpreußen nach allem griff, was sich anbot und versprach, beim Überleben behilflich zu sein.
Der Kessel begann zu pfeifen. Martha goss den Ersatzkaffee auf und reichte Edith eine Tasse mit einer zartbraunen, fast durchsichtigen Flüssigkeit. Die Tasse war warm, und Ediths Finger legten sich dankbar darum.
»Frühstück is nicht.«
Marthas erster Satz an diesem Morgen.
»Doch.«
Edith ging zu ihrer Tasche, die seit dem Vorabend auf einem der Küchenstühle stand, und förderte zwei Packungen Dauerbrot zutage. Martha reckte den Hals aus dem grauen Mantel hervor.
»Guck mal einer an. Aus Wehrmachtsbeständen.«
Sie kramte in der Küchenschublade nach einem Messer und halbierte die vorgeschnittenen Scheiben.
»Dein feiner Chef ist ein richtiger Zauberer«, sagte sie grimmig, während sie Edith eine der Scheibenhälften reichte.
So konnte man es auch nennen, dachte Edith und tunkte ihr Brot in den Kaffee. »Fein« hatte inzwischen bei Martha einen anderen Unterton bekommen. Die Hochachtung war verschwunden, fein besagte nicht mehr: »besser als die Plackerei im Krankenhaus«, sondern es bedeutete: »falscher Glanz« und »nicht ganz geheuer«. Damit mochte sie recht haben, doch es lohnte sich nicht, weiter darüber nachzudenken. Edith sparte sich eine Antwort und wechselte das Thema.
»Wo ist Hella?«, fragte Edith.
»Schläft. Gibt noch mal zwei Wochen Weihnachtsferien.«
Weihnachtsferien bis Mitte Februar, weil in den Schulen das Heizmaterial fehlte.
»Sie geht heute Nachmittag wieder zu den Gleisen. Kohlen sammeln.«
»Sammeln« war eine glatte Beschönigung. Inzwischen fuhren kaum noch Züge, und die Menge der Kohlen, die in den Kurven von den Waggons fielen und aufgelesen werden konnten, ging gegen null, wohingegen die Zahl der eifrigen Sammler immer größer wurde. Hella musste andere Quellen haben, und Martha ahnte es wahrscheinlich. Edith sagte: »Sie soll aufpassen. Die Polizei patrouilliert am Güterbahnhof.«
Martha schaute in ihre Tasse, die Stirn gefurcht von Sorgenfalten.
»Ich sag’s ihr.«
Edith war kurz vor dem Einmarsch der Roten Armee aus Ostpreußen geflohen und hatte in Bochum nach ihren Verwandten gesucht. Gefunden hatte sie niemanden mehr, und mit einer Einweisung des Wohnungsamts war sie bei Martha und ihrer Tochter eingezogen, im Gepäck etwas Kleidung, ein wenig ererbten Schmuck und einen Schwung Bücher: Romane und einen dicken Gedichtband, weil sie sich gedacht hatte: »Viel Literatur auf wenig Papier.«
Und dann war sie in der Arbeiterwohnung mit ihrer Wohnküche, dem Schlafzimmer und der winzigen Kammer geblieben und hatte sich in dem Provisorium eingerichtet. Wie ein Stück Treibgut, angespült und liegen geblieben, dachte sie manchmal. Ein Stück Treibgut, das nicht so recht weiß, wohin und bleibt, wo es ist, bis die nächste Welle kommt. Die alten Bindungen hatte sie verloren – die Eltern, den Verlobten, die Studienfreunde aus Berlin. Tot oder in alle Winde zerstreut.
Jetzt sagte Martha mit einer knappen Bewegung in Richtung Spiegel über dem Spülbecken: »Du zuerst? Ich hab heute verkürzte Spätschicht.«
Martha musste also erst am Nachmittag mit der Arbeit beginnen. Sie verschwand mit ihrer Tasse im Schlafzimmer und verkroch sich in ihr Bett, den wärmsten Ort in der Wohnung.
Edith feuchtete mit dem übrig gebliebenen Wasser aus dem Kessel einen Waschlappen an, trat ans Waschbecken und begann, sich von einer in zahlreiche Stoffschichten eingewickelten Mumie in eine adrette junge Dame zu verwandeln. Schließlich griff sie nach dem Kamm, sorgte dafür, dass eine elegant geschwungene blonde Welle ihre linke Stirnseite bedeckte, und steckte ihren Knoten im Nacken mit ein paar Haarnadeln fest. Sie nickte ihrem Spiegelbild zu. Fertig. Gerüstet für den Arbeitstag.
***
Bei Pollmann ging es an diesem Morgen ruhig zu. Wer nicht unbedingt unterwegs sein musste, um Nahrung oder Brennstoff zu besorgen, blieb zu Hause. Die Straßenbahnen fuhren unregelmäßig, weil häufig der Strom für die Oberleitungen fehlte. Treibstoff für private Pkw war so gut wie nie zu bekommen, die üblichen Transportwege fielen wegen der Kälte aus: Flüsse und Kanäle waren zugefroren, Eisenbahnweichen und Signale vereist. Das ganze Land lag wie erstarrt unter einer Eisdecke.
In ihrem Vorzimmer war es jedoch leidlich warm, in der Ecke bullerte ein Kohleofen vor sich hin.
Ihre Arbeit bei der Straßenbahngesellschaft hatte Edith vor vier Monaten verloren. Ihr Vorgesetzter hatte sie zu sich gerufen und ihr verkündet, dass er ihre Stelle einem versehrten Kriegsheimkehrer gegeben hatte, dessen linker Unterschenkel in einem Acker vor Moskau lag. Edith hatte verständnisvoll genickt und anschließend anderthalb Wochen lang Mörtel von Trümmersteinen geklopft, bis sie auf Pollmann gestoßen war. Oder besser gesagt: Pollmann war auf sie gestoßen. Er war an ihrer Seite aufgetaucht, als sie auf dem Schwarzmarkt an der Marienkirche mit einem englischen Soldaten um zwei Schachteln Zigaretten feilschte, hatte zugehört, und während sie die Zigaretten in ihrer Manteltasche verstaute, hatte er ihr ein Angebot gemacht: Er suche eine Sekretärin mit guten Englischkenntnissen, ob sie vielleicht Lust habe, die Stelle zu übernehmen. Sie hatte sofort beschlossen, die Gelegenheit beim Schopf zu packen, denn das Angebot war weitaus attraktiver, als Steine zu klopfen. Deshalb hatte sie durchblicken lassen, dass sie eine gut bezahlte Stelle habe, mit der sie zufrieden sei, trotzdem, hatte sie verkündet, sei sie bereit, seine Offerte in Erwägung zu ziehen. Pollmann hatte bedächtig genickt, doch hatte er sie vermutlich durchschaut, zumindest hatte sein amüsiertes Grinsen darauf hingedeutet.
Wenig später hatte sie angefangen, bei Pollmann zu arbeiten. Ihr war von Anfang an klar, dass Pollmann sie nicht wegen ihrer Fähigkeiten als Sekretärin engagiert hatte. Sie konnte zwar eine Schreibmaschine bedienen, allerdings würde sie mit der Zahl ihrer Anschläge pro Minute keinen Ehrenpokal gewinnen. Was Stenographie anging, hatte sie ihr eigenes System, das vermutlich jedem Handelslehrer die Tränen in die Augen treiben würde. Ihr Englisch hingegen war alles andere als schlecht, dafür hatten das neusprachliche Mädchengymnasium in Allenstein, ein paar Semester Anglistik in Berlin und der Unterricht eines verrückten Engländers gesorgt, den seine Begeisterung für den Nationalsozialismus in die Hauptstadt des großdeutschen Reichs getrieben hatte. Nach und nach fand sie heraus, warum Pollmann sie eingestellt hatte. Ein Grund war ihr Englisch, ein weiterer, dass sie das war, was allgemein als vorzeigbar galt. Denn Vorzeigen und Repräsentieren waren ein entscheidender Baustein seines Geschäftsmodells.
An diesem Morgen war der junge Hertel der einzige Besucher in Pollmanns Kanzlei. Mit federnden Schritten kam er aus Pollmanns Besprechungszimmer und überquerte beschwingt den Teppich vor ihrem Schreibtisch. Pollmann war ausgezeichnet darin, seine Besucher in gute Laune zu versetzen und ihnen zu versichern, dass ihre Hoffnungen sich erfüllen würden, auch wenn sich Verfahren verzögerten oder nicht ganz nach Wunsch liefen. Das war ihm offensichtlich auch bei dem jungen Hertel gelungen. Vor einer halben Stunde, bei seiner Ankunft hatte der Juniorchef von Hertel und Sohn nervös seine Handschuhe geknetet, während sie seinen Wintermantel an der Garderobe aufhängte, nun aber strahlte er wie ein Honigkuchenpferd.
»Schön wie der junge Morgen!«, sagte er hochgestimmt.
Edith bedankte sich freundlich für das Kompliment und lächelte ihm zu. Auch das gehörte zu ihrer Arbeit – zuvorkommend sein, die Launen der Mandanten auffangen. In ihrem Vorzimmer war sie eine Art Ablage für Stimmungen aller Art. Hoffnung und Freude fanden ihren Ausdruck in liebenswürdiger Ansprache und enthusiastischen Komplimenten, Sorge und Zweifel brachen sich Bahn in missmutigen Bemerkungen über die Versorgungslage, die Kälte oder die Welt im Allgemeinen oder, im schlimmsten Fall, in ungeduldigen Zurechtweisungen an ihre Adresse, die sie mit frostiger Höflichkeit, der dünnen Rüstung der dienstbaren Geister, abwehrte.
»Herr Pollmann ist sicher, dass es mit der Verlängerung des Permits für den Betrieb keine Probleme geben wird«, erklärte ihr Hertel gut gelaunt. Die Erleichterung stand ihm ins Gesicht geschrieben. Er und sein Vater besaßen eine kleine Werkzeugfabrik.
»Das ist ja eine erfreuliche Nachricht.«
»In der Tat. Wir sind wirklich froh, dass Herr Pollmann weiß, wie man diese Engländer anpacken muss, damit sie uns die verflixte Betriebserlaubnis verlängern.«
»Herr Pollmann tut, was er kann«, sagte Edith und bedachte Hertel mit einem weiteren Lächeln.
Hertel sah zufrieden auf sie herab.
»Es ist immer eine Freude, Sie hier zu sehen. Auch wenn ich mich frage, warum eine wunderbare Frau wie Sie arbeiten muss. Aber die Zeiten sind ja schwierig.«
Edith unterdrückte einen Seufzer. Hertels Logik war fragwürdig. Wunderbare – was immer er damit meinte – Frauen bekamen einen Ehemann und hatten es nicht nötig zu arbeiten, die anderen Frauen hingegen gingen leer aus und mussten ihr Leben lang für sich selbst sorgen. Allerdings stand zu befürchten, dass die tüchtigen Männer, die es übernahmen, für die wunderbaren Frauen zu arbeiten, allzu stolz darauf waren, sich mit ihrer Tüchtigkeit eine solche Frau leisten zu können und die wunderbaren Frauen den Besitzerstolz irgendwann zu spüren kamen.
»Ich frage mich, wieso ein so wunderbarer Mann wie Sie arbeiten muss«, entgegnete sie und lächelte weiter.
Hertel junior runzelte die Stirn, dann beschloss er, ihre Antwort als Scherz einzusortieren und den »wunderbaren Mann« als Kompliment zu nehmen, zumindest grinste er und nickte zu ihr herab.
Er verabschiedete sich. Edith stand auf, um ihm in den Mantel zu helfen. Sein breites Lächeln verschwand erst, als er sich an der Garderobe seinen Schal um das Gesicht wand und nur noch die Augenpartie sichtbar war. Immer noch gut gelaunt, zwinkerte er ihr zu und machte sich auf den Weg in die Kälte.
***
Eine Stunde später rief Pollmann nach Edith.
Bei ihrem Eintreten saß er an seinem Schreibtisch und hatte den Kopf über eine Akte gesenkt.
»Einen Augenblick noch«, murmelte er, »ich muss gerade noch …« Was er musste, behielt er für sich. Sie nahm Platz und schickte sich an zu warten.
Hinter Pollmann ging eine Fensterreihe auf den angrenzenden Stadtpark hinaus, so dass Pollmann sich im Gegenlicht befand, sein Gegenüber hingegen von der Helligkeit, die durch die Fenster kam, ausgeleuchtet wurde. Doch die Umrisse seines mächtigen Schädels, die großflächigen Wangen und die in kühnem Bogen geschwungene Nase waren trotzdem gut zu erkennen.
Edith war sich sicher, dass die Sitzordnung auch eine Hinterlassenschaft von Pollmanns Vater war. Pollmann hatte sie beibehalten, so wie er die Einrichtung der gesamten Kanzlei übernommen hatte: Möbel aus dunklem Holz, hohe Regale an den Wänden rechts und links des Schreibtisches, voll mit Gesetzbüchern und ordentlich aufgereihten Jahrgängen juristischer Fachzeitschriften, Teppiche auf Eichenparkett. Alles wirkte solide und gesetzt.
Pollmann las noch ein Stück, dann hob er den Kopf, klappte die Akte zu und klopfte mit dem Knöchel darauf.
Bedächtig sagte er: »Wenn Hertel zwei Arbeiter weniger hätte, würde seine Werkzeugfabrik als kleiner Betrieb zählen und er könnte den Permit bei der hiesigen Industrie- und Handelskammer beantragen, statt sich direkt an die Engländer zu wenden.«
Hertels Schwierigkeiten bestanden also weiterhin. Heute hatte er Hertel lediglich hingehalten, und zwar so geschickt, dass der junge Mann zu dem ebenso falschen wie tröstlichen Schluss gekommen war, seine Probleme seien so gut wie gelöst.
Nachdenklich fuhr Pollmann fort: »Das ließe sich ohne Weiteres machen. Die beiden Hertels müssten nur sich selbst aus der Liste der Beschäftigten streichen. Auf diese Weise würde ihnen die Betriebserlaubnis ohne Probleme erteilt werden.«
Auch das war Teil ihrer Arbeit. Manchmal holte sie Pollmann, damit sie Bedenken und Widerspruch formulierte, den Part der Teufelsadvokatin übernahm. Pollmann nutzte ihre Einwände, um seine Gedankengänge zu prüfen, zog Schlüsse, verwarf sie oder behielt sie bei.
»Können Sie das Hertel und Sohn ohne Weiteres vorschlagen? Es kommt mir nicht ganz«, sie zögerte gebührlich, bevor sie »legal vor« sagte.
»Aber nein, ich würde ihnen nichts vorschlagen. Ich würde ihnen die Sachlage schildern, und einer von beiden, Vater oder Sohn, würde von selbst darauf kommen, dass sie die Zahl der Angestellten in ihrem Verzeichnis verringern müssten. Mehr oder weniger vorsichtig und verklausuliert würden sie mich fragen, ob Derartiges möglich sei, und sehr vorsichtig und sehr verklausuliert würde ich antworten, dass die Möglichkeit natürlich bestehe.«
Die Übermittlung des nicht ganz legalen Ratschlags war also nicht das Problem.
»Wo liegt denn die Schwierigkeit?«, fragte sie.
»Wir hätten weniger zu tun.«
Das war also der springende Punkt. Kein aufwändiges Verfahren mit Beratungen, Anträgen, Ablehnungen und Einsprüchen und dem entsprechenden saftigen Honorar.
Sie waltete ihres Amtes und brachte einen Einwand vor: »Irgendwann aber benötigen Hertel und Sohn wieder einen Anwalt für ihren Betrieb.«
Pollmann fuhr mit der Hand durch die Luft, der goldene Siegelring an seinem kleinen Finger blitzte.
»Falls der Betrieb nicht bankrott geht, weil er keine Kohle mehr für seine Schmiedeöfen hat. Falls er nicht demontiert wird. Oder falls ihn die Sozis nicht verstaatlichen.«
»In jedem Fall werden sie Ihnen dankbar sein und Sie weiterempfehlen. Falls die Fabrik weiterläuft, haben Sie einen Mandanten gewonnen.«
Pollmann betrachtete sie amüsiert mit schief gelegtem Kopf.
»Sie plädieren also für Hypotheken auf eine unsichere Zukunft.«
Edith dachte bei sich: Ja, das tue ich. Zumindest was dich anlangt. Wenn man eine Anwaltskanzlei in bester Lage geerbt hatte und das Mandantenportfolio seines Vaters dazu, kann man sich getrost auf die Zukunft verlassen. In einem Fall wie ihrem war es jedoch besser, von Tag zu Tag zu leben, zu greifen, was sich gerade anbot, ob es nun eine Stelle in einer Anwaltskanzlei war oder eine Packung Dauerbrot.
Laut sagte sie: »Ich plädiere für Weitsicht. Ist das nicht Ihre Rede?«
Pollmann sprach ständig von zukünftigen Entwicklungen und machte Pläne. Wenn er über die Gegenwart redete, verkündete er mit weit ausholenden Gesten, dass es eine Zeit war, in der sich bedeutende Dinge entschieden. Die Zusammenlegung der britischen und der amerikanischen Zone zur Bizone am Anfang des Jahres hieß für ihn, dass die Wege von Amerikanern und Russen sich trennen und sie in ihrer Deutschlandpolitik keine gemeinsame Sache mehr machen würden.
»Weitsicht?«, wiederholte Pollmann nun und schüttelte seinen mächtigen Kopf. »Aber nein. Ich sage lediglich, dass man sehr genau hinschauen muss, um herauszufinden, wie sich die Dinge hier entwickeln werden.«
»Ist das nicht Weitsicht?«, fragte Edith maliziös.
Er wischte ihren Einwand mit einer Handbewegung beiseite.
»Jetzt entwickeln sich die Dinge nicht sonderlich gut«, sagte er ärgerlich. Die Hand mit dem Siegelring flog durch die Luft, als bekämpfte er eine unsichtbare Armee. »Die Leute sind aufgebracht. Die Arbeiter protestieren, weil sie nichts zu essen haben. Die Roten wittern Morgenluft und kommen aus ihren Löchern. Wissen Sie, was der Ober-Sozi kürzlich verkündet hat?«
Edith wusste es, aber sie hütete sich zu antworten. Sie hatte keinesfalls vor, in Pollmanns Büro Kurt Schumachers Reden zu deklamieren. Zudem schien Pollmann keine Antwort zu erwarten, denn er deklamierte selbst.
»Die Schlüsselindustrien gehören in die Hand des Volkes, nie wieder dürfen Großgrundbesitz und Schwerindustrie in der Hand von wenigen liegen.« Pollmann ahmte den Ton des SPD-Vorsitzenden nach. Dann kehrte er zu seiner gewöhnlichen Stimmlage zurück. »Wohin soll das wohl führen? Schauen Sie sich doch diese Briten mit ihrer Labour-Regierung an! Zu Hause haben sie gerade ihre Zechen verstaatlicht. Wer weiß, was sie hier treiben werden! Verstaatlichungen – das hat uns gerade noch gefehlt!«
Pollmann hatte sich aufgerichtet.
»Nun haben sie aber die Amerikaner an ihrer Seite«, wandte Edith ein. »Ich glaube kaum, dass sich die Amerikaner mit Verstaatlichungen von Zechen oder Industrieanlagen anfreunden können.«
Pollmann ließ sich wieder gegen die Lehne seines Schreibtischstuhls zurücksinken.
»Wer weiß, wer weiß …«
Er war zufrieden mit ihrem Beitrag. Er klopfte abermals auf die Akte, hielt dann inne und schob sie mit einer entschiedenen Bewegung zu den anderen auf den Stapel.
»Wie dem auch sei. Ich denke, Sie haben recht, was Hertel angeht. Ich werde die beiden auf die Möglichkeit hinweisen, den Permit einfacher zu bekommen. Und mir die ewige Dankbarkeit von Vater und Sohn Hertel sichern.«
Er zwinkerte ihr zu. »Ich setze auf die Zukunft und zeige Fortuna, dass ich fest an sie glaube.«
Er drehte sich auf seinem Schreibtischstuhl zur Seite, das Morgenlicht fiel ihm ins Gesicht. Seine Augen leuchteten. Der Anflug von Ärger war vorüber, die trübe Sorge vor den Sozialisierungen der Betriebe war offenbar einer glänzenden Aussicht gewichen.
»Am Donnerstag habe ich einen Außentermin und hätte Sie gerne dabei.«
»In einer Zeche?«
»Nein.«
Edith tat ihm den Gefallen und fragte nach, wenngleich sie ahnte, dass sie keine Antwort bekommen würde: »Wo denn?«
»Das werden Sie dann sehen.«
Das Glitzern in seinen Augen war reiner Triumph.
»Ich benötige Ihre Hilfe, Sie sollen für mich ein Gespräch protokollieren.«
Pollmann brauchte niemanden zum Protokollieren. Sie sollte seinen Eine-Frau-Tross bilden. Graues Kostüm, feine Strümpfe, Aktentasche. Und der gute Wintermantel mit dem Pelzkragen, der immer noch manierlich aussah, ein Überbleibsel aus besseren Tagen.
Offensichtlich war Pollmann das gelungen, was er einen Coup nannte. Ein bedeutendes Gespräch, ein wichtiges Mandat. Die Hertels mit ihrer Werkzeugfabrik waren nicht schlecht. Aber es hatte den Anschein, als hätte Pollmann nun etwas Größeres am Haken. Er stand auf.
»Der Ort wird Sie überraschen«, erklärte er mit einem letzten Glitzern in den Augen.
Freitag, 31. Januar 1947, drei Tage vor Birkners Tod
2
»Bitte sehr.«
Edith war pünktlich gewesen, wie Pollmann es verlangt hatte.
Hansen wartete neben dem Auto und hielt ihr den Wagenschlag auf. Er war ein großer und kräftiger Mann mit einem kantigen Gesicht, breiten Schultern, etwas Bauch und ruhigen, sicheren Bewegungen. Ein stattlicher Mann, hätte ihre Mutter gesagt, die ihr Leben lang alles und jeden immer gern beurteilt und kategorisiert hatte. Doch ihre Mutter war tot, begraben in der Familiengrabstätte in Allenstein. Ein gutes Jahr hatte sie sie gepflegt, nachdem sie auf Bitten ihres Vaters aus Berlin zurückgekehrt war, und die Urteile ihrer Mutter waren längst Makulatur.
Als Edith an ihm vorbeiglitt, um auf der hinteren Sitzbank Platz zu nehmen, wehte der Geruch nach Pfeifentabak aus Hansens Winterkleidung sie an.
Bevor der Chauffeur die Tür der Limousine hinter ihr schloss, griff er in die Jackentasche und reichte ihr ein Päckchen. »Ist gestern abgefallen«, sagte er und tippte an den Rand seiner Schirmmütze.
Edith schnupperte. Seife. Pollmann saß neben ihr im Fond des Wagens und sah wohlwollend zu, während sie das Päckchen in ihre Handtasche gleiten ließ.
Hansen ließ den Wagen an, der trotz der Kälte sofort begann, gleichmäßig vor sich hin zu schnurren, ein Wanderer W23, dunkelgrau, geräumig, so gediegen wie Pollmanns Arbeitszimmer und ebenfalls ein Erbstück. Woher Pollmann das Benzin hatte, konnte Edith nur vermuten: aus Quellen, die mit Sicherheit nicht ganz so gediegen und solide waren wie das Auto und Pollmanns Kanzleieinrichtung.
Der Wagen setzte sich in Bewegung, und sie durchquerten die zerstörte Stadt. Auf den Straßen war kaum jemand zu sehen. Die wenigen Menschen, die unterwegs waren, waren bis zu Unkenntlichkeit vermummte Gestalten, die eilig durch die Trümmerlandschaft huschten. Kellerbewohner, die nur hervorkrochen, um Unaufschiebbares zu erledigen und danach schleunigst wieder in ihren Kellern und Höhlen zu verschwinden.
»Sieh an«, sagte Pollmann. Er las die Inschrift vor, die auf der langen Backsteinmauer stand, die parallel zur Straße verlief. »Tod den Schiebern. So ist es.« Pollmann klang zufrieden.
Edith wunderte sich. Schwarzhändler gehörten in der Regel nicht zu denjenigen, denen Pollmann eine heftige Abneigung entgegenbrachte. Der nächste Schriftzug gefiel ihm weit weniger.
»Da, schon wieder!« Sein Finger in dem feinen Kalbslederhandschuh zeigte empört auf die Mauer. Über acht Meter zog sich die Schriftzeile hin. »Bizonesien = Hungertod! Einheit Deutschlands = Frieden und Brot!« hatte jemand dort in großen weißen Lettern hingepinselt. Es war die vierte Inschrift dieser Art auf ihrem Weg.
»Also ob mit der Einheit Deutschlands diese verdammte Kälte verschwinden würde. Und selbst wenn: Sie brauchen gar nicht zu denken, dass ihnen die Russen mehr zu essen geben würden. Ganz im Gegenteil.«
Edith schaute Pollmann von der Seite an. Sie bemerkte: »Mit der gegenseitigen Hilfsbereitschaft steht es ja nun auch nicht zum Besten. Heute hieß es in der Zeitung, dass Bayern sich weigert, Fett und Fleisch in die britische Zone zu liefern.«
»Propaganda der Sozi-Zeitungen«, erklärte Pollmann. Er wandte sich an den Chauffeur.
»Was denken Sie, Hansen?«
»Ich teile Ihre Ansicht.«
Hansen schlug das Lenkrad ein, um einem Schlagloch auszuweichen.
»Tatsächlich?« Pollmann schien enttäuscht.
»Von den Russen ist nichts Gutes zu erwarten«, erwiderte Hansen knapp. Er steuerte schweigend wieder geradeaus. Mehr wollte er offenbar dazu nicht sagen.
Pollmann ließ nicht locker. »Was denken Sie, Hansen? Worauf wird das alles hinauslaufen?«
»Das kann ich nicht sagen«, bekam er brummig zur Antwort. »Keine Ahnung, wohin das alles führen wird.«
Hansen bog nach links ab. Inzwischen hatten sie die Stadtgrenze nach Essen überquert, eine Dreiviertelstunde ging es über holperige Straßen Richtung Südwesten.
Edith lächelte in sich hinein. Anders als sie war Hansen nicht bereit, mit Pollmann zu diskutieren und die Rolle des Widerparts zu übernehmen, der Einwände aussprach und Gegenargumente brachte. Hansen schien sich auf seine Aufgaben zu beschränken: Er fuhr Pollmanns Wagen und organisierte, was nötig war: Benzin, manchmal auch Kohlen und wohl auch das Stückchen Seife, das er ihr zugesteckt hatte.
Die Häuserzeilen hörten auf, die Grundstücke wurden größer, hinter den kahlen Bäumen war das eine oder andere Haus zu sehen. Sie fuhren durch einen Wald, frische Baumstümpfe zeigten an, dass die Menschen sich da und dort mit Feuerholz versorgt hatten. Das Gelände wurde hügeliger.
Schließlich bogen sie von der Straße ab und hielten an einem Torhaus am Eingang zu einem immensen, von einer hohen Mauer umfriedeten Park.
Aus dem Torhaus kam ein britischer Soldat, eine Maschinenpistole hing ihm über der Brust. Ohne auf Pollmanns Anweisung zu warten, ging Hansen auf ihn zu und reichte ihm ein Dokument. Der Brite hatte etwas zu beanstanden, seine Haltung straffte sich, er deutete auf den Schein und schüttelte den Kopf. Hansen richtete sich auf und streckte mit einer herrischen Geste die Hand aus, als ob er das Papier an sich reißen wolle, dann schien er sich zu zügeln und ließ den Arm wieder sinken. Er sagte etwas zu dem Soldaten, der ihm daraufhin den Schein zurückreichte. Hansen zeigte seinerseits auf eine Stelle, der Wachsoldat beugte sich vor, las noch einmal, nickte und öffnete den Schlagbaum für sie.
Eine lange geschwungene Auffahrt führte an winterkahlen Bäumen vorbei auf ein großes Gebäude aus hellem Stein zu. Hinter dem Gebäude senkte sich das Terrain ab, weiter unten war die schneebedeckte Fläche eines Sees zu sehen.
Sie hielten auf den rechten Teil zu, einen dreistöckigen Kasten, weitaus größer als der Gebäudeteil auf der Linken. Acht kannelierte Säulen stützten ein großes Vordach. Darunter lag der Haupteingang, zwei hohe dunkle Türflügel.
Edith war beeindruckt. Trotzdem fragte sie spöttisch: »Ist es Ihnen gelungen, die Familie Krupp als Mandanten zu gewinnen?«
»Wo denken Sie hin, von den Krupps wohnt keiner mehr hier. Sie haben sich auf ein Landgut irgendwo in Österreich zurückgezogen. Außer Alfried natürlich.«
Natürlich, Alfried war nicht auf dem Landgut. Edith hatte das Foto von seiner Verhaftung in einer Zeitung gesehen. Alfried Krupp hockte vor den Säulen der Villa Hügel auf der Rückbank eines amerikanischen Jeeps, die gefesselten Hände elegant über die Knie gelegt, gekleidet in einen dunklen Anzug, Hemd und Krawatte, auf dem Kopf ein Homburg, am kleinen Finger der rechten Hand ein Ring. Vor ihm saß ein GI mit Stahlhelm, an seiner Seite hockte ein weiterer GI hinter einem am Wagen justierten Maschinengewehr. Krupp machte den Eindruck, als glaubte er sich von Wilden entführt, und meinte nun, am Lagerfeuer eine gute Figur machen zu müssen. Inzwischen saß er in Landsberg ein und wartete auf seinen Prozess.
Pollmann erklärte ihr, dass in dem Gebäude nun die North German Coal Control residiere. Dann sagte er: »Ich habe einen neuen Mandanten, Herrn Zielicke. Halten Sie hier, Hansen.«
Hansen stoppte das Auto unter den schwarzen Ästen einer Kastanie.
Pollmann redete weiter. »Ihm gehört eine Zeche in Herne. Die Briten haben sie wie alle anderen beschlagnahmt, sie untersteht jetzt der North German Coal Control.«
»Und nun braucht er einen Permit, um die Zeche zu betreiben«, sagte Edith.
»Nein, Zielicke braucht keinen Permit. Die Zechen fördern ja alle, damit die Kohle für die Reparationsleistungen exportiert werden kann. Die Briten haben nicht genug Leute, um die Führungsebenen zu besetzen oder die Produktion auch nur engmaschig zu überwachen. Neuerdings heißt es, dass sie die Firmen Treuhändern überantworten wollen, bis endgültig geklärt ist, was mit ihnen geschehen soll.«
Und Herr Zielicke möchte die Treuhänderschaft für seine Zeche übernehmen, dachte Edith.
»Und Herr Zielicke möchte, dass sein Schwiegersohn die Treuhänderschaft für die Zeche übernimmt.«
»Darauf lassen sich die Briten ein? Sie haben die Zechen doch nicht beschlagnahmt, um sie ihren alten Eigentümern zurückzugeben.«
Pollmann freute sich, dass er ihr etwas erklären konnte.
»Wer soll denn sonst die Unternehmen leiten? Bei Siemens haben die Amerikaner die Treuhänderschaft dem alten Finanzvorstand übergeben.«
Ein Auto hielt vor den Säulen, ein deutsches Zivilfahrzeug.
»Da ist er. Fahren Sie.«
Hansen ließ den Motor an, ihr Wagen rollte ebenfalls vor den Eingang.
»Lassen Sie uns aussteigen.«
Hansen stieg aus und öffnete seinen Passagieren die Wagentüren. Pollmann strebte auf einen kleinen kräftigen Mann in einem marineblauen Wintermantel zu, der gerade seinem Wagen entstiegen war und nun den Eingang von Villa Hügel in Augenschein nahm. Er nickte beifällig, seine Erwartungen schienen erfüllt worden zu sein.
Pollmann begrüßte ihn und stellte Edith vor. Ihr wurde ebenfalls eine Musterung zuteil, und auch ihr Anblick wurde mit beifälligem Nicken quittiert. Der Eine-Frau-Tross hat seine erste Aufgabe erfüllt, dachte Edith.
Gemeinsam schritten sie durch die hohe Tür, Pollmann einen halben Schritt voran, energisch und selbstgewiss, als betrete er jeden Tag die weitläufige Halle.
Viel weiter kamen sie allerdings nicht. Ein Wachsoldat stellte sich ihnen in den Weg und fragte sie nach ihrem Anliegen. Pollmann erklärte ihm in passablem Englisch, dass sie einen Termin beim stellvertretenden Direktor der Kontrollbehörde hätten. Daraufhin schickte der Wachsoldat sie zu einem Empfangstisch, hinter dem ein junger Mann in Uniform saß. Das Abzeichen auf seinem Ärmel wies ihn als Unteroffizier der Zivilverwaltung der Militärregierung aus. Pollmann wiederholte, was er soeben dem Wachsoldaten erklärt hatte.
Der Unteroffizier verkündete, dass der Brigadier leider nicht im Hause sei. Pollmann insistierte höflich. Er bekam zur Antwort: »Das würde mich erstaunen, Sir, denn der Brigadier ist jeden Dienstag in Düsseldorf bei einer Sitzung.«
Pollmann wirkte fassungslos. »Das kann doch nicht wahr …« Er brach ab und sagte: »Bitte zeigen Sie uns die Terminbestätigung, Fräulein Marheinecke.«
Es gab keine Terminbestätigung, zumindest nicht in den Papieren, die Edith auf Pollmanns Geheiß eingepackt hatte.
Trotzdem öffnete sie die Aktentasche. Der Brite betrachtete sie ungerührt, während sie eine Mappe hervorzog und darin blätterte. Teil zwei ihrer Arbeit begann. Sie achtete darauf, dass der Soldat die Schreiben mit dem Emblem der britischen Militärregierung zu Gesicht bekam. Sie gehörten zu einem anderen Fall, aber das würde der Unteroffizier auf die Schnelle nicht erkennen können.
Zerknirscht sagte sie: »Da ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich fürchte, ich habe die falschen …« Sie stockte und biss sich auf die Unterlippe.
Pollmanns Mundwinkel zuckte, bevor er mit schneidender Stimme sagte: »Fräulein Marheinecke!«
»Es tut mir leid, Herr Pollmann.« Sie schlug demütig die Augen nieder.
Durch die gesenkten Wimpern registrierte sie, dass der Unteroffizier sie peinlich berührt ansah. Pollmann sagte zu ihm: »Wir sollten den Termin nicht ungenutzt verstreichen lassen. Sicher lässt sich eine Lösung finden.«
»Ich sagte Ihnen doch, der Brigadier ist nicht im Hause.«
Pollmann erwiderte: »Ich könnte mir vorstellen, dass der Brigadier nicht sehr erfreut sein wird, wenn wir unverrichteter Dinge wieder gehen. Ich hatte bislang immer den Eindruck, dass dem Brigadier am reibungslosen Ablauf der Kohleförderung gelegen ist.«
Zielicke, der ihre Unterhaltung nicht verstand, bedachte sie mit einem besorgten Blick. Pollmann redete weiter.
»Die Zechen meines Mandanten gehören zu denen, deren Förderleistung stets den Quoten entspricht und die damit einen wichtigen Beitrag zu den Reparationszahlungen leisten.«
»So wie die Zechen im Ruhrgebiet immer einen wichtigen Beitrag geleistet haben«, gab der Brite zurück und verzog den Mund.
Edith wusste, was er meinte. Ohne die Zechen hätte die Waffenschmiede des Reiches nicht arbeiten können. Ohne Kohle kein Feuer in den Hochöfen, ohne Feuer kein Stahl. Ohne Stahl keine Panzer.
Pollmann ging auf die Bemerkung nicht ein.
»Gewiss wird er sehr enttäuscht sein, uns verfehlt zu haben.« Er setzte bedeutungsvoll hinzu: »Gerade in dieser schwierigen Situation.«
Der Unteroffizier hinter dem Pult traf eine Entscheidung und griff nach dem Telefon.
Wenige Minuten später erschien ein Lieutenant.
»Lieutenant McCarson, Stellvertreter von Brigadier Noel«, erklärte Pollmann Zielicke halblaut.
Zielicke machte einen enttäuschten Eindruck, da er erwartete hatte, mit dem stellvertretenden Direktor der Behörde zu sprechen, doch er erhob keine Einwände und folgte dem Offizier in ein Büro im ersten Stock des Gebäudes.
***
Eine Dreiviertelstunde später saßen sie wieder im Auto. Nachdem sie das Torhaus passiert hatten, sagte Pollmann gut gelaunt: »Sie haben Ihre Sache großartig gemacht.«
Edith bedankte sich trocken und fügte hinzu: »Ich hätte es vorgezogen, wenn Sie mich vorher eingeweiht hätten.«
Die Rolle, die Pollmann ihr zugewiesen hatte, war undankbar, die nachlässige, aber hübsche Sekretärin, die von ihrem Chef für dessen Fehler heruntergeputzt wird.
Pollmann lachte.
»Sie waren einfach wundervoll!«
»Was hat Sie so sicher gemacht, dass wir mit dem Stellvertreter des Stellvertreters sprechen würden?«
Sie hatten eine halbe Stunde mit dem Lieutenant verbracht, er hatte Zielickes Antrag entgegengenommen, sich seine Ausführungen angehört, die Edith ins Englische übersetzt hatte, hatte höflich genickt, schließlich Zielickes Papiere gelocht und in einen Aktendeckel gesteckt.
»Sicher war ich nicht, aber die Chancen standen gut. Ein kalkuliertes Risiko sozusagen.«
Pollmann ließ sich lächelnd in die lederne Polsterung der Rückbank sinken.
»Wenn der stellvertretende Direktor da gewesen wäre, wären wir kaum über die Halle hinausgekommen. Einzelne Zechenbesitzer empfängt er nicht. Doch dienstags finden immer diese Ausschusssitzungen im Stahlhof in Düsseldorf statt, und da sie nicht ganz sicher waren, ob ich nicht doch die Wahrheit gesagt habe, haben sie nicht gewagt, uns wieder nach Hause zu schicken. Besser nicht Gefahr laufen, einen Vorgesetzten zu verärgern.«
»Und wenn Ihr Plan nicht aufgegangen wäre?«
»Hätte ich Pech gehabt. Ich hätte Zielicke erklären müssen, dass der stellvertretende Direktor aufgrund einer aktuellen Krise unabkömmlich ist.«
»Zielicke hatte jedoch den Eindruck, betrogen worden zu sein. Offenbar hat er ja erwartet, mit einem Chef der North German Coal Control zu sprechen.«
»Mag sein. Doch er ist sein Anliegen losgeworden, und wer weiß, vielleicht wird er sogar Erfolg haben. Und es gibt eine Akte, auf die wir beim nächsten Besuch verweisen können.«
Er fügte hinzu: »Zielicke hatte einen Anwalt, aber er ist unzufrieden mit ihm, weil er meint, dass dieser sich zu wenig für ihn einsetzt. Jetzt hat er einen neuen.«
Zielicke mit seinen zwei Zechen war eine andere Klasse als die Hertels mit ihrer Werkzeugfabrik und den fünfundzwanzig Arbeitern. Darauf also war Pollmann aus: nicht nur kleinere Unternehmer, sondern größere Fische mit den entsprechenden Honoraren und dem entsprechenden Einfluss.
Neugierig fragte sie: »Wie hat Zielicke zu Ihnen gefunden?«
Pollmann zögerte, bevor er ihre Frage beantwortete.
»Über einen gemeinsamen Bekannten«, sagte er. »Einen Werksdirektor der Eisen- und Stahlwerke.«
Edith nickte. Das waren sie also, die Kreise, die Pollmann im Visier hatte. Offenbar war er davon überzeugt, dass sie wieder nach oben kamen. Vor ihrem inneren Auge tauchte die Villa auf. Villa war eine Untertreibung, ein glattes Understatement für ein Gebäude mit 250 Zimmern, einer weitläufigen Eingangshalle mit einer breiten Treppe, auf der die Besitzer herunterschreiten konnten, um ihre Gäste huldvoll in Empfang zu nehmen, und einer Art Spiegelsaal wie in Versailles, en miniature. Ob die ehemaligen Besitzer wohl irgendwann wieder dort einziehen würden? Oder waren sie für immer entthront, die Krupps und Thyssens und wie sie alle hießen? Pollmann jedenfalls schien an ihre Rückkehr zu glauben.
3
Edith tippte, die Maschine ratterte. Edith wurde zu einem Teil des Geklappers – Augen, die ihre Notizen entlangfuhren, Finger, die das Gelesene in die Maschine tippten, ein Gehirn, das das Denken aufgegeben hatte –, bis die Türklingel sie unterbrach.
Wenig später stand ein Unbekannter vor ihrem Schreibtisch, Eingangspforte und Austrittstor von Pollmanns Reich. Ein dunkler, störrischer Haarschopf, mit Brillantine kaum gebändigt und ein jungenhaftes, blasses Gesicht. Den Hut in der Hand sagte er: »Ich bin mit Herrn Pollmann verabredet. Leo Mantler.«
Edith klappte Pollmanns Terminkalender auf, ein großes, in Leder gebundenes Exemplar, ein rot seidener Faden markierte die aktuelle Woche.
»Ich fürchte, Sie werden mich dort nicht finden. Ich bin kein Mandant.«
Er machte auch nicht den Eindruck, als ob er einer werden wollte. Pollmanns Mandanten trugen in der Regel teurere Kleidung. Keine fabrikneuen Kleider, denn die gab es zurzeit kaum, aber Mäntel und Hüte, denen anzusehen war, dass vor einigen Jahren ihre Besitzer dafür tief in die Tasche gegriffen hatten, und die von einem Schneider und keinesfalls von der Stange stammten.
»Ich gebe Herrn Pollmann Bescheid, dass Sie da sind.«
Pollmann las Zeitung an seinem Schreibtisch, Edith zog die schwere, etwas verzogene Tür hinter sich zu, damit sie tatsächlich ins Schloss fiel und der Besucher nicht hören konnte, was der Anwalt sagte.
»Ein Herr Mantler möchte mit Ihnen sprechen. Er sagt, er sei mit Ihnen verabredet.«
»Mantler?«
Pollmann ließ die Zeitung sinken, er war eindeutig ungehalten.
»Er soll sich gedulden.«
Er verschwand wieder hinter seiner Zeitung.
Im Vorzimmer verdolmetschte Edith dem Besucher Pollmanns Bemerkung.
»Herr Pollmann ist leider beschäftigt. Er ist gleich für Sie da. Er bittet Sie, einen kleinen Moment zu warten, falls es Ihnen nichts ausmacht.«
Sie bot ihm einen Platz in der Besucherecke an. Ohne auf ihre Hilfe zu warten, verstaute der Ankömmling Hut, Schal und Mantel an der Garderobe und steuerte auf den Kohleofen zu.
»Stört es Sie, wenn ich mich ein wenig aufwärme?«, fragte er.
Edith verneinte. Während er sich dem Ofen zuwandte, betrachtete sie ihn. Er war groß und schlaksig und musste sich ein wenig hinunterbeugen, um seine Hände in die warme Luft über der Ofenplatte zu halten.
Ihren Blick hatte er anscheinend bemerkt, denn er drehte sich zu ihr um. Er legte den schmalen Kopf schief und lächelte. Edith lächelte zurück, konstatierte, dass er hübsche grüne Augen hatte, und fragte sich, was er von Pollmann wollte. Doch bevor sie sich unverfänglich danach erkundigen konnte, sprang die Tür von Pollmanns Büro auf, und der Anwalt betrat das Vorzimmer.
»Leo, schön dich zu sehen«, sagte er herzlich.
Er ging mit raschen Schritten auf den Besucher zu, legte ihm jovial die Hand auf die Schulter und tönte: »Schön, dass du da bist. Komm mit.«
»Das Café im Stadtpark hat wegen der Kälte geschlossen. Deshalb bin ich direkt hierhergekommen«, erklärte Mantler.
»Schön.«
Pollmann legte Mantler den Arm um die Schultern und führte ihn in sein Büro.
»Schön, dass du da bist«, sagte er noch einmal, als sie die Schwelle überschritten.
Nach Ediths Empfinden war es mindestens ein »schön« zu viel gewesen.
Sie widmete sich wieder ihrer Schreibmaschine.
***
Zwei Stunden später – Mantler war längst wieder gegangen – deckte sie die Maschine mit einer grauen Hülle ab. Schon in Mantel und Hut entschied sie, noch eine Zigarette in der kleinen Teeküche der Kanzlei zu rauchen, bevor sie sich auf den Weg in die Kälte machte. Es war die letzte in der Schachtel, und sie hatte daran gedacht, sie aufzusparen. Aber irgendwann würde die Schachtel ohnehin leer sein, wie alles leer wurde, also konnte sie die Zigarette genauso gut jetzt rauchen. Eine Gabe an den Gott des richtigen Augenblicks, dachte sie belustigt. Würde sie nicht geradezu verhindern, dass sie neue ertauschte, wenn sie die alten ängstlich aufhob?
Sie ging in die Küche und zündete die Zigarette an. Ans Fensterbrett gelehnt, schaute sie in den Winterhimmel. Sie lachte leise, als sie an die Scharade in der Villa Hügel dachte. Es missfiel ihr, dass Pollmann sie eingesetzt hatte wie eine Marionette. Auf der anderen Seite hatte ihr der Auftritt Vergnügen bereitet: die Geistesgegenwart, die er ihr abverlangt hatte, die sirrende Anspannung, wenn sie sich gespannt fragte, ob das Vorhaben gelingen würde, und die Freude, wenn ihre Vorstellung lief.
Sie drückte die Zigarette aus und trat hinaus auf den dunklen Flur. Nach ein paar Schritten stand sie im Vorzimmer, die Umrisse der Möbel begannen, in der Dämmerung zu verschwimmen, die Schreibmaschine unter ihrer Hülle sah aus wie ein hingekauertes Tier, das sich an die Schreibtischplatte drückte.
Die Tür zu Pollmanns Zimmer stand einen Spaltbreit auf.
Ein schmaler Lichtstreifen fiel auf den großen Teppich im Vorzimmer. Pollmann redete mit Hansen, der vermutlich in die Kanzlei gekommen war, während sie in der Küche rauchte.
Sie machte einen Schritt auf die Tür zu, um sich zu verabschieden, da hörte sie Hansen sagen: »Ich bin nicht überzeugt davon, dass dies der richtige Weg ist.«
Edith blieb verblüfft stehen. Hansen meldete für gewöhnlich keine Zweifel an. Er ging vielmehr Diskussionen aus dem Weg und tat kommentarlos, was Pollmann ihm auftrug. Sie hörte weiter zu.
»Hansen, warum auf einmal so zögerlich?«
Pollmann lachte, sein tiefes Lachen, mit dem er die Einwände und Bedenken seines Gegenübers fortlachte. Edith hörte trotzdem die Nervosität, eine falsch gestimmte Saite in dem vollen Klang.
Hansen antwortete brummend, ein Bass, bei dem jeder Ton saß.
»Wenn man so etwas plant, muss jeder Schritt genau durchdacht sein.«
Pollmanns Stimme stieg an, als er sagte: »Hansen, seien Sie versichert, ich habe …«
Er unterbrach sich, wechselte die Tonlage und fuhr fort: »Machen Sie sich keine Sorgen.« Nun klang er beinah väterlich, ihm schien eingefallen zu sein, dass er Hansen keine Begründungen und schon gar keine Rechenschaft schuldig war.
Wieder ertönte Hansens Bass: »Wie Sie meinen.« Ruhig und gelassen. Sie sind der Chef, sagte der Bass, ich diskutiere nicht mit Ihnen, auch wenn ich anderer Meinung bin.
»Und die Sache bleibt unter uns.«
»Selbstverständlich«, dröhnte Hansen.
»Gut.« Wieder Pollmann. »Machen Sie sich keine Sorgen. Es wird laufen wie geplant, und unser roter Freund wird nie wieder seinen Mund weit aufreißen.«
Pollmann sprach langsam und wohlartikuliert, trotzdem klang er, als müsste er vor allem sich selbst beruhigen.
Edith hörte, dass er den Schreibtischstuhl zurückschob. Sie waren offenbar am Ende ihres Gesprächs angelangt. Gleich würden sie aus dem Arbeitszimmer treten und sie finden, wie sie mitten in dem dämmerigen Zimmer stand, ohne erklärbaren Grund, in Hut und Mantel, die Handtasche über den Arm gehängt. Und allzu offensichtlich Zeugin eines Gesprächs, das gewiss nicht für ihre Ohren bestimmt war.
Bis zur Eingangstür würde sie es nicht mehr schaffen, deshalb ging sie auf dem weichen Teppich einige Schritte zurück, bis zu der Tür, durch die sie den Raum betreten hatte.
Sie betätigte den Lichtschalter und rief nach Pollmann.
Die Tür zu Pollmanns Arbeitszimmer öffnete sich. Im Rahmen erschienen die beiden Männer. Pollmann trat ins Vorzimmer.
»Fräulein Marheinecke, Hansen sagte, Sie seien schon gegangen.«
Sie erklärte ihm, dass sie noch eine Weile in der Küche gewesen war.
»Und haben sich am Küchenfenster eine Zigarette gegönnt.«
Pollmann nickte und zeigte großzügiges Verständnis.
Edith lächelte. Auch als sie Hansens misstrauische Miene bemerkte, lächelte sie weiter. Gelassen trat sie auf den Spiegel an der Garderobe zu und richtete ihren Hut. Im Spiegelbild erschienen die beiden Männer, die hinter ihr im Raum standen.
Während sie ihre Handschuhe überstreifte, kam sie sich vor wie eine Diva in einem alten UFA-Streifen, die unter den bewundernden Blicken ihrer beiden Verehrer die zarten weißen Hände verhüllt. Doch waren die beiden keine Verehrer, und von bewundernden Blicken konnte ebenfalls nicht die Rede sein. Ganz im Gegenteil: In den Mienen der beiden lag Argwohn. Beim Hinausgehen meinte sie, die Blicke der beiden Männer immer noch im Nacken zu spüren.