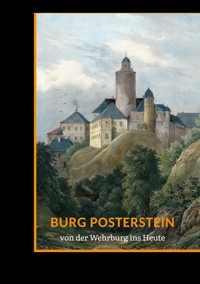9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Edith - Eine Frau geht ihren Weg
- Sprache: Deutsch
Die Gefahren einer neuen Zeit.
Juni 1948 im Ruhrgebiet. Das neue Geld soll kommen – die D-Mark. Auch Edith Marheinecke macht sich auf zur Ausgabestelle. Sie ist nun Journalistin und fotografiert die wartenden Menschen, von denen einige in Streit geraten. Einer der Streitenden ist wenig später tot. Konrad Garthner wird vor eine Straßenbahn gestoßen. Als Edith ihre Fotos auswerten will, erlebt sie eine böse Überraschung. Man hat ihr die Kamera gestohlen. Und dann taucht auch noch ein Ex-Geliebter von ihr auf – und interessiert sich sehr für den toten Garthner.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Sabine Hofmann
Kopfgeld
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1 — Sonntag, 20. Juni 1948
Samstag, 19. Juni 1948
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Sonntag, 20. Juni 1948
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Montag, 21. Juni 1948
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Dienstag, 22. Juni 1948
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Mittwoch, 23. Juni 1948
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Donnerstag, 24. Juni 1948
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Freitag, 25. Juni 1948
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Samstag, 26. Juni 1948
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Sonntag, 27. Juni 1948
Kapitel 67
Montag, 28. Juni 1948
Kapitel 68
Nachwort und Dank
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
1
Sonntag, 20. Juni 1948
Das Letzte, was Konrad Garthner sah, waren die grauen Wolken am Bochumer Himmel.
Das Vorletzte war der runde Kopf eines mittelalten Mannes, der sich mit erwartungsvollem Gesicht über ihn beugte.
Konrad wollte ihm etwas sagen, doch sein Brustkorb machte nicht mehr mit. Die Rippen taten höllisch weh, und irgendwie klappte es mit dem Atmen auch nicht mehr richtig. Vollkommen ramponiert, dachte er, der Triebwagen hatte ganze Arbeit geleistet.
Im Krieg hatte er genug Kameraden gesehen, denen die Latüchte ausgeblasen worden war. Die vor sich hin röchelten und stöhnten, bevor sie endgültig den Löffel abgaben. So wie die Dinge lagen, war es mit dem Röcheln, dem Stöhnen und dem Löffelabgeben nun auch für ihn so weit. Nichts mehr mit neues Geld, neuer Anfang.
Er strengte sich an, seinen Kopf zu heben, auch wenn es furchtbar schmerzte. Er musste dem Kugelköpfigen etwas sagen. Warum es so wichtig war, war ihm nur noch halb klar. Vielleicht, damit man ihn nicht für einen dämlichen Trottel hielt, der nicht einen Fuß vor den anderen setzen konnte. Vielleicht, damit der Kugelköpfige verstand, was sich abgespielt hatte, und der Dreckskerl nicht ungeschoren davonkam. Irgendeiner von den vielen Leuten, die mit ihrem frischen Geld in der Tasche hier herumrannten, musste ihn doch gesehen haben.
Konrad Garthner unternahm einen letzten Versuch. Den Kopf bekam er nicht mehr hoch, aber für die paar Atemzüge, die er für seine Sätze brauchte, reichte es. Er schluckte hinunter, was ihm den Hals hochstieg, und presste Luft in seine blessierte Lunge.
Angestrengt bewegte er die Lippen. Der Kugelköpfige kapierte und brachte sein Ohr ganz nah an seinen Mund. Konrad konnte die grauen Stoppeln an seinem Kopf genau erkennen. Sauberer Mann, guter Mann, dachte er kurz. Unter Mühen bekam er heraus: »Irgendein Dreckskerl hat mich gestoßen.«
Der Kugelköpfige hob seinen Kopf. Er war so anständig, zu nicken, um ihm klarzumachen, dass er verstanden hatte. Er sagte auch etwas, doch das konnte Konrad nicht mehr verstehen. Er schaute an ihm vorbei in den Himmel. Ohne dass er es gewollt hätte, fielen ihm die Augen zu. »Das war’s dann wohl«, dachte er.
Samstag, 19. Juni 1948
2
Edith Marheinecke erwachte aus traumlosem Schlaf, schlug die Augen auf und betrachtete den Mann neben ihr. Die Sonne fiel auf seinen hellen Körper zwischen den zerknautschten Laken.
Er hatte sich halb zur Seite gedreht, den einen Arm über dem Kopf angewinkelt, die Hand verschwand im Gewirr der dichten, dunklen Haare. Das Morgenlicht modellierte die sanfte Wölbung der Muskeln unter der Haut und zeichnete Schatten in die Einbuchtungen von Lenden und Achselhöhle. Die rechte Wange ruhte auf dem Laken, die andere Gesichtshälfte wurde von der Sonne ausgeleuchtet: das Profil mit der geraden Nase, im Schlaf leicht geöffnete Lippen, ein Satz dunkler, ewig langer Wimpern, die sacht die linke Wange berührten. Das Gesicht des Schläfers war glatt und ein wenig entrückt, die Instanz, die tagsüber für ein ständiges und bewegtes Mienenspiel sorgte, hatte im Moment Pause.
Der Mann war eine Schönheit, keine Frage.
Behutsam tastete Edith auf dem Nachttisch herum und fand, was sie suchte. Sie richtete sich vorsichtig auf und schob sich am Kopfteil des Bettes hoch, bis sie aufrecht saß.
Ihre Finger arbeiteten geschwind, stellten Blende, Belichtungszeit und Entfernung ein. Sie hob die Kamera vor ihr Auge, rutschte so weit wie möglich von dem Schläfer weg und suchte nach einem Ausschnitt, der die hellen und die verschatteten Seiten seines Körpers ungefähr zu gleichen Teilen zeigte. Kritisch blickte sie durch den Sucher, drehte noch einmal am Objektiv und drückte ab, als sie sicher war, die beste aller möglichen Einstellungen erwischt zu haben. Das satte Klicken sorgte dafür, dass Tristan sich auf den Bauch drehte und weiterschlief.
Oder so tat als ob, dachte Edith.
Sie richtete die Kamera auf die Haut seines Unterarms. Feine Härchen hoben sich ab und ließen die nackte Haut zart und fast verletzlich aussehen. Sie drehte am Objektiv und drückte wieder auf den Auslöser. Diesmal hatte das Klicken zur Folge, dass Tristan die Augen öffnete und sich ihr zuwandte.
»Fotografierst du mich schon wieder?«
Edith ließ die Kamera sinken und lachte leise.
»Ja, sicher.«
»Bekommst du nicht irgendwann genug davon?«
»Nein, niemals«, sagte sie und ließ ihren Zeigefinger über die Haut seines Unterarmes gleiten. Tristan sah ihrem Finger zu, wie er langsam zu seiner Schulter hinaufkroch.
»Du bist verrückt«, erklärte er. Verrückt nach dir, meinst du, dachte sie. Das war sie vermutlich, und Tristan hatte nichts dagegen. Ganz im Gegenteil.
»In einem gewissen Maße, ja«, sagte sie.
»Wann kann ich die Bilder anschauen?«
Edith schaute auf das Zählwerk.
»Bald, der Film ist fast voll.«
Tristan lächelte und streckte träge die Glieder.
»Dann kannst du ja noch einige Aufnahmen von mir machen.«
Er setzte sich auf, strich sich die Haare aus dem Gesicht, öffnete weit die Augen und richtete den Blick auf etwas, das anscheinend weit jenseits der Rosentapete von Ediths Zimmer lag. In seinem Gesicht erschienen Melancholie und unendliches Sehnen.
Tristan war ein Profi, und er wusste, was er tat.
»Hör auf, das Foto gibt es in hundertfacher Ausführung!« Sie machte keine Anstalten, die Kamera erneut zu heben.
»Tatsächlich? Wo denn?«
»Im Programmheft des Schauspielhauses, rund zweihundertmal gedruckt. Es ist dein übliches Gesicht: Tristan Wegener, der junge Held des Ensembles.«
Der Ausdruck auf Tristans Gesicht wechselte von Sehnsucht zu Schmerz.
»Ich bin ein Abklatsch meiner selbst«, verkündete er in Bühnenlautstärke.
Edith hoffte, dass er die übrigen Bewohner der Wohnung nicht geweckt hatte. Fritzi war entgegen ihrer Gewohnheit schon früh aus dem Haus gegangen.
Das Ehepaar Koppitz rumorte üblicherweise zu dieser Zeit in der Küche, da Frau Koppitz ihrem magenkranken Mann Haferschleim kochte, doch heute war es still in der Dreizimmerwohnung. Und es blieb still, als Tristan noch einmal ausrief: »Ein Abklatsch.«
Er sank dramatisch in sich zusammen.
»Sind wir das nicht alle?«, gab Edith zurück. »Irgendein schwacher Abklatsch unseres besseren und schöneren Selbst?«
Nicht so edel, so hilfreich und so gut, wie man es gern hätte, weder so klug noch so schön, sondern im besten Fall ein mittelprächtiges Gemisch.
Tristan verwandelte sich wieder zurück in einen ganz gewöhnlichen Samstagmorgen-Tristan.
»Wahrscheinlich«, stimmte er zu. »Was gibt es zum Frühstück?«
»Brot und Rübenkraut.«
Falls Herr Koppitz noch etwas übrig gelassen hatte. Der zähe, braune Sirup wurde in seinem Pappbecher auch ohne ihr Zutun weniger, da Herr Koppitz sich heimlich daran bediente. Sie hatte ihn einmal ertappt, als er in seiner braunen Samtjacke in der Küche stand, das schlechte Gewissen in seinem Mienenspiel genauso deutlich wie der teerdunkle Fleck des Zuckerrübensirups am Kinn. Sie hatte die Gelegenheit genutzt und von der kaputten Lampe in ihrem Zimmer gesprochen. Einen Tag später hatte sie wieder geleuchtet, denn Herr Koppitz war Chef der Lichttechnik im Theater.
»Keine Butter?«
»Keine Butter. Selbst die Kühe scheinen auf den Tag X zu warten.«
»Begrüßen wir freudig den Tag X«, sagte Tristan und sprang aus dem Bett, als wollte er unverzüglich und höchstpersönlich besagten Tag X in Empfang nehmen. Er schlüpfte in Hemd und Hose.
»Apropos Tag X. Kannst du mir vierzig Mark leihen?«
Edith schüttelte den Kopf.
»Tut mir leid.«
Ihr letztes Geld war in der Kasse des Fotoateliers gelandet. Sie hatte Glück gehabt. Einen guten Fitsch gemacht, wie die Leute hier sagten. Lehmann, der Fotohändler, hatte sich vor einer Woche überreden lassen, ihr Filme zu verkaufen, was weder ihrem Verhandlungsgeschick noch den Bündeln Reichsmark zu verdanken war, die sie auf seiner Ladentheke gestapelt hatte, sondern vielmehr den zwei Päckchen Zigaretten, die am Ende der Verhandlungen dem Geld Gesellschaft geleistet hatten. Zum Schluss war sie mit drei Rollfilmen in der Tasche aus dem Laden spaziert.
»Wirklich nicht? Bist du sicher?«
Edith lachte. Tristan hatte eine komische Verzweiflung auf sein Gesicht gezaubert, die vermutlich seine Unverfrorenheit etwas abmildern sollte.
»Sehr sicher. Bist du sicher, dass du wirklich nichts hast?«
Tristan drehte die Taschen seiner Hose nach außen.
»Nichts. Nada. Niente.«
Er schaute sie mit schief gelegtem Kopf wie ein betrübtes Kind an.
»Dito«, gab Edith zurück.
Sein Blick glitt zu ihrer Tasche, aber er wagte es nicht. Er hob die Hände zum Himmel: »Macht nichts. Bis morgen ist ja noch Zeit. Bis dahin werde ich es noch auftreiben. Mach dir keine Gedanken.«
Edith war weit entfernt davon, sich Gedanken zu machen, zumindest nicht über Tristans Geldprobleme. Für diese fand sich in der Regel rasch eine Lösung. Irgendjemand würde ihm die vierzig Mark für den Umtausch borgen, vielleicht mit bärbeißiger Gutmütigkeit angesichts des stets klammen Tristan, vielleicht voller Hoffnung, eine Portion von dem Leuchten abzubekommen, das ihn zumeist umgab.
Sie stand ebenfalls auf und zog einen rotsamtenen Morgenmantel über, den sie auf dem Schwarzmarkt erstanden hatte.
»Es gab einen regelrechten Ansturm auf die Theaterkarten«, erklärte Tristan einen Moment später, als sie in der Küche der noch halbwegs unversehrten Wohnung saßen.
»Alle wollen ihr altes Geld loswerden«, fuhr er fort. »So viel Andrang hatten wir noch nie. Die Vorstellungen für die nächste Woche sind ausverkauft.«
»Verflixt.«
»Wieso?«, fragte Tristan. »Volle Vorstellungen – « Er brach ab und setzte erneut an. »Volle Vorstellungen sind großartig. Aber – «
»Wenn man damit nichts verdient – «, fiel Edith ein.
»Dann ist es Mist«, vollendete er ihren Satz. »Denn essen muss auch ein Künstler. ›Was macht die Kunst?‹ ›Sie geht nach Brot‹«, deklamierte er.
Tristan kehrte zu seiner normalen Stimmlage zurück. »Eure Zeitungen verkauft ihr nicht im Voraus, oder?« erkundigte er sich.
»Nein. Auch die Abonnenten zahlen ab der nächsten Woche mit neuem Geld.«
Tristan nickte.
»Sag mal, hast du wirklich nicht die vierzig Mark zum Eintauschen?«
Edith legte den Kopf schräg. Hatte sie. Exakt vierzig Reichsmark, ihr Kopfgeld. Sie schwieg.
»Du hast«, stellte Tristan befriedigt fest. »Wenn wir halbe-halbe machen? Die anderen zwanzig Mark könnten wir uns ja irgendwo leihen.«
Sei nicht so kleinlich, sagte sein Blick, kleinlich und kleinbürgerlich, du klebst am schnöden Mammon. Das traf nun wirklich nicht zu. Bürgerlich war sie vielleicht einmal gewesen, wenn sie an ihre Kindheit in Ostpreußen dachte, Edith Marheinecke, einzige Tochter des Apothekers Georg Marheinecke, wohlbehütet und wohlbestallt, höhere Schule, Abitur und ein Sprachstudium, Klavierunterricht und mütterlicherseits Anweisungen, wie sich eine wohlerzogene junge Dame zu verhalten hatte, damit sie sich vom gemeinen Volk unterschied. Eine solche Edith gab es nicht mehr, wie es auch alles Übrige nicht mehr gab: die Apotheke, die Glaubenssätze ihrer Mutter und das treue Parteigängertum ihres Vaters. Sie schob den Gedanken daran beiseite.
»Prima, so machen wir das«, sagte Edith. »Leih du doch mal die vierzig Mark, und dann machen wir halbe-halbe. Ich leihe dir zwanzig, du leihst mir zwanzig, und die anderen geliehenen zwanzig behältst du einfach.«
Tristan kniff die Augen zusammen. Dann lachte er.
»Du bist und bleibst eine bourgeoise Krämerseele.«
3
Geld ist ein silbriger Fluss. Der Gedanke stellte sich ein, kurz bevor Helmut Garthner aufwachte. Der Gedanke blieb und hielt sich, als Garthner wach war. Geld ist ein silbriger Fluss. So war es, dachte Garthner, Geld muss fließen. Das tat sein Geld, in welcher Währung auch immer.
Geld liebte ihn, und er liebte Geld. Man musste das Geld allerdings zu lenken wissen; wissen, in welchen Bahnen es munter plätschernd seinen Lauf nehmen sollte; planen, wohin der Strom fließen und wann er sein Geschäft wieder verlassen sollte, damit das Geld klingend wieder in die Kassen zurückkehrte und später erneut hinausströmte, Ware in den Laden zurückspülte und bald darauf wieder zurückkam, in weit mächtigerer Welle.
Die Wege allerdings, die das Geld nahm, hatten sich in den letzten Jahren gravierend verändert. Geld zirkulierte lange Zeit nicht mehr in Form der feinen Cheques und Bankanweisungen, die er mit raschem Schwung unterzeichnet hatte, damit sich die Schleusen seines Kontos öffneten. Nein, ganz und gar nicht. In den letzten Jahren ging ohne Tausch nichts mehr, Zigaretten waren als Leitwährung auf den Plan getreten, aber im Grunde blieb es dabei: Wesentlich waren Umsicht, Bewegung und ein geschicktes Steuern des Stroms.
Er lächelte, als er sich an den letzten Transfer erinnerte. Vor ein paar Wochen hatte er Konrad einen Koffer packen lassen, voll mit Reichsmarkscheinen, und Konrad hatte ihn durch die Stadt getragen. Es war nicht gerade das, was man sich landläufig unter einem seriösen Geldfluss vorstellte, doch was die Leute sich vorstellten und was tatsächlich geschah, waren ohnehin zwei unterschiedliche Dinge. Auch dieses Geld würde er zurückbekommen, mehr noch: Das Geld würde seine Gestalt wandeln, die alten, abgegriffenen Scheine würden zu dem frischen, neuen Geld werden, das sie in Amerika für sie gedruckt hatten. Die Amerikaner hatten es begriffen: Geld musste fließen, und wenn es alt und müde war, musste es ersetzt werden.
Müdes Geld. Garthner lächelte. Im morgendlichen Dämmer wurde er nahezu poetisch. Er reckte sich.
Charlotte schlief im Zimmer nebenan. Helmut Garthner schürzte nachdenklich die Lippen. Aus ihr wurde er im Augenblick nicht recht schlau. Sie hatte sich ganz offenkundig gefreut, als er vor drei Wochen aus dem Internierungslager zurückgekehrt war, aber inzwischen war die Freude einer Gereiztheit gewichen, für die er keinen Grund ausmachen konnte.
Möglicherweise war es eine Sache der Gewöhnung. Früher hatten sie immer gut miteinander harmoniert, Charlotte und er. Als gemischtes Doppel waren sie vor dem Krieg im Tennisklub Rot-Weiß unschlagbar gewesen. Sie war das, was er sich gewünscht hatte: eine Gefährtin. Und das würde sie hoffentlich auch bald wieder werden, ohne Wenn und Aber. Sie war nicht immer mit ihm einer Meinung, doch das war sie auch früher nicht gewesen. Sie hatten diskutiert, Charlotte war alles andere als dumm und hatte oft gute Ideen und kluge Einwände, die er zu schätzen wusste. Was jedoch neu war, war ihr Blick. Es war kein freundlicher, sondern ein abschätziger Blick, der ihn von der Seite traf, dazu hin und wieder eine ungeduldige Bemerkung, fast scharf im Ton, eine Tasse, die lauter auf den Tisch geknallt wurde, als eigentlich nötig gewesen wäre, bevor Charlotte aufstand und mit spitzen Ellenbogen das Geschirr abräumte.
Garthner überlegte einen kurzen Moment, ob er sie wecken sollte, entschied sich aber dagegen. Er würde noch ein wenig mit seinen Gedanken allein bleiben. Er dachte an sein Geheimnis, zart und glänzend. Nur er wusste davon, und er würde wie immer dafür sorgen, dass es so blieb. Ein Geheimnis wie ein schillernder Stein, den man ab und an, wenn man ganz allein war, aus der Tasche holte, um sich darüber zu freuen.
Nach einer Weile stand er auf und nahm den Tag in Angriff.
4
Selma Winterstein wachte in einem Hotel auf.
Ein paar Meter von ihr, auf dem Sofa in der Zimmerecke, lag Max. Ihr Bruder hatte es sich in Straßenkleidung auf dem Sofa bequem gemacht. Selbst die Schuhe hatte er anbehalten, zumindest einen, sein rechter Fuß baumelte in einem braunen Budapester über der Sofalehne. Er selbst lag auf dem Rücken, den Mund leicht geöffnet und atmete geräuschvoll. Die Ursache für seinen lamentablen Zustand lag nicht allzu weit entfernt: eine leere Flasche auf dem Fußboden. Sie war ihm aus der vom Sofa herabhängenden Hand gerutscht.
Die Flasche hatte er gestern in einem Spirituosenladen erstanden. Zunächst hatte der Verkäufer ihnen versichert, dass alle Vorräte leider, leider zur Neige gegangen seien. Max hatte schon einiges intus gehabt und war unwirsch geworden. Er glaubte, man wolle ihn nicht bedienen, und hatte sich brüsk umgedreht, um den Laden zu verlassen. Doch Selma hatte getan, was sie immer getan hatte, seit sie diese Reise mit Max machte: Sie hatte dafür gesorgt, dass sie bekamen, was sie wollten. Sie hatte rasch ihr Bedauern ausgedrückt und anschließend vorgegeben, in ihrer Geldbörse etwas zu suchen. Dabei hatte sie ihre grünen Dollarscheine aufblitzen lassen, die sie auf der Bank in Manchester gegen ihr Erspartes getauscht hatte.
Schlagartig hatte sich das Verhalten des Verkäufers geändert. Er hatte Max’ Wunsch artig wiederholt: »Was war es doch gleich, der Herr? Weinbrand?« Eilfertig hatte er hinzugefügt: »Oder darf’s ein Cognac sein?«
Aus Knappheit war angesichts der Dollarnoten auf wundersame Weise Überfluss geworden, und im Lager hatte sich eine Flasche gefunden, die gegen einen grünen Schein den Besitzer gewechselt hatte.
»Siehst du, in diesem Land dienern sie jetzt für Geld und winden sich vor dir«, hatte Max laut zu Selma gesagt. »Geld sorgt dafür, dass sie dir in diesem Land geben, was du willst.«
In diesem beschissenen Land, hatte er hinzugefügt, das auch mit einer gehörigen Alkoholmenge im Blut kaum zu ertragen war. Sie hatte rasch bezahlt und Max aus dem Laden gezogen.
Sie betrachtete Max und erwog, ein Kopfkissen oder ihren Hausschuh nach ihrem Bruder zu schleudern, es war besser, ihn seinen Rausch ausschlafen zu lassen, das hatte sie in den letzten Tagen gelernt. Für das, was sie vorhatten, brauchte sie Max mit einem klaren Kopf.
Selma stand auf. Sie schaute aus dem Fenster des Hotels. Auf dem Vorplatz war der Schutt beiseitegeräumt und zu zwei hohen Haufen getürmt worden, die mit den bunten Plakaten auf der Litfaßsäule daneben kontrastierten. Auf der linken Seite des Platzes gähnten die leeren Fensterhöhlen einer zerstörten Häuserzeile, und rechts konnte sie über ein Trümmerfeld bis zum Bahnhofsgebäude schauen. Sodom und Gomorrha. Die britischen Bomber waren gründlich gewesen, Selma erkannte die Stadt kaum wieder.
Der Bahnhof und die umliegenden Häuser waren das Letzte gewesen, das sie von der Stadt vor gut zehn Jahren gesehen hatte. Ihre Eltern hatten sie an einer stillen Ecke des Vorplatzes abgeliefert, auf den Bahnsteig hatten sie sie nicht begleiten dürfen. Nur Fräulein Hirsch und Fräulein Philipp waren dort gewesen, hatten noch einmal überprüft, ob jedes Kind und jeder Jugendliche die runde Pappkarte mit seiner Kennnummer trug, hatten bei den Kleineren die eine oder andere Nase geputzt, zur Ruhe gemahnt und darauf gedrängt, dass sie rasch einstiegen, als der Zug hielt. Schließlich hatte er sich Richtung Hoek van Holland in Bewegung gesetzt. Die Fahrt über hatte Selma das große Einmaleins aufgesagt, um nicht zu heulen, denn mit vierzehn heulte man nicht mehr. Danach hatte sie sich die Primzahlen vorgenommen und war bis in die hohen Tausender gekommen, als sie die Fähre nach Dover bestiegen.
Auf dem Platz unter ihr wieselten trotz der frühen Stunde Menschen herum. Männer mit Hüten und der unvermeidlichen Aktentasche unter dem Arm, in die wohl – das hatte sie gestern beobachtet – eher auf dem Schwarzmarkt erstandene Waren als Akten wanderten. Frauen mit Taschen und Rucksäcken, die Richtung Bahnhof strebten. Eine Gruppe Kinder, zerlumpt und barfüßig, wühlte in einer Mülltonne nach Essen. Zwei halbwüchsige Mädchen hatten in einem Hauseingang in kurzem Rock und eindeutiger Pose Stellung bezogen.
Selma beobachtete, wie zwei weitere Kinder, um die zehn Jahre alt, auf einen Mann zugingen und ihm im Schatten der Litfaßsäule Zeitungen anboten. Sie umringten ihn und zeigten ihm die auseinandergefalteten Blätter. Selma ging davon aus, dass das dünne Papier ihnen einen Sichtschutz lieferte, um darunter unbemerkt in seine Tasche zu greifen.
Sie stützte sich auf die Fensterbrüstung und schaute zu.
Ebenso plötzlich, wie sich die Kinder dem Mann aufgedrängt hatten, ließen sie wieder von ihm ab und machten sich in Windeseile davon. Der Mann ging weiter, nach ein paar Schritten tastete er nach etwas in der Brusttasche seines Mantels. Augenscheinlich tastete er vergeblich, denn er blieb stehen und blickte sich um. Die Kinder waren längst im Eingang eines zerstörten Hauses verschwunden.
Selma hörte eine Bewegung in ihrem Rücken und drehte sich um. Max war wach geworden und hatte sich aufgesetzt. Er stützte sich mit der rechten Hand auf der Sitzfläche des Sofas ab, den Arm etwas verdreht, so dass der Handrücken auf dem Stoff auflag und die Finger nach hinten deuteten. Kaum jemand stützte sich so ab, nur sie und ihr Bruder. Sie wunderte sich wieder über die Geste. Sie kam ihr vor wie der Ausdruck eines geheimen Bandes, das sie beide im Körper trugen, auch wenn ihr Bruder ihr ansonsten fremd war.
Sie sah zu, wie Max langsam zu sich kam, sich herabbeugte und ein wenig hilflos nach seinem zweiten Schuh tastete. Nachdenklich wickelte sie sich eine ihre Locken um den Finger.
In England hatten sie sich nicht allzu häufig gesehen, zu Beginn, weil sie in unterschiedlichen Städten untergebracht worden waren, später, weil Max beim Militär war.
Er setzte sich erneut auf, die Hand abermals verdreht. Es ist nur eine Geste, dachte Selma, nichts anderes, als auf eine bestimmte Art, die Hand zu verdrehen. Sie bedeutet nichts weiter, lediglich, dass ihre Körper blind und instinktiv auf dieselbe Weise arbeiteten.
»Was ist draußen los?«, fragte Max.
»Nichts Besonderes«, antwortete sie.
5
Der Platz neben Oberinspektor Bernd Dietrichs war leer. Das war er nicht immer gewesen. Früher hatte er Emma gehört, bis sie bei einem der Bombenangriffe umgekommen war, doch das war lange her. Jetzt lag da immer mal jemand, Frauen, die eine ordentliche Portion Hartnäckigkeit besaßen und es schafften, bei ihm einzuziehen, weil er nachgab und für eine Weile zu dem Schluss gelangte, dass es gut war, wenn eine Frau im Haus war. Irgendwann knurrte er sie weg, weil sie doch nicht waren wie Emma. Die letzte war vor vier Wochen mit viel Geschimpfe ausgezogen.
Er betrachtete das bauschig aufgeschüttelte Kopfkissen neben sich. Irgendwann würde die nächste kommen und mit ihrem Kopf dort einen Abdruck hinterlassen. Alles würde wieder laufen wie gehabt: Zufriedenheit am Anfang, dann nagende Zweifel, später Wegknurren, Gezeter und Geschrei am Schluss, und es würde zu einem guten Teil an ihm liegen.
Er stand auf. Auf ihn wartete ein Arbeitstag. Gestern hatte es endlich in der Zeitung gestanden, auch im Radio hatten sie es ständig wiederholt. Der Tag X, der Tag, über den seit Wochen alle Welt spekulierte, stand fest: Sonntag, der 20. Juni. Natürlich war klar gewesen, dass sie das konkrete Datum nur kurz vor knapp nennen würden, damit nicht alle wie die Kaninchen vor der Schlange auf den Tag schauten, an dem es das neue Geld geben würde – ihre Waren horteten oder auf Teufel komm raus ihr altes Geld loswerden wollten. Aber seit drei Wochen stellten sich die Leute ohnehin darauf ein. Es hatte sich herumgesprochen, dass das neue Geld in Bremerhaven angelandet und mit Sonderzügen nach Frankfurt verfrachtet worden war, auch wenn die Sache strikt geheim gehalten werden sollte. In Frankfurt war es eingelagert, in den Tresoren der ehemaligen Reichsbankhauptstelle. Von dort war es in den letzten Tagen auf die Länder der westlichen Besatzungszonen verteilt worden. In Bochum waren die Kollegen von der Schutzpolizei zur Bewachung des Geldes abgestellt.
Den ersten Gelddiebstahl hatten sie auch schon zu verzeichnen. Als der Direktor der Sparkasse durch seinen Tresorraum geeilt war, in dem die für die Stadt bestimmten Säcke untergebracht waren, hatte er ihn entdeckt. Jemand hatte einen Geldsack aufgeschlitzt und sich bedient. »Mitgenommen, soviel er tragen konnte«, hatte der Direktor kommentiert. Die Kollegen vom Diebstahl waren noch dabei, Träger, Fahrer und Sparkassenangestellte zu verhören. Diskret, hatte der Polizeichef ihnen eingeschärft, weil nicht nach außen dringen sollte, dass das neue Geld schon gestohlen wurde, noch bevor es in Umlauf kam.
Dietrichs war die Sache mit dem Währungsschnitt gleichgültig.
Für seine Arbeit hatte es keine Folgen. Altes Geld, neues Geld – die Leute würden sich weiterhin die Köpfe deswegen einschlagen. Wie in dem Fall, den er hoffentlich heute zum Abschluss bringen würde. Eine klare Sache, eigentlich.
Stratmann von der Schwarzmarktbekämpfung dagegen ging davon aus, dass es mit dem Schwarzhandel bald vorbei sein würde. »Kein Mensch wird den Schwarzmarkt mehr brauchen«, hatte Stratmann in den letzten Wochen getönt. »Das neue Geld wird wieder was wert sein, und die Leute werden sich alles kaufen können.«
»Werden sie nicht«, hatte Kleinert dagegengehalten. »Sie werden nämlich kaum noch Geld haben.« Kleinert wollte immer was Besseres, war nie mit dem zufrieden, was gerade war, und hoffte auf die Zukunft. Kleinert war ein Sozi. Und ein passabler Kollege, mit dem es sich halbwegs ordentlich zusammenarbeiten ließ.
Aber Kleinerts Einwand war Stratmann egal gewesen. Er hatte gesagt: »Und ich werde in eine andere Abteilung wechseln müssen.« Wohin er wollte, war klar: dahin, wo Dietrichs war, zu den Tötungsdelikten.
Dietrichs wollte nirgendwohin, Dietrichs blieb, wo er war. Das neue Geld machte auch keinen Unterschied. Es ging einfach immer weiter, egal, welche großartige Zukunft, welcher kurz bevorstehende Aufbau oder absoluter Neuanfang gerade angekündigt wurde. Er hielt alles für hohles Getöne. Er hatte entschieden, jegliches Getöne zu ignorieren, und sah für seinen Teil zu, dass er die Dinge so gut hinbekam wie möglich.
Dietrichs stand auf.
6
Anton Krusmann war zeitig aufgestanden, weil er angenommen hatte, dass er auf diese Weise einer der Ersten sei. Weit gefehlt. Die Schlange vor der Bank zog sich schon bis zur nächsten Straßeneinmündung. Krusmann stöhnte und stellte sich hinten an. Im Schneckentempo rückte er mit den übrigen Wartenden vor. Eine Stunde Wartezeit, schätzte er.
Die meisten von ihnen waren still. Normalerweise wurde in den Schlangen geredet. Man stand beieinander und verkürzte sich die Zeit, indem man die stechende Sonne, den kalten Regen oder den beißenden Wind kommentierte, anfing, über die hohen Preise, die Lebensmittelrationierung, den Währungsschnitt und die da oben zu palavern. Aber hier nicht, hier herrschte Schweigen. Bekannte wurden lediglich mit einem verbissenen Nicken gegrüßt, stellte er fest.
Offenbar hatten sie alle vor, was er vorhatte. Er rieb sich verärgert das linke Auge. Was hieß vorhaben? Vorhaben war nicht das richtige Wort. Wenn es nach ihm gegangen wäre, würde er jetzt nicht in dieser Schlange stehen, mit einem lächerlichen Koffer und seinem noch lächerlicheren Inhalt in der Hand. Er fragte sich wieder einmal, ob er vielleicht doch das Angebot des Schwarzmarkthändlers hätte annehmen sollen. Doch das war schlicht erbärmlich gewesen.
Deshalb war das jetzt die letzte Gelegenheit. Wer hier wartete, hatte eine Niederlage eingefahren. War nicht schnell genug gewesen, nicht schlau genug, nicht ausreichend auf Zack.
Krusmann musterte die übrigen Wartenden. Sie waren besser angezogen und wohlgenährter als der Durchschnitt, auch besser angezogen und wohlgenährter als er selbst, der hier in seinem alten guten Anzug stand, der um ihn herumschlotterte wie ein leerer Kohlensack.
Alle waren sie mit Handkoffern, Aktentaschen oder prall gefüllten Handtaschen ausgerüstet. Es fehlten dagegen die Mütterchen mit den Einkaufsnetzen, die Arbeiter mit ihren Schiebermützen, stattdessen warteten hier Sommermäntel und Anzüge oder, wie es bei der Frau drei Plätze vor ihm der Fall war, Damenkostüme. Am Handgelenk des Mannes vor ihm in der Reihe blitzte eine schwere goldene Uhr, die Schuhe waren zweifarbig und glänzten.
Das Gewicht zog Krusmanns Arm in die Länge, und der Griff des Koffers schnitt ihm in die Hand. Er setzte ihn zwischen seinen Füßen ab. Es würde wohl niemand vorbeikommen und ihn wegreißen, denn was sollte derjenige damit anfangen? Kein Dieb, der seine fünf Sinne beieinanderhatte, würde hier etwas stehlen.
Therese hatte ihre fünf Sinne im entscheidenden Augenblick jedenfalls nicht beieinandergehabt. Er hatte heftig an sich halten müssen, als sie ihm mit ihrer melodiösen Stimme, die seinen Vater so bezaubert hatte, davon erzählte. All die wohlgewählten Worte, die Therese deutlich moduliert hatte, hatten nicht darüber hinwegtäuschen können, dass sie nicht das Geringste verstanden hatte. Sie hatte sich schlichtweg über den Tisch ziehen lassen. Früher wäre ihr das nicht passiert, da hatte sie über ein scharfes Augenpaar verfügt, dem nichts entging, und einen ebenso scharfen Verstand, den niemand hinters Licht führen konnte. Doch sie hatte sich in den sechs Jahren verändert, in denen er sie nicht mehr gesehen hatte.
Nachdem er verstanden hatte, worauf sie sich eingelassen hatte, hatte er sie angefahren und war kurz davor gewesen, sie zu schlagen. Der ängstliche Blick aus den wässerig blauen Altfrauenaugen hatte ihn abgehalten. »Entschuldigung«, hatte er gemurmelt, während sie anfing, stumm vor sich hin zu weinen.
Sie hatte nichts begriffen, und sie würde auch nichts mehr begreifen. Reden konnte sie immer noch, aber sie fing an, stets dasselbe zu erzählen, so, als erzähle sie es zum ersten Mal, weil sie die übrigen Male vergessen hatte. Meist ließ er sich nicht anmerken, dass er die Geschichte schon fünfmal gehört hatte. Er hatte auch bei seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft begonnen, sie bei ihrem Vornamen zu nennen, weil sie ihm erklärt hatte, dass Mutter sich so pathetisch anhöre. Es war eine ihrer schrägen Ideen, die bei den übrigen Menschen nur verständnislose Gesichter und hochgezogene Augenbrauen verursachten. Trotzdem tat er ihr den Gefallen, wie sein Vater ihr auch die meisten Gefallen getan hatte.
Weil sie ihre fünf Sinne nicht mehr beieinanderhatte, stand er nun hier, mit einem Koffer voller Geld, das er im letzten Moment einzahlen wollte, wie all die anderen hier in der Reihe.
Denn nur Geld, das auf einem Bankkonto lag, konnte umgetauscht werden, zu einem lächerlich geringen Teil. Am Montag würde der Inhalt seines Koffers keinen Pfifferling mehr wert sein. Gut, etwas mehr als einen Pfifferling, für den Inhalt seines Koffers würden ihm 307,45 Deutsche Mark gutgeschrieben werden.
Wenn Therese auf der Höhe gewesen wäre, hätte sie ein Vielfaches der Summe dafür bekommen können.
So hatten sie ihre Schwäche gnadenlos ausgenutzt, ihr einen Preis geboten, der lächerlich war, in einer Situation, in der man am besten gar nichts verkaufte.
Zorn stieg wieder in ihm hoch. Er hatte versucht, die Sache rückgängig zu machen, doch das war ein Schlag ins Wasser gewesen. Er hatte beim Notar lediglich indigniertes Staunen und Herablassung geerntet. »Ein gültiger Vertrag«, hieß es. Der Käufer hatte erst gar nicht mit ihm sprechen wollen, angeblich war er nicht zu Hause gewesen.
Und jetzt stand er hier und sah zu, dass er das Geld loswurde und einzahlte. Verdammt, er hatte nicht drei Jahre in einem russischen Kriegsgefangenenlager überlebt, um auf diese Weise abgespeist zu werden. Er rieb sich wieder sein linkes Auge, das zu zucken begonnen hatte.
»Na, Penunzen auf den letzten Drücker einzahlen?«
Das galt nicht ihm, sondern dem Mann vor ihm in der Reihe. Der schien nicht allzu erfreut über die Ansprache zu sein und brachte lediglich ein verkniffenes Ja hervor. Dem anderen, einem gedrungenen, nahezu quadratischen Kerl, schien es nichts auszumachen. Sein rosiges, auch ziemlich quadratisches Gesicht verzog sich zu einem breiten Grinsen, ein Goldzahn blinkte in der Sonne.
»Na, Montach geht es weiter. Allet wieder auf null gestellt. Aber wir werd’n das Kind schon schaukeln. Wir sind ja auf Zack.«
»Klar.« Dabei beließ der Mann es und schaute stur geradeaus.
»Und dann geht et wieder los«, sagte der andere.
Er verabschiedete sich und stapfte an der Schlange entlang. Krusmann drehte sich neugierig um, um zu sehen, ob er sich hinten anstellte. Doch das tat er nicht, sondern marschierte weiter die Straße hinunter.
Was ihn betraf, so ging es auch wieder bei null los. Ihm fehlte schlicht das Startkapital, weil Therese alles andere als auf Zack war. Ohne ihre Transaktion hätte er es gehabt: ein Grundstück in bester Lage, das er sicher gut hätte verkaufen können.
Er rückte mit der Schlange abermals ein paar Schritte vor und fluchte leise.
7
»Alles wie neu!«
Fritzi strahlte Edith an, hob die Hand und berührte sanft ihre frisch gelegten Wellen, die kastanienbraun in der Junisonne leuchteten. Das also hatte Fritzi früh am Samstagmorgen aus dem Bett und aus der Wohnung getrieben.
»Beim Friseur ist der Affe los. Seit endlich raus ist, dass wir am Montag mit der Reichsmark unsere Wände tapezieren können, steht halb Bochum beim Salon Schneider auf der Matte. Schnell noch eine Wasserwelle für die olle Reichsmark. Deshalb ist es bei mir ein bisschen später geworden.«
Fritzi lächelte entschuldigend. »Hast du lange gewartet?«
»Eine halbe Stunde«, sagte Edith trocken. Fritzi hakte sie gut gelaunt unter, sie roch eindeutig nach Friseur.
»So, dann lass uns schauen, wie wir unsere letzten Bestände noch umsetzen können«, verkündete sie und ging rascher.
Was Fritzi auch tat, sie tat es schnell. Sie redete schnell, sie ging schnell, sie aß schnell und traf schnell ihre Entscheidungen. Eine von ihnen hatte darin bestanden, sich nicht mehr Friederike rufen zu lassen, sondern sich Fritzi zu nennen, nachdem der Krieg zu Ende war. »Es klingt einfach flotter«, hatte sie Edith erklärt. Flott war Fritzis Lieblingswort, es bedeutete nicht nur schnell, sondern auch schick und modern. Friederike war Konzertpianistin gewesen, mit einer Ausbildung am Konservatorium in Köln und einem Faible für Bachs Goldberg-Variationen. Fritzi hingegen spielte an drei Abenden pro Woche in einer Bar Klavier, sie hatte es tatsächlich geschafft, den Barbesitzer zu überreden, sie statt eines männlichen Klavierspielers zu engagieren. Seitdem saß sie dort auf ihrem Klavierhocker, angetan mit einem hochgeschlossenen Kleid, damit keine Missverständnisse aufkamen, und spielte, was verlangt wurde: amerikanische Schlager.
Dort hatte Edith sie getroffen, und bald hatte sich herausgestellt, dass Fritzi ein Zimmer frei hatte. Edith hatte kurz gezögert und war bei Fritzi eingezogen.
Gemeinsam schlenderten sie durch die Straßen im Stadtzentrum. Zwischen den Häusern klafften die Lücken der Trümmergrundstücke; bei manchem Geschäftshaus, von dem lediglich die Fassade stand, ging der Blick direkt auf den Schutt, der sich hinter den hohlen Schaufenstern auftürmte. Der Trümmerkran war im Einsatz und schaufelte Ziegelsteine, zerborstene Dachpfannen und verkohlte Balken in die Waggons der Trümmerbahn. Viele der Schaufenster waren wieder verglast, hinter einer der Scheiben verrenkte sich ein Lehrmädchen und wienerte das Glas blitzblank. Die Auslagen dahinter waren karg bis nicht vorhanden. In den letzten Wochen hatte es nicht nur einen Ansturm auf Friseurläden gegeben; wer mehr Geld hatte als Fritzi, die sich die flüchtige Freude einer neuen Frisur leistete, investierte in Schmuck, Uhren, Kunst, Antiquitäten. Mancher Schwarzhändler schleppte einen Tafelaufsatz, eine Jugendstilfigur oder auch ein mächtiges Bild mit röhrendem Hirsch und vergoldetem Rahmen nach Hause, in der Hoffnung, sein Geld in Beständiges investiert zu haben. Doch solche Gelegenheiten waren inzwischen von den Schaufenstern in die Hinterzimmer gewandert.
»Komm!«
Fritzi zog sie am Ellenbogen und steuerte mit ihr auf Miederwaren Garthner in der unteren Kortumstraße zu. Der Laden war die erste Adresse für Wäsche und Miederwaren bester Qualität. Die beiden großen Schaufenster waren leer. Aber der Dekorateur hatte es nicht bei der Leere belassen. Er hatte die Leere in Szene gesetzt, so dass sie Verheißung wurde. Die Podeste, auf denen sonst ausgewählte Stücke lagen, waren von einem weich fließenden Stoff verdeckt, genauso wie die beiden Schaufensterpuppen, die nur darauf zu warten schienen, enthüllt zu werden und die Kostbarkeiten, die sie trugen, zur Schau zu stellen. Wenn die Schaufenster Verheißung waren, war die Tür Einladung. Lautlos und leicht schwang sie auf, als Fritzi den polierten Griff anstieß. Eine junge Verkäuferin kam eilfertig auf sie zu und erkundigte sich nach ihren Wünschen. Fritzi erklärte ihr freundlich, dass sie sich umschauen wollten.
Kundinnen strichen durch die Gänge oder begutachteten die Waren auf den recht spartanisch bestückten Tischen. Wer hoffte, die letzten Reichsmark in eine schicke Corsage, ein seidenes Strumpfband oder hauchzarte Nylons umzusetzen, wurde enttäuscht. Einzig schlichte Leibwäsche war zu sehen, viele der Regale und Vitrinen waren leer.
Fritzi peilte einen Tisch an. Wir verhalten uns wie Tiere auf der Jagd; dort, wo schon ein anderer Interessent lauert, findet sich die fetteste Beute, dachte Edith. Sie folgte ihr zu dem Tisch, an dem schon zwei Kundinnen Witterung aufgenommen hatten. Zwei Frauen mittleren Alters, angetan mit zwei hellen Sommerkostümen, die sich nur durch ihre Farbe – Taubengrau und Sandbeige – unterschieden, befingerten die Wäschestücke und tauschten halblaut Kommentare aus.
Fritzi stellte sich dazu und griff nach einem Wäschestück.
Eine weitere Frau kam aus einer der Kabinen und suchte sich ebenfalls einen Platz an dem Tisch. Sie schien sich jedoch weniger für die Ware als vielmehr für die Messingreling zu interessieren, die um den Verkaufstisch herumlief. Zumindest strichen die Finger ihrer behandschuhten Hand unablässig über das schimmernde Metall.
Edith betrachtete sie. Sie war etwas jünger als sie, hochgewachsen und eine auffällige Erscheinung. Dunkle, halblange Haare kontrastierten mit heller Haut, die Augen leuchteten goldbraun, und die Augenbrauen sahen aus wie mit Tusche gezogen. Sie ließ die Reling los und wickelte sich eine ihrer dunklen Locken um den Finger.
Edith fragte sich, was sie in dem Laden wollte, Miederwaren waren es anscheinend nicht.
Fritzi hielt ein Wäschestück hoch. Ein Schlüpfer von immenser Größe, der gut und gern zwei Fritzis Platz bieten würde.
»Größe zweiundfünfzig«, murmelte sie enttäuscht. »Und die anderen sehen nicht kleiner aus.«
Nahezu unverkäufliche Ware, dachte Edith. Es gab auch hier ein Angebot, allerdings eines, das niemand kaufen würde, das jedoch die Hoffnung auf bessere, passendere Stücke in nächster Zeit aufrechterhielt.
»Na, wenn das kein Ladenhüter ist«, sagte Fritzi mit gesenkter Stimme, damit die Verkäuferin, die ein paar Meter weiter stand und eine Vitrine abstaubte, sie nicht hören konnte. »Größe zweiundfünfzig, wem soll das wohl passen, klapperdürr, wie wir alle sind.«
Die Frau neben ihr erwachte aus ihrer Starre. Sie sah sich um, als wäre sie auf einem fremden Erdteil unterwegs.
»Klapperdürr«, wiederholte sie leise.
Fritzi entgegnete friedlich: »Klar, hat doch keiner mehr was auf den Rippen hier. Seit Jahren sind wir alle auf Diät.«
Eine der beiden Frauen auf der anderen Seite des Tisches lachte, die andere seufzte.
»Dat können Se laut sagen. Ich leb’ nur noch von Milchsuppe und Muckefuck.«
Die junge Frau legte den Kopf schief, so dass ihr elegantes Hütchen fast hinabzurutschen drohte. Sie betrachtete die beiden Damen, dann drehte sie sich abrupt um.
»Was ist denn mit der los?«
»Völlig plemplem, vielleicht zu lange unter Trümmern gelegen«, kommentierte die größere der beiden Frauen. Zu lange unter den Trümmern gelegen – eine ungebetene Erinnerung blitzte auf. Edith verscheuchte den Gedanken.
Sie sah der Frau nach. Sie marschierte ohne einen Blick auf die ausliegende Ware auf den Kassentisch zu, dort traf sie auf eine weitere Verkäuferin, die gerade aus einem der Hinterzimmer des Geschäfts kam. Sie redeten kurz miteinander, die junge Frau nahm ein Stück Papier entgegen, dann verließ sie den Laden.
Fritzi drehte eine weitere Runde um die Tische, um festzustellen, dass sich das Angebot wirklich nicht lohnte.
Beim Hinausgehen drehte sie sich um und deutete auf die verhüllte Schaufensterpuppe.
»Ich bin neugierig, was sie am Montag anhat.«
8
»Ich war’s nicht. Glauben Sie mir, Herr Oberinspektor«.
Dietrichs seufzte leise. Der Mann log. Adelheid Beckmann, die das Verhör mitstenografierte, erkundigte sich mit einem fragenden Blick, ob sie den Satz, den Cordsen zum dritten Mal äußerte, noch einmal ins Protokoll aufnehmen sollte. Dietrichs bejahte mit stummem Nicken. Samstagmittag, er saß im Präsidium und hörte sich zum zehnten Male Cordsens Lügen an.
Franz Cordsen hatte seinen Vermieter Gustav Hüttner getötet, Dietrichs war sich sicher und hatte den Staatsanwalt überzeugt, einen Haftbefehl zu beantragen. Die Sachlage war klar.
Am vergangenen Sonntag waren Dietrichs und sein Kollege frühmorgens in die Feldsieper Straße gerufen worden. »Normalerweise hör ich den Hüttner morgens immer über mir rumwetzen«, hatte der vierschrötige Metzgergeselle gesagt, der sie an der Haustür empfangen hatte. »Klock, klock, wie bekloppt rennt der mit seinen Holzpantinen durch die Wohnung. Aber heute Morgen: nix. Totenstille. Den ganzen Tag über: nix. Da hab’ ich gedacht: guckse mal nach. Der Hausmeister hat die Tür aufgeschlossen. Dann ham wir ihn gefunden. Im Kleiderschrank.«
Der Mann war tatsächlich in seinen Kleiderschrank gezwängt worden, und der Metzgergeselle hatte ihn entdeckt, weil er die Blutlache auf dem Boden gesehen hatte.
Nicht aufzufinden und verschwunden war dagegen Franz Cordsen, der Untermieter des Toten.
Also hatten sie Cordsen zur Fahndung ausgeschrieben und eine Personenbeschreibung in die Zeitung setzen lassen. Fünf Tage später, am gestrigen Freitag, hatte sich ein Kneipenwirt gemeldet.
»Ich hab ihn, euren Mörder.«
»Mutmaßlichen Mörder«, hatte Dietrichs korrigiert und dem Zeitungsgeraschel auf der anderen Seite der Leitung gelauscht. Dann drang aus der Muschel: »Sechzig Jahre alt, jünger aussehend, ein Meter fünfundsechzig bis eins siebzig groß, schlank, frisches Gesicht, dunkelblondes in der Mitte gescheiteltes Haar, niedrige Stirn, Augen grau, Nase gradlinig, Lippen wulstig, dreiteiliger Straßenanzug mit Nadelstreifen, blau gestreiftes Hemd. Der sitzt bei mir vorn im Gastraum und trinkt ’n Pils.«
Und genau so war es gewesen.
Die Personenbeschreibung war in der Tat treffend. Cordsen trug immer noch seinen Dreiteiler und das blau gestreifte Hemd. Der Kragen war inzwischen zerknittert und schmutzig, da Cordsen es nicht mehr gewagt hatte, in sein Zimmer zurückzukehren. Jetzt fischte er ein Taschentuch aus seiner Hosentasche und tupfte sich damit die rosige Stirn.
»Sie haben ihn erstochen und haben sich aus dem Staub gemacht«, behauptete Dietrichs.
Cordsen schwieg.
»Ihre Nachbarn haben einen lautstarken Streit gehört. Außerdem hat einer gesehen, dass Sie kurz danach die Wohnung verlassen haben.«
Das war der Metzgergeselle gewesen. Er hatte erklärt: »Sie hatten heftigen Zoff. Danach isser die Treppe runtergepoltert und nix wie weg.«
Außerdem hatte eine Mieterin aus dem Erdgeschoss gesehen, wie Cordsen gegen acht in seinem dreiteiligen Anzug und mit seiner großen Tasche das Haus verlassen hatte. Vermutlich hatte er darin seine blutige Kleidung aus dem Haus getragen und irgendwo versteckt. Finden würden sie diese wohl kaum. Auf den Trümmergrundstücken gab es ausreichend Verstecke, in denen man auch eine große Tasche problemlos verschwinden lassen konnte.
»Warum haben Sie ihn in den Kleiderschrank gepackt? Damit man ihn nicht auf den ersten Blick sieht?«
Cordsen betrachtete seine Fingernägel und sagte keinen Ton.
»Leider haben Sie nicht daran gedacht, dass aus so einer Stichwunde Blut läuft. Und ein Kleiderschrankboden Ritzen und Spalten hat. Mann!« Dietrichs wurde laut. »Und da meinen Sie, dass Sie mit der Geschichte durchkommen.«
Cordsens Gesicht blieb ausdruckslos.
»Legen Sie ein Geständnis ab, und der Richter wird Ihre Reue wohlwollend berücksichtigen.«
Cordsen schüttelte den Kopf.
»Ich war’s nicht.«
Cordsens Taktik war nicht die schlechteste. Stumpfes, mechanisches Leugnen war wirkungsvoller, als sich ein Lügengespinst auszudenken, das irgendwann doch zerriss. Aber auch mit seinem Leugnen würde er nicht durchkommen.
Dietrichs fragte nach dem Grund für die Auseinandersetzung und erhielt zur Antwort:
»Es ging um Geld. Hüttner hatte Schulden bei mir und wollte sie nicht zurückzahlen.«
Dietrichs glaubte ihm kein Wort. Wahrscheinlich war es umgekehrt gewesen. Unter den Dielen von Hüttners Schlafzimmer, verborgen vom Bettvorleger, hatten sie ein Versteck mit Schmuck und Uhren gefunden, die Früchte erfolgreichen Schwarzhandels, nahm Dietrichs an. Es war Hüttner, der Geld hatte, nicht Cordsen.
»Was waren das für Schulden?«
»Schulden halt.«
Cordsen schob die Unterlippe vor und verfiel in Schweigen.
Dietrichs seufzte. Diesmal laut und deutlich, wie man eben seufzt, wenn man merkt, dass die gutwilligsten Bemühungen nur mit Missachtung bestraft werden, und man möchte, dass das Gegenüber Bescheid weiß.
»Wie Sie wollen. Wir brauchen kein Geständnis. Was wir haben, reicht für viele Jahre im Bau. In Ihrer Haut möchte ich nicht stecken.«
Er klappte die Akte zu. Das Verhör war vorbei, Cordsen sollte begreifen, dass er seine Chance gehabt und vertan hatte. Cordsen saß wie festgenagelt auf seinem Stuhl. Dietrichs wartete.
Cordsen rutschte auf die Vorderkante seines Stuhls.
»Hüttner hatte am Nachmittag Besuch.«
Versuchte Cordsen es doch mit einer Lüge?
Dietrichs setzte ein gelangweiltes Gesicht auf.
»Ein Mann mit einem Handkoffer, einem blauen Segeltuchkoffer.«
»Wie außergewöhnlich.« Dietrichs sorgte dafür, dass der Spott in seiner Stimme nicht zu überhören war. Männer mit Koffern gab es in dieser Stadt zuhauf. Schwarzhändler, Hamsterer, selbst Otto Normalverbraucher lief in der Hoffnung auf ein günstiges Angebot auf seinem Weg mit Stoffbeuteln, Aktentaschen oder Handkoffern umher.
»Der Koffer war voller Geld. Reichsmark. Er wollte sie Hüttner andrehen. Wollte dafür Schmuck kaufen.«
»Woher wissen Sie davon?«
»Ich – ich hab’s im Flur gehört.«
Gelauscht? Dietrichs glaubte nicht daran. Cordsen dachte sich die Geschichte aus.
»Hüttner hat den bloß ausgelacht«, sagte Cordsen jetzt. »›Wat soll ich mit dem gammeligen Geld?‹, hat Hüttner gefragt.«
Das gammelige Geld war in der Tat ein Problem. Manche Schwarzhändler waren auf die Idee gekommen, es in die Ostzone zu verschieben, dort behielten die alten Scheine ihre Gültigkeit, weil die Kommunisten da drüben sich nicht an der Währungsreform beteiligen wollten. Inzwischen wurde an der Zonengrenze scharf kontrolliert, Personen ebenso wie Güter, und die Schmuggler hatten es schwer. Manche sagten, dass die Sowjets den Schmuggel zum Vorwand nahmen, um die Grenzen zwischen den Zonen abzuriegeln. Aber das war Politik.
»Und weiter?«, fragte Dietrichs.
»Sie haben herumdiskutiert, schließlich hat Hüttner ein Angebot gemacht, das der andere abgelehnt hat. Er hat aber nicht lockergelassen.«
»Sie standen aber lange im Flur«, bemerkte Dietrichs. Cordsen ignorierte die Bemerkung.
»Und danach«, Cordsen brach ab und nahm einen neuen Anlauf, »und danach hat Hüttner dem anderen gesagt, er hätte eventuell was für ihn, aber er müsse noch was klären. Er soll am Abend, um halb neun wiederkommen. Dann kann er ihm Bescheid geben.«