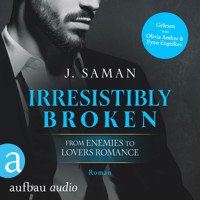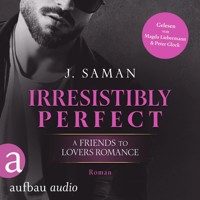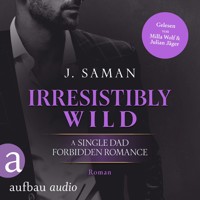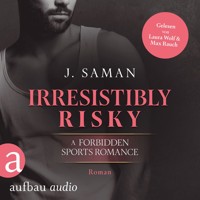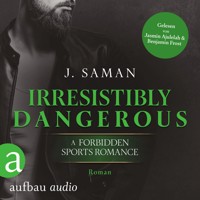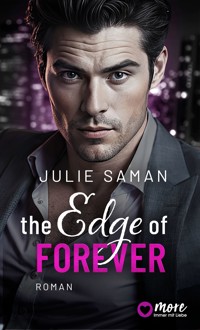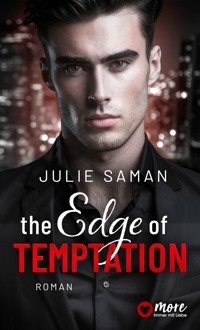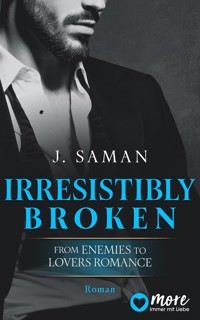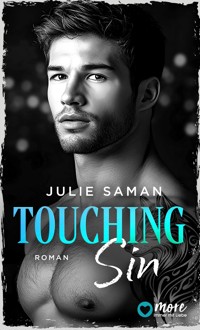
9,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Las Vegas Sin Serie
- Sprache: Deutsch
Manchmal muss man alles verlieren, um sich selbst zu finden …
Mia ist auf der Flucht. Vor ihrer Vergangenheit, vor der Wahrheit und vor dem Leben, das nie wirklich ihres war. Mit nichts als einem gestohlenen Auto und falschen Papieren strandet sie in Las Vegas. Ihre Pläne? Überleben, untertauchen, nicht auffallen. Doch ausgerechnet der wortkarge, viel zu attraktive Barkeeper Jake rettet sie und weckt etwas in ihr, das sie längst verloren glaubte: Vertrauen.
Jake kennt Geheimnisse. Und erkennt, wenn jemand versucht, vor sich selbst davonzulaufen. Als Mia in sein Leben stolpert, bringt sie mehr mit als eine tragische Geschichte. Sie bringt sein Herz durcheinander. Und das Letzte, was er will, ist, sich zu verlieben – schon gar nicht in eine Frau, die mehr Fragen aufwirft als Antworten gibt …
Spannend, deep und zutiefst emotional – perfekt für Fans von Ana Huang, L.J. Shen und Vi Keeland.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Liebe Leserin, lieber Leser,
Danke, dass Sie sich für einen Titel von »more – Immer mit Liebe« entschieden haben.
Unsere Bücher suchen wir mit sehr viel Liebe, Leidenschaft und Begeisterung aus und hoffen, dass sie Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Freude im Herzen bringen.
Wir wünschen viel Vergnügen.
Ihr »more – Immer mit Liebe« –Team
Über das Buch
Manchmal muss man alles verlieren, um sich selbst zu finden …
Mia ist auf der Flucht. Vor ihrer Vergangenheit, vor der Wahrheit und vor dem Leben, das nie wirklich ihres war. Mit nichts als einem gestohlenen Auto und falschen Papieren strandet sie in Las Vegas. Ihre Pläne? Überleben, untertauchen, nicht auffallen. Doch ausgerechnet der wortkarge, viel zu attraktive Barkeeper Jake rettet sie und weckt etwas in ihr, das sie längst verloren glaubte: Vertrauen.
Jake kennt Geheimnisse. Und erkennt, wenn jemand versucht, vor sich selbst davonzulaufen. Als Mia in sein Leben stolpert, bringt sie mehr mit als eine tragische Geschichte. Sie bringt sein Herz durcheinander. Und das Letzte, was er will, ist, sich zu verlieben – schon gar nicht in eine Frau, die mehr Fragen aufwirft als Antworten gibt …
Spannend, deep und zutiefst emotional – perfekt für Fans von Ana Huang, L.J. Shen und Vi Keeland.
Über Julie Saman
Julie Saman ist USA-Today-Bestsellerautorin und süchtig nach Cola Light, sauren Bonbons und Indie-Rock. Sie flucht viel zu viel (vor allem nach einem Glas Wein) und hat eine Vorliebe für Sarkasmus (zumindest sagen das ihr Mann und ihre Kinder gerne).
Sie ist vor allem bekannt für ihre witzigen und emotionalen Second Chance Romances mit intelligenten, starken Frauen und sexy Alpha Männern.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Julie Saman
Touching Sin
Aus dem Amerikanischen von Nicole Hölsken
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Grußwort
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Kapitel 1 — Mia
Kapitel 2 — Mia
Kapitel 3 — Mia
Kapitel 4 — Mia
Kapitel 5 — Mia
Kapitel 6 — Jake
Kapitel 7 — Mia
Kapitel 8 — Jake
Kapitel 9 — Mia
Kapitel 10 — Mia
Kapitel 11 — Mia
Kapitel 12 — Jake
Kapitel 13 — Mia
Kapitel 14 — Mia
Kapitel 15 — Jake
Kapitel 16 — Jake
Kapitel 17 — Mia
Kapitel 18 — Mia
Kapitel 19 — Jake
Kapitel 20 — Fiona
Kapitel 21 — Jake
Kapitel 22 — Jake
Kapitel 23 — Fiona
Kapitel 24 — Jake
Kapitel 25 — Fiona
Kapitel 26 — Jake
Kapitel 27 — Jake
Kapitel 28 — Jake
Kapitel 29 — Fiona
Epilog — Drei Jahre später
Danksagung
Was mir noch zu sagen bleibt
Impressum
Lust auf more?
Playlist:
After The Storm – Mumford and Sons
Cold Desert – Kings of Leon
Liar (it takes one to know one) – Taking Back Sunday
I Wanna Be Yours – Arctic Monkeys
High Hopes – Kodaline
Angela – Lumineers
We Don’t Know – Strumbellas
How to Disappear Completely – Radiohead
Panic Switch – Silversun Pickups
Prolog
Die hässliche Wahrheit? Menschen verletzen einander. Über diesen Teil der menschlichen Natur reden wir nur selten und erkennen ihn noch seltener an. Vornehmlich, weil wir ihn mittlerweile genauso akzeptieren wie den Wechsel der Jahreszeiten.
Als unabänderliches Naturgesetz.
Manchmal wird der Schmerz unabsichtlich hervorgerufen. Manchmal auch nicht. Aber egal, was dahintersteckt, wir fühlen uns automatisch genötigt, uns Entschuldigungen dafür auszudenken. Wir rationalisieren das, was nie rationalisiert werden wollte, denn die Wahrheit trifft uns härter, als der geliebte Mensch es je könnte. So läuft das nun mal …
Bis schließlich etwas Unvorhergesehenes passiert. Dann hören wir auf, Entschuldigungen für das Unentschuldbare zu ersinnen. Und wenn das passiert, erlangen wir Macht über den anderen. Über den Schmerz. Manchmal beginnt es wie ein leises Brennen. Ein schmerzhafter Seufzer. Ein Aufflackern lang vergessener Hoffnung, die man zuvor entsorgt hat, weil man sie für nutzlos gehalten hat wie Müll.
Irgendwann beginnt das leise Brennen zu schwelen, das Feuer wird größer, saugt Sauerstoff und Blut und Schweiß, Tränen und Schmerz in sich auf, bis es sich zum Buschfeuer ausgewachsen hat. Wild und unkontrollierbar. Ein verdammter Flächenbrand, den man weder eindämmen noch löschen kann.
Und das ist der Augenblick der Freiheit.
Wenn man erklärt, dass es jetzt reicht, und dafür sorgt, dass es aufhört.
Das könnte der entscheidende Moment im Leben sein. Zumindest für mich war er das. Wenigstens für eine Weile. Denn ich floh. Ich lief davon. Aber es war umsonst, denn letztlich fand er mich trotzdem wieder.
»Fakt ist, dass jeder Mensch dich verletzen wird: Du musst nur denjenigen finden, für den sich das Leiden lohnt.«
–Bob Marley–
Kapitel 1
Mia
Der beißende Geruch nach verbranntem Öl raubt mir beinahe den Atem. Obwohl die Fenster offen sind und durch die Lüftungsschlitze die Außenluft hereingeblasen wird, ist er unerträglich. Der Rauch, der von der Motorhaube des Wagens aufsteigt, ist sogar noch beunruhigender. Ich muss anhalten. Wahrscheinlich am besten sofort. Ich weiß, was das heißt. Es heißt, dass ich festsitze, und zwar mitten in … wo zum Teufel bin ich überhaupt?
Die eiskalte Erkenntnis trifft mich wie eine Ohrfeige. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin.
Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal eine Stadt oder etwas anderes als Flachland, Wüste und Berge gesehen habe.
Um mich herum ist es dunkel. Nicht einfach nur dunkel, sondern kohlrabenschwarze Nacht. So schwarz, dass ich nichts außer dem schmalen Lichtstreifen sehen kann, den die uralten schwachen Scheinwerfer werfen. Wie zwei Taschenlampen, die vorn am Auto befestigt wurden, beleuchten sie nur die unmittelbare Umgebung. Vollkommen nutzlos.
Nicht mal richtig weglaufen kann ich. Wie kann man nur so unfähig sein?
Der Rauch wird jetzt dichter, weht mir durch die Lüftungsschlitze und geöffneten Fenster ins Gesicht. Immer wenn ich versuche, durchzuatmen oder etwas zu erkennen, verbrennt er mir Kehle und Augen. Ironie des Schicksals, wenn ich an den Abgasen eines gestohlenen Fahrzeugs ersticke, obwohl ich auch den Mercedes meiner Mutter hätte nehmen können. Er steht seit ihrem Tod unbenutzt in der Garage herum. Niklas hätte sein Fehlen gar nicht bemerkt. Zumindest eine Weile nicht. Aber der Mercedes besitzt ein eingebautes GPS wie all unsere Fahrzeuge, weshalb ich ihn stehen gelassen und mich für die alte Klapperkiste unseres Gärtners entschieden habe.
Der Wagen stottert vor sich hin, dann zuckt er erst einmal, dann noch einmal, was das Lenkrad dermaßen zum Vibrieren bringt, dass ich es kaum mehr festhalten kann. Jetzt kann ich nichts mehr tun. Die Innenbeleuchtung flackert – an und aus, an und aus –, und dann erstirbt der Motor ganz, was mich dazu zwingt, den Wagen auf dem Seitenstreifen der Straße ausrollen zu lassen.
Dieser vollkommen verlassenen Straße.
Mist.
So war das nicht geplant. Wenn es nicht so tragisch wäre, würde ich darüber lachen. Wenigstens herrscht Sommer, und draußen ist es warm.
Ich habe keine Ahnung, wie weit ich von der nächsten Stadt entfernt bin. Gestern habe ich Dallas verlassen und bin nach Westen gefahren. Definitiv nach Westen, denn eine ganze Weile folgte ich den Schildern nach Flagstaff und dann Las Vegas. Aber dann bin ich irgendwo falsch abgebogen – und prompt hier gelandet.
Auf der Straße nach nirgendwo.
Das Auto gibt keinen Mucks mehr von sich. Noch einmal drehe ich den Schlüssel im Zündschloss, was ein unangenehmes Knirschen verursacht. Wie Metall, das über Metall reibt. Der Geruch ist sogar noch schlimmer als dieser Klang, und ich frage mich, ob ich das Fahrzeug nicht besser verlassen sollte.
Was, wenn es in Flammen aufgeht?
Können Autos tatsächlich einfach so in Brand geraten, oder passiert das nur im Film? Ich habe keine Ahnung. Meine Lage ist äußerst beunruhigend. Ich muss nachdenken.
Auf dem weichen Polster des Beifahrersitzes taste ich nach meiner Handtasche, und meine Finger finden den Riemen. Es ist so dunkel, dass man die Hand nicht vor Augen sieht. Ich krame in meiner Tasche herum, bis ich mein neues Mobiltelefon gefunden habe, und drücke auf den Knopf. Der Homescreen leuchtet auf. Stöhnend sehe ich, dass ich keinen Empfang habe.
Ich tippe auf die Suchmaschine, aber eine Internetverbindung habe ich natürlich ebenso wenig.
Und was jetzt?
Die Tränen, die hinter meinen Augen brennen, sind keine Folge der giftigen Rauchschwaden. Wie hatte ich es nur so weit kommen lassen können? Ich hätte aufmerksamer auf die Straßenschilder achten sollen, statt unaufhörlich darüber nachzudenken, was in meinem Leben alles schiefgelaufen war. Ich aktualisiere die Internetseite – mit dem gleichen Ergebnis wie zuvor.
Kein Empfang, kein Internet. Kein funktionierendes Auto. Keine Ahnung, wo ich bin. Kein Essen, kein Wasser. Nicht mal eine gottverdammte Decke. Aber ich kann wahrscheinlich sowieso nicht im Auto sitzen bleiben. Wahrscheinlich würde ich hier drin ersticken.
Mega. Ätzend.
Ich schlage mit den Händen auf das Plastiklenkrad ein und stoße den schrillsten Schrei aus, den meine rauchverklebten Lungen zustande bringen. Aber auch das kann die aufsteigende Panik und Frustration nicht eindämmen. Ich schaue mich um, suche durch die geöffneten Fenster hindurch die Gegend ab – ohne Erfolg. Kein Mond. Nur nutzlose Sterne, die weder Wärme noch Licht spenden.
Gerade als ich aussteigen und mich zu Fuß auf den Weg machen will, fluten grelle Lichter meinen Rückspiegel und blenden mich ein paar Sekunden. Automatisch kneife ich die Augen zusammen und ducke mich, ehe mir klar wird, dass es sich um Scheinwerfer handelt. Oh, Gott sei Dank. Es ist zu dunkel, um den Wagen erkennen zu können, der sich mir nähert, aber mittlerweile bin ich so weit, dass es mir egal ist. Nur die Polizei sollte es nicht sein. Das wäre nicht so gut. Jeder andere ist mir willkommen.
Doch dann sehe ich, dass es ein großer Pick-up ist, der hoch emporragt und so laut ist, dass die ganze Umgebung unter seinem Gewicht zu vibrieren scheint.
Wie Suchscheinwerfer richtet er das Licht auf mich.
Einerseits bin ich erleichtert, dass er angehalten hat. Andererseits bin ich eine junge Frau, allein mitten im Nirgendwo und dieser Gestalt plötzlich vollkommen ausgeliefert. Man könnte mich vergewaltigen und umbringen und meinen Leichnam ins Gebüsch werfen. Genau. Tolles Szenario. Aber momentan kann ich nicht allzu viel dagegen unternehmen.
Warum habe ich keine Waffe eingesteckt? Verdammt, immerhin stamme ich aus Texas. Wir hatten überall Waffen in unserem verfluchten Haus. Warum habe ich nicht daran gedacht, eine mitzunehmen? Allerdings, wie ich mich und mein Glück kenne, würde ich mich wahrscheinlich eher selbst verletzen, statt einen möglichen Angreifer. Zumal ich null Ahnung habe, wie man tatsächlich jemanden erschießt.
Vielleicht konnte ich den Betreffenden ja irgendwie bestechen, damit er auf Vergewaltigung und Mord verzichtet?
Man sollte die Hoffnung nie aufgeben.
Die Fahrertür fällt mit einem dumpfen Knall ins Schloss, und ich beobachte im Seitenspiegel, wie eine hochgewachsene vermummte Gestalt langsam auf mein Auto zukommt. Mein Herz sprengt beinahe meine Brust, mein Atem geht stoßweise, meine Knöchel treten weiß hervor, so fest umklammere ich das Lenkrad. Ich bin wie gelähmt und kann die Augen nicht von der Gestalt abwenden, die immer näher kommt.
Dann hat er mein Fenster erreicht und blickt auf mich herab, ohne dass ich seine Augen erkennen kann. Seine Kapuze überschattet sein ganzes Gesicht. Ich weiß lediglich, dass er groß und breitschultrig ist und mich innerhalb weniger Sekunden in der Mitte durchbrechen könnte wie einen Zweig.
Erst beobachtete er mich nur, während ich misstrauisch zu ihm emporblicke, immer noch vollständig bewegungsunfähig. Wie so ein blödes Reh im Scheinwerferlicht.
»Alles in Ordnung da drinnen?«, fragt er, und sein weicher Bariton ergießt sich über mich wie Whiskey über Eis. Ich stoße den Atem aus, den ich angehalten habe. »Brauchen Sie Hilfe?«
Diesem Kerl die Tür zu öffnen, ist das Letzte, was ich will, aber wahrscheinlich habe ich keine andere Wahl. Zumal mir meine Stimme immer noch nicht gehorcht. Er tritt zurück, als mein Türschloss klickt, und gibt mir jede Menge Raum zum Aussteigen.
Meine Hände zittern wie Espenlaub, und ich bezweifle, dass meine Beine mich tragen, wenn ich versuche, mich hinzustellen. Also bleibe ich sitzen und drehe mich ihm auf dem dünnen, klumpigen Stoff des Fahrersitzes ein wenig zu, wobei die Tür einen Spalt offen steht.
In was habe ich mich da verdammt noch mal nur reingeritten?
»Sind Sie verletzt?«, hakt er nach, als ich beharrlich schweige.
»Nein«, antworte ich und blicke auf seine Füße hinab – schwarze, fleckige Wanderstiefel und eine alte, abgetragene Jeans über muskulösen Schenkeln. Meine Stimme ist zwar leise, aber trotzdem laut genug, um den lärmenden Motor seines Trucks zu übertönen, der mein nutzloses Auto zu verspotten scheint.
»Dem Geruch nach zu urteilen verbrennt Ihr Wagen jede Menge Öl. Lässt sich der Motor einschalten?«
»Nein«, wiederhole ich und schlinge die Arme schützend um meinen Bauch, in dem mein spärlicher Mageninhalt gefährlich zu rumoren anfängt. Ich fühle mich verwundbar und schutzlos. Schon an guten Tagen und im günstigsten Fall fühle ich mich in männlicher Gesellschaft unbehaglich, und von gut oder günstig ist diese Situation weit entfernt.
Er brummelt irgendetwas Unverständliches vor sich hin, dann sagt er: »Kommen Sie.« Sein Befehlston jagt mir einen Schauer über den Rücken, und ich kann nicht entscheiden, ob er von der guten oder schlechten Sorte ist. Aber wenn er mir etwas antun wollte, hätte er das nicht längst getan? Keine Ahnung. Mir fehlt der Vergleichsmaßstab im Hinblick auf die Methodik, die Vergewaltiger und Killer bei ihren Opfern anwenden.
»Wo fahren wir hin?«, stoße ich mühsam hervor, wobei meine Stimme kräftiger klingt, als ich für möglich gehalten hätte.
Ich lehne mich auf meinem Sitz zurück, und mein Blick wandert nun endlich nach oben. Im Gegensatz zu seiner Jeans und den Boots sind seine Hände sauber und gepflegt. Sein Gesicht liegt immer noch im Dunkeln, und er unternimmt nichts, um das zu ändern, obwohl meine Absicht doch auf der Hand liegt. Dass er mir keinen Blick auf sein Gesicht gewährt, steigert meinen Angstlevel auf Acht von Zehn. Vielleicht hatte man ihn in seiner Jugend misshandelt, weshalb er mir jetzt das Gleiche antun wollte. Oder er war der Psycho aus dem Texas Chainsaw Massacre.
»Ich fahre Sie in die Stadt«, erklärt er, als sei das die einzig denkbare Lösung für jede geistig gesunde, vernünftig denkende Person. Aber im Moment bin ich weder das eine noch das andere. Ich sitze seit zwei Tagen praktisch Nonstop im Wagen. Hab nur ein paar Stunden geschlafen, und zwar ganz hinten auf dem Parkplatz eines Vierundzwanzig-Stunden-Walmarts.
Stadt. Er wird mich in die Stadt bringen. Welche Stadt meint er wohl? Würde man Las Vegas eher als Stadt oder als Großstadt bezeichnen? Aber wenn er mich in die Stadt bringen will, hat er zumindest nicht vor, mich zu vergewaltigen und umzubringen, oder? Aber vielleicht lügt er ja auch, ruft mir die Stimme in meinem Hinterkopf ins Gedächtnis. Mein Gott, ist das alles ätzend. Mir bleibt keine andere Wahl, als ihm zu vertrauen.
Hier zu bleiben, ist jedenfalls keine Option.
Ich befinde mich mitten in der verdammten Wüste.
»Okay. Danke. Das wäre nett.«
Er tritt noch einen weiteren Schritt zurück, als sei er mir gegenüber genauso misstrauisch wie ich ihm. Ich steige aus und stelle mich hin, wobei Kies und getrocknete Erde unter meinen Reitstiefeln knirschen. Wenigstens bin ich angemessen gekleidet. Ich blicke zu ihm empor, erhasche lediglich einen Blick auf seinen Mund und das stoppelige Kinn. Kantiger Kiefer und weiche, volle Lippen. Aber der Rest?
»Können Sie, hmm …« Ich schlucke schwer und trete unruhig von einem Fuß auf den anderen. »Macht es Ihnen etwas aus, die Kapuze abzunehmen?«
Er stößt ein tiefes, rumpelndes Lachen aus. »Damit Sie sichergehen können, dass ich nicht Leatherface bin oder so was?«
Ich lache ebenfalls, aber es klingt verlegen und zittrig, denn eigentlich hat er meine Gedanken exakt erraten. Bis hin zu dem gruseligen Horrorfilm.
Er schiebt seine Kapuze vom Kopf, und mir stockt der Atem, wenn auch aus einem ganz anderen Grund. Er ist wunderschön, ein Wort, das angesichts seiner männlichen und wilden Erscheinung seltsam klingt. Dennoch ist es das Erste, was mir in den Sinn kommt.
»Zufrieden?«
Ich starre ihn nur an. Schön ist nicht gleichbedeutend mit anständig.
Ein schiefes Lächeln umspielt seine Lippen. Er schüttelt beinahe unmerklich den Kopf und hebt kapitulierend beide Hände.
»Ich tue Ihnen nichts. Versprochen. Aber ich kann Sie hier auch nicht einfach zurücklassen. Immerhin ist die nächste Stadt über dreißig Kilometer weit weg.« Dreißig? »Eigentlich haben Sie sogar Glück gehabt. Ich fahre rein zufällig hier entlang, nachdem ich an der Talsperre war. Ich wollte noch ein bisschen herumfahren und habe deshalb den längeren Heimweg gewählt. Gott sei Dank«, betont er, fährt sich mit der Hand übers Kinn und mustert mich von Kopf bis Fuß. »Sie hätten die ganze Nacht hier herumhocken können, ohne dass auch nur ein Auto vorbeigekommen wäre.«
Was für eine Talsperre? Etwa der Hoover Dam? Wo zur Hölle war ich?
»Glück gehabt«, plappere ich nach, und die Worte hinterlassen einen sauren Nachgeschmack auf meiner Zunge, denn in Bezug auf mich selbst habe ich sie vermutlich noch nie ausgesprochen. Beinahe möchte ich loslachen, so absurd ist das alles. »Wie heißen Sie?«, frage ich und sehe ihm in die Augen. Sie könnten braun sein. In dieser Dunkelheit ist es schwer zu sagen, aber ich vermute es. Sein Haar ist ein wenig zerzaust, am Oberkopf länger, an den Seiten kurz rasiert. Die Farbe ist in diesem Licht kaum zu identifizieren, doch sie scheint genauso dunkel zu sein wie seine Augen. Das kräftige, markante Kinn ziert eine ordentliche Schicht Bartstoppeln, die ihm ein verwegenes Aussehen verleihen.
Er ist ein Forstarbeiter, überlege ich. Und sexy obendrein.
Er lächelt und zeigt mir seine perfekten Zähne. Weiß und gerade. Ein interessanter und höchst willkommener Kontrast zu seiner sonstigen Wildheit. Und dann dieses Lächeln. Heiliger Strohsack. Aus irgendeinem merkwürdigen Grund entspanne ich mich bei dem Anblick. Als seien gründliche Zahnhygiene und ein fantastisches Lächeln ein Zeichen für anständigen Charakter. Seit wann bin ich so dumm?
»Jake«, stellt er sich vor und nimmt bedächtig jeden Zentimeter meines Körpers in Augenschein, bis er wieder an meinem Gesicht ankommt. Dann verändert sich seine Miene. Skeptisch und misstrauisch nimmt er meine Züge in sich auf. Ich frage mich, ob er mich wiedererkennt. Ich hoffe, nicht. Aber im Grunde ist es unwahrscheinlich. Wahrscheinlich kennt man mich in diesem Bundesstaat gar nicht. »Und Sie?«
Wie ich heiße. Ich zögere. Welchen Namen soll ich ihm nennen? Bestimmt nicht meinen richtigen.
»Mia«, platze ich heraus und meide seinen Blick.
»Okay, Mia. Warum schnappen Sie sich nicht Ihre Sachen aus dem Wagen und kommen mit? Ich habe einen Kumpel, der Ihren Wagen in die Stadt schleppen könnte.«
Ich nicke, habe aber gar keine Gelegenheit, ihm zu antworten, denn schon stapft er zu seinem Pick-up zurück, sodass seine beeindruckende Silhouette von einem Glorienschein aus Licht umgeben ist. Ich zögere keinen Augenblick und zerre meine Tasche vom Beifahrersitz des gestohlenen Fahrzeugs.
Dann beiße ich mir auf die Unterlippe. Ist da sonst noch etwas drin, das ich brauche? Irgendetwas, das mich mit diesem Auto in Verbindung bringen könnte?
Abgesehen von dem Ort des Diebstahls und deinen Fingerabdrücken?
Leise knurre ich einen Schwall Flüche vor mich hin. Der Wagen wird sie auf meine Spur bringen. Aber dieser Typ behauptet, jemanden zu kennen, der ihn abschleppen kann. Vielleicht kann ich das Auto danach ja verschrotten lassen. Dann würde keiner etwas merken.
Ich gehe zum Kofferraum, öffne ihn und hole meine Koffer heraus, einen nach dem anderen, um sie auf den staubigen Boden zu stellen. Jake wartet bereits auf mich. Seine Scheinwerfer beleuchten die Rückseite meines Autos und weisen mir so den Weg. Auch mein Nummernschild ist deutlich zu erkennen, und ich zucke innerlich zusammen. Darauf prangt in Großbuchstaben das Wort TEXAS neben einer Abbildung des Staates. Zu spät, seufze ich. Ich kann nur hoffen, dass er kein besonders aufmerksamer Beobachter ist.
Wortlos greift Jake nach einem meiner Koffer. Ich folge ihm, wobei ich den zweiten hinter mir herziehe. Die Räder des Trolleys verhaken sich in der geborstenen Erde. Wir schlängeln uns zwischen seinen Pick-up und meinem Auto hindurch, dann öffnet er mir die Beifahrertür. Er nimmt mir den Koffer ab, hebt ihn mühelos hoch und wirft ihn zusammen mit meinem anderen Koffer auf die kleine Rückbank hinter dem Beifahrersitz.
Seine beeindruckend große Hand berührt meinen Arm, und ich zucke instinktiv zurück, als stünden seine Finger in Flammen. »Rühren Sie mich nicht an«, blaffe ich.
Sofort hält er begütigend die Hände in die Höhe und reißt erstaunt die dunklen Augen auf. »Ich wollte Ihnen nur hinaufhelfen.«
»Oh. Tut mir leid, aber ich schaffe es auch allein, glaube ich. Danke«, murmele ich ein wenig schuldbewusst.
Ich hieve mich in die saubere, kühle Fahrerkabine hinauf und atme den berückend erdigen Duft ein, eine Mischung aus seinem Eau de Cologne und neuem Auto. Dieser Pick-up ist hübsch. Den weichen Ledersitzen, der Holzvertäfelung und dem riesigen Armaturenbrett mit zahllosen Knöpfen und Ziffernblättern und jeder Menge technischem Schnickschnack nach zu urteilen, war er sicher teuer.
Dann trifft mich ein Gedanke. Der Typ, der meinen Wagen abschleppt, könnte den Besitzer ermitteln lassen, bevor ich mir überhaupt mit ihm handelseinig würde. Ich muss so schnell wie möglich fort von hier. Vielleicht ist es besser, wenn Jake niemanden anruft. Wenn wir das Auto einfach hier, mitten im Nirgendwo, stehen lassen.
»Sie müssen Ihren Freund nicht anrufen«, sage ich, als er ebenfalls ins Auto gestiegen ist und sich anschnallt, »Wir können den Wagen hier stehen lassen. Wahrscheinlich ist er ohnehin nur noch Schrott, so alt, wie er ist. Kann ich hier irgendwo einen neuen kaufen?« Das wäre ein Risiko, aber was bleibt mir für eine andere Wahl? Allerdings habe ich keine Ahnung, was für eine Art Wagen ich mir mit meinem mageren Budget leisten kann. Wahrscheinlich nichts Besseres als der, dem ich gerade entstiegen bin.
Jake starrt mich lange forschend an. Als versuche er, mich zu durchschauen. Das macht mir Angst. Am liebsten würde ich so schnell wie möglich wieder aussteigen. Es ist, als könne er mit diesen Augen bis auf den Grund meiner Seele sehen, und es erfordert meine ganze Konzentration, unter seinem Blick nicht unbehaglich auf meinem Sitz hin und her zu rutschen. Mit der braunen Augenfarbe hatte ich recht, aber es ist nicht einfach nur irgendein Braun. Sondern eines, das an warme Milchschokolade erinnert.
»Wenn wir Ihr Auto hier stehen lassen, wird die Polizei es irgendwann abschleppen lassen.« Er beobachtet mich aufmerksam, und obwohl mein Herz rast wie verrückt, bemühe ich mich um eine stoische Miene. »Und vor morgen früh macht ohnehin kein Autohändler auf.«
Ich schließe die Augen, und für kurze Zeit bleibt mir die Luft weg. Ich könnte mit dem Bus oder per Zug weiterreisen, aber das wäre der letzte Ausweg, und ich bezweifle, dass ich heute Nacht noch irgendeinen Anschluss bekomme.
»Ich sitze hier fest«, flüstere ich vor mich hin. »Wo bin ich?«, frage ich, momentan eigentlich eher aus Neugier.
»Kurz vor der Stadtgrenze von Henderson oder Boulder City, je nachdem, wohin Sie wollen«, antwortet er, und ich runzele die Augenbrauen. »Nevada«, fügt er hinzu.
Henderson in Nevada? Ich habe keine Ahnung, wie weit das von Las Vegas entfernt ist, und der Name dieser Stadt stand auf den letzten Straßenschildern, an die ich mich erinnere. Herrje, ich sitze ganz schön in der Tinte.
Was zum Teufel soll ich jetzt nur tun?
Kapitel 2
Mia
Die Fahrt in die Stadt ist lang und verläuft schweigsam. Während wir Henderson durchqueren, fällt mir auf, dass er gar nicht gefragt hat, wo ich hinwill. Wahrscheinlich nimmt er automatisch an, dass ich nach Las Vegas will, denn das steht auf den Schildern, denen wir auf der Fahrt über den Highway folgen. Ich mache mir nicht die Mühe, etwas anderes vorzuschlagen. Las Vegas bietet die meisten Möglichkeiten, und ich wollte schließlich sowieso dorthin.
Das Radio ist eingeschaltet, aber leise gedreht, weshalb es eher wie Hintergrundrauschen klingt und kaum zur musikalischen Untermalung beiträgt. Ich kann nicht mal heraushören, welchen Song sie gerade spielen.
»Was glauben Sie, was fehlt dem Auto?«, frage ich, als ich die Stille nicht länger ertrage.
»Keine Ahnung, aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass Ihr Motor wegen eines ziemlich großen Öllecks Schrott ist.«
»Ist so eine Reparatur teuer?«
Er gluckst leise vor sich hin und reibt sich mit der Hand über sein stoppeliges Kinn. Seine Reaktion macht mich sauer. Diese Situation ist nun wirklich nicht amüsant. Absolut nicht. Aber natürlich hat er keinen blassen Schimmer, wie verzweifelt ich bin.
»Dieser Wagen ist vermutlich älter als Sie selbst, und da er seit mindestens zehn Jahren auch nicht mehr produziert wird, lohnt sich eine Reparatur wohl kaum noch. Aber das ist Ihre Entscheidung, nicht meine.«
Ich schlucke die Galle herunter, die mir die Kehle emporsteigt und mich zu ersticken droht. Oder nach draußen drängt, sodass ich sein Auto vollkotze. »Könnten Sie mich zu einer Bushaltestelle oder einem Bahnhof bringen? Ich kann Sie auch bezahlen«, füge ich hinzu.
Jake wirft mir einen Blick zu. Dann wendet er sich wieder der schwarzen Straße zu, auf der seine Scheinwerfer die gelben Längsmarkierungen des Highways beleuchten.
Er sagt nichts. Geduldig warte ich auf seine Antwort. Doch als die ausbleibt, schaue ich ihn wieder an. Ich beobachte, wie er sich – vermutlich nachdenklich – übers Kinn reibt. Schließlich sieht er mich wieder an. Sogar in dem spärlich beleuchteten Führerhaus kann ich erkennen, dass er versucht, in meinem Gesicht zu lesen. Langsam lässt er den Blick über mich hinwegwandern, bevor er sich wieder der Straße zuwendet.
»Es ist schon spät«, antwortet er schließlich. »In Las Vegas kennt man zwar keine Nacht, aber deshalb ist es trotzdem keine gute Idee, jetzt den Busbahnhof aufzusuchen.«
»Ich kann Ihnen nicht folgen.«
»Sie sind eine junge Frau. Noch dazu eine schöne junge Frau. Und Sie sind allein. Der Busbahnhof in Vegas ist zu dieser späten Stunde wohl kaum ein sicherer Aufenthaltsort für Sie.«
Ich nicke und kriege keinen Ton heraus, so groß ist mein Kloß im Hals. Allerdings finde ich zumindest ein wenig Trost in der Tatsache, dass ich gleich in Las Vegas sein werde, einer riesigen Stadt mit jeder Menge Touristen.
»Okay«, bringe ich schließlich heraus. »Und wie wär’s mit einem Hotel?«
Er nickt, und sein Gesichtsausdruck sagt, dass ich endlich Vernunft angenommen habe. »Dort könnte ich Sie absetzen. An was für eine Art von Hotel haben Sie denn gedacht?«
An irgendeinen Laden, wo man mir keine Fragen stellt oder eine Kreditkarte verlangt. Oder einen Personalausweis mit Foto.
Doch so einen Ort gibt es auf diesem Planeten nirgends mehr.
Ich weiß nicht, was ich ihm antworten soll, also halte ich den Mund. Dieses Gefühl, hilflos in der Falle zu sitzen, ist mir einfach unerträglich. Es schnürt mir die Luft ab. Absolut beängstigend. Es steht für alles, vor dem ich davonlaufe, und hier bin ich nun: stecke schon wieder bis zum Hals in einer Situation, aus der es kein Entrinnen gibt.
Kein Auto. Kein Dach über dem Kopf. Kein Ausweg.
»Können Sie nicht irgendjemanden anrufen?«
»Nein«, fauche ich. Doch meine Stimme klingt belegt von den Tränen, die ich mir immer krampfhafter verkneife. Meine einzigen Angehörigen sind gleichzeitig die Menschen, vor denen ich davonlaufe. Er hatte recht, als er sagte, dass ich allein sei. Das bin ich. Ich habe niemanden.
»Wo kommen Sie her?«
Ich gebe keine Antwort.
»Wo wollen Sie hin?«
Wieder schweige ich.
Er atmet vernehmlich aus. Offensichtlich genauso genervt von mir, wie ich selbst es bin. Aber obwohl ich weiß, dass ich dazu kein Recht habe, ärgere ich mich auch über ihn. Er ist doch eigentlich nur freundlich. Aber genau das ertrage ich nicht. Ich ertrage weder seine Fragen noch seine Hilfsbereitschaft. Nichts von alldem. Ich wusste, dass das Auto alt war. Ich wusste, dass Roderigo es seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt hatte. Aber als ich den Schlüssel im Schloss drehte, sprang es an, und im Tank war sogar Benzin. Ich konnte kein anderes Auto nehmen, und ganz sicher würde ich auch keines kaufen.
Wo immer er mich heute Abend hinbringt, ich habe keine Möglichkeit, von dort wieder zu verschwinden. Ich kenne kein Hotel, in dem man keine Kreditkarte hinterlegen muss. Und auf jeder meiner Kreditkarten steht mein richtiger Name. Einfach so abzuhauen, war impulsiv und abgrundtief dumm. So verdammt dumm.
Jetzt sitze ich in der Falle.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er mich findet und nach Hause zerrt.
Bei diesem Gedanken ist es mit meiner Beherrschung vorbei. Ich verberge das Gesicht in den Händen, und die Tränen schießen mir aus den Augen wie Wasser aus einem kaputten Wasserhahn. Ich zittere und bebe und schluchze herzzerreißend. In diesem Augenblick ist es mir sogar gleichgültig, dass ich mich vor einem Fremden in dieses flennende Häufchen Elend verwandelt habe. Was soll ich jetzt nur tun?
»Hey«, sagt er sanft. »Schon gut. Alles wird gut.«
Ich schüttele den Kopf, verberge nach wie vor das Gesicht in den Händen. Der Typ hat ja keine Ahnung.
»Hören Sie. Ich werde Sie nicht einfach vor der Werkstatt absetzen, ohne dass Sie eine Bleibe gefunden haben. Das würde ich nie tun. Wir reden mit meinem Freund von der Werkstatt, und dann suchen wir Ihnen ein Hotel.«
Wieder schüttele ich den Kopf und lasse die Hände in den Schoß sinken. Dann schaue ich ihn an. »Ich kann nicht in ein Hotel.«
Eine Sekunde lang sagt er nichts. Dann fragt er: »Verraten Sie mir, wieso?«
Noch ein Kopfschütteln.
»Ich kann Sie nicht einfach am Busbahnhof absetzen. Dort ist es wirklich nicht sicher. Das meine ich ernst. Sie kennen sich in Vegas vielleicht nicht aus, aber ich schon.«
Er hat ja keinen blassen Schimmer, was Unsicherheit tatsächlich bedeutet. Woraus wahre Albträume gemacht sind.
»Das ist nicht Ihre Entscheidung.« Wenn er mich nicht hinbringt, lasse ich mich eben von einem Taxi hinfahren. Ich habe Bargeld. So weit kann der Bahnhof von dieser Werkstatt, zu der er mich fährt, nun auch wieder nicht entfernt sein.
Er reibt sich mit der Hand übers Gesicht, bevor er mit der flachen Hand aufs Lenkrad schlägt. »Okay, wie wäre es damit? Sie begleiten mich zur Arbeit, und ich tätige dort ein paar Anrufe«, drängt er mich. Seine rechte Hand löst sich vom Lenkrad und bewegt sich in meine Richtung, als wollte er mich berühren. Aber dann besinnt er sich eines Besseren und legt sie wieder ans Steuer. »Wir überlegen uns eine Lösung. Ich werde Sie heute Abend nicht ohne eine Bleibe zurücklassen.«
Wir, sagt er. Er benutzt das Wort »Wir«, als interessierte ihn mein Schicksal. Aber wieso? »Warum helfen Sie mir?«
Er stößt ein sardonisches Lachen aus, und etwas an diesem Geräusch veranlasst mich, mir die letzten Tränen abzuwischen und ihn näher zu mustern. Offenbar hat er keine Ahnung, warum er mir hilft.
»Sie sind allein und in Vegas gestrandet. Ich meine, wirklich originell ist das nicht gerade.«
Wütend funkele ich ihn an. Ganz schön unverschämt.
Anscheinend merkt er selbst, dass er gerade eine Grenze überschritten hat, denn er fügt hinzu: »Sie brauchen Hilfe, und ich gehöre nicht zu den Typen, die eine junge Frau, die kein Dach über dem Kopf hat, sich selbst überlassen.« Er macht eine Pause und ein winziges, schiefes Lächeln umspielt seine Mundwinkel. Seine ach so dunklen Augen funkeln im blauen Schimmer des Armaturenbretts. »Vielleicht kann ich Sie ja auch nur nicht weinen sehen. Was auch immer der Grund ist, ich habe gesagt, dass ich Ihnen helfe, und ich habe es ernst gemeint.«
Er sieht wieder auf die Straße und konzentriert sich aufs Fahren, um mir zu signalisieren, dass die Unterhaltung damit beendet ist.
Ich begutachte sein Profil, frage mich, ob er tatsächlich real ist. Noch nie im Leben habe ich einen selbstlosen Menschen kennengelernt. Mir ist klar, wie schrecklich das klingt; trotzdem ist es wahr. Jeder in meiner Umgebung hat bei dem, was er tut, Hintergedanken. Selbst Spenden für einen guten Zweck sollen Steuererleichterungen und guten Leumund bringen. Wie traurig ist das? Dieser Typ hat mir seine Hilfe angeboten, und ich ertappe mich prompt dabei, wie ich auf den Haken warte.
»Was wollen Sie als Gegenleistung?«
Ruckartig wendet er den Kopf, und für den Bruchteil einer Sekunde wirkt er verletzt, als sei allein die Frage ungeheuerlich. Vielleicht blickt er ja auch angewidert drein, denn eine solche Frage kann auf vielerlei Weise missverstanden werden.
Dabei war es nur eine Frage, kein Angebot.
Er gibt keine Antwort, und ich kann nicht sagen, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist. Ärgerlich dreht er sein Radio lauter, und statt Country Music oder Metal, wie ich erwartet hätte, ertönt ein Lied der Arctic Monkeys.
Ich muss wider Willen und trotz meiner miesen Lage lächeln. Diese Band habe ich durch Anthony, den Sohn unseres Hausmädchens, kennengelernt. Er spielte mir das Album vor, aber nachdem mein Vater herausfand, dass wir Zeit miteinander verbrachten, verbot er ihm das Haus.
»Sie kennen die Band?«, fragt Jake überrascht.
Ich runzele die Augenbrauen und schaue ihn an. Woher weiß er das?
»Sie haben mitgesummt«, beantwortet er die unausgesprochene Frage.
Oh. Ups. »Ja. Ich kenne sie. Aber nicht allzu gut. Nur ein paar wenige Songs.«
Er verlagert sich auf seinem Sitz und sieht mir kurz in die Augen, bevor er schnell wieder auf die Straße sieht. »Sie haben einen Akzent«, beginnt er und holt erst tief Luft, bevor er weiterspricht. »Und auf Ihrem Nummernschild war etwas von Texas zu lesen. Kommen Sie da her?«
Ich gebe keine Antwort, sondern starre nur aus dem Fenster, nehme den Las Vegas Strip in Augenschein, dem wir uns langsam nähern, während wir uns durch die Stadt schlängeln.
»Haben Sie irgendwelchen Ärger?« Bei dieser Frage möchte ich am liebsten laut auflachen, aber er meint es ernst. Ich kann ihm keine ehrliche Antwort geben. »Ist die Polizei hinter Ihnen her?«
Auch darauf weiß ich keine Antwort.
Aber mir wird klar, dass ich irgendetwas sagen muss. Immerhin ist er mir behilflich und will sich wahrscheinlich nur vergewissern, dass er später nicht verhaftet wird, weil er einer Kriminellen oder so geholfen hat.
»Ich habe kein Gesetz gebrochen, wenn es das ist, wonach Sie fragen.«
»Sind Sie eine Ausreißerin?«
Ich schnaube und fahre mir mit den Fingern durchs Haar. »Ich bin zweiundzwanzig«, teile ich ihm mit. Hoffentlich kapiert er, dass ich kein minderjähriges Mädchen bin, das von zu Hause abgehauen ist. Vielmehr bin ich eine erwachsene Frau, die aus ihrem Zuhause geflüchtet ist, aber das ist ein ganz anderes Problem. »Und Sie müssen mir auch nicht helfen.«
Er stellt keine weiteren Fragen. Stattdessen drückt er ein paar Knöpfe an seinem Lenkrad, um die Lautstärke seiner Soundanlage hochzudrehen, womit er jedes weitere Gespräch im Keim erstickt.
Ich wette, er bereut jetzt schon, mich aufgelesen zu haben. Mir ginge es an seiner Stelle jedenfalls so. Ein paar Minuten später fährt er an einer Tankstelle vor, über der der Name Healey & Sons prangt. Das Hauptgebäude und die Parkplätze liegen teilweise im Dunkeln, aber die Zapfsäulen sind noch hell erleuchtet. Bei näherem Hinsehen entdecke ich eine Gestalt im Hauptgebäude, die die Füße auf den Ladentisch gelegt hat.
»Das ist Brennan.« Jake deutet auf den Mann. »Er betreibt einen Abschleppdienst in der Stadt und kann Ihr Fahrzeug herholen.« Ich starre Brennan an. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich mit dem Auto machen soll. Während der halbstündigen Fahrt hierher bin ich nicht plötzlich erleuchtet worden. »Warten Sie hier, okay?« Er mustert mich eindringlich. »Ich rede jetzt mit ihm, und sobald das geregelt ist, bringe ich Sie in ein Hotel.«
Ich stoße scharf die Luft aus und atme sogleich wieder ein. Ich kann nicht in ein Hotel. Das habe ich ihm doch gerade gesagt.
»Ich kenne da ein hübsches Plätzchen, nicht weit von hier.«
Hübsche Plätzchen sind heute Nacht nichts für mich.
»Klar«, schnaufe ich und ringe mir ein Lächeln ab. »Klingt perfekt.« Und weil ich bestimmt keine zweite Gelegenheit bekommen werde, es auszusprechen, drehe ich mich zu ihm um, sehe ihm ins Gesicht und sage: »Danke, Jake. Dass Sie mich am Straßenrand aufgelesen und hergebracht haben. Und dafür, dass Sie sich so sehr ins Zeug legen, um mir zu helfen.«
Er schenkt mir ein schiefes Lächeln und reibt sich den Nacken. Nachdem er mich noch einmal forschend gemustert hat, hüpft er aus dem Pick-up. Ich schaue ihm hinterher, wie er auf das Hauptgebäude zusteuert. Ich nehme mir sogar eine Minute Zeit, um sein Aussehen zu würdigen.
Kaum hat er den Bau betreten, steige ich aus dem Pick-up, schnappe mir meine Koffer und laufe davon.
Ich zerre sie die Straße entlang und von der Tankstelle fort. Überall stehen Taxis herum, und ich bin versucht, mir eins heranzuwinken und hineinzuspringen, aber wohin soll ich fahren?
Wahrscheinlich hat er recht mit seiner Einschätzung, dass der Busbahnhof zu dieser Uhrzeit nicht sicher ist. Es ist weit nach ein Uhr morgens, und obwohl die Straßen ziemlich bevölkert sind, sind jede Menge Betrunkene unterwegs, die lautstark lamentieren und mir im Vorbeigehen anzügliche Blicke zuwerfen. Vielleicht bilde ich mir Letzteres ja auch nur ein, aber das Gefühl lässt mich einfach nicht los. Mir sinkt das Herz, als ich irgendwie den Las Vegas Strip erreiche.
Hier ist es hell. Gleißend hell. Verwirrend hell. Und sogar noch überfüllter. Menschen strömen in sämtliche Richtungen. Männer preisen Prostituierte per Flugblatt an, und Frauen tragen mit Juwelen besetzte Bikinis und ein freundliches Lächeln zur Schau.
Ich könnte zum Flughafen fahren, aber meinen Personalausweis zu benutzen, ist ein hohes Risiko, denn dann ist mein Weg zurückverfolgbar.
Vor einem der riesigen Hotels, die den Strip säumen, bleibe ich stehen und grübele darüber nach. Er hat gesagt, dass eine Frau in dieser Stadt verloren geht, sei ein Klischee, und in diesem Augenblick glaube ich ihm. Denn genauso komme ich mir vor. Wie ein Klischee.
»Hey, Sie da«, ruft jemand und reißt mich aus meinen Tagträumen. Ich wende meine Aufmerksamkeit von dem riesigen, goldenen Gebäude ab und schaue einer Gruppe Typen entgegen, die auf mich zukommen. Sie begutachten mich von Kopf bis Fuß, nehmen meine Koffer und meinen verlorenen Gesichtsausdruck wahr. Derjenige, der wahrscheinlich mit mir gesprochen hat, grinst auf eine Art, die mir das Blut in den Adern gefrieren lässt. »Du siehst ein bisschen verloren aus, Püppchen. Warum kommst du nicht mit uns? Wir würden dir liebend gern helfen, dich zurechtzufinden.«
Ich schüttele den Kopf, und bei der Vorstellung, was diese Typen mir alles antun könnten, dreht sich mir der Magen um.
»Danke, aber es ist alles in Ordnung. Mein Mann wartet auf mich.« Und dann rase ich wie von der Tarantel gestochen die Rampe hinauf, die zu dem riesigen goldenen Hotel führt. Ich schaue mich nicht um, und sie folgen mir nicht.
Am besten schleiche ich mich erst mal in diesen Hotelkomplex, der den Namen The Turner Grand trägt. Dort finde ich vielleicht unbemerkt Unterschlupf, bis mir eine Lösung einfällt. Wobei ich keine Ahnung habe, wie lange das dauern wird.
Kapitel 3
Mia
»Einchecken, Miss?«, fragt der Hotelpage, der mir die große Glastür aufhält, durch die man in die Lobby gelangt.
»Äh.« Völlig überrumpelt bleibe ich stehen. Aber ich zerre zwei Koffer hinter mir her und habe gerade ein Hotel betreten, also entscheide ich mich für ein »Ja.«
»Möchten Sie, dass ich Ihnen mit Ihrem Gepäck behilflich bin, während Sie einchecken?«
Ich schüttele den Kopf und ringe mir ein Lächeln ab. »Nein, das schaffe ich schon. Trotzdem vielen Dank.«
Er schenkt mir ein freundliches Lächeln und bietet mir nichts weiter an. Die kleinen Absätze meiner Reitstiefel klicken auf dem Marmorboden der Lobby. Inmitten des Atriums befindet sich ein Steinbrunnen mit griechischen Göttern. Die Decke besteht aus reich verziertem, vielfarbigem Glas, das von innen zu leuchten scheint. Zu meiner Linken befindet sich die geräumige Rezeption, an der es vor Menschen, die einchecken, nur so wimmelt. Am Tresen neben mir haben die Hotelpförtner ihren Platz. Einer der smart aussehenden Männer in Anzug blickt genau in dem Moment auf, da ich eintrete, und entdeckt mich. Er mustert mich von Kopf bis Fuß. Ich muss ziemlich abgerissen aussehen. Zwei Tage im Auto und jede Menge Tränen. Schnell eile ich davon, habe allerdings keine Ahnung, wohin.
Ich wandere erheblich länger umher, als ratsam ist, und je stärker der Adrenalinschub nachlässt, desto erschöpfter fühle ich mich. Jake. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich vor ihm davongelaufen bin. Er war … nett. Hilfsbereit. So gut aussehend, dass mein Innerstes schon bei nur einem Blick dieser braunen Augen dahinschmolz. Darüber hätte ich beinahe laut aufgelacht und schüttele innerlich den Kopf über mich. Wie lächerlich, in meiner derzeitigen Lage an so etwas zu denken.
Nach einer Weile wird mir klar, dass ich so langsam die Aufmerksamkeit der Angestellten und betrunkenen Männer auf mich ziehe, und mir gehen die Ideen aus, wo ich noch entlanglaufen und was ich mir noch ansehen könnte.
Ich entdecke ein Schild, das zum Pool weist, und schlage aus Mangel an Alternativen die entsprechende Richtung ein. Hier drüben ist es ruhiger. Die Geschäfte, die diesen Teil des Gebäudes säumen, haben geschlossen. Der wahre Andrang findet weiter vorn statt, wo sich die Casinos und Bars befinden.
Eine der Eingangstüren zum Poolbereich fällt mir ins Auge, weil sie einen Spalt offen steht und ein Schild vor Reparaturarbeiten warnt. Niemand ist in der Nähe.
Ich schaue nach links.
Ich schaue nach rechts.
Dann senke ich den Kopf und wende mich von den zahllosen Überwachungskameras über mir ab, während ich eilig meine Koffer hinter mir her durch die Tür ziehe. Kaum bin ich hindurch, fällt die Tür mit lautem Scheppern ins Schloss.
Ich erstarre, stehe stocksteif da und warte auf das unvermeidliche Auftauchen der Security. Aber zwei Minuten später ist immer noch keine Kavallerie im Anmarsch, die mich abführen will. Also wandere ich hinaus in die laue Sommernacht.
Die leichte Brise kühlt meine Wangen, verfängt sich in meinem Haar und umfängt mich mit schwachem Chlorgeruch. Meine Boots klicken laut auf dem Asphalt, ein Laut, der durch die Nacht hallt und mich verleitet, schneller zu laufen.
Aber wohin? Ich habe keine Ahnung.
Ich muss einfach nur ein Versteck finden. Einen Ort, an dem ich mich hinsetzen und meine Gedanken ordnen kann, ohne dass neugierige, forschende Augen jede Bewegung verfolgen.
An der hinteren Wand, in der Nähe eines Schildes mit der Aufschrift Ausgang, entdecke ich einen Liegestuhl, der teilweise von Buschwerk verborgen wird. Schnurstracks laufe ich darauf zu, schiebe die Koffer dicht neben mich und rolle mich auf der Liege so klein wie möglich zusammen.
Dann spitze ich die Ohren.
Keine Ahnung, wie lange ich den Geräuschen des Pools bei Nacht lausche, dem Wasserfall, dem Rascheln der Bäume, aber irgendwann fallen mir die Augen zu, und meine Gedanken driften umher, nur um von den Bildern all dessen, vor dem ich davongelaufen bin, wieder aus dem Halbschlaf gerissen zu werden.
Instinktiv fährt mein Kopf herum, mein Puls geht durch die Decke, und meine Brust hebt und senkt sich krampfartig. Ich stehe kurz vor einer Panikattacke. Dunkelheit hüllt mich ein, und ich unterdrücke ein Schluchzen und versuche, mich daran zu erinnern, wo ich bin.
Pool. Hotel. Las Vegas.
O Gott. In was habe ich mich da reingeritten? Wie konnte ich in einer dermaßen hoffnungslosen Lage enden?
Eigentlich sollte ich doch erleichtert sein.
Ich bin entkommen. Ich habe es geschafft. Aber meine Furcht hat kein Jota nachgelassen. Wenn überhaupt, ist sie schlimmer geworden. Für den Bruchteil einer Sekunde bereue ich meine übereilte Aktion.
Heimatlos. Ohne Auto. Kein brauchbarer Ausweis. Kein Job. Wenig Geld.
Ich könnte in ein Obdachlosenheim gehen. Das wäre wahrscheinlich sicherer, als unter freiem Himmel zu campieren. Oder ich könnte versuchen, eine Bleibe wie ein Motel oder ein Apartment zu finden, die man nur bar bezahlen muss.
Atme.
Schotte dich ab.
Atme.
Schieb alles beiseite.
Atme.
Überlege dir einen Plan.
Ich setze mich auf meinem Liegestuhl auf und wische mir den restlichen Albtraumschweiß von der Stirn. Mein Herzschlag normalisiert sich langsam, und ich mache eine Bestandsaufnahme meines Lebens und meiner Möglichkeiten. Nein. Mit meinem Leben kann ich mich momentan nicht befassen. Ich muss mich darauf konzentrieren, das hier zu überstehen. Genau. Konzentration.
Ich beiße mir auf die Innenseite der Wange und betrachte meine Koffer. Die kann ich nicht dauernd mit mir herumschleppen. Meine Mutter würde sich im Grab umdrehen, wenn sie wüsste, dass ich kurz davor bin, sie und einen Großteil des Inhalts zu entsorgen. Oder sie zu verkaufen. Vielleicht könnte ich sie ja tatsächlich verkaufen? Einen gewissen Wert haben sie sicher durchaus. Die Koffer und alles, was drin ist, sind Designerware.
Ich öffne den Reißverschluss des ersten Koffers und schlage den Deckel zurück. Mit dem zweiten Koffer verfahre ich ebenso. Dann hole ich einen großen Rucksack heraus, den ich in letzter Minute hineingeworfen habe, und fange an, die notwendigsten Klamotten hineinzupacken. Schuhe. Shirts. Shorts. Blusen. Ordentliche Hosen. Unterwäsche.
Ich mache weiter, bis der Rucksack voll ist. Als ich fertig bin, schließe ich die Koffer wieder und lehne mich an die Wand auf der anderen Seite der Liege. Im Geiste fertige ich eine Liste an.
Ich brauche falsche Papiere. Womöglich auch eine falsche Sozialversicherungskarte. Ich brauche einen Job – oder zwei Jobs, oder drei. Ich muss so viel Geld zusammenkratzen, wie es ohne Bankraub möglich ist. Ein falscher Pass, mit dem ich durch den Zoll komme, scheint jedoch unmöglich zu sein.
Ich muss also klein anfangen und mich hocharbeiten.
Aber zum Teufel. Das hier ist Las Vegas. Wenn es je eine Stadt auf der Welt gab, in der man sich verstecken, ein falsches Leben aufbauen und schnelles Geld machen konnte, dann diese. In Tuchfühlung mit der Sünde.
Ich lache. Laut. Humorlos und vielleicht ein wenig irre, und als es schließlich in ein hicksendes Schluchzen übergeht, breche ich zusammen. Tränen strömen mir die Wangen hinab wie Regen bei einem texanischen Gewitter.
Das soll also jetzt mein Leben sein. Mia … Jones? Klar. Das hört sich okay an.
»Das ist jetzt dein Leben, Mia Jones«, sage ich laut zu mir selbst, wie um mich aufzumuntern. Mir den Rücken zu stärken. Und dieses Gefühl der Verzweiflung und des Schiffbruchs in Schach zu halten.
Eines steht fest. Ich kann nicht nach Hause zurückkehren.
Noch nicht. Vielleicht nie mehr.
Und noch etwas anderes ist sicher: Ich lasse mein altes Ich dort zurück.
Ich muss von vorn anfangen. Mich ganz neu erfinden. Die Frau sein, die ich immer werden wollte. Die selbstbewusste, smarte Frau, die alles im Griff hat. Die Frau mit Antworten und ohne Angst.
Die Frau, die zurückschlägt.
»Was haben Sie hier zu suchen?«, ertönt eine tiefe, männliche Stimme aus dem Nichts, und ich springe so erschrocken von der Sonnenliege auf, dass ich hinfalle und entsetzt aufschreie.
»Sorry. Mist. Alles okay?« Ein großer Mann tritt aus den Schatten und streckt die Hand nach mir aus, um mir aufzuhelfen.
Ich weiche hastig zurück, wobei ich gegen das Metall des Liegestuhls pralle, und presse den Arm gegen meine Brust, als habe er gerade versucht, meine Haut mit Pesterregern einzureiben.
»Okay.« Er zieht seine Hand zurück und richtet sich zu voller Größe auf. »Ich rühre Sie nicht an. Was zum Teufel macht eine junge Frau wie Sie hier draußen?«
Ich blicke auf, streiche mir das Haar aus dem Gesicht, kann aber immer noch nicht allzu viel erkennen. Dieser Teil des Poolbereichs ist nur schwach beleuchtet. Aber seine Silhouette verrät mir, dass der Mann riesig ist. Ich kann nicht genau sehen, was er trägt, aber eine Uniform scheint es nicht zu sein, denn ich kann seine nackten, muskulösen Arme und eine Jeans erkennen.
»Ich, äh …«
Und dann breche ich wieder zusammen. Ich schaffe das einfach nicht. Ich komme mir wie eine Heulsuse und ein absoluter Loser vor. Alles bricht über mir zusammen. Schlafmangel und mein Leben, das in jeder Hinsicht ätzend ist, und außerdem zu viele Männer, die mir in dieser Nacht vielleicht helfen wollen, vielleicht aber auch nicht.
»Tut mir leid«, sage ich, wische mir die Tränen ab und schnappe mir Handtasche und Rucksack. »Ich werde gehen.«
»Ach, Schätzchen«, sagt er gedehnt, und sein Südstaatenakzent bringt mich zum Lächeln. Warum? Keine Ahnung, verdammt. Aber wenn man am Boden ist, klammert man sich an den kleinsten Fetzen, der sich gut anfühlt. Und ein Südstaatenakzent ist offensichtlich jetzt genau das, was ich brauche. »Ich werfe Sie nicht hinaus. Ich frage mich nur, warum ein hübsches Ding wie Sie sich hier hinten versteckt.«
»Werden Sie mir wehtun?«
Keine Ahnung, warum ich so unverblümt frage. Vielleicht habe ich jetzt ja offiziell den Verstand verloren, oder ich bin total am Ende. Ich raffe mich vom Boden auf und setze mich wieder auf die Liege, denn wenn er mir wehtun will, dann besser nicht auf dem harten Boden.
»Ihnen wehtun?«, fragt er so entsetzt und ungläubig, dass seine Stimme eine Oktave höher klingt. »Ich liebe Frauen.« Dann gluckst er leise. »Vielleicht ein wenig zu sehr, wenn man einigen von ihnen Glauben schenken will. Aber ihnen wehzutun, wie Sie es andeuten … so etwas ist noch nie vorgekommen und wird auch nie vorkommen. Sind Sie deshalb hier? Weil Ihnen irgendein Kerl übel mitgespielt hat?«
Ich lache. Wieder klingt es leicht irre. Irgendein Kerl? Mir übel mitgespielt? Das ist ja zum Schießen. Weil es die Geschichte meines Lebens ist, seine Worte der Realität jedoch so gar nicht gerecht werden. Als ob er unabsichtlich etwas bagatellisieren würde, das sich nicht wie eine Bagatelle anfühlt.
»Soll ich wieder verschwinden?«, frage ich stattdessen, denn mehr als ausweichende Antworten bringe ich heute Nacht nicht mehr zustande.
»Nein«, sagt er langsam und setzt sich behutsam neben mich auf den Liegestuhl, obwohl ich ihn in meine Krisenblase gar nicht eingeladen habe. In meine Welt, die schneller dahinschmilzt als Eiscreme unter der Sonne von Las Vegas. »Sie können hierbleiben. Und wenn Sie Hilfe brauchen, nun ja, dann bin ich vielleicht genau der Richtige für Sie.«
Ich schüttele den Kopf und starre auf die großen Hände in seinem Schoß hinab, deren Finger er lässig ineinander verschränkt hat. Keine geballten Fäuste. Keine starre Haltung. Seine Stimme klingt so aufrichtig, dass mir ganz anders wird. Sie verwirrt mein ohnehin schon überfordertes Hirn nur noch mehr.
»Warum wollen Sie das tun?«
»Weil Sie allein sind. Weil Sie auf einem gottverdammten Liegestuhl sitzen, sich in der Dunkelheit an einem Pool in Las Vegas verstecken und zwei Koffer neben sich stehen haben. Weil sie weinen und Angst haben und gefragt haben, ob ich Ihnen wehtun wollte. Und ich gehöre zu den Männern, die es nicht tolerieren, wenn Frauen bedroht werden.«
»Sie sind heute Nacht schon der zweite Mann, der versucht hat, mir zu helfen. Ist das so ein Las-Vegas-Ding, oder habe ich mich bislang mit den falschen Leuten umgeben?«
Er lacht, fährt sich mit der Hand durchs Haar, stützt dann die Ellbogen auf die Knie und schaut ins Nichts.
»Keine Ahnung. Aber es klingt, als träfe Letzteres zu.«
»Ich bin eine Ausreißerin«, verkünde ich und frage mich, warum ich ihm freiwillig anvertraue, was ich Jake nicht erzählen wollte. Vielleicht verleiht mir die Dunkelheit ja Mut. Vielleicht habe ich bei Jake auch geschwiegen, weil ich ihn anziehend fand und ihm nicht zeigen wollte, wie erbärmlich ich bin. Oder Jake hat irgendwie den Schalter umgelegt, weshalb ich jetzt unbedingt reden muss, bevor meine Wahrheit mich von innen verbrennt. Tatsächlich wünschte ich, Jake stünde jetzt neben mir, und nicht dieser Typ.
»Ich bin Maddox Sinclair, Ausreißerin. Freut mich, Sie kennenzulernen.« O mein Gott. Ich muss lachen. Ich lache mich halb schlapp, und ich glaube, es ist das erste echte Lachen meines verdammten Lebens. Wirklich. »Wie kann ich Ihnen aus der Patsche helfen?«
Ich zucke mit den Schultern. Ich kann genauso gut aufgeben und alles auf eine Karte setzen. Schließlich habe ich buchstäblich nichts zu verlieren. Und was immer dieser Kerl mit mir macht, na ja, im Grunde ist es mir egal. Schwer zu sagen, ob es demoralisierend oder befreiend ist, ganz am Boden zu sein.
»Ich brauche einen falschen Ausweis. Eine falsche Sozialversicherungsnummer. Dazu einen Job und ein neues Leben. Und ich muss lernen, wie man jemandem ordentlich in den Hintern tritt.«
»Hmm …«, summt er nachdenklich, und sein Blick huscht zu mir herüber. »Sind Sie ein Cop?«
Erneut lache ich laut auf. »Das fragen Sie nicht im Ernst, oder?«
Er zuckt mit den Schultern und sieht mir nun trotz der Dunkelheit forschend ins Gesicht. »Ich musste fragen.«
»Nein. Ich bin definitiv kein Cop.«
»Dann kann ich Ihnen helfen. Tatsächlich sogar mit allem.«
Ich starre ihn an. Seine Augen funkeln im spärlichen Licht des Poolbereichs. Er erwidert meinen Blick unverwandt und eindeutig weder mitleidig noch nachsichtig. Er meint es ernst.
»Und was erwarten Sie als Gegenleistung?« Beinahe die gleiche Frage habe ich auch Jake gestellt – mit der gleichen Bedeutung.
»Diese Frage gefällt mir ungefähr genauso gut wie die Vorstellung, dass Sie hier draußen übernachten. Sollen wir Ihnen nicht lieber ein vernünftiges Dach über dem Kopf suchen?«
Ich zucke mit den Schultern. »Vielleicht. Aber vorläufig ist das hier mein neues Zuhause. Mir gefällt es hier. Ich fühle mich hier sicher. Hier laufen keine fremden Leute herum. Na ja, außer Ihnen.«
»Ich arbeite hier.«
»Na bitte.« Ich deute mit dem Finger auf ihn. »Genau das meinte ich. Ein einigermaßen abgeschiedener Ort. Keine zweifelhafte Gegend oder zwielichtigen Gestalten. Es ist ruhig und dunkel. Und beides gefällt mir.«
»Darüber muss ich noch mal genauer nachdenken, denn dass Sie hier draußen übernachten, ist mir alles andere als recht.«
»Was, wenn ich verspreche, mir demnächst eine andere Unterkunft zu suchen?«
»Dann helfe ich Ihnen dabei, Ausreißerin. Ich bringe Ihnen bei, wie man kämpft, und besorge Ihnen verdammt noch mal falsche Papiere, und dann verschaffe ich Ihnen ein paar Jobs, die gut bezahlt werden, solange Sie nichts dagegen haben, sexy Klamotten anzuziehen.«
»Doch hoffentlich nichts mit Sex?«
Er seufzt, als habe ich ihn wieder beleidigt. »Nein. Ich spreche von den sexy Uniformen, die man in den Clubs oder Restaurants von Las Vegas trägt.«
»Bin dabei«, verspreche ich, denn wie gesagt: Was habe ich schon zu verlieren? »Aber wenn Sie ein falsches Spiel treiben oder das hier nur ein Trick ist, um mir letztlich doch zu schaden, sollten Sie wissen, dass ich mittlerweile auf alles scheiße. Und ich fluche sonst nie. Zumindest nach außen hin nicht. Das beweist, wie ehrlich ich es meine.«
»Wenn wir hier schon mal dabei sind, Vertraulichkeiten auszutauschen, sollten Sie wissen, dass ich auch nach außen hin ziemlich viel fluche und ein Typ bin, der auf gar nichts scheißt.«
Ich lächele. Ich glaube, ich mag Maddox Sinclair.
»Wollen Sie noch etwas Cooles über mich wissen? Ich bin bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Hatte nie einen Vater. Deshalb respektiere ich Frauen ganz besonders. Ich liebe Frauen. Besonders solche, die meine Hilfe brauchen. Und Sie, Ausreißerin, Sie brauchen meine Hilfe tatsächlich.«
»Also werden Sie mir wirklich helfen?«
»Ja. Ich bringe Sie genau dahin, wo Sie hinwollen.«
Nur dass Maddox Sinclair ja keine Ahnung hat, wie unmöglich das ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis mein Albtraum mich wieder einholt.
Kapitel 4
Mia
»Du bist neu hier«, sagt eine junge Frau, als ich meinen großen Rucksack unter ein Regal und hinter einen Kistenstapel stopfe. Hastig stehe ich auf und hoffe, dass sie nicht mitgekriegt hat, was ich da mache. Dann drehe ich mich um, wische mir die Nervosität vom Gesicht und setze eine heitere, fröhliche Miene auf.
»Ja«, strahle ich mit breitem Lächeln. Ein falsches Lächeln. So ziemlich alles an mir ist falsch, aber das weiß dieses Mädchen nicht – mit den leuchtend roten Lippen wie meinen und dem langen, glatten, schwarzen Haar, das perfekt zu ihrer Haut passt.
Zwei Wochen. Ich bin jetzt seit zwei Wochen in dieser Stadt, und die Jobs, die Maddox mir vermittelt hat, scheinen alles zu sein, was ich habe. Nein, Korrektur. Sie sind alles, was ich habe. »Erster Abend.«
»Toll. Willkommen. Ich bin Millie.« Sie tritt vor und streckt mir die Hand entgegen. Schon lange hat sich niemand mehr die Mühe gemacht, mich mit Handschlag begrüßen zu wollen, weshalb ich kurz erstarre. Aber ich erhole mich schnell wieder und ergreife sie. »Es wird dir hier gefallen. Die restliche Belegschaft ist superfreundlich, und die Chefs sind toll.«
»Mia«, sage ich und schaudere beinahe dabei. »Du arbeitest auch in der Bar?« Ich mustere ihr Outfit. Sie hat vielleicht die gleichen roten Lippen wie ich, aber definitiv andere Klamotten, was mich stutzig macht. Sie trägt ein weißes Button-up-Blusenkleid, das bis zur Mitte ihrer Schenkel reicht und an der Taille von einem breiten Gürtel zusammengehalten wird. Ich hingegen musste in ein hautenges schwarzes Kleid schlüpfen, das so kurz ist, dass man meinen Hintern sieht, sobald ich mich – nur ein bisschen, gar nicht viel – nach vorn beuge. Und als sei das nicht schon schlimm genug, ist der Ausschnitt so tief, dass man mühelos meinen Brustansatz erkennen kann.
»Nein«, sagt sie, als sei das offensichtlich, was es angesichts unserer unterschiedlichen Outfits sicher auch ist. »Ich bin Hostess.« Ihr Blick huscht zum Ausgang des Hinterzimmers, bevor sie wieder mich ansieht. »Ich muss los, und du wahrscheinlich auch. Hoffentlich hast du eine gute Schicht. Vielleicht quatschen wir ja später noch mal miteinander.«
Und schon ist sie verschwunden. Ich habe nicht mal Gelegenheit zu einem Dir auch eine gute Schicht oder Ja gern, obwohl ich mich eigentlich ohnehin nicht mit ihr unterhalten will, aber auch das braucht sie nicht zu wissen. Ich sehe mich noch einmal kurz um, um mich zu vergewissern, dass mein Rucksack gut versteckt ist, verlasse das Hinterzimmer und sause durch das überfüllte Restaurant. Es ist einer dieser trendigen Vegas-Szenelokale mit Lounge-Area sowie Indoor- und Outdoor-Essbereich. Die riesige Bar nimmt eine ganze mit roten Subway Tiles geflieste Wand ein.
Rot. An diesem Ort ist so ziemlich alles rot. Zumindest die Einrichtung, denn ansonsten sind die Wände dunkel gestrichen und die Böden aus rustikaler Eiche.
Bei meiner Einstellung hatte Cal versprochen, dass jemand mich anlernen würde. Er erwähnte allerdings nicht, wer. Als ich mich nun also dem hinteren Teil der Bar nähere, durch den die Belegschaft hinein und hinaus kann, bleibe ich unschlüssig stehen. Ich blicke mich suchend um, als müsste gleich wie durch Zauberhand jemand vor mir auftauchen und mir mitteilen, was zum Teufel ich hier zu tun habe.
Kellner und Kellnerinnen wuseln geschäftig umher, füllen ihre Tabletts mit Getränken oder, falls erforderlich, Beilagen. Sie ignorieren mich, als ich mich an ihnen vorbeidränge und um eine kleine Ecke schiebe, die zu dem langgestreckten Barbereich führt, wo ich arbeiten werde. Hier besteht der Bodenbelag aus Gummi, damit man nicht ausrutscht, und angesichts der Größe des Restaurants ist dieser Arbeitsplatz schmaler als erwartet.
»Du musst Mia sein«, sagt ein Mädchen mit kurzem, unnatürlich platinblondem Haar, dunklen Augen und Nasenring zu mir.
»Stimmt«, antworte ich und hoffe, dass meine Stimme zuversichtlicher klingt, als ich mich momentan fühle. In Wirklichkeit mache ich mir nämlich vor Angst in die Hose. Ich hatte noch nie im Leben einen Job. Habe nie irgendeine wertvolle Arbeit verrichtet. Nie auch nur einen einzigen Dollar meines Geldes selbst verdient. An diesem Abend geschieht so ziemlich alles zum ersten Mal. Eigentlich sollte ich total aufgeregt sein, aber mir ist einfach nur übel.
Doch Geld ist gleichbedeutend mit Freiheit, und damit ist es mir bitterernst.
»Perfekt«, stößt sie hervor, als habe ich damit ihren Abend gerettet. »Ich heiße Diamond. Hoffentlich weißt du, was du tust, denn Cal meinte, du hättest schon früher mal hinter einer Bar gestanden, und ich kann dich nicht anleiten.«
»Oh.« Ich blinzele. »Na ja, schon, ich hab mich schon mal um eine Bar gekümmert, aber niemand hat mir bislang gezeigt, wie ihr die Drinks mixt, die ihr hier anbietet, oder wie die Kasse funktioniert.«
Diamond knurrt verdrießlich. »Kippa ist nicht aufgekreuzt. Sie sollte dich anlernen. Wir sind heute Abend nur zu zweit, denn die Bitch drückt sich, mal wieder«, betont sie, als sei es meine Schuld, dass diese Kippa uns im Stich gelassen hat. »Also kann ich dir nicht helfen. Schwimmen musst du schon allein.«
Damit wirbelt sie auf ihren zehn Zentimeter hohen Plateaustiefeln herum und macht sich wieder an die Arbeit. Ich bin eindeutig entlassen. Allein schwimmen? Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, obwohl ich keine Ahnung von dem Job habe.