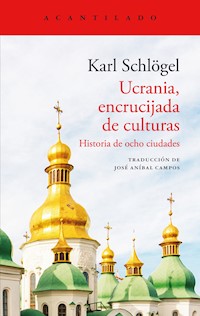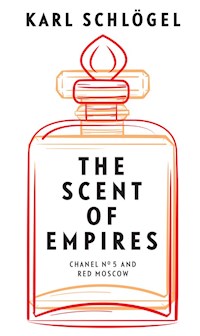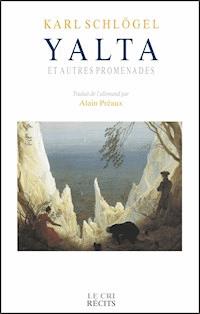Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Kritik
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Die Auflösung von Imperien ist immer so etwas wie eine glückliche Katastrophe«, beginnt Karl Schlögel seinen Parcours durch die Museumslandschaften Russlands nach dem Ende der Sowjetunion. Der damit einsetzende Umbruch bringt Gefahren für die fragile Institution Museum mit sich, aber auch Chancen für einen neuen Anfang. Die mögen inzwischen allerdings vertan sein, sind wir doch Zeugen brachialer Anstrengungen, den imperialen Anspruch Russlands zu restituieren. »Wir sind längst inmitten des Ringens um eine neue ›Meistererzählung‹ russischer Geschichte, vor allem der des 20. Jahrhunderts.« Es ist zu befürchten, dass die russischen Museen künftig abermals einem Narrativ zu dienen haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Transitwird herausgegeben am Institut für die Wissenschaften vom Menschen
(IWM) in Wien und erscheint im Verlag Neue Kritik, Frankfurt am Main.
Herausgeberin: Shalini Randeria
Gründungsherausgeber: Krzysztof Michalski †
Gastherausgeberin des Orthodoxie-Schwerpunkts: Kristina Stoeckl
Redaktion: Klaus Nellen
Kurator des Bildteils: Walter Seidl
Redaktionskomitee: Cornelia Klinger (Hamburg), János M. Kovács (Budapest/Wien), Ivan Krastev (Sofia/Wien), Timothy Snyder (Yale/Wien)
Beirat: Peter Demetz (New Haven), Timothy Garton Ash (Oxford), Elemer Hankiss †, Claus Leggewie (Essen), Petr Pithart (Prag), Jacques Rupnik (Paris), Aleksander Smolar (Warschau/Paris), Fritz Stern (New York)
Redaktionsanschrift: Transit c/o IWM, Spittelauer Lände 3, A-1090 Wien, Telefon (+431) 31358-0, Fax (+431) 31358-60, www.iwm.at
Website von Transit: Europäische Revue und Tr@nsit_online:www.iwm.at/transit
Anzeigenpreisliste wird auf Wunsch zugesandt.
Transiterscheint zweimal im Jahr. Jedes Heft kostet 14 Euro (D). Transit kann
im Abonnement zu 12 Euro pro Heft (in D und A portofrei) über den Verlag bezogen werden.
Verlagsanschrift: Verlag Neue Kritik, Kettenhofweg 53, D-60325 Frankfurt/
Main, Telefon (069) 72 75 76, Fax (069) 72 65 85, E-mail: [email protected]
Textnachweise: Das Gespräch mit Krzysztof Michalski erschien zuerst in polnischer Sprache in der Zeitschrift Krytyka Polityczna, Nr. 31/32 (2012). Übersetzung und Abdruck des Ausschnitts aus Olga Tokarczuks Roman Ksibgi Jakubowe mit freundlicher Genehmigung der Autorin. Bei Hedwig Saxenhuber und Georg Schöllhammer, die die School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015 kuratieren, bedanken wir uns für die Vermittlung des Photoessays von Anna Zvyagintseva.
ISSN 0938
Transit ist Partner von Eurozine – the netmagazine (www.eurozine.com), einem Zusammenschluss europäischer Kulturzeitschriften im Internet. Transit is regularly listed in the International Current Awareness Services. Selected material is indexed in the International Bibliography of the Social Sciences.
© 2014/15 für sämtliche Texte und deren Übersetzungen Transit / IWM
Die Printausgabe erschien 2015 im Verlag Neue Kritik
E-Book-Ausgaben 2015:
ISBN 978-3-8015-0576-9 (epub)
ISBN 978-3-8015-0577-6 (mobi)
ISBN 978-3-8015-0578-3 (pdf)
Transit 47 (Herbst 2015)
Russland Nacheuropa Religion
Editorial
Karl Schlögel
Museumswelten im Umbruch
Russische Museen nach dem Ende der Sowjetunion
Ludger Hagedorn
Europa da Capo al Fine
Jan Patočkas nacheuropäische Reflexionen
Nicolas de Warren
Deutsche Philosophen im Ersten Weltkrieg
Der Fall Edmund Husserl
Anna Zvyagintseva
Event(gap), 2014
Photoessay
Orthodoxes Christentum und (Post-)Moderne
Kristina Stoeckl (Gastherausgeberin)
Einleitung
Vasilios N. Makrides
Östliches orthodoxes Christentum und Säkularität
Ein Vergleich mit dem lateinischen Christentum
Pantelis Kalaitzidis
Orthodoxie und Moderne
Alexander Agadjanian
Neue Formen der östlichen Orthodoxie
*
Wozu braucht die Philosophie Religion?
Krzysztof Michalski im Gespräch mit Jakub Majmurek
David Martin
Christentum und Gewalt
Victor Shnirelman
Russland und die Apokalypse
Zwischen Eschatologie, Esoterik und Verschwörungsglaube
*
Polen von einer anderen Seite
Olga Tokarczuk im Gespräch mit Sławomir Sierakowski
Olga Tokarczuk
Das Buch des Sands
Aus den Büchern Jakob
Zu den Autorinnen und Autoren
Editorial
»Die Auflösung von Imperien ist immer so etwas wie eine glückliche Katastrophe«, beginnt Karl Schlögel seinen Parcours durch die Museumslandschaften Russlands nach dem Ende der Sowjetunion. Der damit einsetzende Umbruch bringt Gefahren für die fragile Institution Museum mit sich, aber auch Chancen für einen neuen Anfang. Die mögen inzwischen allerdings vertan sein, sind wir doch Zeugen brachialer Anstrengungen, den imperialen Anspruch Russlands zu restituieren. »Wir sind längst inmitten des Ringens um eine neue ›Meistererzählung‹ russischer Geschichte, vor allem der des 20. Jahrhunderts.« Es ist zu befürchten, dass die russischen Museen künftig abermals einem Narrativ zu dienen haben.
Auch Victor Shnirelman beschäftigt sich mit den Folgen des Zerfalls der Sowjetunion. Die Krise der 1990er Jahre vermittelte »den Eindruck, das Land sei kollabiert und das Ende der Geschichte stehe unmittelbar bevor. Zeitgleich (…) erstarkte die orthodoxe Kirche mit ihren tradierten Erklärungsmodellen zum Wesen der ›letzten Tage‹.« Seit dieser Zeit gibt es eine weit verbreitete apokalyptische Grundstimmung in Russland. Genährt wird sie von einer Literatur, die auf Altbewährtes zurückgreift: So wurden und werden die Protokolle der Weisen von Zion neu aufgelegt und in zahlreichen Ausgaben und hohen Auflagen verbreitet.
»Europa wurde errichtet in Jahrtausenden – und vernichtet in dreißig Jahren, zeitlich begrenzt von den beiden Weltkriegen, die eigentlich ein einziger Krieg waren. Dieses Machtgebilde beherrschte den ganzen Planeten, konnte sich aber nicht auf dem Gipfel halten. Es trat ab in Form eines Niedergangs, der beispiellos ist; der Fall Europas ist das größte Ereignis in der Weltgeschichte«, schrieb der tschechische Philosoph Jan Patočka Mitte der 1970er Jahre in einem Fragment, betitelt »Nachdenken über Europa«. Ludger Hagedorn führt uns in Patočkas Reflexionen über die Idee Europas nach seinem Ende ein. »Vielleicht ist der Sinn von Europas Untergang positiv.« Diesen Satz aus einem anderen Fragment könnte man so verstehen, dass gerade die Enteignung oder Dezentrierung Europas einen neuen Zugang zu den kulturellen Differenzen der globalisierten Welt bietet.
Nicolas de Warrens Beitrag führt uns mitten in den Kollaps der europäischen Idee: Der Erste Weltkrieg machte eine sich als Europäer verstehende Generation von Denkern über Nacht zu Feinden. Auch Edmund Husserl, ein glühender Verfechter der universalen Vernunft, blieb vom nationalen Furor nicht verschont. De Warren verfolgt diesen Wandel anhand der Korrespondenz des Freiburger Philosophen. Am Ende steht eine bittere Enttäuschung, die Husserl schließlich zu einem emphatischen Begriff Europas als »geistiger Gestalt« führt.
Die drei Beiträge in dem von Kristina Stoeckl herausgegebenen Schwerpunkt drehen sich um die Frage, wie das orthodoxe Christentum historisch mit der Säkularisierung umgegangen ist und wie es sich zur modernen Gesellschaft verhält. Sie korrigieren die verbreitete Sicht, es handle sich hier um einen monolithischen Block, der sich der westlichen Moderne verschließt, und geben einen tiefen Einblick in die inneren Spannungen und Entwicklungen der orthodoxen Kirchen von heute.
In einem Gespräch, das der polnische Philosoph Krzysztof Michalski ein Jahr vor seinem Tod geführt hat, hinterfragt er den Gemeinplatz, dass die Philosophie die privilegierte Form eines Denkens sei, das die Religion hinter sich gelassen hat. Die Stärke der Philosophie entspringe vielmehr Quellen, die in die westliche Kultur eingeschrieben, der Vernunft aber unverfügbar sind. Dazu gehöre die Religion. Sie sei anwesend im Innersten der Vernunft, und damit der Philosophie. Diese kann ohne Religion nicht existieren, so wenig sie sie ersetzen kann. »Die Vernunft, die Philosophie, ist ein Versuch, die conditio humana, das menschliche Leben zu begreifen – aber sie verleiht keine Kraft, es zu leben. Diese Kraft soll Religion verleihen, das ist das Versprechen, die Hoffnung, die sie gibt.«
In seinem kurzen Beitrag über Christentum und Gewalt kommt David Martin auf seine Kritik der gängigen Auffassung1 zurück, dass es einen quasi naturwüchsigen Zusammenhang von Religion und Gewalt gebe. Gerade im Hinblick auf das Christentum sei diese Überzeugung irreführend, verkörpere dieses doch einen radikalen Bruch mit der sich durch die gesamte Geschichte hindurchziehenden Logik der Gewalt: Was »nach Erklärung verlangt, ist nicht der Antagonismus des ›Wir gegen sie‹ (…), sondern dass in der Geschichte (…) auf Gewaltanwendung zur Durchsetzung des ›territorialen Imperativs‹ bewusst verzichtet wird.« Mit dem Christentum entstand, so Martin, eine »neue, gewaltlose und über alle Grenzen hinweg gültige Geschwisterlichkeit«. Es ist wahr: Alles menschliche Handeln bleibt in Gewalt verstrickt, und damit auch das Christentum, spätestens seit es zur Staatsreligion erhoben wurde. Doch es ist ein Fehlschluss, diese Verstrickung zu seinem Wesen zu machen.
Was Olga Tokarczuk in ihrem Gespräch mit Sławomir Sierakowski über eine Episode aus ihrem neuen Roman sagt, gilt für das ganze Buch: Es »soll ein Stachel sein, der den aufgeblasenen Mythos, das Stereotyp von der polnischen katholischen Identität zerplatzen lässt«. Die Bücher Jakob führen uns in eine vergessene Welt, in der Jakob Frank (1726-1791) – der Stifter einer messianischen Bewegung, die mit dem Bann sowohl der Rabbiner als auch des Papstes belegt wurde – »für eine östliche, eurasische Variante der Aufklärung (steht). Im Westen entstand zu dieser Zeit Diderots Enzyklopädie (…). Die östliche Aufklärung hat ganz andere Wurzeln, sie liegen im 17. Jahrhundert, am Schnittpunkt der drei großen Religionen Islam, Judentum und Christentum, in einer synkretistischen, auf ihre Weise globalisierten Welt.«
Die Photographien von Anna Zvyagintseva stellen ein Echo des vorletzten Heftes von Transit dar, das der ukrainischen Revolution von 2013/14 gewidmet war.2 Sie zeigen verlassene Orte des Widerstands. Was auf dem Maidan geschah, ist im Gedächtnis noch lebendig, während die realen Spuren verblassen – eine Diskrepanz, die der leere Streifen auf den Bildern und der Titel des Photoessays reflektieren. Die Photographien entstammen einer Arbeit, die die Künstlerin auf der Biennale The School of Kyiv (Kiew, September und Oktober 2015) ausstellt, an deren Programm das IWM beteiligt ist. Mehr dazu ist auf der Website des Instituts www.iwm.at nachzulesen.
Wien, im September 2015
Anmerkungen
1Vgl. David Martin, »Religion und Gewalt. Eine Kritik des ›Neuen Atheismus‹«, in: Transit 43 (Winter 2012/13).
2Transit 45, Maidan – Die unerwartete Revolution (Sommer 2014).
Karl Schlögel
MUSEUMSWELTEN IM UMBRUCH
Russische Museen nach dem Ende der Sowjetunion1
Die Auflösung von Imperien ist immer so etwas wie eine glückliche Katastrophe. Mit all ihren Unsicherheiten und Instabilitäten ist sie eine Gefahr für so sensible, über viele Generationen gewachsene und auf Ordnung angewiesene Institutionen, wie es Museen sind. Sie ist andererseits eine große Chance, weil ein neuer Anfang gemacht und der Museumskosmos neu geordnet werden kann, weil Geschichten erzählt werden können, die bisher nicht erzählt worden sind, weil neue Narrative formuliert, neue Objekte aus den Depots hervorgeholt, neue Parcours entwickelt werden können – ein »Dekorationswechsel« im buchstäblichen Sinne. Eine solche Situation ist mit der Auflösung des sowjetischen Imperiums eingetreten.
Erfahrungsraum Museum
Museumsbesuche stehen auf den Besichtigungslisten von Russlandreisenden nicht an erster Stelle. Natürlich gibt es die Highlights, die zum Pflichtprogramm gehören und die bei keinem Besuch fehlen dürfen: die Gemäldesammlungen, allen voran die Eremitage und das Russische Museum in Sankt Petersburg oder die Tretjakow-Galerie und die Rüstkammer im Kreml in Moskau. Aber wen verschlägt es schon einmal ins Eisenbahnmuseum in Sankt Petersburg oder ins Bachruschin-Museum für Theatergeschichte in Moskau, nicht zu reden von den vielen, schon dem Umfang der Sammlungen nach eindrucksvollen Museen, die man außerhalb der beiden russischen Metropolen besuchen könnte. Dorthin finden Experten, die auf der Suche nach etwas sind, das nur Sachkundige mit besonderen Interessen und Kenntnissen wissen können, etwa die Tatsache, dass bedeutende Kunstwerke der sowjetischen Moderne auch außerhalb der Hauptstadt in der sogenannten Provinz zu finden sind: in Samara an der Wolga oder in Nowosibirsk, wohin sie dank eines dem Erziehungsgedanken verpflichteten Volkskommissariats für Aufklärung einmal – nach dem Prinzip der gerechten Umverteilung und Dezentralisierung von Kulturgütern – gesandt worden waren. So kommt es, dass man Meisterwerke von Boris Kustodjew oder Kasimir Malewitsch auch an abgelegenen Orten findet, an denen man sie nicht vermutet hat. Experten und sachkundige Russlandreisende können so, jeder für seinen Geschmack oder sein Fach, eine Museumswelt entdecken, die in keinem Reiseangebot oder Reiseführer zu finden ist.2
Aber die Museumswelt beschränkt sich nicht auf Kunstmuseen. Museen sind, wie eine inzwischen ins Riesenhafte angewachsene Literatur zum Museumswesen zeigt, viel mehr.3Sie sind Speicher des kulturellen Gedächtnisses – im Großen wie im Kleinen: von Familien, Stämmen, Nationen, Imperien, Unternehmen. An ihnen kann man nicht nur die ausgestellte Geschichte ablesen, sondern den Umgang der Gegenwart mit der je eigenen Vergangenheit. An ihren Exponaten und der Art, in der sie präsentiert werden, lässt sich Zeit vergegenwärtigen, die vergangene wie die, in der wir leben. So will eine Nation, eine Stadt sich selbst gesehen wissen. So soll ein Bild von sich in die Welt hinausgeschickt oder zumindest in den Köpfen der Besucher verankert werden. Museen können als Zeitkapseln fungieren, in denen geschichtliche Momente – wie die berühmte Fliege im Bernstein – festgebannt, stillgestellt sind oder aus der Vergangenheit in die Gegenwart des Betrachters katapultiert werden. Das kann in Kunstkabinetten, Wunderkammern, Galerien mit Vitrinen, viel Staub und Spinnweben geschehen, oder in Museen, die auf dem allerneuesten technischen Stand sind, mit laufenden Bildern, Audioguides und der Produktion von Lautwelten, die den Besucher wie in Zeitmaschinen an andere Orte oder in andere Epochen versetzen oder – etwas bescheidener – ihn in eine »interaktive« Beziehung zu längst verstorbenen Generationen bringen. Museen können streng chronologisch aufgebaut sein, der Besucher folgt gleichsam einem Zeitpfeil, beginnend bei »Adam und Eva« und nach einer Zeitreise durch die Epochen, wieder in der Gegenwart ankommend. In solchen Museen hat alles seine Ordnung, fast wie in einem alten Schulbuch, und wer sich an diese Abfolge, an diese Narrative hält, der kann nicht verloren sein. Er wird gleichsam an die Hand genommen und gelangt am Ende des Parcours durch alle Fährnisse und Unsicherheiten hindurch doch zum Ziel, ohne das keine geschichtliche Erzählung auskommt. Sie braucht ein Ziel, ein Telos, das freilich ganz verschieden aussehen kann: Es kann einen mit einer festen Botschaft, einer »Lehre« zurücklassen, die man fürs ganze Leben mit nach Hause nehmen kann; der Endpunkt kann aber auch ganz anders aussehen: Angefüllt mit sich widersprechenden Informationen, hin- und hergerissen zwischen konkurrierenden Perspektiven und Interpretationen, tritt man hinaus ins Tageslicht und fühlt sich aufgeklärt und bereichert, aber auch alleingelassen, fast benommen, leicht überfordert, wie es nach Achterbahnfahrten der Fall ist.
Dafür, dass der museologische Diskurs und die Reflexion über das, was Museen sind oder sein sollen, sich ausweitet, sich ins Unendliche differenziert, dass hier eine eigene, nicht schlecht dotierte Disziplin entstanden ist, vielleicht sogar ein Betrieb mit ganz eigenen Routinen, lassen sich viele Gründe und Motive anführen, ohne dass man eine Hierarchie der Prioritäten einführen müsste. Im Zentrum des Museums stehen die Sammlung, die Sammelaktivität, der Sammler. Die Sammlung ist die Akkumulation dessen, was der Sammler als bemerkenswert ausgewählt und zusammengetragen hat. Lange Friedenszeiten sind solcher Akkumulationsarbeit förderlich, während Zeitbrüche mit ihren Unsicherheiten und ikonoklastischen Entgleisungen zu irreversiblen Verlusten führen können. Doch epochale Zäsuren gehen auch mit einer »Umwertung der Werte«, mit der Neuordnung von Museumsbeständen einher. In Museen wird etwas gezeigt – das »Erbe der Menschheit« – , aber es geht nie ohne die Absicht und den Willen, sich darin selber zu zeigen und sich zur Erscheinung zu bringen. Die Präsentation der materialen Hinterlassenschaft der Vergangenheit in ihren tausenderlei Formen ist bekanntlich selber schon wieder eine eigene Geschichte. Nicht nur das präsentierte Objekt, sondern ebenso das präsentierende Subjekt und die Form der Präsentation sind aufschlussreich: So also soll die Welt geordnet und gesehen werden, so also werden die Akzente gesetzt oder verschoben. Museen sind daher, wie »verstaubt« und »ewig« sie auch auszusehen scheinen, wahrhafte Abbilder und Barometer der Zeit. Jede Ausstellung und jede Veränderung des Parcours ist bedeutungsvoll – so oder so. Sie besagt: Hier ist es zu einer Modifikation, einer Revision, einer Umwertung, einem Perspektivenwechsel gekommen. Wie dramatisch nicht nur die in den Museen erzählte Geschichte ist, sondern die Gegenwart der Museen selbst, lässt sich an der Situation der Museen im »postsowjetischen Raum« zeigen. Das gilt weniger für die oben erwähnten, weltweit bekannten Kunsthäuser, die keiner Reklame bedürfen und durch ihren Status geschützt sind, wohl aber für jene Museen, die abseits der Königswege oder Trampelpfade des Kulturtourismus liegen.
Die Geschichte der Museen in der »Zeit der Wirren« der 1990er Jahre und der Entsowjetisierung wird noch geschrieben werden müssen. Die Museumsleute wissen das besser als ich. Man müsste hier über vieles sprechen: über den punktuellen Zusammenbruch der Security-Systeme, über den Boom des Antiquitäten- und Kunstschmuggels, von der Tragödie, dass das Lebenswerk einer ganzen Generation von Museumsleuten, Kustoden, Restauratoren in Frage gestellt und in manchen Fällen auch ruiniert wurde. Aber man würde auch ein Denkmal setzen für die Hingabe, die Tapferkeit, ja den Heroismus, den diese »Arbeiter der Kultur« – nicht zum ersten Mal in der Geschichte – an den Tag gelegt haben, um in bedrohlichen Situationen die »Werte der Kultur« zu verteidigen. Man denke nur an den Mut und die Beharrlichkeit, mit denen das Personal des Nationalen Kunstmuseums in Kiew 2014 über Wochen hinweg und rund um die Uhr das Museum inmitten der Kämpfe auf dem Maidan geschützt und verteidigt hat. Eine spätere Zeit, ist sie erst einmal zur Ruhe gekommen, wird diese Leistung noch zu würdigen wissen. An dieser Stelle geht es um Betrachtungen zu einigen Besonderheiten der Museumskultur in der ehemaligen Sowjetunion. Sie stehen in Zusammenhang mit einer »Archäologie des Kommunismus«, die ich an anderer Stelle skizziert habe und an der ich derzeit weiterarbeite.4
Museums-Imperium
Auch wenn man kein Museumsfachmann ist, kann man im Laufe der Jahre doch zu einem solchen werden oder wenigstens zu jemandem, der sich in der russischen Museumswelt auskennt. Dafür gibt es einen einfachen, weil zwingenden Grund: Der Besuch von Museen war in sowjetischer Zeit, wo sie zentrale Orte des Wissens und der Information gewesen sind, obligatorisch. Museen waren in einem Land, in dem es fast keine allgemein zugängliche Literatur zu vielen, vor allem aber orts- und regionalgeschichtlichen Themen gab, der wichtigste Ort, um sich ein Bild machen zu können. Die Buchhandlungen hatten nur wenig zu bieten – vielerorts konnte man nicht einmal Stadtpläne auftreiben –, und wenn es Publikationen zu bestimmten Themen gab, waren sie im Nu vergriffen und unerreichbar. Museen waren – für die ausländischen Besucher jedenfalls – ein eminent wichtiger Anlaufpunkt, oftmals sogar der erste, wenn man sich eine vorläufige Orientierung verschaffen wollte. In meiner Reisepraxis hat sich im Laufe der Jahrzehnte fast so etwas wie ein obligatorisches Ritual ausgebildet, um sich auf möglichst rasche und effektive Weise vor Ort ins Bild zu setzen: Da waren erstens die Buchhandlungen – als Orte, an denen man, wenn es überhaupt etwas an Spezialliteratur gab, fündig werden konnte, denn es gab ja keinen unionsweit funktionierenden Katalog oder Vertrieb lieferbarer Bücher, schon gar nicht von der eminent wichtigen grauen Literatur mit ihren Miniauflagen von 100 bis 500 Exemplaren. Da waren zweitens die Friedhöfe, die – falls sie überhaupt noch vorhanden und nicht in Kultur- und Erholungsparks umgewandelt oder planiert worden waren – dem Fremden Auskunft geben konnten über die »unsichtbaren Städte« (Italo Calvino), die der real existierenden vorausgegangen waren, und weil man an ihnen – an Pflege oder Verwahrlosung – den Umgang der Gegenwart mit der Vergangenheit ablesen konnte. Mit den Museen vor Ort, dem Blick in die örtliche Buchhandlung und dem Gang auf den Friedhof war man ziemlich gut bedient, wenn man in einer Stadt ankam und zu navigieren begann; ich rede nicht vom mitgebrachten Wissen, von den Stadtplänen, die man in der Staatsbibliothek Berlin kopiert und mitgenommen hatte, weil es faktisch keine der wirklichen Topographie entsprechenden Karten gab; ich rede nicht von den Bibliotheken im Kopf, die ein jeder sich über viele Jahre hinweg angelesen hat und die nun als das innere Navigationszentrum – »Erkenntnis und Interesse« – für die Erkundung einer uns ja nicht leicht zugänglichen Welt fungierten.
Die Museumstopographie, die sich über Jahrzehnte herausgebildet hat – meine erste Reise in die Sowjetunion fand 1966 statt –, wurde immer ausführlicher und detaillierter. Sie setzt sich zusammen aus Museen in Russland, im Baltikum, in der Ukraine, in Belarus, auch im Kaukasus, in Usbekistan, in Sibirien und in Fernost. Ich brauchte diese Museen aber nicht nur, um mich zu informieren und zu navigieren – wegen des soeben beschriebenen Mangels an Literatur zur Lokalgeschichte –, sondern ich lernte sie zu schätzen und zu bewundern, um das Mindeste zu sagen. Sie standen für mich für einen Typus der Museumskultur, die in westlichen Ländern fast ausgestorben ist, und die aller sowjetischen Fortschrittsrhetorik zum Trotz eher mit der Tradition der Bildungs- und Erziehungsinstitution Museum zu tun hatte, wie sie im 19. Jahrhundert ausgebildet wurde und im 20. Jahrhundert in der Sowjetunion ihren Höhepunkt erreichte. Es gab so etwas wie einen festen Museumskanon, mit konkreten Objekten, mit einer strengen chronologischen Ordnung, mit einer reichsweit vereinheitlichten und reichsweit durchgesetzten Methodik. Im Zentrum meines Interesses standen nicht die großen Kunstmuseen, die sich wenig von anderen großen Museen der Welt unterscheiden. Mich interessierten vor allem die historischen und landesgeschichtlichen, die lokalgeschichtlichen Museen (istoričeskie i kraevedčeskie muzei). Auch wenn ich mich in den Museen in Moskau und Leningrad / Sankt Petersburg besser auskannte, weil sie jederzeit leicht erreichbar waren, so waren doch die Museen draußen im Land immer auf meinem »Radarschirm«: Museen in Leningrad / Sankt Petersburg, Moskau, Dmitrow, Twer, Nischnij Nowgorod, Saratow, Samara, Simbirsk, Wolgograd, Astrachan, Nowosibirsk, Jekaterinburg, Wladiwostok, Irkutsk, auf den Solowki-Inseln, dann aber auch Museen in den nichtrussischen Sowjet- und später unabhängigen Republiken, also in Gori, Tbilissi, Kiew, Charkiw, Donezk, Odessa, Dnipropetrowsk, Lwiw, Minsk, Witebsk, Riga, Vilnius, Kaunas, Tallinn und anderswo. Ich konnte die Entwicklung der Museen über einen sehr langen Zeitraum beobachten (und habe das auch in Reisetagebüchern festgehalten). Besonders einschneidend war die Neuformierung der Museumslandschaft nach 1991, vor allem in einigen der ehemaligen nichtrussischen Sowjetrepubliken. Die Erfassung der ungemein reichen und vielfältigen Museumslandschaft der ehemaligen UdSSR wird meines Wissens noch nicht betrieben; wünschenswert wäre eine Arbeit, wie sie für die Archivlandschaft von russisch-sowjetischen und ausländischen Experten angegangen worden ist.5
Unendliche Vielfalt. Lebenswelten im Imperium
Es ist aber nicht allein die Anzahl großer, mittlerer und kleiner Museen, die einen überwältigt, sondern ihre thematische Bandbreite. Man kann sagen, dass sie die ganze unendliche Vielfalt, den Reichtum der sowjetischen bzw. russischen Welt abbilden. Die landeskundlichen Museen, die sich mit Orten und Regionen beschäftigen, führen in klassischer Transdisziplinarität, man könnte auch sagen, in einer ganzheitlichen Weise, in das Werden einer Region ein – beginnend mit der natürlichen Raumbeschaffenheit, den klassischen Fragen von Geologie, Geographie, Botanik, Flora und Fauna bis hin zu den Ereignissen in der Gegenwart. Aber neben diesen, praktisch an allen größeren Orten vorhandenen, lokal zentrierten Museen gibt es thematische Museen. Sie sind nicht weniger vielfältig als die lokalen und ihre Bandbreite kann nur angedeutet werden: die Eroberung der Arktis und Antarktis (Leningrad / Sankt Petersburg), die Geschichte des Eisenbahnbaus im Russischen Reich (Leningrad / Sankt Petersburg, Nowosibirsk und anderswo), das Theater-Museum (Bachruschin-Museum in Moskau), zahlreiche Museen für Architektur und Stadtentwicklung, Museen der Flussschifffahrt und des Treidlerwesens (Gorki / Nishnij Nowgorod), Kunstmuseen und Galerien, Museen und Gedenkstätten (Solowki, Medweschegorsk am Weißmeer-Ostsee-Kanal), Museen, die nach der Unabhängigkeit 1991 eingerichtet worden sind (Okkupationsmuseum in Riga, Genozid-Museum in Vilnius). Eine bedeutende Rolle spielen alle Museen, Gedenkstätten und Dioramen, die mit dem Großen Vaterländischen Krieg verbunden sind (Dioramen in Sewastopol, Wolgograd, Rschew, wie auch in der unabhängigen Ukraine in Dnipropetrowsk oder Kiew). Ein besonderer Typus, der mir aus anderen Museumskulturen kaum bekannt ist, sind in der russisch-sowjetisch geprägten Museumswelt die »Wohnungs-Museen« (muzei-kvartiry), also die Originalschauplätze, die Wohnungen, in denen berühmte Persönlichkeiten gelebt haben oder die in irgendeiner Beziehung zu diesen standen: eine kaum überschaubare Zahl von Museen, die mit Aufenthalten von Puschkin, Dostojewski, Alexander Blok, Rimskij-Korsakow, Dmitrij Mendelejew, Iwan Pawlow und vielen anderen verbunden sind. In sowjetischer Zeit waren es die Repräsentanten der Partei- und Staatsführung, denen solche Museen besonders oft gewidmet waren (etwa Lenin, Kirow oder Lunatscharski).
Um diese »Museums-Wohnungen« herum sind ein ganz eigenes Genre und ein fast kanonischer Stil der Repräsentation bestimmter Epochen und Milieus entstanden. Dazu gehören die »Lebenswelten« des Adels, die Gutshäuser auf dem Lande – die Adelsnester, sofern sie die Wellen der Plünderung, Brandschatzung oder auch systematischen Zerstörung und Abtragung nach 1917 oder während des deutsch-sowjetischen Krieges überstanden haben.
Aus der historischen Vogelperspektive betrachtet, erscheint der sowjetische Raum ja immer als unendlich unifiziert, homogenisiert, gleichförmig, was durchaus zutreffend ist. Um dem, was die »Sowjetunion« war, gerecht zu werden, bedarf es allerdings des Blicks auf die »Welt vor Ort«. Und hier entfaltet sich – aller Unifizierung und Zensur zum Trotz – die ganze Vielfalt eines großen Landes, die eben nicht in einem »Kurzen Lehrgang« der sowjetischen oder russischen Geschichte aufgeht.
Linearität und Fortschrittsgeschichte
Die Museen sowjetischen Typs – und nicht nur sie – folgten einem einfachen, plausiblen Narrativ – wenn derartige Pauschalisierungen und Generalisierungen überhaupt möglich sind. Es ist das Narrativ der (marxistischen) Fortschrittsgeschichte von der Entstehung der Welt, von Flora und Fauna, Steinzeit, Urgesellschaft, Sklavenhaltergesellschaft, Feudalismus, Kapitalismus, Arbeiterbewegung und Sozialismus. Das ist eine einfache chronologische Ordnung. Sie ist schulmäßig informativ und umfassend. Man lernt sehr viel – oder ruft sich wieder in Erinnerung, was man zu Zeiten des Abiturs schon einmal gewusst hat. Die Ausstellungsabfolge liefert ein festes Gerüst. Diese Linearität ist natürlich gewollt, konstruiert, verbunden mit einer weltanschaulichen Interpretation und einem Erziehungsauftrag. Alles, was nicht in die Fortschrittsgeschichte passt, wird verschwiegen oder in einer dialektischen Bewegung »aufgehoben«. Große Segmente der Geschichte und bestimmte Aspekte fehlen überhaupt: im Bürgerkrieg etwa die Verbrechen der Roten, in der Kollektivierungs- und Industrialisierungsgeschichte das Hungersterben des Holodomor in der Ukraine, die Unterdrückung der Nationalitäten, die schmutzige und blutige Seite des Großen Vaterländischen Krieges mit seinen entsetzlichen Opfern.
Es ist einer der größten Fortschritte der letzten 25 Jahre, dass viele der »weißen Flecken« getilgt worden sind. Während an vielen Orten fast alles beim Alten geblieben ist, wird an anderen offen über Repression und Gewalt gesprochen. Es gibt Lockerungen im Standard-Narrativ und in der Zensur, eine Entdoktrinalisierung, aber noch keinen entfalteten – kultivierten – Pluralismus, der sich auf die Perspektivenvielfalt und die Kontrastierung unterschiedlicher Interpretationen und Narrative, und letztlich politische Urteilsbildung, einlässt. In der nördlich von Moskau gelegenen Stadt Dmitrow, dem Verwaltungszentrum der Lagerzone beim Bau des Moskwa-Wolga-Kanals in den Jahren 1932-1937, findet sich eine Darstellung der Gutsbesitzer- und Agrarwelt vor 1917, aber auch eine Abteilung zur Kollektivierung und zur Geschichte des Lagers in unmittelbarer Nähe der Hauptstadt.
Wie schwer sich Museen nach dem Ende des sowjetischen Fortschritts-Narrativs mit der Produktion eines neuen, nicht-ideologischen und nicht-mythischen Narrativs tun, kann man in fast allenMuseen der unabhängig gewordenen Republiken beobachten. Im Nationalmuseum in Tbilissi wird die Zeit von 1922 bis 1991 schlicht als die »Zeit der Okkupation« bezeichnet, als wäre die Sowjetrepublik Georgien nur und ausschließlich ein besetztes Land gewesen – ohne eigenen Modernisierungs-Drive, ohne eigenes Engagement bei der Errichtung der Sowjetunion (»Stalin, der größte Sohn des georgischen Volkes«).
Der Zauber der Vitrinen. Sowjetische Museumskultur – gibt es das?
Zu begründen, weshalb die sowjetische Museumskultur auch eine große Leistung ist, ist nicht ganz einfach, wenn man um die verordneten Geschichtsbilder, die schamlosen Fälschungen, die gleichsam plastische Behandlung der Vergangenheit je nach parteipolitischer Konjunktur weiß. Doch so wie die historische Forschung nach unendlichen Mühen endlich versteht, dass die Schaffung der Sowjetunion nicht einfach dem Kopf einer überhistorischen Gestalt namens Lenin entsprungen ist, und sich zu einem Verständnis durchgerungen hat, dass es nicht nur Herrschaft, System, Propaganda etc. gegeben hat, sondern Lebenswelt, Alltag, vielleicht sogar so etwas wie eine kohärente »Zivilisation« (so Stephen Kotkin), so wird man sich auch zu einem Verständnis des sowjetischen Museums durchringen, das mehr ist als eine bloße Indoktrinations- und Propaganda-Einrichtung, und dass hier Traditionen zusammengekommen sind, die mehr mit dem 19. Jahrhundert zu tun haben, mit dem »Geist der Aufklärung« und der »Verbesserung des Menschengeschlechts durch Erziehung und Bildung« als mit einem utopischen »Projekt«. Es ist sogar so, dass die russisch-sowjetische Museumskultur als kulturelle Leistung erst in dem Augenblick in Erscheinung tritt, in dem sie in ihren Fundamenten bedroht ist, abgewickelt und selbst Geschichte wird.
Das sowjetisch-russische Museum verdient eine phänomenologische Studie, in der vieles in Betracht käme: die Öffnungszeiten, die Kasse für die Eintrittskarten, die ausführlich-umständliche Ausfertigung des Billetts, die Prozeduren an der Garderobe, der strenge Blick der Museumswärterinnen, meist ältere Frauen, Babuschki, das Gefühl der Verlassenheit und die Stimmung von Resignation, wenn es einen in ein Museum abseits des Besucherstromes verschlagen hatte. Das Schönste, worauf sich der Besucher am Ende des Rundgangs freuen durfte, war, am Museumskiosk ein Set mit 10 Postkarten, auf denen die wichtigsten Exponate abgebildet waren, erwerben zu können.
Zu den sinnfälligen Eigenschaften des sowjetischen Museums gehörte sein Bestehen auf materialer Gegenständlichkeit und Konkretheit der Objekte – ob es sich um ausgestopfte Bären, Tongeschirr oder das Exemplar einer vorrevolutionären Untergrundzeitung handelte. In allen Museen der Welt gibt es Exponate, aber hier gab es noch nicht die Auflösung in rasche Bildfolgen, in interaktive Displays, in Zerstreuungsmaschinen. Sie hatten sich einem von außen herangetragenen Erziehungsauftrag zu fügen, mit all seinen doktrinären Verengungen und Beschränkungen, aber waren doch Lernorte. Sowjetische Museen waren mehr als anderswo pädagogische und moralische Veranstaltungen. Der Besucher war nicht sich selbst überlassen, sondern wurde gleichsam an die Hand genommen und erhielt sanftes Geleit. Nicht der Einzelne, sondern die Exkursionsgruppe bewegte sich durch die Säle. Die Exkursion war vollgepackt mit Informationen, die niemand sich merken konnte, auch wenn manche mitschrieben – ein intensiver Belehrungsvorgang, der große Selbstdisziplin verlangte.
Ein anderer Charakterzug des sowjetischen Museums war das Anliegen, den »Geist der Epoche« oder eines bestimmten Milieus anschaulich vor Augen zu führen. Ich finde diese Form der atmosphärischen Rekonstruktion, die in der Postmoderne als naiv und unreflektiert verachtet wird, bis heute eindrucksvoll – ob in Adelspalais, Behausungen der vorrevolutionären Intelligenzija oder in Fabrikmuseen. Das geht nicht ohne Stilisierungen, Stereotype, Klischees ab. Man kann von einem regelrechten Kanon der Stilisierung von »Epochengeist« sprechen. Wo immer man hinkam in die Museen zwischen Brest und Wladiwostok, es gab ein bestimmtes Interieur mit Tapeten, Klavier und Jugendstillampen, das für die Welt der russischen Intelligenzija stand, ein anderes – die gläserne Veranda, der Lüster, die Empire-Möbel mit Schonbezügen – für die russischen Adelsnester und wieder ein anderes für die Welt der Kaufmannschaft (hier nicht selten die Ikonenecke oder Privatkapelle). Eine Liste der Gegenstände, die zum Objektprogramm gehörten, würde Thonet-Stühle, die Schreibmaschine der Marke Mercedes oder Underwood, die Singer-Nähmaschine oder das Metallbett aufzählen, auf dem sich eine asketische revolutionäre Jugend zur Nachtruhe niedergelassen hatte.
Man könnte geradezu eine Phänomenologie der soziokulturellen Milieus, eine Geschichte ihrer Generierung über Jahrzehnte hinweg, eine Studie zu stilistischen Topoi verfassen, mit dem Museum als stilbildender Institution, mittels deren Bildwelten von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Es gab hier nicht jenen Fetischismus des »Originals« – wo hätte es auch herkommen sollen nach so viel Zerstörung –, das im Westen manchmal den Rang einer Ausstellung definiert, sondern es war eher die möglichst genaue stimmungsmäßige, farblich schlüssige Inszenierung einer Welt, wie wir sie aus den russischen Gesellschaftsromanen, aus Fotoalben der Vorfahren oder aus Plakaten, die bildmächtig geworden sind, kennen. Diese Inszenierungen verrieten oft eine außerordentliche Stilsicherheit, bezeichnenderweise eher bei der Rekonstruktion bürgerlicher Milieus als bei der Inszenierung der Welt des Proletariats.6
Die Geschichte neu lesen. Selbstentdeckung
Es gehört zu den aufregendsten Vorgängen im geistigen Leben einer Nation, wenn die ganze Geschichte noch einmal bedacht und re-interpretiert wird. Solche Vorgänge des Neu-Sehens und des Um-Wertens sind ein konfliktreicher und riskanter Prozess, bei dem es zu neuen Mythenbildungen und Ideologisierungen kommen kann. Es handelt sich dabei um die Entdeckung und Visualisierung von Themen, die bis dahin tabu waren, obwohl sie zentrale Lebenserfahrungen verkörperten – etwa die Kriegserfahrung als Leiden, nicht nur als heroische und patriotische Tat; die Erfahrung des Bürgerkriegs als Tragödie des Brudermords, die Rote wie Weiße umfasste, die Kollektivierung als Zerstörung der Welt des russischen Dorfes, der Holodomor, der nach Jahrzehnten zum ersten Mal überhaupt »ausgestellt« werden konnte; die Gewalt der 1930er Jahre und der Gulag – kurzum alle bis dahin verschwiegenen Aspekte der sowjetischen Geschichte. Neu – jedenfalls für eine bestimmte Generation – wird zum Thema, dass auch die vorrevolutionäre Zeit ihre Verdienste und Leistungen aufzuweisen hat und nicht nur aus Niedergang und Verfall bestand: etwa der ökonomische Boom im späten Zarenreich, die erste Globalisierung um 1900, die epochalen Projekte des Eisenbahnbaus (Transsibirische Eisenbahn) und die Leistungen der sowjetischen künstlerischen Avantgarde.
All dies führt zwangsläufig zu einer Belebung der Museumsszene, werden die Museen dadurch doch aus dem Abseits der bloßen Bildung ins Zentrum der öffentlichen Auseinandersetzung gerückt. Museen sind so zu gesellschaftlichen Foren und damit auch zu umkämpften Orten geworden. Sie werden zu Orten der Neuorientierung, der Konfrontation mit Themen und Materien, für die es bis dahin keinen Raum und keine Sprache gab. Dies läuft in unterschiedlichem Tempo und unterschiedlichen Formen ab. Mein Eindruck ist, dass die Provinzmuseen etwas langsamer und mit Verspätung auf die Veränderungen der geistigen und politischen Situation reagieren, doch generell gilt das nicht. Gerade die Ferne von der hauptstädtischen Öffentlichkeit erlaubt es Kuratoren und Museumsdirektoren, eigene Projekte durchzusetzen – immer mit Bezug auf die »Besonderheiten« der lokalen und regionalen Verhältnisse. So kommt nicht »die« Kollektivierung oder »der« Große Terror vor, wohl aber die Vorgänge vor Ort, herausgearbeitet aus den lokalen Quellen, Zeugnissen und Archiven. Es ist die Konkretheit des Materials vor Ort, das in den allgemeinen Diskurs einsickert, vordringt und diesen auf mittlere und längere Sicht transformiert. Es ist daher eine ganz kindische Vorstellung anzunehmen, das historische Wissen und die konkrete Erinnerung vor Ort in einem so großen Land wie Russland ließen sich von einem Punkt aus »geschichtspolitisch« steuern und regulieren. Zudem hat das Internet noch die entfernteste russische »Provinz« an die Zentren des globalen Kulturbetriebes angeschlossen (die jungen Kuratoren, die im Jahr 2000 mit ihrem Laptop auf den Solowki-Inseln im Weißen Meer saßen – in einem Hangar für Wasserflugzeuge aus den 1930er Jahren! –, besprachen gerademit ihren Kollegen in New York und Rotterdam eine gemeinsame Ausstellung).
Eine zentrale Rolle bei der Veränderung der geschichtlichen Selbstwahrnehmung in den Museen spielen Ausstellungen. Auch hier ist man wieder überrascht, was jenseits der im Scheinwerferlicht der internationalen Kunstwelt stehenden Museen alles passiert und trotz Mittelknappheit, Ausbleiben von Sponsoren und bürokratischer Gleichgültigkeit zustande kommt. Ausstellungen können wie Neueröffnungen eines Themas, wie Wendepunkte wirken. Ich habe einige Ausstellungen gesehen, bei denen Besucher sichtlich erschüttert waren, weil hier zum ersten Mal die Erfahrungen einer ganzen Generation zur Sprache und zur Anschauung gebracht worden waren, wie etwa die Ausstellung über die Chruschtschow-Ära, die in den Perestrojka-Jahren Mitte der 1980er Jahre in Moskau gezeigt wurde, in den Hallen des Moskauer Jugendpalastes am Komsomolskij Prospekt. Zentrale Sujets dieser Ausstellung waren die Kommunalka, also die Gemeinschaftswohnung, die Rückkehr der Lagerhäftlinge aus dem Gulag und ihre Erzählungen, die USA-Ausstellung, das Weltjugendfestival von 1957, die neue Mode, vorgeführt von den Mannequins von Dior auf dem Roten Platz. Die Besucher fanden hier ihre Welt vor, zum ersten Mal wurde die »Banalität des Alltagslebens« thematisiert, das ansonsten immer nur aus Höchstleistungen, Rekorden bei der Planerfüllung, heroischen Taten bestand. Die Menschen waren gerührt, sie konnten sich und ihre Zeit wiedererkennen – ein Moment der Selbstwahrnehmung und Selbstaufklärung. Eine andere Ausstellung wurde von dem Photographen Jurij Brodskij auf dem Territorium des Solowjetzer Klosters mitorganisiert, wo nach dem Bürgerkrieg das erste Konzentrationslager eingerichtet worden war. Zum ersten Mal wurde dort die Geschichte des Lager-Archipels dargestellt, mit Bezug auf die heute noch sichtbaren Spuren – die Kaianlage, wo die Schiffe mit den Häftlingen ankamen, die umfunktionierten Kirchenräume, die von den Häftlingen angelegten Kanäle und errichteten Werkstätten, die halbverfallenen Kirchen auf den Inseln, in denen die politischen Gefangenen eingesperrt waren.7 Ein anderes Beispiel ist die Ausstellung im Russischen Museum über die sowjetische Unterwäsche, in der es um Mode, vor allem aber um das Verhältnis der Sowjetmenschen zum Körper, um das Verhältnis von privat und öffentlich ging – ein überaus wichtiges Thema, für das in einer Geschichte der sowjetischen Hochkultur und der Haupt- und Staatsaktionen indes kein Raum geblieben war.8 Es sind die schiere Materialität der gezeigten Exponate – der Primuskocher in der sowjetischen Küche, das Transistorradio aus der Rigaer Radiofabrik, das Muster des aserbaidschanischen Wandteppichs – und die Konfrontation mit einer verschwundenen Lebenswelt, die die Stärke solcher Vergegenwärtigung ausmachen. Ausstellungen können, wenn sie ihr Momentum treffen, Einschnitte in der Geschichte kultureller Selbstwahrnehmung und Aneignung werden. Eine Geschichte der Auflösung und Neubildung nach 1991 könnte man daher entlang der Entwicklung des Ausstellungswesens (Themen, Besucherzahlen, öffentliche Kontroversen etc.) schreiben.
Spurenlesen im öffentlichen Raum. Geschichte hat einen Ort
Geschichtliche Ereignisse spielen nicht nur in der Zeit, sondern auch im Raum. Geschichte hat einen Ort, Geschichte findet statt. Nicht umsonst spricht man vom genius loci