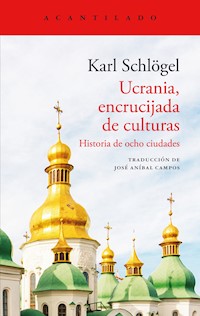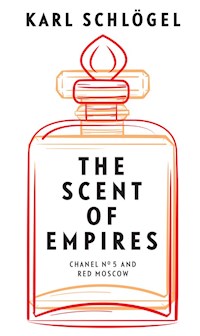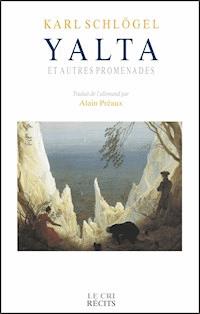Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was macht Amerika aus? Karl Schlögels besonderer Blick auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts: die großen Jahre der USA Karl Schlögel hat als Historiker den Osten nach Europa zurückgebracht. Er hat aber auch intensiv die USA bereist, wo ihn die Weite des Landes genauso faszinierte wie in Russland. „American Matrix“ erzählt, wie Nordamerika von Eisenbahn und Highway erschlossen wurde, Städte und Industrien aus dem Nichts entstanden, Wolkenkratzer in den Himmel schossen – Errungenschaften einer Gesellschaft, die sich frei von allen Traditionen fühlte. Das Versprechen des American Way of Life veränderte die Welt genauso wie das sozialistische Experiment. Karl Schlögels großes Buch beschreibt die USA aus einer einmaligen, überraschenden Perspektive – und erzählt eine Geschichte des 20. Jahrhunderts, wie sie noch nicht zu lesen war.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1196
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Was macht Amerika aus? Karl Schlögels besonderer Blick auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts: die großen Jahre der USAKarl Schlögel hat als Historiker den Osten nach Europa zurückgebracht. Er hat aber auch intensiv die USA bereist, wo ihn die Weite des Landes genauso faszinierte wie in Russland. »American Matrix« erzählt, wie Nordamerika von Eisenbahn und Highway erschlossen wurde, Städte und Industrien aus dem Nichts entstanden, Wolkenkratzer in den Himmel schossen — Errungenschaften einer Gesellschaft, die sich frei von allen Traditionen fühlte. Das Versprechen des American Way of Life veränderte die Welt genauso wie das sozialistische Experiment. Karl Schlögels großes Buch beschreibt die USA aus einer einmaligen, überraschenden Perspektive — und erzählt eine Geschichte des 20. Jahrhunderts, wie sie noch nicht zu lesen war.
Karl Schlögel
American Matrix
Besichtigung einer Epoche
Hanser
Vorwort
Was muss passiert sein, dass jemand wie ich, der sich ein Leben lang mit Russland beschäftigt hat, auf die Idee verfällt, ein Buch über Amerika zu schreiben? Vielleicht ist die Antwort einfacher als vermutet: Wer sein Leben lang in der sowjetischen und der amerikanischen Hemisphäre unterwegs war, der blickt anders auf die eine wie die andere Welt. Ich reiste 1970 zum ersten Mal in die USA, war aber 1966 und 1969 bereits in der Sowjetunion unterwegs gewesen. Das ist nun ein halbes Jahrhundert her. Der sowjetische Realsozialismus war für einen linken Aktivisten, der damals mehr von der chinesischen antibürokratischen Kulturrevolution fasziniert war, nicht besonders interessant, und wer es nach dem Internationalen Vietnam-Kongress in Westberlin 1968 mit dem Kampf gegen den Imperialismus ernst meinte, der ging in die USA: The belly of the beast, wie es damals hieß. Die erste Reise ging vor allem in die Zentren der Antikriegsbewegung, in das Amerika der Bürgerrechtler, in meinem Fall besonders zu Kundgebungen und Büros der Black Panther Party, die mit ihrem Konzept, die soziale Frage mit der Rassenfrage zu verbinden, eine neue Perspektive zu eröffnen schien.
Von dieser ersten Reise, der zahlreiche andere folgten, stammen die Eindrücke, die dauerhaft bleiben, so wie das bei ersten Eindrücken oft der Fall ist. Monate lang die USA von Küste zu Küste und von Nord nach Süd durchquerend, das Land durch die Fenster des Greyhound Bus entdeckend, überall freundlich aufgenommen — so ist eine tiefe Sympathie gewachsen, die ich bis heute nicht anders fassen kann als in Goethes berühmter Verszeile in den Xenien: »Amerika, du hast es besser/Als unser Kontinent, das alte,/Hast keine verfallene Schlösser/Und keine Basalte./Dich stört nicht im Innern/Zu lebendiger Zeit/Unnützes Erinnern/Und vergeblicher Streit.« Daran haben auch die auf die dunklen Seiten Amerikas verweisenden Erfahrungen — die Bilder aus den Städten des Rust Belt, die von Drogen und Gewalttätigkeit verwüsteten Viertel, die gottverlassenen Siedlungen irgendwo in einem Tal der Appalachen, die verhängnisvollen Kriege im Irak und Afghanistan — im Prinzip nichts geändert. Man konnte von der Größe und Großzügigkeit Amerikas fasziniert sein, auch wenn man an dem Land unendlich Vieles auszusetzen hatte. Ich habe mich gefragt, woher diese tiefe Sympathie rührte, ob es sich nicht doch um eine Projektion handelte, die alles ausblendet, was zu einem Idealbild von Amerika nicht passt, eine Form von Verdrängung, eine Fluchtreaktion in einer Situation, in der eine Alternative zur freiheitlich-liberalen Lebensform des Westens nicht in Sicht ist.
Für die Rekonstruktion der eigenen Faszination — und vielleicht nicht nur meiner — bleibt nichts anderes übrig als — für einen Augenblick wenigstens — die großen Erzählungen von Aufstieg und Fall des amerikanischen Imperiums erst einmal ruhen zu lassen und jene Stationen noch einmal Revue passieren zu lassen, an denen die dauerhafte Begeisterung für das Land geweckt wurde. Das sind — nicht überraschend — die Pflichtstationen jeder Amerika-Reise, die in jedem Reiseführer verzeichneten Naturwunder, die Sehenswürdigkeiten und Highlights, die jeden Ankömmling aus Europa schockierende und befreiende Weite des Raums, der Eintritt in eine Zeit mit ihrem eigenen Tempo und Rhythmus. Man bewegt sich dabei, ob man will oder nicht, immer schon auf Wegen, auf denen andere vor einem unterwegs gewesen sind. So werden Reisen im Raum zu Reisen durch die Zeit.
Wenn es einen übergreifenden Begriff gibt für das, was mich nie losgelassen hat, dem ich nachgehen musste, dann war es: die Produktion des amerikanischen Raumes, die aus dem nordamerikanischen Kontinent in so kurzer Zeit das Zentrum einer Zivilisation hat werden lassen, die im 20. Jahrhundert weltweit ausstrahlte und große Teile der Welt bis heute prägt.
Ein Titel wie »Americanization of the World. The Trends of the Twentieth Century« von William T. Stead, erschienen im Jahre 1901, konnte in einem Augenblick auftauchen, als Amerika im Begriffe war, sich definitiv von seinen Vorbildern zu lösen und zu einer eigenen Form zu finden. Vielleicht war die Weltausstellung von Chicago 1893 — zur Feier des 400. Jahrestags der Ankunft von Christoph Kolumbus im Jahre 1492 — der erste große selbstbewusste Auftritt des »amerikanischen Jahrhunderts«, so wie vielleicht der Einsturz der Türme des World Trade Center am 11. September 2001 in unüberbietbar prägnanter Symbolik dessen Ende und den Eintritt in eine Konstellation mit gänzlich neuen Grenz- und Frontverläufen signalisierte. Was sich in dem Jahrhundert ereignet, ist der Aufstieg Amerikas, verkörpert in der Entfesselung einer beispiellosen gesellschaftlichen Dynamik, die die USA zum Kraftzentrum der transatlantisch-westlichen Zivilisation haben werden lassen. Es ist kein Zufall, dass der Amerika-Enthusiasmus europäischer Reisender um 1900 in vielem dem zwischen Fassungslosigkeit und Verunsicherung schwankenden Staunen heutiger China-Reisender gleicht.
Man kann die Geschichte Amerikas im 20. Jahrhundert entlang der Geschichte der Verfassung, der Institutionen, der Kultur und vieler anderer Themen schreiben, enzyklopädisch in chronologisch geordneter Form, aber man kann sie auch als Ortsbeschreibung versuchen, als Topographie des Wandels, ob ausgelöst durch technologischen Fortschritt, demographische Veränderungen, Naturkatastrophen oder andere Prozesse. »Im Raume lesen wir die Zeit«, auf die Geschichte der USA bezogen, bedeutet dann, sich auf der Oberfläche zu bewegen, durch den Raum zu navigieren, Landschaften zu erschließen, sich auf Schauplätzen umzusehen, Zeitschichten freizulegen und lesbar zu machen. So entsteht ein Amerikabild nicht primär aus der Vertikale der zeitlichen Abfolge von Epochen, sondern aus der Horizontale des Raums. Für eine derartige Neuvermessung des amerikanischen Jahrhunderts werden dann Objekte, Quellen und Materialien wichtig, die sonst eher in Spezialdisziplinen — Verkehr, Kommunikation, Infrastruktur, Bau und Stilgeschichte — abgedrängt oder ausgewandert sind. Die Arbeit an Raumbildern und die Analyse von Orten und Landschaften rücken ins Zentrum. Besondere Aufmerksamkeit richtet sich auf die Gemeinplätze, die man in der Regel der Rede nicht für wert befindet, weil sie sich von selbst verstehen. Es sind aber gerade jene wie selbstverständlich in Anspruch genommenen Common Places und Alltagsroutinen, die Gesellschaften zusammenhalten und über die das Nachdenken in der Regel immer erst dann beginnt, wenn sie — wie in Katastrophenfällen oder Ausnahmezuständen — ausfallen und zu funktionieren aufgehört haben. Infrastrukturen und Netzwerke, Knotenpunkte und Verkehrskorridore sagen etwas aus über Beschleunigung und Verlangsamung, über Integration oder Desintegration, über soziale Stabilität und Mobilität, über gesellschaftliche Basiskräfte, die auch die Institutionen tragen. Die Geschichte der amerikanischen Gesellschafts- und Nationsbildung lässt sich, wie Donald W. Meinig in seinem großen Werk »The Shaping of America. A Geographical Perspective of 500 Years of History« gezeigt hat, entlang der Transformation des kontinentalen Raums beschreiben. Diese räumliche Prägung, die sich nicht nur in den Grundrissen von Städten und Kartenbildern von Landschaften niedergeschlagen hat, bezeichne ich als American Matrix.
Und hier kommt die andere Erfahrung ins Spiel, die Erfahrung des sowjetischen Wegs im 20. Jahrhundert. Es bedurfte nicht erst der Lektüre der berühmten Passage in Alexis de Tocquevilles »De la démocratie en Amérique«, wo er von den verschiedenen Wegen Amerikas und Russlands als den Mächten der Zukunft spricht, um einen vergleichenden Blick zu entwickeln. Wer sich auf beiden Seiten der Grenze bewegte, die Europa geteilt hat, konnte Verbindungslinien und Wahlverwandtschaften entdecken, für die der bloß auf das politische System fixierte Blick unempfindlich oder blind war. Der an den Phänomenen der sowjetischen Welt geschärfte Blick sieht anders und anderes auch in der amerikanischen Welt.
Das System der Highways, das den Kontinent durchzieht, wird als Form der Raumerschließung und Raumdurchdringung erst wirklich bedeutsam, wenn man etwas von der Wegelosigkeit im weiten russischen Raum erlebt hat. Die Bedeutung der Automobilität und Dichte des Flugnetzes ist erst vollständig zu ermessen, wenn man ihr Fehlen und die damit verbundene Einschränkung von Bewegungsfreiheit erfahren hat. Der Nachtflug von Moskau nach Wladiwostok zeigt ein anderes Relief als der Flug von der Ost- an die Westküste Amerikas: hier das sich in der Weite Sibiriens verlierende schmale Städteband entlang der Transsib, dort das über das ganze Territorium sich ausbreitende Netz hell illuminierter Städte. Die sichtbaren Siedlungsformen und Infrastrukturen drücken anders geartete Besitz- und Eigentumsverhältnisse aus. Vom disziplinierten Lining-up, ob an der Kasse des Supermarkts oder beim Einstieg ins Flugzeug, kann nur fasziniert sein, wer ein Leben lang das unübersichtliche Gedränge und Geschiebe in den Warteschlangen der Sowjetzeit erlebt hat. Dass Höflichkeit und Abstandswahrung gesellschaftliches Leben erst erträglich macht, versteht besser, wer am eigenen Leib die Rohheit des Umgangs im Alltag einer von ständiger Knappheit und Gewalt imprägnierten Gesellschaft erfahren hat. Vom Komfort, den gewöhnliche amerikanische Motels und Lodges bieten, kann nur schwärmen, wer ohne solche jederzeit zur Verfügung stehenden Facilities auskommen musste.
Aber es gibt auch die Momente einer fast unangestrengt-natürlichen Übereinstimmung, wenn man sich etwa die fast identische Bildsprache von Erstem Fünfjahresplan und Machine Age ansieht, von jenem Aufbruch in eine Welt jenseits des »alten Europa«. Wie verwandt sind die heroischen Arbeitergestalten auf den Murals des New Deal und den sozrealistischen Fresken der Stalinzeit! Gemeinsame Leitbilder gab es für die Jugend hier wie dort: den Beruf des Piloten und des Ingenieurs. Wie ähnlich sind sich die Großprojekte der Elektrifizierung und Industrialisierung, von Hoover Dam und Dnjeproges-Kraftwerk. Man träumt in Moskau den Traum von einem Kalifornien und einem sowjetischen Hollywood auf der Krim. Wer die Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft in Moskau gesehen hat, wird leicht die Vorbilder — die White City der Weltausstellung von Chicago und den Lunapark von Coney Island — erkennen. Delegationen von Arbeitern und Technikern pilgern zu Henry Ford, um die neueste Technik zu studieren, während Albert Kahns Architekturbüro für die Sowjetunion Hunderte Fabrikanlagen entwirft, darunter eine Autofabrik für »Detroit an der Wolga« und eine Traktorenfabrik für Stalingrad. Der Palast der Sowjets, das in Moskau geplante höchste Gebäude der Welt, nimmt Maß am Empire State Building, während Wjatscheslaw Oltarschewski, der nach dem Krieg für die Planung und die Errichtung der Hochhäuser in Moskau verantwortlich ist, seine Erfahrung beim Bau von Wolkenkratzern in New York gesammelt hat. Stalins für die Lebensmittelindustrie zuständiger Volkskommissar interessiert sich für die Verfahren der amerikanischen Konservenindustrie, für elektrifizierte Küchen und Automatencafes. Wie eng die sowjetisch-amerikanischen Verhältnisse jener Jahre verflochten waren, darauf stoßen heute Besucher an ganz unvermuteten Orten: etwa in der National Gallery in Washington, wo die Meisterwerke zu sehen sind, die Stalin aus der Eremitage verkaufte, um die Industrialisierungsprojekte des Ersten Fünfjahresplan zu finanzieren.
Der am Vergleich geschulte Blick ist aber auch scharf genug, um jederzeit die radikale Differenz der Erscheinungen zu erkennen — zwischen offener und geschlossener Gesellschaft, zwischen dem Leben in einem demokratischen Land und dem in einem totalitären »System«. Die Strategen des New Deal sind fasziniert vom Plangedanken, aber doch meinen sie etwas anderes als die Staatliche Plankommission der sowjetischen Kommandowirtschaft. Präsident Roosevelt preist 1936 bei der Einweihung des Hoover Dams die Helden der Arbeit, aber er hat nicht Stachanow’sche Stoßarbeiter vor Augen. Die Natur soll erobert und gezähmt werden im Tennessee Valley Authority Project, aber vor allem mit modernen Maschinen, nicht mit Schubkarren und Schaufeln der Gulag-Häftlinge. Die Massen, die in die Nationalparks pilgern, kommen als Touristen in ihren eigenen Autos, die sowjetischen Urlauber reisen in Gewerkschafts-Kollektiven und Delegationen an. Amerika hat viele Zentren aus eigener Kraft, Russland die eine Hauptstadt, in der alles entschieden wird. Und auch diese Differenz ist überall mit bloßem Auge zu erkennen: Amerika blieb vom Krieg unversehrt, anders als das verheerte Territorium der UDSSR.
Dieses Buch handelt von einem Amerika, das es so nicht mehr gibt, von dem ungewiss ist, ob und wie es sich neu erfindet und aufstellt. Seit dem Angriff auf das World Trade Center ist schon wieder eine Epoche vergangen mit Erschütterungen, die deutlich machen, dass die »Welt von gestern« sich aufzulösen begonnen hat und sich auch die erste Supermacht von einst auf eine neue Verteilung der Macht im Weltmaßstab einstellen muss. Tektonische Verschiebungen, der Aufstieg Chinas, die Erschütterung des Finanzsystems mit allen Konsequenzen, die auf die Fragilität, vielleicht sogar auf das Ende der bis dahin bekannten Form der Globalisierung und die Stellung des »globalen Westens« verweisen. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine sowie die Drohung Chinas gegen Taiwan haben das Gesamtsystem der internationalen Beziehungen in Frage gestellt. Unter den veränderten Bedingungen sind die Schwächen Amerikas offen zutage getreten. Amerikas Heartland, für lange Zeit von vielen nur noch wahrgenommen als Fly-over-Country zwischen den dominierenden Zentren an der Ost- und Westküste, nahm Rache für die desaströsen Folgen einer entfesselten und außer Kontrolle geratenen Globalisierung. Unbemerkt, hinter dem Rücken der politischen Parteien, Institutionen und Medien öffnete sich die tiefe soziale, ökonomische, vor allem aber kulturelle Kluft, die Amerika zu spalten droht und die die Radikalisierung der Lager vorantreibt, bis hin zum offenen Aufstand gegen die bis dahin unantastbar geltenden Orte und Institutionen der amerikanischen Demokratie, wie geschehen am 6. Januar 2021: Bilder, die eine tiefe Erschütterung sichtbar machen und Formen des Bürgerkriegs in den Horizont des Möglichen rückten. Wie diese Auseinandersetzung ausgehen wird, ob die Institutionen und die mit ihnen gegebenen Verfahrensweisen standhalten, wird sich zeigen.
Der Abschied vom Amerika des 20. Jahrhunderts gibt den Blick frei auf eine Szene der Verunsicherung, der Erschöpfung und der inneren Verfeindung. Und als ob dies noch nicht genügte, brachte die Corona-Epidemie das Riesenland von einem auf den anderen Tag zum Stillstand. Die Zeit angehalten. Der Fluss des Alltags unterbrochen. Leere Abflughallen. Kein Stau auf den Runways, aber Stau der Containerschiffe vor Long Beach. Der Rhythmus der Pendelbewegung zwischen Wohnung und Arbeit ausgesetzt. Highways, die Arterien des Landes, für einen Augenblick verödet. Der Strom der Besucher in Nationalparks und Museen versiegt. Die Hotels geschlossen. Einreisesperren. Amerika über Nacht von der übrigen Welt abgeschnitten. Der Times Square verwaist. In den Schluchten von Manhattan die Sirenen von Ambulanzen und Feuerwehr. Alle Bewegungen und Formen des gesellschaftlichen Lebens für eine historische Sekunde erstarrt. Alles, was uns als Normalität der Zivilisation vertraut war, in ein neues Licht getaucht. Zeit der Disruption, der Trennung, der Atomisierung, des Rückzugs. Welch eine Erfahrung! Es war dies der Augenblick, in dem selbst die Kraftmaschine des San Diego Freeway zum Stillstand kam, die zehnspurigen Betonbänder leer — aber nur für einen Augenblick. Wie ein großes Innehalten, so als sollten die Zeitgenossen die Möglichkeit bekommen, noch einmal, einen genaueren Blick auf die Szene zu werfen, um sich ihrer Kraft zu vergewissern. Es ist aber auch der Augenblick, in dem sich das große Land fit macht für Amerikas Zeit nach dem amerikanischen Jahrhundert.
Berlin im Mai 2023
Melancholische Reise: Alexis de Tocqueville und Gustave de Beaumont in Amerika
Reise über die Landkarte der Neuen Welt / Der Auftrag: Erforschung des Gefängniswesens. Die Verbesserung der Menschen / Die Besichtigung des alten Frankreich in Kanada und Louisiana / Die Spur zu den letzten Mohikanern Fenimore Coopers. Die Eingeborenen. Wilderness / Ohio oder die Erfahrung der Frontier. Zivilisation auf vorgeschobenem Posten / New Orleans, der Süden und die Rassenfrage / Civil society, Städte, die Abwesenheit des zentralistischen Staates / Rückkehr nach Europa. Sich fügen ins Unabänderliche. Projektionen / Die Parallelaktion: Custines »La Russie en 1839«
David Riesman und mit ihm viele andere haben Tocquevilles »Demokratie in Amerika« das »bedeutendste Buch, das je über Amerika geschrieben wurde« genannt. »Certainly the greatest book ever written by anyone about America«.1 Ähnlich heißt es bei Max Lerner: »Sein Glück — und unseres — war, dass er auf seiner Reise ins Jacksonianische Amerika 1831 zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, mit den richtigen Fragen und der richtigen Vorbereitung, um die Auswirkungen der amerikanischen Erfahrung auf sich selbst zu erkennen. Das Ergebnis war nicht nur das großartigste Buch, das je über Amerika geschrieben wurde, sondern wahrscheinlich auch das großartigste Buch über jedes nationale Gemeinwesen und jede Kultur.«2
Die Rezeptionsgeschichte seit der Erstveröffentlichung — Band 1 erschien im Jahr 1835, Band 2 im Jahr 1840 — belegt, wie dieser Text geradezu kanonische Bedeutung gewann. Keine Diskussion über Amerika, ja über das Wesen der modernen Demokratie überhaupt kommt an Tocquevilles Buch vorbei: an der These von der Unaufhaltsamkeit der Durchsetzung des Gleichheitsgedankens, dem Ende der auf Standesprivilegien beruhenden alten Ordnung und dem Beginn einer ins Universale zielenden Demokratie, aber auch — und dies im Lichte der totalitären Erfahrungen des 20. Jahrhunderts — an der Warnung vor einer Gefährdung ebendieser neuen Ordnung, wenn eine durch Gleichheit beförderte politische Ordnung umschlägt in eine »Tyrannis der Mehrheit«, der Minderheiten schutzlos ausgeliefert sind. Doch dagegen habe sich das politische System aus »checks and balances«, wie es in den Gründungsdokumenten der Vereinigten Staaten, noch mehr in der praktisch gelebten Demokratie der Bürger verankert ist, bisher behaupten können. Ein Leitbild für das von Krisen, Umstürzen, gewaltsamen Revolutionen zerrissene Europa. In Tocquevilles Buch schienen sich Enthusiasmus für die Neue Welt und eine aus dem Scheitern der Großen Revolution in Frankreich genährte Skepsis zu einem weisen und über die Generationen hinausweisenden Fortschrittsnarrativ verbunden zu haben, eine Erfahrungssumme, die weit in die Zukunft wies.
Tocqueville selbst war sich indes nicht so sicher, ob er je ein Buch dieser Art überhaupt schreiben sollte. Er bezweifelte bereits, ob man überhaupt auf einer Reise von knapp einem Jahr ein so riesiges Land wirklich kennenlernen und sich dann darüber kompetent äußern könne. Auf dem Weg nach Amerika äußerte er in einem Brief an seine Mutter: »Werde ich jemals etwas über dieses Land schreiben? In Wahrheit weiß ich das absolut nicht. Alles, was ich sehe, alles, was ich höre, alles, was ich aus der Ferne nicht sehen kann, bildet in meinem Kopf eine verworrene Masse, die ich vielleicht nie die Zeit oder die Fähigkeit haben werde, zu entwirren. Es wäre eine ungeheure Arbeit, ein Tableau einer so riesigen und unhomogenen Gesellschaft wie dieser darzustellen.« Er war skeptisch, ob man ein solches Buch in so kurzer Zeit wirklich schreiben könne: »Es wäre absurd, ein ganzes Volk beurteilen zu wollen, nachdem man eine Woche oder zehn Tage unter ihm gelebt hat. Ich kann mich daher nur auf on-dit, hearsay verlassen.«3 Und er deutet an, was er vielleicht zustande bringen könnte: »Zu versuchen, alles abzudecken, wäre verrückt. Ich kann keine vollständige Genauigkeit anstreben, dazu habe ich noch nicht genug gesehen, aber ich glaube, ich weiß schon viel mehr über dieses Land, als wir in Frankreich je erfahren haben, und einige Teile des Bildes könnten von großem Interesse sein, gerade in diesem Augenblick.«4
Sogar nach dem Erscheinen des ersten Bandes 1835 und dem großen Erfolg glaubte er, Leser vor seinem Buch warnen zu müssen. Tocquevilles Zurückhaltung und Vorsicht stehen in einem krassen Gegensatz zur manchmal fast apodiktischen Weise des knappen summarischen Urteilens, wie es im ersten Satz der »Demokratie in Amerika« anklingt: »Keine Neuheit in den Vereinigten Staaten hat mich während meines Aufenthalts dort mehr beeindruckt als die Gleichheit der Bedingungen. Es war leicht, den immensen Einfluss dieser grundlegenden Tatsache auf den gesamten Verlauf der Gesellschaft zu erkennen. Sie gibt der öffentlichen Meinung eine besondere Wendung und den Gesetzen eine besondere Wendung, den Regierenden neue Maximen und den Regierten besondere Gewohnheiten.«5 Man hat hier das Produkt, die Summe, ein Fazit vor sich, ein Destillat, fast in eine Formel gegossen, der die dahinterstehende disparate Erfahrung nicht mehr anzusehen ist, jene Reduktion, die nicht zuletzt den anhaltenden Erfolg des Buches mitbewirkt haben dürfte. Ein Grund dafür ist gewiss, dass er von Anfang an nicht nur einen Reisebericht im Sinne hatte, sondern weit mehr. Er gesteht freimütig, dass er mehr suchte als nur ein exotisches Abenteuer, er suchte ein Vorbild, eine Orientierung: »In Amerika habe ich mehr gesehen als Amerika: Ich habe dort ein Bild der Demokratie selbst gesucht. Ich habe versucht, nicht anders, sondern weiter zu sehen, als es die politischen Parteien tun. Während sie mit dem nächsten Tag beschäftigt sind, wollte ich über die Zukunft nachdenken.«6 Er versteht sich sehr selbstbewusst als zweiter Entdecker: »Man könnte sogar sagen, dass Amerika ein zweites Mal entdeckt wird.«7 Er verfolgt als Zeitgenosse die Geburt einer neuen Welt, ein früher Vertreter einer »History of the Presence« — einem anderen Entdecker Amerikas, Alexander von Humboldt, nicht unähnlich, dessen Reiseroute sich drei Jahrzehnte zuvor mit der Tocquevilles überkreuzt hätte.
Doch der Summe amerikanischer Erfahrungen, ihrer Verdichtung in Tocquevilles Klassiker, gehen die Exploration, die Erkundung, das Navigieren in einem weithin unbekannten Gelände voraus. Um diesem Prozess der Entstehung, der im Resultat getilgt ist, auf die Spur zu kommen, muss man sich anderen Texten, anderen Genres zuwenden, zurückgehen zur Werkstatt, in der das große Buch Gestalt annahm, zu jenen Texten, die Aufschluss geben über den Prozess der Erkundung selbst. Diese Quellen gibt es, und sie bilden den Ausgangspunkt dieser Untersuchung Amerikas. Es handelt sich um Reisebeobachtungen, Aufzeichnungen in Notizbüchern, Briefe, Tagebücher, Erinnerungen, Gesprächsprotokolle, auch Zeichnungen. Heute können Interessierte Reisen buchen auf den Spuren Tocquevilles — und seines Begleiters Gustave de Beaumont.8 Die überlieferten Materialien sind der Rohstoff für das »große Buch«, sie können heute als Logbücher fungieren, um dabei zu sein bei der Neuvermessung Amerikas durch die beiden Franzosen. Wir begegnen dabei leidenschaftlich interessierten, buchstäblich: neugierigen Reisenden, für die »study and society« — Forschen und Teilnahme am gesellschaftlichen Leben — zur Alltagsroutine geworden waren, die ein ungeheuer dichtes Programm abarbeiteten und sich zugleich die Freiheit bewahrten, lang gefasste Pläne umzustoßen, von vorgesehenen Routen abzuweichen und mitunter lebensgefährliche Situationen — einschließlich Schiffbruch auf dem Ohio oder schwere Erkrankungen — durchzustehen. »Ich habe eine glühende und unstillbare Neugier, die mich ständig von meinem Weg nach rechts oder links abbringt.«9
Alexis de Tocqueville (1805—1859), anonyme Zeichnung ca. 1850.
Die beiden Reisenden entstammten der französischen Aristokratie, Alexis Tocqueville (1805—1859) sogar einem Geschlecht, das sich auf die Zeit der Eroberung Englands durch William the Conqueror zurückverfolgen ließ, seine Vorfahren hatten für Voltaire und Rousseau gestritten und waren der Guillotine zum Opfer gefallen. Als Kind hatte er den Einzug Napoleons nach der Schlacht von Waterloo erlebt, erhielt eine ausgezeichnete Erziehung und wurde nach einem Studium an der Sorbonne Untersuchungsrichter in Versailles, wo er auf seinen zukünftigen Reisebegleiter, den ebenfalls aus der Aristokratie kommenden Prokurator des Versailler Gerichts Gustave de Beaumont (1802—1866), traf.
Gustave de Beaumont (1802—1866), Porträt aus dem Jahr 1848.
Zusammen reisten sie im Auftrag der französischen Regierung im April 1831 nach Amerika, um das dortige Gefängniswesen zu studieren und Vorschläge für die Reform des französischen Systems auszuarbeiten. Nach ihrer Rückkehr im Februar 1832 machten sie politische Karrieren. Tocqueville war zunächst Abgeordneter der verfassunggebenden Nationalversammlung, als zeitweiliger Außenminister unter dem Bürgerkönig Louis-Philippe, wurde zum Augenzeugen der 1848er-Revolution und war danach kurz Außenminister, um sich nach dem Putsch Louis Napoleons aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen. 1859 starb er in Cannes. Beaumont war nach der Rückkehr aus Amerika Abgeordneter der Nationalversammlung, Botschafter in Wien, unter Louis Napoleon wurde er vorübergehend verhaftet. Er war es, der sich um die Edition des Berichts zum Gefängniswesen gekümmert hat, außerdem veröffentlichte er einen bedeutenden Roman, in dessen Zentrum das Rassen- und Sklavereiproblem in den USA steht. Auch war er Nachlassverwalter Tocquevilles. Von beiden war Beaumont der künstlerisch Begabtere: Er hielt unentwegt das Gesehene mit seinem Zeichenstift fest, und er hatte nicht vergessen, seine Flöte mit auf die Reise zu nehmen. Beide hatten nicht nur einen gemeinsamen familiären Hintergrund, sondern gemeinsame Erfahrungen — Napoleon, die Rückkehr der Bourbonen, die Julirevolution 1830 —, standen nicht nur für eine geglückte wissenschaftliche Zusammenarbeit, sondern auch für eine tiefe Freundschaft — wiederum nicht unähnlich dem Verhältnis von Alexander von Humboldt und Aimé Bonpland.
Die Untersuchung des amerikanischen Gefängniswesens war angeblich, wie Tocqueville mehrfach betont, »nur der Vorwand, um etwas Größeres zu sehen«.10 »Aber während wir das Strafvollzugssystem studieren, werden wir Amerika sehen. Während wir seine Gefängnisse besuchen, werden wir seine Einwohner, seine Städte, seine Institutionen und seine Sitten kennenlernen. Wir werden die Funktionsweise der republikanischen Regierung kennenlernen. Diese Regierung ist in Europa nicht bekannt.«11 Ein Brief an die Schwester Emilie bringt die hohen Erwartungen zum Ausdruck: »… Unser Leben ist wie eine Reihe von Bildern aus einer magischen Laterne: eine neue Welt … Wir leben, liebe Schwester, in dem ungewöhnlichsten Land der Welt.«12
Reise über die Landkarte der Neuen Welt
Sie verlassen am 2. April 1831 auf einem Segelschiff mit 180 Passagieren an Bord Le Havre und erreichen am 9. Mai Newport, von wo es am 11. Mai 1831 nach New York City weitergeht. Die Dauer der Überfahrt — in diesem Falle 38 Tage — hing von Richtung und Stärke der Winde ab. Die Rückreise erfolgt am 20. Februar 1832, Ende März sind sie wieder in Frankreich. Dazwischen liegen neun Monate äußerst dichter und anstrengender Arbeit. Sie bereisen siebzehn der damals existierenden Staaten der Union und lernen drei Regionen, die später in die Union aufgenommen werden (Michigan, Wisconsin, West Virginia), näher kennen.
Die Reiseroute von Alexis de Tocqueville und Gustave de Beaumont.
Es ist ein Reisen in der Vor-Eisenbahn-Zeit, in der Flüsse und Seen die schnellsten Verkehrsverbindungen darstellen. Trotz der großen Entfernungen sind sie in einem erstaunlichen Tempo unterwegs, dank eines Systems von Postkutschen, das sich binnen weniger Jahrzehnte außerordentlich verdichtet hatte. Hatte es 1790 noch 75 Poststationen gegeben, waren es 1815 schon 3000 und 1830 an die 8000, wobei Poststationen auch zentrale Knotenpunkte von Kommunikation, Information und Handel in dem rapide wachsenden Netzwerk neuer Städte waren. Der Übergang vom Segelschiff auf das Dampfschiff, der Bau von Kanälen — hier besonders der Eriesee-Kanal, der die Verbindung zwischen Neuengland und dem Gebiet der Großen Seen herstellt —, die Einrichtung fester Schiffsverbindungen auf Ohio und Mississippi oder auf dem Hudson zwischen New York und Buffalo erklären das außerordentliche Tempo, mit dem sich Tocqueville und Beaumont in dem für europäische Verhältnisse riesigen Land fortbewegen konnten; dazu gehört auch der Komfort von Herbergen und Pensionen, die Voraussetzung für das konzentrierte Sammeln und Arbeiten unterwegs waren. Man bedenke, dass die Reise per Dampfschiff von Buffalo nach Detroit auf der »Ohio« nur vier Tage dauerte!13
Mit Hilfe der Reiseunterlagen lassen sich Arbeitsweise und Arbeitsstil dieser »Research Machine« — so Tocqueville14 — ganz gut rekonstruieren: Es ging um die Beschaffung von Dokumenten, Grundlagen- und Gesetzestexten; die Besuche in den einzelnen Orten mussten vorbereitet und detaillierte Fragebögen Auskunftspersonen geschickt werden; Dutzende Interviews mit den wichtigsten Gesprächspartnern mussten protokolliert und ausgewertet werden — »Wort für Wort«, wie Tocqueville seiner Mutter schreibt.15 Beobachtungen werden in Notizbüchern festgehalten, Statistiken und Daten zusammengetragen. Sie machen sich mit der Landessprache vertraut und tauchen in das gesellschaftliche Leben der Städte ein. Ihnen kommt die große Aufmerksamkeit zugute, die ihnen als prominenten Besuchern aus Frankreich zuteilwird. Sie treffen auf kompetente und großzügige Gesprächspartner und vieles, was sich später in Tocquevilles Opus magnum an treffenden Formulierungen findet, stammt aus den Konversationen in den Salons von Boston, Philadelphia oder aus den Interviews mit Leitern von Gefängnissen, Schulen oder Kirchengemeinden. In mancher Gesellschaft fühlen sie sich wie zu Hause. Sie treffen Albert Gallatin, der, aus der Schweiz kommend, perfekt Französisch sprach, unter Jefferson und Madison Secretary of State war; sie sprechen ausführlich mit dem Leiter des Auburn-Gefängnisses; sie lernen Charles Carroll, den reichen Sklavenhalter und letzten noch lebenden Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung, kennen16 und sogar Andrew Jackson, den siebten Präsidenten der Vereinigten Staaten in Washington. Die Korrespondenz über den Atlantik bricht niemals ab, sie halten sich auf dem Laufenden über die politischen Entwicklungen in Europa und die familiären Beziehungen. Kurzum: Diese Art von Material führt in die chaotische Fülle von Beobachtungen und Eindrücken vor aller Systematisierung und Stilisierung, allen Modellen oder Idealtypen.
Eine Besonderheit des überlieferten Amerika-Materials sind die Zeichnungen, die Gustave Beaumont mit ebenso stupender Regelmäßigkeit wie leichter Eleganz angefertigt hat. Es ist ein großartiges Zeichenwerk und nichts weniger als das, was man heute eine Fotostrecke nennt. Es ist praktisch die zeichnerische und fast fotografisch genaue Dokumentation der Reise mit Landschaften, Stadtsilhouetten, Kirchtürmen, Hafenanlagen, Ansichten von Privathäusern, aber auch Naturbildern — wie etwa denen von der »watery hell« der Niagarafälle.17 Beaumont hielt die Stelle auf dem Ohio fest, wo ihr Dampfer in den Fluten versank18, er liefert die Illustration für die Entwicklung der Blockhaustypen und hält sogar die Szenen der grausamen Zwangsumsiedlung der Choctaws, eine frühe Form der »ethnischen Säuberung«, aus ihren ursprünglichen Stammesgebieten in Gebiete westlich des Mississippi fest.19
Die Karte der Reiserouten gibt einen Überblick über den von Tocqueville und Beaumont erkundeten Raum: Newport — New York City — Albany — Auburn — Buffalo — Detroit — Saginaw — Green Bay — Detroit — Buffalo — Niagara Falls — Montreal — Quebec — Boston — New York City — Philadelphia — Pittsburgh — Cincinnati — Nashville — Memphis — New Orleans — Montgomery — Norfolk — Washingon, D. C. — Baltimore — New York City.
Die dabei berührten Orte sind nicht zufällig und schon gar nicht exotisch-touristischer Natur, sondern verweisen auf die großen Themen, die mit diesen Orten verbunden sind.
Welche sind die großen Themen entlang ihrer Route?
Das ist erstens der Auftrag, der sie überhaupt nach Amerika führte: das Studium des amerikanischen Strafsystems, also: die Gefängnisse von Sing Sing, Auburn und Philadelphia.
Die Besichtigung des alten Frankreich im britisch gewordenen Kanada. Kontaktaufnahme mit einer wohlvertrauten Welt, also: Montreal, Québec, Sault Ste. Marie.
Die Spur zu den »letzten Mohikanern« Fenimore Coopers, also: Saginaw in Michigan.
Die Erfahrung der Frontier und der Zivilisation auf vorgeschobenem Posten, also: Ohio.
Der Süden, die Sklaverei und die Rassenfrage, also: Kentucky, Alabama, New Orleans.
Die Gesellschaftsbildung in den Städten, also: die Städte Neuenglands, Boston, Philadelphia, New York.
Der Auftrag: Erforschung des Gefängniswesens. Die Verbesserung der Menschen
Tocqueville und Beaumont sollten prüfen, welche Verbesserungen des Gefängniswesens aus Amerika für Frankreich mit seinen überalterten Institutionen der Einschließung, Ausgrenzung, Bestrafung und Umerziehung übernommen werden könnten. Beide haben diesen Auftrag nur als Vorwand bezeichnet, um die Amerika-Reise unternehmen zu können. Dies trifft gewiss zu, aber nur zum Teil. Denn ihre Route war zunächst wesentlich bestimmt von ihrer Aufgabe und sie sammelten an diesen Stationen auch ihre ersten Erfahrungen. »Wir werden sicherlich die führenden Strafvollzugsexperten der Welt sein«, kommentieren sie ihre Mission ironisch.20 Amerika ging neue Wege in der Bekämpfung von Kriminalität, was im Zuge der Auflösung der alten Gesellschaft, der chaotischen Prozesse der Einwanderung und der beginnenden Industrialisierung eine neue Dringlichkeit erreicht hatte. Wie sollte die neue Gesellschaft fertigwerden mit den Folgen all dieser Prozesse, wie die soziale Frage auffangen, der Kriminalität Herr werden, wie die »Resozialisierung«, die Wiedereingliederung in die Gesellschaft betreiben? Hier gab es verschiedene Konzepte vor dem Hintergrund eines Straf- und Gefängnisdiskurses, der auf die Disziplinierung, aber auch auf die moralische Verbesserung des Menschen und seinen künftigen Nutzen für die Gesellschaft abzielte. Hier gab es die Konzepte der Strafanstalten von Sing Sing bei New York City, Auburn in der Nähe von Albany und der neuen Anlage in Philadelphia; ursprünglich vorgesehen war auch ein Besuch in Baltimore und Pittsburgh. In dieser Diskussion standen zwei Konzepte einander gegenüber: in Philadelphia das Prinzip strenger Isolation rund um die Uhr, während in Sing Sing und Auburn die Insassen nur nachts in Einzelzellen eingeschlossen waren, tagsüber aber nützlicher Arbeit nachgehen sollten. Tocqueville führte ausführliche Interviews mit den Gefängnisleitern — so mit Elam Lynds in Auburn —, verschaffte sich aber auch einen persönlichen Eindruck von den Haftbedingungen. Er war entsetzt über das System in Philadelphias Eastern State Penitentiary, das auf totaler Isolation beruhte. »Die Strafe hier ist die mildeste und zugleich die schrecklichste, die je erfunden wurde. Sie richtet sich nur an den Geist des Menschen, aber sie übt eine unglaubliche Macht über ihn aus.«21 Tocqueville und Beaumont beschäftigen sich in für sie schockierender »teilnehmender Beobachtung« zehn Tage lang mit den Verhältnissen in Sing Sing, führten ausführliche Gespräche und sahen sich in den Zellen um. Strafe und Resozialisierung waren Projekte der Aufklärung und der Moderne, verbunden mit einem gewissen Menschenbild und religiösen Vorstellungen von der Verbesserung und Rettung der Menschen, dienten aber auch der Ökonomisierung des Gefängniswesens, das sich nach Möglichkeit finanziell tragen sollte. Das Gefängnis als Mikrokosmos der bürgerlichen Gesellschaft wird später Michel Foucault formulieren, der sich auf Tocquevilles und Beaumonts Publikation zum Strafsystem beziehen sollte. Tocqueville und Beaumont entwerfen eine Landschaft der Strafanstalten, eine Ordnung des Strafens und Disziplinierens, des Umgangs mit abweichendem Verhalten und der Rehabilitierung der straffällig Gewordenen. Viele der damals fortschrittlichen Strafanstalten sind heute Touristenattraktionen — Alcatraz in der Bay von San Francisco — oder zu Brennpunkten militanter Auseinandersetzungen geworden — San Quentin in den Unruhen der 1960er Jahre —, aber sie sind bis heute auch ständig wiederkehrender Topos inneramerikanischer Selbstverständigung — was bei zwei Millionen Gefängnisinsassen naheliegend, wenn nicht zwingend ist.22
Die Besichtigung des alten Frankreich in Kanada und Louisiana
Die französische Kolonie Neufrankreich war mit dem Ende des Siebenjährigen Krieges 1763 und dem Verkauf Louisianas 1803 an die USA Geschichte geworden. Aber die Spuren dieses französischen Amerika, das sich vom St.-Lorenz-Strom über die Großen Seen den Mississippi entlang bis zum Golf von Mexiko erstreckte, waren noch allgegenwärtig — in Bauwerken, Sprache, Kultur und einem anderen Verhältnis zu den Indianern. Die beiden Reisenden ließen sich einen Abstecher in das nun britische, aber im Osten weithin französisch geprägte Kanada nicht entgehen. Kanada hatte 1831 etwa 600.000 Einwohner, davon 450.000 französischer Herkunft.23 Unverkennbar ist ein Moment des Wiedererkennens in Montreal, am St.-Lorenz-Strom, in New Orleans, die Idealisierung des Frankreich ihrer Väter. »Was wir hier gefunden haben, ist das Frankreich von vor einem Jahrhundert, das wie eine Mumie zur Erbauung der heutigen Generation aufbewahrt wird.«24 Sie spielen mit dem Gedanken, was aus einem französisch geprägten Amerika geworden wäre, und fühlen sich durch die Landschaftsbilder, die Architektur und die Kirchtürme, die Sichtbarkeit des Katholischen, die Kleidung und die Umgangsformen immer wieder an Frankreich erinnert — »wie in der Normandie« —, die Trauer um ein verspieltes Neufrankreich ist unverkennbar. Aber sie verstehen auch, weshalb die Engländer gewonnen haben und Kanada britisch geworden ist. Und doch: Unverkennbar ist ihre innere Bewegung, wenn sie von einem Indianer mit einem »Bonjour« begrüßt werden oder wenn sie die Nachkommenschaft aus französisch-indianischen Verbindungen bewundern. »Die Indianer in den Tiefen der Wildnis grüßen die Europäer mit ›Bonjour‹.«25
Die Spur zu den letzten Mohikanern Fenimore Coopers. Die Eingeborenen. Wilderness
Auf die ersten Indianer trafen Tocqueville und Beaumont im Nordosten, in Buffalo. Und sie waren schockiert. Später hatten sie von Detroit aus eine Reise nach Saginaw unternommen, die allein dem Zweck diente, das Leben der indigenen Völker näher kennenzulernen. Sie wollten unbedingt die Wildnis und die »Wilden« sehen, eine Art von »edlen Wilden«, die sie aus den Schriften von Jefferson, in den Romanen von Fenimore Cooper und von anderen kannten. Chateaubriand hatte 1791 und 1792 Nordamerika bereist und mit seinem Roman »Atala« das Bild des edlen Wilden geprägt. Sein Bruder, der während der Französischen Revolution unter der Guillotine starb, war Tocquevilles Onkel.26 Die Beobachtungen der beiden Reisenden sind in »Two Weeks in the Wilderness« niedergelegt und von Beaumont dreißig Jahre später veröffentlicht worden.27 Auch Tocqueville ist voller Bewunderung. Wie ein Ethnograph beschreibt er Kleidung, körperliche Erscheinung, Zeremonien und Rituale, die Familien- und Stammesordnungen der Indianer. Fast erkennt er in ihnen eine andere Form aristokratischen Selbstbewusstseins, das sich um die Standards der amerikanischen Zivilisation nicht kümmert, gleichgültig, ja verächtlich auf eine Gesellschaft herabblickt, die auf Privateigentum an Grund und Boden, Ackerbau und Viehzucht angewiesen ist und von der Freiheit des Jagens und des Nomadentums nichts ahnt. Aber jenseits dieser Faszination gibt es auch ein Erschrecken über die Grausamkeit der Skalpjäger und ein Entsetzen über den Zerfall des stolzen Indianertums, dessen Augenzeugen sie überall da werden, wo die Welt der Indianer auf die der weißen Siedler trifft. Dort erscheinen sie korrumpiert von Spiel und Alkohol, in lächerlich europäischer Kleidung, geblendet von dem billigen Krimskrams, den sie für ihre Pelze eingetauscht haben, von Krankheit und Brandy zerstört. Sie werden im Süden Augenzeugen des indianischen »trail of tears«, der Zwangsumsiedlung im Zuge des »indian removal« von 1830, und Tocqueville fürchtet trotz allen Mitgefühls für die indigene Bevölkerung immer wieder, dass die indianische Welt zum Untergang verurteilt sei, weil sie der Überlegenheit der weißen Rasse nichts entgegenzusetzen habe. »Die indianischen Rassen schmelzen in der Gegenwart der europäischen Zivilisation wie Schnee unter den Strahlen der Sonne.«28
Ohio oder die Erfahrung der Frontier. Zivilisation auf vorgeschobenem Posten
Die Reise über die Alleghenies nach Westen, den Ohio hinab zum Mississippi führt Tocqueville und Beaumont in das Gebiet des neuen Westens, in das Zielgebiet von Einwanderung und Landnahme, rasanter Urbarmachung der Wildnis, der Städtegründung, kurzum: der Verfertigung der amerikanischen Gesellschaft entlang der sich immer weiter nach Westen vorschiebenden Frontier. Wie Max Lerner bemerkt, war Tocqueville zur rechten Zeit gekommen: »Er kam zu einem guten Zeitpunkt für einen sozialen Beobachter. Die Jacksonianische Ära war eine der Wasserscheiden der amerikanischen Geschichte, in der sich die Tröpfchen kleiner Veränderungen zu einer starken Strömung großer Veränderungen bündeln, die das Kommende für einige Zeit bestimmen.«29 Hier konnte er den präzedenzlosen Ausbruch sozialer Energien studieren, die Ausweitung des Transportwesens, Wegebau, den Übergang zum Dampfschiffverkehr, die Gründung neuer Industrieorte.
Ohio hatte damals eine Million Einwohner, war damals »a microcosm of nineteenth-century America«30. Diese Erfahrung gehört zu den stärksten Eindrücken der beiden Amerika-Reisenden. »Dies ist eine Gesellschaft, in der es noch keine politischen, hierarchischen, sozialen oder religiösen Bindungen gibt, in der jeder auf sich allein gestellt ist, weil es ihm passt, ohne sich um seinen Nächsten zu kümmern — eine Demokratie ohne Grenzen und ohne Mäßigung.« In seinen Aufzeichnungen notiert er: »Noch weiß niemand, was so etwas wie eine Oberschicht sein könnte. Der Mischmasch ist total. Die ganze Gesellschaft ist eine Fabrik! Mehr als anderswo gibt es in Ohio keine allgemeinen Vorstellungen, die sozialen Ränge sind vermischt, und die eigentlichen Verhaltensregeln sind noch unklar. Niemand hat Zeit gehabt, sich politisch und gesellschaftlich zu positionieren; die Menschen entziehen sich allen Einflüssen. Die Demokratie ist dort grenzenlos … Im Westen kann man beobachten, dass die Demokratie ihre äußerste Grenze erreicht. In jenen Staaten, die gewissermaßen zufällig entstanden sind, sind die Bewohner erst gestern auf dem Land angekommen, das sie bewohnen. Sie kannten einander kaum, und niemand wusste etwas über die Vergangenheit seines nächsten Nachbarn. In diesem Teil des amerikanischen Kontinents entgehen die Menschen daher nicht nur dem Einfluss großer Namen und Reichtümer, sondern auch der natürlichen Aristokratie, die sich aus Weisheit und Tugend ergibt.«31 Über Cincinnati heißt es: »Der Charakter dieser Gesellschaft ist es, keinen Charakter zu haben«, und: »Da jeder in Ohio ein Neuankömmling ist, kennt man sich untereinander nicht gut. In einer solchen Instant-Gesellschaft ist niemand dem Einfluss der seit langem bestehenden Sitten unterworfen. Erinnerungen haben keinen Einfluss auf Menschen, die gestern geboren wurden. Da sie einander nicht kennen, unterliegen sie nicht dem Einfluss, den die häuslichen Tugenden normalerweise ausüben. Jeder genießt die gleichen politischen Rechte und bewegt sich in völliger Freiheit, ohne seine Interessen oder Leidenschaften zurückhalten zu müssen.«32
Er trifft hier geradezu idealtypische Pioniere, unternehmerisch, abenteuerlustig, voll neuer Ideen: »Nichts hindert ihn daran, innovativ zu sein. Alles bringt ihn dazu, innovativ zu sein. Er hat die Energie, die es braucht, um innovativ zu sein.« Aus den Einwandererströmen entsteht eine neue Gesellschaft. »Stellen Sie sich, mein Freund, eine Gesellschaft vor, die sich aus allen Nationen der Welt zusammensetzt — Engländer, Franzosen, Deutsche … Alle diese Völker haben unterschiedliche Sprachen, Überzeugungen und Meinungen. Mit einem Wort, ist eine Gesellschaft ohne Wurzeln, Erinnerungen, Vorurteile, Routinen, gemeinsame Ideen oder einen nationalen Charakter und dennoch hundertmal glücklicher als unsere eigene tugendhafter? Ich bezweifle es. Das ist also die Ausgangslage: Was verbindet so unterschiedliche Elemente? Was macht aus all dem ein Volk? L’intérêt! Das ist das Geheimnis: das Interesse der Individuen, das in jedem Moment durchscheint und sich offen als soziale Theorie deklariert.«33 Anstelle der alten Aristokratie tritt nun eine unternehmerische Aristokratie, deren Status nicht durch vererbte Privilegien, sondern durch den materiellen Erfolg des Selfmademans definiert ist. Aber sie notieren auch die zerstörerischen Folgen des Vorrückens der Grenze; immer wieder beschreiben sie unberührte Landschaften, bedeckt von Baumstümpfen, so weit das Auge reicht, Urwälder in Mondlandschaften verwandelt, Lichtungen und Wüstungen, verlassen von den Siedlern, die weiter westwärts gezogen sind. Die Urbarmachung, der Fortschritt, der einer Dampfwalze gleich über das Land hinwegrollt. Es gibt Land genug, und wen es im alten atlantischen Osten nicht mehr hält, der zieht westwärts. Die Blockhäuser, die Cabins und Logs, die auf dem Weg westwärts entstehen, hat Beaumont in seinen Zeichnungen festgehalten. Irgendwann wird, so Tocqueville, auch die Hauptstadt westwärts, in die Mitte des nordamerikanischen Kontinents verlegt werden, ins Tal des Mississippi — nach Cincinnati, St. Louis oder Chicago.
Zu dieser Landschaft der Frontier gehören aber auch die Errungenschaften der Alten Welt, die dort schon angekommen sind. Pariser Chic im Vorposten Detroit, französische Waren bei den Indianern in Saginaw, dem von der American Fur Company 1815 gegründeten Handelsposten, ein Konzert mit Werken von Rossini an Deck eines Schiffes auf dem Lake Huron, Luxuskabinen auf dem Mississippi-Raddampfer, verlässliche Fahrpläne in fast unwegsamem Gelände. In der Wildnis gibt es Zeitungen, Briefpost, französische Journale, Vielsprachigkeit, nicht weniger als in den großen Städten. Beaumont: »Was halten Sie von der Tatsache, dass die Einwohner von Michigan der Pariser Mode folgen? In den kleinsten Dörfern Amerikas ist man sich der französischen Mode bewusst und glaubt, dass Paris in diesen Dingen den Ton angibt.«34 Die Frontier ist der vorzügliche Ort nicht nur der Konfrontation, der Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit, sondern auch der Vermischung, dessen, was man später als Hybridisierung bezeichnet, der Geburtsort jener Mentalität, aus der Frederick J. Turner später den amerikanischen Charakter erklären wird.
New Orleans, der Süden und die Rassenfrage
In New Orleans, der Hauptstadt der alten französischen Kolonie am Golf, dem zweitgrößten Hafen Nordamerikas, dem Sündenbabel, das die Weißen und Plantagenbesitzer anlockt, fühlen sie sich fast wieder in einer vertrauten Umgebung, wären sie dort nicht auf Schritt und Tritt konfrontiert mit dem Makel dieser so neuen Welt: der Sklaverei und der Rassentrennung. Ausführlich beschäftigen sie sich mit der doppelt-dreifachen Diskriminierung und Ausbeutung, wie sie in den Bordellen der Stadt zum Alltagsgeschäft gehört: »In New Orleans gibt es eine Klasse von Frauen, die sich dem Konkubinat verschrieben haben. Es sind farbige Frauen. Unmoral ist sozusagen ihr Beruf, und sie gehen ihm treu nach: Farbige Mädchen sind von Geburt an dazu bestimmt, die Mätressen der weißen Männer zu werden.«35 Zuweilen hat man den Eindruck, Tocqueville und Beaumont suchten in New Orleans einen Punkt jenseits der puritanischen Geschlechtermoral des Nordens, einen Ort, der seelisch-kulturellen Entspannung der Geschlechter- und Rassenspannungen, ja sogar einer Versöhnung durch Vermischung der Hautfarben und Kulturen. Zwar tritt Tocqueville kategorisch für die Abschaffung der Sklaverei und der Diskriminierung der Schwarzen ein, aber in seinem großen Werk ist dies nur ein Passus neben anderen, nicht die grundsätzliche Infragestellung einer Demokratie, die auf dem Ausschluss eines großen Teils der Bevölkerung von den Bürgerrechten basiert. »Es ist unmöglich, sich etwas vorzustellen, das der Natur und den geheimen Instinkten des menschlichen Herzens mehr widerspricht als diese Art der Unterwerfung.« Und er formuliert die Unausweichlichkeit eines kommenden Rassenkrieges. Seine Angst: »Die Bedrohung durch einen mehr oder weniger weit entfernten, aber unvermeidlichen Konflikt zwischen Schwarzen und Weißen aus dem Süden spukt in der amerikanischen Vorstellungswelt wie ein böser Traum herum.«36 Sie sehen hinter den Fassaden der weißen Villen der Plantagenbesitzer die Lebenshaltung und die Ökonomie einer zum Untergang verurteilten Feudalklasse; sie haben die Kluft zwischen dem Wohlstand im kapitalistischen Ohio und der Rückständigkeit im Kentucky der Sklavenwirtschaft mit eigenen Augen gesehen, und sie sind überzeugt, dass selbst nach Aufhebung der Sklaverei die Rassenfrage, der Unterschied der Hautfarbe und die daraus abgeleitete Segregation Amerika noch lange beschäftigen wird — einschließlich von Projekten zur Aussiedlung und Koloniegründung in Liberia oder der Gründung eines eigenen »Negerstaates« auf dem nordamerikanischen Kontinent.
Viel deutlicher und eindeutiger hat sich hier Beaumont geäußert, und zwar in seinem Roman »Marie ou l’esclavage aux États-Unis. Tableau de mœurs américaines« (1835).37 Beaumont erhielt dafür einen wichtigen Preis der Académie française. Drei Freunde — Nelson, Ludovic, George — diskutieren darin über die Liebe in Zeiten von Sklaverei und Rassendiskriminierung. »Aber wie kommt es, dass eine so aufgeklärte und religiöse Nation wie die amerikanische nicht mit Entsetzen vor einer Verfassung zurückschreckt, die gegen die Gesetze der Natur, der Moral und der Menschlichkeit verstößt? Sind nicht alle Menschen gleich geschaffen?«38 Nelson versucht Ludovic zu überzeugen, dass er niemals seine Liebe, Marie, wird heiraten können, da sie wegen ihrer zum Teil schwarzen Vorfahren bloße Ware, Eigentum und Arbeitsinstrument ohne bürgerliche Rechte sei. Das Drama endet in einer Katastrophe, einem Pogrom. Beaumont folgt in seinem Roman der Gesetzgebung einzelner Südstaaten. Aber selbst in den Staaten, in denen die Sklaverei abgeschafft ist, ist der Schwarze nur dem Namen nach frei. »In Krankenhäusern werden die Patienten und in Gefängnissen die Insassen nach Hautfarbe getrennt. Überall erhalten Weiße Pflege und Aufmerksamkeit, die armen Negern verweigert wird.«39An manchen Stellen erscheint es dem heutigen Leser so, als hätten Tocqueville und Beaumont schon das persönliche Drama Thomas Jeffersons, großer Humanist, Staatsmann und Sklavenbesitzer in einer Person, beschrieben, der darum besorgt sein musste, dass er die zahlreichen Kinder, die er mit seiner Geliebten und faktischen Ehefrau gezeugt hatte, irgendwann auf dem Sklavenmarkt wiederfinden könnte. Die »Colour Question«, die Stellung der Schwarzen — aber auch der Indianer —, erscheint fast als ein Geburts- und Konstruktionsfehler, der alles, wofür die Gründung der Vereinigten Staaten steht, in Frage stellt.
Civil Society, Städte, die Abwesenheit des zentralistischen Staates
Die meiste Zeit verbrachten die beiden Reisenden in den Städten. Dort wurden sie mit großer Aufmerksamkeit aufgenommen und fanden weltläufige und kundige Gesprächspartner. Sie waren beeindruckt vom Schauspiel der städtischen Gesellschaft vor Ort, nicht zuletzt von der Erscheinung und Aktivität der selbstbewussten amerikanischen Frauen. »Was jedem, der dieses Land bereist, am meisten auffällt, ob er nun über das, was er sieht, nachdenkt oder nicht, ist der Anblick einer Gesellschaft, die sich von selbst weiterentwickelt, ohne jegliche Führung oder Unterstützung, nur durch die Zusammenarbeit des individuellen Willens. Man kann die Regierung noch so sehr suchen, man findet sie nirgends, und die Wahrheit ist, dass sie in gewisser Weise gar nicht existiert.«40 Der Umgang lehrte sie den Unterschied zwischen den Yankees Neuenglands und den Plantagenbesitzern des Südens, sie hatten Gelegenheit, Vertreter fast aller Schichten, insbesondere jener neuen Mittelklasse, die den Kern der civil society bildet, kennenzulernen. Daraus zogen sie ihre Schlüsse über die nivellierende Rolle des Geldes, den Einfluss der Presse, insbesondere der lokalen. Sie lernten die Vielfalt der diversen Vereinigungen und religiösen Gemeinden kennen, aus der sich ihre Zuversicht in die Kraft der bürgerlichen Gesellschaft ableitete. Immer wieder staunten sie über die bescheidenen Repräsentationsformen und die geringe Präsenz der Staatsorgane vor Ort. Bei den Feiern zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli in Albany, der Hauptstadt des Staates New York, bemerken sie über die Regierung des Staates: »Really it doesn’t exist at all.«41 Sie suchen Sitzungen der wichtigsten Verfassungsorgane auf, über Präsident Andrew Jackson notieren sie beiläufig und respektlos: »He is not a man of genius.«42 Ihrer Ansicht nach ist Amerika weitaus christlicher als das alte Europa. »Meines Wissens hat dieses Land immer noch ein tieferes Reservoir an christlicher Religion als jedes andere Land der Welt, und ich habe keinen Zweifel daran, dass diese Mentalität weiterhin das politische Regime beeinflusst«43; aber das Religiöse kommt primär vor als Lobpreis der Leistung des Katholizismus in Nordamerika, als Lob der Arbeitsmoral, während Tocqueville eher verständnislos, wenn nicht verächtlich das geistliche Leben der Quäker kommentiert. »Ich floh, angewidert und von Schrecken gepackt. ›Autor und Bewahrer aller Dinge‹ sagte ich zu mir selbst, ›ist es möglich, dass du dich in dem abscheulichen Bild, das diese Kreaturen hier malen, wiedererkennst?‹«44 Die sogenannte »zweite Erweckungsbewegung«, die seit Beginn des 19. Jahrhunderts das geistig-moralische Leben der Union durchzieht, scheint Tocqueville nicht sonderlich beeindruckt zu haben.
Es ist letztlich der Blick auf die offene, wenn nicht verwirrende Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Ansichten und Interessen, aus dem sich Tocquevilles Betonung der Bedeutung der »mœurs«, der Sitten, Haltungen, praktischen Einstellungen, für die Stabilität von Gesellschaft herleitet. »Kaum hat man den amerikanischen Boden betreten, befindet man sich in einer Art Tumult. Von allen Seiten erhebt sich ein wirres Geschrei, und tausend Stimmen dringen an dein Ohr, die alle irgendein soziales Bedürfnis zum Ausdruck bringen. Um Sie herum ist alles in Bewegung. In einem Bezirk haben sich die Menschen versammelt, um über den Bau einer Kirche zu entscheiden; in einem anderen arbeiten sie daran, einen Abgeordneten zu wählen. Noch weiter entfernt eilen Delegierte vom Land in die Stadt, um über bestimmte lokale Verbesserungen zu beraten; in einem anderen Dorf haben die Bauern ihre Felder verlassen, um über Pläne für eine Straße oder eine Schule zu diskutieren.«45 Tocquevilles Bewunderung gilt, trotz aller Kritik an den informell-formlosen Manieren, den Staatsanwälten und Richtern, die Tabak kauen und ihre Hände nicht aus den Hosentaschen nehmen, der gelebten Verfassung und ihren Trägern: »Das wichtigste Gesetz von allen ist nicht in Marmor oder Messing eingraviert, sondern in den Herzen der Bürger (…) Es bewahrt ein Volk im Geiste seiner Gründung und setzt unmerklich die Kraft der Gewohnheit an die Stelle der Autorität. Ich spreche von Sitten und Gebräuchen und vor allem von der Meinung, einem Thema, das unseren politischen Theoretikern unbekannt ist, von dem aber der Erfolg aller anderen Gesetze abhängt.«46 Es geht zentral um die »habits of the heart«.47
Rückkehr nach Europa. Sich fügen ins Unabänderliche. Projektionen
Vier Jahre nach der Rückkehr nach Frankreich erschien der erste Band der »Demokratie in Amerika«. Er wurde — wider Erwarten — zu einem außerordentlichen Erfolg — bis heute. Tocqueville war fest überzeugt — und noch einmal bestätigt durch die Revolutionen in Europa 1848/49. Er wollte kein Loblied singen, er wollte wohl eine Lehre ziehen, ohne dass alle dem amerikanischen Beispiel folgen müssten, aber: »Ich halte es für unbezweifelbar, dass wir früher oder später genau wie die Amerikaner zur Gleichheit der gesellschaftlichen Bedingungen kommen werden.«48 Der erste Satz des Buches — »Von all dem Neuen, das während meines Aufenthaltes in den Vereinigten Staaten meine Aufmerksamkeit auf sich zog, hat mich nichts so lebhaft beeindruckt wie die Gleichheit der gesellschaftlichen Bedingungen«49 — ist das Resultat seiner in alle Richtungen ausgreifenden Erkundung, fast zu einer Formel geronnen, die nicht nur Amerika fassen soll, sondern »ein Bild der Demokratie selbst, ihres Strebens, ihres Wesens, ihrer Vorurteile, ihrer Leidenschaften«, also weit mehr als nur ein empirischer Befund, sondern: »ein echt Weberianischer Idealtyp«.50
Über die Differenz zwischen unmittelbarer Erfahrung und abstrakter Verallgemeinerung, über den Vorzug der Nähe und den Vorzug der Distanz war sich Tocqueville im Klaren, wenn er bemerkt: »Ich werde wie ein Reisender sein, der aus einer großen Stadt kommt und einen nahen Hügel erklimmt. Je weiter er sich entfernt, desto mehr verschwinden die Menschen hinter ihm aus dem Blickfeld. Ihre Behausungen verschmelzen miteinander, er kann die öffentlichen Plätze nicht mehr erkennen, er kann die Straßen kaum noch ausmachen. Aber jetzt nimmt sein Auge die Umrisse der Stadt leichter auf, und zum ersten Mal begreift er ihre Form. Es scheint mir, dass sich mir auf diese Weise die gesamte Zukunft der englischen Rasse in der Neuen Welt offenbart. Die Einzelheiten dieses gewaltigen Tableaus sind noch schemenhaft, aber mein Blick nimmt das Ganze auf, und ich bekomme eine klare Vorstellung vom Ganzen.«51
Die Rückkehr in die Werkstatt Tocquevilles und Beaumonts erlaubt es, noch einmal einen Schritt zurückzutreten von der Systematisierung und die Komplexität und Vielstimmigkeit zu erkennen, die dem Buch zugrunde liegt. Verfasser des Buches ist selbstverständlich Tocqueville, doch recht eigentlich ist es geschrieben von einem vielstimmigen Kollektiv, dessen Sprecher Tocqueville ist. Die Reisenotizen sind direkter, deskriptiver, nicht auf ein System bezogen, im Stadium der Sammlung, nicht der Destillierung, der Konzentration, der Endgültigkeit: ein »Kollektivwerk« (Claus Offe).52
Ein Blick in die Werkstatt Tocquevilles und Beaumonts zeigt jedoch noch etwas anderes: Beide waren von ihrer Herkunft »Menschen von gestern«, einer sozialen Schicht entstammend, die Opfer der Revolution geworden war, traumatisiert und stigmatisiert, zugleich aber tief davon überzeugt, dass die Welt, der sie sozial, kulturell, psychologisch angehörten, zum Untergang verurteilt war und dass die Zukunft einer »offenen Gesellschaft« jenseits von Standesschranken und Standesvorrechten gehören würde.
Tocqueville schickt sich, fortgerissen von der amerikanischen Erfahrung, ins Unabänderliche: den Untergang der alten feudalen Gesellschaft, der Aristokratie, er trauert ihr aber nach als den Zeugen einer höheren, verfeinerten Kultur, er begrüßt die Herausbildung einer breiten Mittelklasse, die mitreden will, die sich keinem König mehr unterwirft und selbständig entscheiden will, auf der Jagd nach Glück, pragmatisch, ohne Dogmen und Ideologien. Es ist das gespaltene Bewusstsein eines Zeitgenossen, der sich dem »Gang der Geschichte« fügt, ein Fall von »unglücklichem Bewußtsein«, wie Hegel es genannt hat, oder von Melancholie, in der sich Trauer um das Verlorene mischt mit dem Vertrauen in Kommendes. Es ist die Sehnsucht nach einer ohne mörderischen Terror vollzogenen Revolution und die Warnung vor einer Demokratie, die in Diktatur, in die Unterjochung der Minderheit durch ein Regime der Mehrheit umschlägt. Das beste Buch über Amerika, das soll wohl heißen: ein Buch, das sich dem Elan einer von keiner Tradition behinderten Gesellschaft im Aufbruch anvertraut, aber auch die Risiken minimiert, die mit der Leidenschaft der Politik, des Parteienkampfs um Macht und Einfluss verbunden sind. Tocquevilles Amerika ist damit nicht nur Abbild, sondern Projektion und Projekt zugleich.
An solchen Projektionen bestand in einem von Krisen, Revolutionen, Staatsstreichen gepeinigten Europa des 19. Jahrhunderts großer Bedarf. Es sind vor allem die Kinder und Exilanten der Französischen Revolution, die Ausschau hielten nach Alternativen. Und diese waren am ehesten auszumachen in den großen unbekannten Räumen jenseits von Europa — in Amerika und Russland. Es ist wiederum kein Zufall, dass es zwei derselben Generation und derselben sozialen Schicht angehörige Intellektuelle waren, die sich auf den Weg machten: Alexis de Tocqueville und sein Pendant — und entfernter Verwandter — Astolphe de Custine, der in die andere Richtung aufbrach: nach Russland, und über das er ein Buch verfasste, das nicht weniger Schlagzeilen machte und eine bis heute andauernde und angesichts der Geschichte Russlands im 20. Jahrhundert immer wieder neu entfachte Rezeptionsgeschichte aufweist.
De Custine war nach Russland gefahren, weil er in der russischen Monarchie den rettenden Anker für ein in revolutionären Wirren versinkendes Europa zu finden hoffte. Was in Amerika die Sklaverei des Südens war, war in Russland die Leibeigenschaft der Bauern. Desillusioniert kehrte de Custine aus dem Zarenreich nach Paris zurück, wo sich beide im Salon der Madame Récamier begegnet sind. Tocqueville schließt sein Buch unvermittelt mit der Aussicht auf eine Zukunft, die jenseits von Europa liegt und — auf je andere, radikal verschiedene Weise — den aufsteigenden Mächten USA und Russland gehören wird:
»Alle anderen Völker scheinen etwa die Grenzen erreicht zu haben, die ihnen von der Natur gezogen sind, und scheinen diese nur noch bewahren zu sollen. Rußland aber und Amerika wachsen: alle anderen sind entweder zur Ruhe gekommen oder dringen doch nur unter großen Anstrengungen vor; sie allein schreiten leicht und rasch aus in einer Bahn, deren Ziel das Auge noch nicht zu erkennen vermag.
Der Amerikaner kämpft gegen die Hindernisse, die die Natur ihm bietet; der Russe liegt im Kampf mit den Menschen. Jener ringt mit Wüste und Barbarei, dieser mit der vollbewaffneten Zivilisation: Daher erobert der Amerikaner mit dem Pflug, der Russe mit dem Schwert des Soldaten.
Sein Ziel zu erreichen, baut der Amerikaner auf das private Interesse und läßt die Kraft und die Vernunft des Einzelnen wirken, ohne sie zu dirigieren.
Der Russe drängt gewissermaßen die ganze Macht der Gesellschaft in einen Menschen zusammen.
Freiheit ist dem einen der Antrieb, Knechtschaft dem anderen. Ihr Ausgangspunkt ist verschieden, verschieden ist ihr Weg; und doch, nach einem geheimen Plan der Vorsehung scheint jeder von ihnen berufen, dereinst die Geschicke der halben Erde zu lenken.«53
Tocqueville hatte — wie fast alle Amerika-Besucher vor und nach ihm — mehrfach geäußert, dass er noch einmal nach Amerika fahren wolle. Es waren gewiss nicht seine Anteile, die er bei der Michigan Central Railway hielt54, die ihn dazu bewogen, sondern sein leidenschaftliches Interesse am Fortgang der Geschichte, die er sich zu erklären versucht hatte. Es war ihm nicht vergönnt, er starb am 16. April 1859 in Cannes — im selben Jahr, in dem auch Alexander von Humboldt starb, Charles Darwins »Entstehung der Arten« erschien und Karl Marx seine »Kritik der politischen Ökonomie« veröffentlichte.
Man könnte hier die Amerika-Reise mit Tocqueville und Beaumont abschließen, wäre da nicht eine Korrespondenz, die nicht erst durch die Rezeption und die Nachwelt konstruiert werden musste, sondern bereits den Zeitgenossen bewusst war. Die Rede ist von Marquis Astolphe de Custines1843 erschienenem vierbändigem Werk »La Russie en 1839«.
Die Parallelaktion: Custines »La Russie en 1839«
»La Russie en 1839« war gleich nach seinem Erscheinen ein großer Erfolg, erlebte viele Auflagen und wurde rasch in viele Sprachen übersetzt, allerdings nicht ins Russische. In Russland wurde es von Alexander Herzen, einem der wichtigsten Köpfe der demokratischen Intelligenzija, als »das beste von einem Ausländer über Russland« geschriebene Buch gerühmt, es zirkulierte über russische Kreise im Ausland — meist in Frankreich lebende Aristokraten — auch im Reich selbst, eine allgemein zugängliche Übersetzung konnte aber erst nach dem Ende der Sowjetunion erscheinen. Seine eigentliche Karriere fällt ins 20. Jahrhundert, wo das Buch als ahnungsvolle und fast prophetische Vorwegnahme von Despotie und totalitärer Herrschaft gelesen wurde. Kein Geringerer als George F. Kennan, langjähriger Diplomat mit Moskau-Erfahrung und Erfinder der Containment-Politik, hat dem Werk eine eigene Studie gewidmet.55
Astolphe de Custine (1790—1857).
Wie bei Tocqueville erklärt sich die immer wieder neu entfachte Diskussion über das Buch des Marquis damit, dass es offensichtlich wesentliche Züge der russischen Welt erfasst hat. Man hat gegen de Custines Russland-Buch eingewandt, dass er Sprache und Kultur des Landes nicht kannte, dass sein Aufenthalt von nur drei Monaten — Juni bis September 1839 — für ein tiefergehendes Verständnis nicht ausreichen konnte. Tatsächlich unterscheidet sich die Arbeitsweise de Custines grundlegend von der Tocquevilles, der Mengen von Dokumenten gesammelt und ausgewertet, gezielt Gesprächspartner gesucht und befragt und das Material nach bestimmten Gesichtspunkten systematisiert hatte. De Custine charakterisiert im Unterschied dazu seine Arbeitsweise wie folgt: »Ich betrachte ein mir neues Land ohne andere vorgefaßte Meinungen als die, welche Niemand von sich abwehren kann … Ich betrachte die Gegenstände, beobachte die Thatsachen und die Personen und gestatte der täglichen Erfahrung, meine Meinungen zu modifizieren (…) Man kann mir vielleicht Vorurtheile zur Last legen, gewiß aber nicht den Vorwurf machen, dass ich die Wahrheit wissentlich entstelle. Ich beschreibe, was ich gesehen habe, an Ort und Stelle, und erzähle, was ich hörte, noch den Abend desselben Tages.«56 Ebenso bestimmt wie bescheiden beschreibt er, nicht von möglichen »Unrichtigkeiten« frei zu sein, aber doch das Beste versucht zu haben, dem, was er erlebt und gesehen hat, gerecht zu werden. De Custine kann an eine bewährte und erfolgreiche Schreibpraxis anknüpfen, wie seine Reisebücher zu Spanien und Italien, die vor der Russland-Reise erschienen waren, beweisen.
Nicht nur der Erfolg dieser Bücher ermutigte ihn, sich auf ein völlig neues Terrain zu begeben, sich Beschreibung und Urteilsbildung zuzutrauen. Russland war in jenen Jahren ein großes Thema, unerforscht, rätselhaft, aber durch den Sieg über Napoleon, die Kosaken, die ihre Biwaks auf den Champs Élysées aufgeschlagen hatten, auch einem größeren Publikum nahegerückt. »Russland ist in unseren Tagen für den Beobachter das merkwürdigste Land, weil man in ihm die tiefste Barbarei neben der höchsten Civilisation findet.«57 Custine folgte diesem Interesse, das sich mit der Begeisterung für den Aufstand der polnischen Freiheitskämpfer im Jahre 1830 verband und mit der Sympathie für die polnischen Exilanten, die sich in Paris niedergelassen hatten. Das Thema Russland lag also in der Luft. Frankreich war erschüttert von den tiefgreifenden Folgen der Revolution und der napoleonischen Kriege und war mit der Julirevolution 1830 in eine neue Phase revolutionärer Unruhen eingetreten. Frankreich suchte nach einer Antwort, nach einem Ausweg aus der Staats- und Gesellschaftskrise. Hier spielten die Angehörigen der alten, von der Revolution besonders getroffenen Elite eine herausragende Rolle. Tocqueville wie Custine, alten Familien der Aristokratie entstammend und entfernt miteinander verwandt, waren vom Terror der Revolution unmittelbar getroffen und traumatisiert — de Custine hatte die Verhaftung und Hinrichtung seines Großvaters und anderer Angehöriger der Familie mit ansehen müssen —, beide machten sich keine Illusionen über das Ende des Ancien Régime und waren umgetrieben von der Frage, wie ein erneuertes nachrevolutionäres Frankreich aussehen sollte. Tocqueville suchte eine Antwort in Amerika, Custine machte sich nach Russland auf den Weg, in der Hoffnung, eine Ordnung vorzufinden, die die Exzesse der Französischen Revolution würde vermeiden können. Zwei Suchbewegungen, zwei Fluchtrichtungen, gespeist aus den traumatischen Erfahrungen der in der Revolution untergegangenen herrschenden Klasse, die um die Schwächen des alten Regimes wusste und Wege jenseits der Restauration suchte. Im Falle de Custines war das Ergebnis blanke Enttäuschung. »Ich ging nach Russland, um Gründe gegen die repräsentative Regierung zu suchen, und komme als Anhänger der Constitutionen zurück.«58
Der Zusammenhang zwischen Tocquevilles Amerika-Buch und Custines