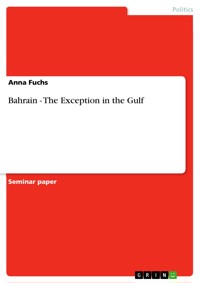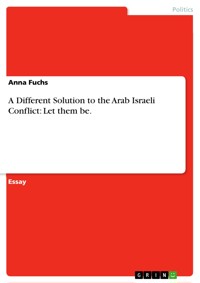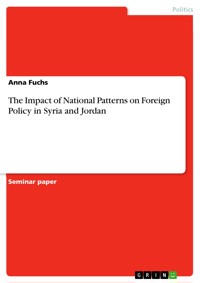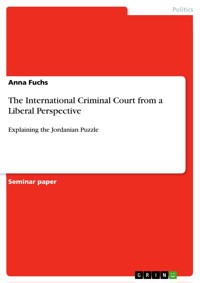9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Kommunikationspsychologie für eine kulturübergreifende Verständigung Was ist Kultur und wie beeinflusst sie unser Denken und Handeln? In einer zunehmend vernetzten Welt sind diese Fragen von großer Bedeutung. Transkulturelle Herausforderungen meistern bietet praxisnahe Einblicke in die Dynamiken interkultureller Begegnungen. Anna Fuchs erklärt anschaulich, wie sich Weltbilder, Kommunikationsstile und Konfliktverhalten unterscheiden und welche zwischenmenschlichen Herausforderungen daraus entstehen können. Mithilfe bewährter Methoden und Modelle aus der Kommunikationspsychologie zeigt die Autorin, wie wir kulturelle Unterschiede erkennen, verstehen und wertschätzen können. Ob im Auslandsstudium, bei der Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund oder im internationalen Business – dieses Buch ist ein wertvoller Ratgeber für alle, die ihre transkulturelle Kompetenz stärken und interkulturelle Begegnungen souverän meistern möchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Anna Fuchs
Transkulturelle Herausforderungen meistern
Missverständnisse klären und Kompetenzen stärken
Über dieses Buch
Angewandte Kommunikationspsychologie nach Schulz von Thun: Praxisnah und übersichtlich erklärt Anna Fuchs, was passiert, wenn Menschen unterschiedlicher Herkunft aufeinandertreffen: Weltbild, Kommunikationsstil und Konfliktverhalten unterscheiden sich. Konflikte und Missverständnisse scheinen da unausweichlich. Wie also kann ich schwierige transkulturelle Situationen souverän meistern? Und welche Methoden und Modelle bietet mir der kommunikationspsychologische Werkzeugkoffer dafür? Fragen, die angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen von großer Relevanz sind und die dieses Buch beantwortet.
Vita
Anna Fuchs ist Diplom-Psychologin, langjährige Trainerin am Schulz von Thun Institut für Kommunikation, Projektleiterin des Certificate of Advanced Studies: Angewandte Kommunikationspsychologie nach Schulz von Thun in Luzern und Dozentin für Interkulturelle Kommunikation und Führung an der EAE Business School, Barcelona. Sowohl ihr Berufsalltag als Dozentin, Trainerin und Coach als auch ihr Privatleben – gemeinsam mit ihrem argentinischen Partner lebt sie seit 2001 in Barcelona, wo ihre beiden Kinder dreisprachig aufwachsen – bieten ihr eine Fundgrube an Beispielen für interkulturelle Situationen, Missverständnisse und Konflikte.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Lektorat Ana González y Fandiño
Abbildungen im Innenteil Anna Fuchs
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
ISBN 978-3-644-00337-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Vorwort
Einführung
Wie dieses Buch zu lesen ist
Statische Eisberge oder lebendige Flusslandschaften?
1. Was ist Kultur? Eine Annäherung
2. Wie kommuniziere ich? Das Kommunikationsquadrat
3. Wer bin ich? Das Innere-Team-Modell
Teil I Wie kulturelle Identität entsteht
1. Das Innere Team und Multikollektivität
2. Unsere Umwelt und die Ausprägung des Inneren Teams
3. Wie Kultur unsere Wahrnehmung prägt
4. Wie unser Denken funktioniert – ein Überblick
5. Exkurs: Wenn Kulturwechsel zum Schockerlebnis werden
6. Politisch korrekt – unser Denken ist es nicht und wir sind es erst recht nicht!
7. Third Culture Kids und Cross Culture Kids – zu Hause an mehreren Orten
8. Keine transkulturelle Kompetenz ohne innere Beweglichkeit – von weltgewandten Menschen und Persönlichkeits-Schwerstarbeit
Fazit Teil I
Teil II Wie Kulturen sich unterscheiden und welche Dynamiken zwischen ihren Mitgliedern wirken
1. Werte sind die Grundlage unseres Verhaltens
2. Das Werte- und Entwicklungsquadrat – Perspektivwechsel und Ergänzungspotenzial
3. Stimmigkeit als Kommunikationsideal
4. Kommunikation – und wie Kultur sie beeinflusst
5. Das Riemann-Thomann-Modell – von Himmelsrichtungen der Seele und Kulturfeldern
6. Kulturdimensionen – von der Kunst, Kulturen zu vergleichen
7. Kulturdimensionen und das Innere Team – Welche Stammspieler melden sich zu Wort?
8. Der Teufelskreis – zirkuläre Konfliktdynamiken
9.Fazit Teil II
Teil III Wie die transkulturelle Perspektive unser (globales) Zusammenleben verbessern kann
1. Ich – Auf die Haltung kommt es an
2. Du – I see you!
3. Wir – die Entwicklung einer globalen Identität
Zum Schluss
Anhang
Methodenkoffer – ein Überblick
Literatur
Internetquellen
Dank
Vorwort
Friedemann Schulz von Thun
Nehmen wir einmal an, Sie gehören einer Kultur an, in der es als extrem unhöflich gilt, das Angebot einer Gastgeberin abzulehnen. Und nehmen wir weiter an, Sie haben jemanden aus einem anderen Kulturkreis zu Gast, in dem die Höflichkeit es wiederum gebietet, ein Angebot nicht gleich anzunehmen, sondern erst wenn es ein zweites und drittes Mal bekräftigt wird. Sie können sich bestimmt ausmalen, was passiert. Eine Verstimmung auf beiden Seiten ist programmiert, und weil Menschen sich ihrer kulturellen Werte und Verhaltensnormen oftmals kaum bewusst sind, kann sie metakommunikatorisch nicht ohne Weiteres aufgelöst werden. Solche Verstimmungen können Beziehungen schnell vergiften oder gleich im Keime ersticken. Hier ist interkulturelle Kompetenz gefragt, die (auch) in diesem konkreten Fall darin bestehen würde, sich erstens in den Gepflogenheiten des Gastlandes gut auszukennen und sich zweitens die Normen der eigenen Kultur bewusst zu machen, die einem als implizite Selbstverständlichkeiten in Fleisch und Blut übergegangen sind.
Diesen interkulturellen Ansatz haben wir 2006 in unserem Buch «Interkulturelle Kommunikation» (Kumbier und Schulz von Thun, Hrsg.) mit den Modellen der Hamburger Kommunikationspsychologie verfolgt. Dieser Sammelband hat sich mittlerweile erfreulich zu einem Standardwerk entwickelt.
Anna Fuchs würdigt diesen Ansatz, greift ihn ihrerseits auf und systematisiert die Beiträge unserer Modelle. Inzwischen sind aber auch Gefahren und Fallstricke deutlicher geworden, die sich aus diesem Ansatz ergeben können (Stichwort «Kulturalismus») – und vor allem scheint die Zeit reif zu sein, um genauer zu erkennen, wie viel kulturelle Vielfalt in jeder und jedem Einzelnen von uns steckt, wie viel fundamentale Gemeinsamkeiten auch zwischen den Kulturen bestehen und welche Chancen sich eröffnen, wenn kulturelle Qualitäten einander ergänzen und etwas Neues hervorbringen. Hier zeichnet sich ein transkultureller Ansatz ab, den Anna Fuchs mit viel Erfahrung und Kenntnisreichtum im dritten Teil ihres Buches entfaltet.
Erst mal wird nun alles komplexer. Zu lernen, «Die Italiener sind so, die Chinesen so, die Deutschen so …», war übersichtlich, aber leider rettungslos unterkomplex und nur allzu geeignet, neue Stereotype hervorzubringen. Doch wie gelangen wir über die interkulturelle zu einer transkulturellen Reife? Anna Fuchs ist prädestiniert, hierüber nachzudenken, und zwar nicht (nur) theoretisch, sondern im engen Kontakt mit konkreten Lebensbeispielen: sowohl aus ihrem eigenen Leben – sie lebt als Norddeutsche in Barcelona, ihr Mann ist Argentinier, ihre Kinder wachsen dreisprachig auf – als auch aufgrund ihrer Erfahrungen als Dozentin und Coach. Sie entdeckt zu meiner Freude, dass auch zur Erlangung der transkulturellen Reife die Modelle unserer Hamburger Kommunikationspsychologie entscheidend beitragen können.
Und es lohnt sich, dieses Ziel zu verfolgen! Die Probleme der Welt lassen sich nicht im urheimatlichen Kreise lösen, der Planet ist längst zur gemeinsamen Heimat geworden. Und die gelingende Koexistenz aller Menschen und Lebewesen auf Erden bekommen wir nicht geschenkt, sie ist nur als gemeinsame Errungenschaft zu denken. Klug, lebendig und zukunftsweisend, wie Anna Fuchs dieses Buch geschrieben hat, generiert es dafür eine optimistische Aufbruchsstimmung.
Friedemann Schulz von Thun, 9.9.21
Einführung
«Anna», donnerte mein argentinischer Freund los, «das erkläre ich dir doch jetzt schon zum dritten Mal!» Vor lauter Schreck über diesen Gefühlsausbruch, aber vor allem aus Empörung über diese ungerechte Behandlung traten mir die Tränen in die Augen. Wie konnte er es wagen, mich wegen einer Kleinigkeit so anzufahren? Erstaunt sah er mich an: «Was hast du denn?», fragte er ehrlich überrascht. «Ich rede doch ganz normal mit dir!» Nun war es an mir, ihn mit großen Augen anzuschauen. Konnte es sein, dass er das tatsächlich so sah?
Als angehende Psychologiestudentin war ich besonders interessiert daran zu verstehen, was wiederholt zwischen uns passierte: Wir gerieten regelmäßig in Situationen, in denen wir Konflikte und Kommunikationsverhalten ganz unterschiedlich wahrnahmen und bewerteten. Ich recherchierte – und entdeckte so mit Anfang zwanzig das Feld der Interkulturellen Kommunikation. Sofort war ich Feuer und Flamme: Mein Freund war in seiner Andersartigkeit nicht einfach verrückt, stattdessen gab es vermutlich kulturelle Ursachen für unsere unterschiedlichen Bewertungs- und Verhaltensmuster – und diese ließen sich nachlesen!
Ich lernte: In manchen Kulturen, darunter auch in der argentinischen, wurden Gefühle deutlich lebhafter kommuniziert als in Deutschland. Und dieser unterschiedlich starke Einsatz von Gestik, Mimik und Tonlage wiederum barg das Risiko für Missverständnisse. Das passierte also nicht nur meinem Freund und mir – wie beruhigend.
Plötzlich erschienen mir auch viele weitere meiner alltäglichen Beobachtungen in einem anderen Licht. Damals lebte ich bereits ungefähr die Hälfte des Jahres in Spanien, die andere Hälfte in Deutschland. Selbstverständlich waren mir kulturelle Unterschiede aufgefallen – nun konnte ich sie endlich einordnen.
Die Interkulturelle Kommunikation hat mich seither nicht mehr losgelassen: Sie begleitete mich durch mein Psychologiestudium in Hamburg und Barcelona, und sie macht auch heute noch einen großen Teil meiner Tätigkeit als Dozentin, Trainerin und Beraterin aus.
Doch je länger und tiefer ich mich mit unserem komplizierten menschlichen Miteinander beschäftigte, desto mehr Zweifel kamen mir an der interkulturellen Sichtweise. Sie erschien mir zu statisch, zu sehr auf Unterschiede fokussiert, zu vereinfachend. Interkulturelle Kommunikation wurde entwickelt, um Kulturen beschreibbar und vergleichbar zu machen: «So sind Deutsche» versus «So sind Argentinier». Aber hält diese Sichtweise nicht auch gewisse Stolperfallen bereit? Benehme ich mich nicht manchmal viel «argentinischer» als mein Partner? Ist er nicht z.B. viel strukturierter und ordnungsliebender als ich, Eigenschaften, die man tendenziell eher Deutschen nachsagen würde? Ist unsere Nationalkultur also wirklich relevanter als andere Gruppenzugehörigkeiten wie «Psychologin versus Programmierer» oder «Mann versus Frau»? Und wieso eigentlich «versus»? Warum werden Menschen unterschiedlicher Kulturen einander so gut wie immer nur gegenübergestellt?
Gibt es, neben allen Unterschieden, nicht auch diverse kulturelle Zugehörigkeiten, die mein Partner und ich teilen, z.B. als junge, weit gereiste Großstädter, ehemalige Studierende und Migranten? Habe ich als Studentin mit meiner gleichaltrigen Mitbewohnerin aus Stockholm nicht vielleicht mehr kulturelle Werte geteilt als mit vielen Deutschen, die ganz anders lebten und sozialisiert worden waren als ich? Und darüber hinaus: Beeinflussen wir uns nicht sowieso ständig gegenseitig im Kontakt und im Zusammenleben? Schließlich lernen wir voneinander und finden oft einen dritten Weg.
Ähnliche Zweifel äußerten später auch viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer meiner Trainings, die in ihrer Arbeitspraxis als Führungskräfte, in der Lehre oder im Non-Profit-Bereich auf viel komplexere Verhaltensmuster stießen als die, die sie in der Literatur fanden.
Erneut machte ich mich also auf die Suche nach Erklärungen für die vielschichtigen Tücken, die im zwischenmenschlichen Miteinander lauern, bis mich Kolleginnen und Kollegen auf das Konzept der Transkulturalität aufmerksam machten. Es begreift Kultur als Prozess und zeichnet ein viel realistischeres – aber eben auch unweigerlich komplexeres Bild – unseres Zusammenlebens. Denn komplex ist es allemal, dieses Miteinander mit seiner internationalen Geschäftswelt, der kulturellen Vielfalt und den allgegenwärtigen digitalen Medien, die Menschen weltweit vernetzen. Unweigerlich treffen hier die unterschiedlichsten Vorstellungen, Wertmaßstäbe, Strategien und vieles mehr aufeinander, die es zu erkennen, zu verstehen und – im besten Fall – zu nutzen gilt.
Wieder begann ich zu recherchieren: Der transkulturelle Diskurs auf akademischer Ebene schien mir erhellend, allerdings wurde meine innere Praktikerin immer ungeduldiger und begann frustriert zu skandieren: «Alles schön und gut! Aber wie kann ich Transkulturalität leben und lehren?» Erst war ich enttäuscht, dass ich kaum etwas zur praktischen Umsetzung finden konnte. Doch dann wurde mir klar, dass mir das passende Handwerkszeug längst zur Verfügung stand: Die Kommunikationsmodelle von Friedemann Schulz von Thun – bei dem ich studiert hatte und mit dessen Institut ich seitdem zusammenarbeite – helfen uns, menschliches Miteinander zu beleuchten, zu verstehen und zu verändern.
Die Modelle waren mir schon lange wertvolle Wegbegleiter, um kulturübergreifende Begegnungen aus interkultureller Sicht zu betrachten. Nun fiel mir auf, dass ich in der Anwendung oft bereits ganz automatisch über diese «traditionelle interkulturelle» Sicht hinausgegangen war. Denn das Menschenverständnis und die dualistische Haltung, die der Kommunikationspsychologie zugrunde liegen, weisen große Gemeinsamkeiten mit der transkulturellen Perspektive auf.
Ich war schon damals der festen Überzeugung, dass die Hamburger Kommunikationspsychologie nach Schulz von Thun den aktuellen Diskurs um einen dringend benötigten handlungsorientierten Ansatz ergänzen kann. Sie hilft zu verstehen, was passiert, wenn Menschen sich begegnen. Denn einerseits macht sie die ablaufenden komplexen innermenschlichen und zwischenmenschlichen Vorgänge beschreibbar und sprachfähig. Und andererseits ist sie durchdrungen von dem Gedanken, sowohl Herausforderungen zu meistern und Missverständnisse zu klären als auch Kompetenzen zu stärken und Synergien zu schaffen.
Inzwischen verbinde ich die interkulturelle und transkulturelle Sichtweise in meiner Arbeit – und mein Anfangsverdacht hat sich erhärtet: Die Kommunikationsmodelle eignen sich wunderbar, um Brücken zwischen verschiedenen Positionen zu schlagen, komplexe Theorien und Dynamiken nachvollziehbar abzubilden und den Kontakt zwischen Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zu verbessern.
Ein unterschiedliches Verständnis davon, wie gefühlsbetont Konflikte ausgetragen werden sollten, haben mein Freund und ich auch nach fast zwanzig Jahren Partnerschaft übrigens immer noch. Einiges scheint so tief verwurzelt zu sein, dass es nur schwer veränderbar ist; in vielem haben wir aber auch voneinander gelernt und uns aufeinander zubewegt. Wir haben unser interkulturelles Wissen erweitert und neue transkulturelle Handlungsmöglichkeiten für uns entdeckt, das heißt, wir haben vor allem viel über uns selbst gelernt. So etwas geht nicht ohne Reibung vonstatten und kann Nerven – oder ausnahmsweise auch mal Tränen – kosten; es macht aber gleichzeitig wahnsinnig viel Spaß.
Wie dieses Buch zu lesen ist
Erlauben Sie mir noch einige Anmerkungen, bevor es losgeht. Als Kommunikationspsychologin ist mir bewusst: Sprache konstruiert Realität, denn über Sprache lernen und reproduzieren wir Normen und Werte einer Gesellschaft. Daher ist es mir ein ehrliches Anliegen, mit meiner Sprache zu transportieren, dass ich von der Gleichwertigkeit aller Menschen überzeugt bin – und zwar jenseits von Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung oder Geschlecht. Eine gendergerechte Sprache kann Sprech- und Lesegewohnheiten verändern und dadurch – vor allem auf lange Sicht – zu einer Veränderung der Kultur führen. Leider macht sie Texte aber oft umständlicher und dadurch weniger gut nachvollziehbar. Weil es für dieses heiß diskutierte Dilemma leider immer noch kein Patentrezept gibt, habe ich mich für einen pragmatischen Kompromiss entschieden: Einerseits habe ich mich bemüht, durchgängig so zu formulieren, dass ich möglichst viele Menschen mit-meine. Andererseits bin ich je nach Kontext und Lesefluss davon abgewichen – in der Hoffnung, dass Sie, liebe Leser*innen, mir dann besser folgen können.
Der Aufbau des Buches folgt der chronologischen Entwicklung des Feldes: von «Intrakulturalität» (Was ist Kultur? Wie kommt sie in unseren Kopf? Was macht sie mit uns?) über «Interkulturalität» (Wie unterscheiden sich Kulturen? Welche Dynamiken wirken im zwischenmenschlichen Kontakt?) zu «Transkulturalität» (Welche Gemeinsamkeiten haben wir? Wie können wir unsere Ressourcen am besten nutzen, um Synergien zu schaffen? Was entsteht dabei Neues? Und auch: Was bedeutet Transkulturalität für unser globales Miteinander, da zwischenmenschliches miteinander Reden und gesellschaftliches miteinander Leben unmittelbar ineinandergreifen?).
Die Abgrenzung ist nicht immer messerscharf, sondern genauso wie das Forschungsfeld durchlässig und dynamisch. Als methodischer Konstante werden Sie den Hamburger Kommunikationsmodellen das gesamte Buch hindurch immer wieder begegnen. Um Ihnen die Übersicht zu erleichtern, habe ich die Anwendungsperspektiven der Modelle am Ende des Buches in Form eines «Methodenkoffers» zusammengefasst.
Sie werden im Folgenden eine Synthese aus ganz unterschiedlichen Zugängen zu Kultur finden, und zwar meine ganz persönliche Synthese. Und wie jeder Mensch unterliege auch ich einem bestimmten Weltbild. Zudem schreibe ich mit einem bestimmten Ziel: Im Mittelpunkt steht die Verbesserung der zwischenmenschlichen Kommunikation. Meine Sicht auf Kultur und Kommunikation ist demnach nur eine Sicht, die um weitere Perspektiven – beispielsweise Ihre eigene – ergänzt werden sollte.
Praxisbeispiele und Anekdoten machen Informationen lebendig, Zusammenhänge nachvollziehbar und Hintergründe verständlich. Die Fallbeispiele, die Sie durch dieses Buch begleiten werden, sind mir alle prinzipiell so in meiner Arbeit begegnet. Ich habe sie allerdings teilweise didaktisch aufbereitet und selbstverständlich anonymisiert, um keine Rückschlüsse auf Personen oder Organisationen zu ermöglichen. Dabei stand ich immer wieder vor der Herausforderung, der Vielfalt und Komplexität von Menschen und Kulturen gerecht zu werden. Beim Schreiben musste ich mich gehörig zusammenreißen, nicht nach jedem Beispiel à la «so sind die Deutschen» und «so sind die Spanier» anzumerken, dass diese Sichtweise auch stereotypisierend sein kann und solche Klassifizierungen zu einem nicht mehr zeitgemäßen Verständnis von Kultur beitragen.
Dieses Dilemma, das Ihnen gleich hier am Anfang begegnet, ist ein wunderbares Beispiel für die Koexistenz von unterschiedlichen Wahrheiten, die sich wie ein roter Faden durch das gesamte Buch ziehen wird. Denn darum geht es (mir): Brücken zu schlagen und das «dialektische Denken der Gleichzeitigkeit des Verschiedenen» zu trainieren (Pörksen, Schulz von Thun 2014), um ein Konzept anzuführen, das uns ebenfalls kontinuierlich begleiten wird. Dieser Brückenbau wird manches Mal zum Drahtseilakt geraten. So wie die Verbindung der verschiedenen Forschungsgebiete und durchaus widersprüchlichen wissenschaftlichen Perspektiven an einigen Stellen stabiler, an anderen Stellen wackeliger gelingen wird. Und dann werden sowohl ich als auch Sie, liebe Leserin, lieber Leser, mit den Widersprüchen leben müssen. Insofern können Sie das Buch als Plädoyer verstehen, Ihre Ambiguitätstoleranz zu trainieren, das heißt, weniger im «Entweder-oder» zu denken und dafür mehr im «Sowohl-als-auch».
Nach diesen einleitenden Worten lade ich Sie nun ein, den Balanceakt mit mir zu wagen: zwischen lebenspraktischer, aber kategorisierender Vereinfachung einerseits und dem Bewusstsein um menschliche Komplexität andererseits.
Statische Eisberge oder lebendige Flusslandschaften?
Unsere Sicht auf Kultur und was sie grundsätzlich prägt
Während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts tobte der Kalte Krieg zwischen den Supermächten USA und Sowjetunion sowie ihren jeweiligen Militärblöcken. Die Systemkonfrontation zwischen Kapitalismus und Kommunismus drohte zu eskalieren, die Gefahr einer bewaffneten Auseinandersetzung bestimmte weltweit die Außen- und Sicherheitspolitik.
In dieser Zeit, die geprägt war von Misstrauen, Konkurrenzkampf und Bereitschaft zur Repression, stellte der Foreign Service der USA fest, dass nur ein geringer Anteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Sprache ihres Entsendungslandes sprach. Russische Diplomaten schlugen sich, mit bis zu neunzig Prozent, deutlich besser. Es gab Handlungsbedarf. Also wurde der Anthropologe und Ethnologe Edward T. Hall beauftragt, US-amerikanischen Diplomaten beizubringen, wie kulturelle Unterschiede zu Missverständnissen und zum Misslingen ihrer Missionen beitragen konnten. Das Hauptziel war damals nicht etwa, in bunt gemischten Kulturen gut zusammenzuleben. Vielmehr sollte das Verhalten von Menschen aus unterschiedlichen Ländern für Diplomatinnen, Politiker, Militärangehörige und Geschäftsleute beschreibbar, berechenbar und kontrollierbar werden (vgl. Nguyen 2017).
Hall gilt als Begründer der Interkulturellen Kommunikation. In seinem wegweisenden Buch Beyond Culture (1976) legt er ausführlich seine bekannte Metapher dar, der zufolge Kulturen wie Eisberge sichtbare und unsichtbare Anteile in sich vereinen (vgl. Abb. 1). Sie spiegelt aber auch ein Verständnis von Kultur als homogenes, in sich abgeschlossenes Gebilde, dessen größter Teil mysteriös, unvorhersehbar und potenziell gefährlich ist.
Abb. 1: Kultur als Eisberg nach Edward T. Hall (1976)
Dabei wurden bereits mit der Entstehung von Nationalstaaten die Begriffe «Kultur» und «Nation» eng aneinandergekoppelt, und zwar ebenfalls aus dem Bedürfnis heraus, sich klar von anderen abzugrenzen. «Jede Nation hat ihren Mittelpunkt der Glückseligkeit in sich wie jede Kugel ihren Schwerpunkt!», beschreibt der Philosoph Johann Gottfried Herder dieses Phänomen (1774, S. 44f.). Wenn ich im Folgenden daran angelehnt von einem «kugeligen» Kulturverständnis spreche, dann meine ich damit ein Verständnis, nach dem – auch heute noch fast ausschließlich – Nationalkulturen klare Grenzen nach außen aufweisen und gleichzeitig homogen nach innen sind. Diverse Lehrbücher und Ratgeber bauen auf dieser Sichtweise auf. Sie stellen dann «die Spanier» «den Deutschen» gegenüber, weisen auf Konfliktpotenzial hin und geben konkrete Verhaltensempfehlungen.
Die interkulturelle Sichtweise bietet zweifellos hilfreiche Erklärungen, um Unterschiede aufzuzeigen oder, mit Hall gesprochen, um die Interaktion zweier Eisberge möglichst störungsfrei vonstattengehen zu lassen, bevor diese – voneinander unbeeinflusst und unbeeinträchtigt – ihren weiteren Weg durchs Eismeer fortsetzen. Aber sollten wir Kulturen tatsächlich als statische Gebilde verstehen, die aneinander vorbeiziehen? Die Antwort, Sie ahnen es, lautet nein.
Migration, Austausch, Durchmischung, das sind keine neuen Phänomene. Für mich als Hamburgerin spiegelt sich das in der Geschichte meiner Heimatstadt wider. Zwischen 1850 und 1939 wurde die Stadt für über 5 Millionen Menschen aus ganz Europa das Tor zur Welt. Von hier brachen sie per Schiff auf, um sich zum Beispiel in Nord- und Südamerika ein neues Leben aufzubauen – unter ihnen waren übrigens auch viele Deutsche. Allein in den USA gaben 2015 etwa 45 Millionen Menschen an, deutsche Vorfahren zu haben – damit stellen sie dort die größte ethnische Bevölkerungsgruppe dar (Plamper 2019).
Im Zuge dieser Einwanderung aus Europa wurde Buenos Aires 1905 zur ersten Millionenmetropole Lateinamerikas. Die Menschen kamen in Kontakt miteinander und hinterließen Spuren bei jenen, denen sie auf ihrem Weg begegneten. In der neuen Heimat veränderten sie sich, entwickelten neue kulturelle Praktiken und kommunizierten in mehreren Sprachen. Bis sie sich nicht nur in zwei Ländern, sondern auch auf zwei Kontinenten zu Hause fühlten und neue identitätsstiftende Kollektive für sich entdeckten. Ein Beispiel dafür sind die internationalen Arbeiterbewegungen Lateinamerikas, die vielen Europäern Anschluss, Zusammenhalt und ein Identitätsgefühl boten – auch dann noch, als sich ihre ehemaligen Landsleute in Europa gegenseitig bekriegten und töteten (vgl. Wätzold 2016).
Doch wer fortgeht, kann auch wiederkommen. Bis zu 40 Prozent der Ausgewanderten kehrten nach Europa zurück. Im Gepäck: neue Eindrücke von einer Welt, die sie nun auch den Zurückgebliebenen durch ihre Erzählungen und neuen Gewohnheiten näherbrachten – wodurch sie fast unmerklich Veränderungen anstießen. Überall, wo sich Menschen über einen längeren Zeitraum hinweg begegnen, verändern sich sowohl der Einzelne als auch die Gruppe – und langfristig auch beide Ursprungskulturen.
Wie dieses Beispiel zeigt: Kulturellen Austausch gab es schon immer. Doch noch nie waren Menschen, Informationen, Wissen und Waren so beweglich wie heute. Für viele Studierende gehören Auslandsaufenthalte zum Studium. Eine internationale Karriere anzustreben, ist für sie völlig normal. Und auch außerhalb universitärer Kontexte bewegen sich Menschen über Landesgrenzen hinweg und lassen sich zeitweise oder gar dauerhaft außerhalb ihrer ursprünglichen Heimatländer nieder. Viele von ihnen gehen bikulturelle Partnerschaften ein, manche bekommen gemeinsam Kinder. In Deutschland hat knapp jeder Vierte einen sogenannten Migrationshintergrund. Und auch meine Kinder haben einen argentinischen Vater, eine deutsche Mutter und leben in Spanien, genauer gesagt, in Katalonien. Auf welchen von Halls Eisbergen soll ich meine Familienmitglieder setzen?
Die interkulturelle Betrachtungsweise dieser Frage ist zwar nicht falsch, aber doch unvollständig. Deswegen haben sich im Laufe der Jahrzehnte verschiedene Ansätze entwickelt, um kulturelles Zusammenleben zu beschreiben, auf die ich hier kurz eingehen möchte:
«Multikulturalität» steht für die Idee weitestgehend voneinander abgegrenzter, homogener nationaler oder ethnischer Gruppen, die innerhalb einer Gesellschaft mehr oder weniger friedlich nebeneinanderher leben – wie die einzelnen Blumen eines großen, bunten Blumenstraußes. Bestehende Unterschiede werden wahrgenommen und akzeptiert. Das zeigt sich zum Beispiel auf multikulturellen Straßenfesten.
«Interkulturalität» geht einen Schritt weiter und versteht das Zusammenleben als Prozess, in dem Gruppen zwar klar voneinander abgrenzbar sind, aber interagieren, sowie sich und ihre Mitglieder vernetzen – wie bei einem Blumenbeet, in dem Blätter und Wurzelwerk ihren Lebensraum teilen. Diese Interaktion macht es notwendig, dass Mittel und Wege zur Verständigung und Akzeptanz zwischen den Kulturen gesucht und gepflegt werden.
Diese traditionellen Erklärungsmodelle bauen auf dem kugeligen Kulturverständnis auf, demzufolge Kulturen in sich abgeschlossene, homogene Systeme sind. Sie vernachlässigen, dass wir unser Selbstkonzept nicht nur auf Grundlage unserer Nationalkultur, sondern anhand diverser identitätsstiftender Gruppenzugehörigkeiten konstruieren, und das in einem lebenslangen Prozess. Weil die althergebrachten Modelle nicht ausreichen, sind in den letzten Jahren verschiedene neue Ansätze entstanden, darunter «Hyperkulturalität», «Multikollektivität» und «Diversity». Um bei der Pflanzen-Metapher zu bleiben, beschreiben sie Kultur als Lebensgemeinschaft diverser Organismen, als lebendiges und wachsendes Ökosystem mit offenen Grenzen, in denen alle Elemente Einfluss auf das Ganze haben und die Übergänge fließend sind. Auch «Transkulturalität» (lat. trans- darüber, jenseits von, hindurch, auf die andere Seite) gehört zu diesen neuen Erklärungsmodellen. Der Begriff geht auf den kubanischen Anthropologen Fernando Ortiz Fernández (1940) zurück und wurde in Deutschland Anfang der 1990er-Jahre von dem Philosophen Wolfgang Welsch (2017, 2018) in die Diskussion eingebracht. Inzwischen wird das Konzept «Transkulturalität» von verschiedenen Autorinnen und Autoren aufgenommen und weiterentwickelt.
Transkulturalität versteht Kulturen nicht als Eisberge, sondern als hochgradig verflochtene, dynamische Gebilde. Ein in der Fachliteratur beliebtes Bild ist das der Flusslandschaften, demzufolge Kulturen – wie Flüsse – von sichtbaren und unsichtbaren Quellen gespeist werden. Die Wasseroberfläche ist meist ruhig, dennoch können wir davon ausgehen, dass darunter machtvolle Unter- und Gegenströmungen aufeinandertreffen. Flüsse laufen zusammen, durchdringen sich und bilden neue Arme aus. Sie erneuern sich ständig und sind immer in Bewegung. Kritische Ereignisse können in Ausnahmesituationen dazu führen, dass ein Fluss über die Ufer tritt, sich einen neuen Weg suchen muss, gar ein neues Flussbett entsteht. Und dennoch bleibt selbst dann vieles wie gehabt: Weiterhin fließt Wasser aus unzähligen sichtbaren wie unsichtbaren Quellen, Gletschern und Regenwolken in einem einzigartigen Mischungsverhältnis durch eine Umgebung, die es prägt und verändert.
Transkulturalität geht also von einer starken Hybridisierung, also einer Durchdringung, der Einzelkulturen aus: Grenzen sind zwar vorhanden, aber durchlässig, Kulturen haben sich schon immer gegenseitig beeinflusst, und jeder Mensch wird von vielen Kulturen geprägt. Dadurch verlagert sich der Fokus von den kulturellen Unterschieden auf die Gemeinsamkeiten.
Vor Kurzem hat ein Mathematikprofessor eine Formel gefunden, mit der sich erklären lässt, warum Hipster überall auf der Welt gleich aussehen. Dass vor ein paar Jahren plötzlich Fotos von Avocado-Broten auf Instagram trendeten und ebenso unvermittelt wieder verschwanden, mag ein Beweis dafür sein, dass die Lebensformen in großstädtischen Szenevierteln weltweit kulturelle Gemeinsamkeiten aufweisen. Gleichzeitig können sich Lebensstile in ein und demselben Land drastisch unterscheiden, etwa zwischen Regionen, Stadt- und Landbevölkerung oder sogar einzelnen Stadtteilen.
Welsch geht davon aus, dass gesellschaftliche und kulturelle Identitäten sich gegenseitig durchdringen und nicht an Landesgrenzen oder Ortsschildern enden. Insofern ist es schwierig, allgemeingültige Verhaltensempfehlungen für den Umgang mit Deutschen, Argentiniern oder Chinesen zu geben. Was aber dann? Laufen wir nicht Gefahr, uns wichtiger Orientierungshilfen zu berauben, wenn wir Menschen nur noch in ihrer bunten Individualität betrachten? Ja, auch dieses Risiko gibt es! Die Kunst besteht darin, sich all dessen bewusst zu sein.
Kultur als offenes, hybrides Beziehungsgebilde oder als in sich geschlossener Eisberg: Wer sich in diesem Spannungsfeld bewegt und nicht um die Schwierigkeit des Kulturbegriffs weiß, hat es verpasst, seine Hausaufgaben zu machen. Dass der Kulturbegriff polarisiert, ist vor allem an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis zu spüren: Was ist Kultur, was fällt darunter und was nicht, ist sie in sich geschlossen und statisch oder durchlässig und dynamisch? Während in den Kulturwissenschaften eine «Transkulturelle Wende» zu beobachten ist, in deren Folge sich eine regelrechte «Homogenitätsphobie» entwickelt hat und kaum noch von Unterschieden zwischen Kulturen die Rede sein darf (weil Kulturen dann ja als homogen verstanden werden), bringt die Sachbuchlandschaft weiterhin einen «kugeligen» Kulturratgeber nach dem nächsten hervor (vgl. auch Bolten 2013). Denn natürlich spielen die jeweiligen National- und Herkunftskulturen eine Rolle, wenn Menschen sich begegnen – und zweifellos entstehen dadurch Missverständnisse, Irritationen und mitunter Konflikte. Deswegen sind auch Ländervorbereitungstrainings, in deren Rahmen sich Menschen mit ihrem neuen Heimatland auseinandersetzen, so gefragt wie nie. Und auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in meinen Kursen und Coachings bringen oft ein geschärftes Bewusstsein für kulturelle Eigenheiten mit und suchen nach weiteren Kulturinformationen, die ihnen Orientierung geben. Sie wollen Differenzen verstehen und Missverständnisse vermeiden. Ihnen hilft es wenig, wenn ich sie auf kulturelle Durchmischung und Hybridisierung hinweise.
Entsprechend werden immer mehr Stimmen laut, die für eine Sowohl-als-auch-Logik plädieren, in der je nach Bedarf zwischen den Perspektiven hin und her gewechselt wird. Der Kultur- und Kommunikationswissenschaftler Jürgen Bolten spricht von «Fuzzy Cultures» und will damit beschreiben, dass die unterschiedlichen lebensweltlichen Bereiche, denen jeder Mensch angehört, vielfältig untereinander vernetzt sind. Die Ränder dieses Netzwerks überlappen einander, sind unscharf oder fransig, also fuzzy.
Bolten plädiert daher für ein mehrwertiges Kulturverständnis und empfiehlt, je nach Kontext verschiedene Perspektiven einzunehmen und wie bei einer interaktiven Weltkarte, etwa Google Earth, je nach Bedarf heran- und herauszuzoomen (vgl. Bolten 2011, 2013a). Die Vogelperspektive lässt kulturelle Unterschiede in Sozialisation, Werten und Grundannahme erkennbar werden, wodurch sie bei der Orientierung hilft und Handlungssicherheit verschafft. Denn auch wenn viele Organisationen das nach wie vor unterschätzen, hängen auch die Erwartungen an den Führungsstil oder das Kommunikationsverhalten in beträchtlichem Maße von kulturellen Hintergründen ab.
Weil die Draufsicht uns wertvolle Einblicke ermöglicht, gerät leider allzu oft in den Hintergrund, dass sie eben kein detailliertes Bild liefert, und so ist in den letzten Jahrzehnten eine regelrechte Kulturalisierungstendenz zu beobachten: Ob Wissenschaft oder Gesellschaft – wir übertreiben den flüchtigen Blick von oben, zoomen oftmals so stark, dass wir Religion, Nationalität und ethnische Zugehörigkeit stärker gewichten als die Identität der jeweiligen Menschen mit all ihren individuellen Eigenheiten, zwischenmenschlichen Beziehungsgeflechten und sozialen Zugehörigkeiten. Dann gilt es, näher heranzuzoomen, um Unterschiede, Widersprüche, Hybridität und Mehrfachzugehörigkeiten zu erkennen.
Beide Sichtweisen haben ihre Berechtigung und unterliegen gleichzeitig der Gefahr, übertrieben zu werden. Entscheidend ist, dass wir uns erstens klarmachen, mit welchem Zoomfaktor wir gerade unterwegs sind, und dass wir zweitens je nach Situation die Perspektive wechseln. Die Lösung liegt nämlich nicht im «Entweder-oder», sondern im «Sowohl-als-auch». Deswegen wird Ihnen in diesem Buch beides begegnen: zum einen die interkulturelle Perspektive als Grundlage, um kulturelle Unterschiede zu verstehen, zum Beispiel in Form von Kulturdimensionen, also festen Kategorien, mit denen die Wissenschaft versucht, Kulturen anhand einer einheitlichen Methode zu erfassen – und zum anderen die transkulturelle Perspektive, die komplexer ist, unsere Realität aber auch realistischer abbildet und versucht, Entwicklungspotenziale zu erkennen, Synergien zu nutzen und Gemeinsamkeiten zu betrachten.
1. Was ist Kultur? Eine Annäherung
Was ist Kultur? Wenn ich diese Frage im Seminar stelle, setzen viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Sprechen an – dann werden sie nachdenklich, und meistens bleibt es im Raum still. Die Antwort scheint zwar auf der Zunge zu liegen, doch die Definition fällt erstaunlich schwer. Tatsächlich gibt es im wissenschaftlichen Kontext bisher keine allgemein anerkannte Begriffsklärung, und das Wort «Kultur» wird auf ganz unterschiedliche Art und Weise benutzt. Vielleicht hat der Soziologe Dirk Baecker (2003) recht, wenn er schlussfolgert, wer versuche, den Kulturbegriff zu definieren, zeige lediglich, dass er diesem nicht gewachsen sei. Kultur ist irgendetwas zwischen einem kollektiv entwickelten künstlichen Konstrukt – also einer Idee, die nur in unseren Köpfen existiert – und einer objektiven, ja fast körperlich spürbaren Realität – der wir bei genauerem Hinsehen tagtäglich auf die Schliche kommen können.
Vielleicht probieren wir es zur Veranschaulichung einmal mit einem Gedankenexperiment: Woran denken Sie bei dem Satz «Oh, wie schön ist Panama»? Wenn Sie die Gutenachtgeschichten-Erfahrungen mehrerer deutscher Generationen teilen, vermutlich nicht an beeindruckende Natur und weiße Sandstrände, sondern an das gleichnamige Kinderbuch von Janosch, in dem zwei kuschelige Freunde mit ihrer gestreiften Ente auf Abenteuersuche gehen. Und vielleicht steigt Ihnen auch ein ganz leichter Bananenduft in die Nase. Kultur ist natürlich viel mehr als eine Kindergeschichte – und doch haben beide vieles gemeinsam: Sie werden von Generation zu Generation weitergegeben, von klein auf internalisiert, und sie vermitteln eine bestimmte Einstellung zum Leben. Sie bringen Menschen bei, Erfahrungen, Werten und Symbolen eine Bedeutung zu geben. Zwar verändert und entwickelt sich Kultur mit der Zeit – ihre Botschaft oder die kulturellen Werte verändern sich allerdings nur sehr langsam.
Kultur wird oft als der Kitt beschrieben, der Zugehörigkeit schafft, unsere sozialen Beziehungen stärkt und Gesellschaften zusammenhält. Darüber hinaus stellt sie ein Orientierungssystem dar, das uns dabei hilft einzuordnen, wer wir sind und wofür wir stehen, und das festlegt, was im Leben erstrebenswert ist und was wir für gut oder schlecht halten. In «unseren» Kulturen können wir uns mühelos, ja fast schlafwandlerisch, bewegen: Wir wissen, zu welcher Tageszeit was gegessen werden sollte, ob Mahlzeiten im Stehen oder Sitzen eingenommen werden, auf Stühlen oder auf dem Boden, und ob wir dazu unsere Hände, Besteck oder Stäbchen benutzen. Wir wissen sogar, wann Ausnahmen üblich sind. Das heißt, wir sind uns auch der unausgesprochenen Widersprüche oder gar Konflikte bewusst. Wenn ich im Folgenden von Kulturen spreche, dann meine ich also kein trennscharf zu definierendes Konstrukt, sondern ein komplexes System von Wirkungselementen, das beeinflusst, wie wir die Welt verstehen. Ich meine damit ein geteiltes Weltbild, das wir aktiv weitergeben. Ein Identitätsgefühl, dem bestimmte Wertvorstellungen zugrunde liegen, die sich auch in der Art und Weise zeigen, wie wir uns in der Welt bewegen und sie erleben, welche Verhaltensweisen wir an den Tag legen – und wie wir mit anderen kommunizieren.
2. Wie kommuniziere ich? Das Kommunikationsquadrat
Kultur schlägt sich – auch – in der Kommunikation mit sich selbst und anderen nieder. Im Laufe dieses Buches werden Ihnen diverse Methoden und Modelle begegnen, die uns als Hilfsmittel und Verständigungsbrücken für diesen Prozess dienen. Eine vertiefende Auseinandersetzung mit der Kulturgeprägtheit von Kommunikation erwartet Sie in Teil II. Hier wenden wir uns zunächst dem Kommunikationsquadrat zu. Im Anschluss betrachten wir das Innere-Team-Modell.
Kommunikation ist mehr als nur «miteinander reden». Informationen werden simultan über Sprache, Mimik, Gestik und viele weitere Hinweisreize gesendet. Ein Sachverhalt kann verstanden oder missverstanden werden, die als angemessen bzw. selbstverständlich vorausgesetzte Art des Umgangs kann akzeptiert oder abgelehnt werden, einer bewussten oder auch unbewussten Aufforderung kann entsprochen werden oder auch nicht. Gleichzeitig zeigen wir uns ganz nebenbei als Person, das heißt, wir teilen explizit oder implizit mit, wie es uns geht. Schulz von Thun hat mit dem Kommunikationsquadrat (2013a) ein Analyseinstrument entwickelt, das uns hilft, diese Prozesse unter die Lupe zu legen und uns ihrer bewusst zu werden (vgl. Abb. 2).
Das Modell fußt auf der Grundannahme, dass jede Äußerung vier Aspekte hat, die mit den vier Seiten eines Quadrats dargestellt werden können: 1. einen Sachinhalt – Über was informiere ich?; 2. einen Appell – Was möchte ich bei meinem Gegenüber erreichen?; 3. einen oder mehrere Beziehungshinweise – Was halte ich von meinem Gegenüber und wie stehe ich zu ihm oder ihr?; sowie 4. eine Selbstkundgabe – Was zeige ich von mir?
Abb. 2: Das Kommunikationsquadrat mit seinen vier Schnäbeln, vier Ohren und vier Ebenen der Kommunikation
Weil wir immer diese vier Botschaften gleichzeitig senden, spricht die Hamburger Kommunikationspsychologie vom «Simultancharakter» der Kommunikation und geht davon aus, dass alle Menschen mit vier Schnäbeln sprechen und mit vier Ohren hören. Was allerdings nicht heißt, dass der Empfänger die vier Botschaften zwingend so verstehen muss, wie sie vom Sender gemeint waren. Das gilt für jede zwischenmenschliche Kommunikation und für interkulturelle Kommunikation oft ganz besonders. Denn auch wenn Menschen überall auf der Welt auf diesen vier Ebenen kommunizieren: Wie uns diese Schnäbel gewachsen sind, auf welchen Ohren wir besonders hellhörig sind und für welche Hinweise wir sogar taub sein können, ist eben auch kulturbedingt. Lassen Sie mich das anhand der vier Seiten des Kommunikationsquadrats verdeutlichen:
1. Der Sachinhalt informiert. Steht die Sachseite im Vordergrund, geht es um präzise, verständliche und differenzierte Informations- und Wissensvermittlung. Es zählen Zahlen, Daten und Fakten.
Wer sich hier zu Hause fühlt, versucht, andere mithilfe detaillierter Informationen und überprüfbarer Tatsachen vom eigenen Standpunkt zu überzeugen. Satzanfänge wie «Fakt ist …» oder «Die Daten zeigen …» suggerieren maximale Objektivität und objektive Wahrheit.
Eine stärkere Sozialisierung auf der Sachseite findet sich traditionell in technischen Berufen und in männerdominierten Lebensbereichen. Auch die Kommunikation der Deutschen wird von Nichtdeutschen häufig auf der Sachseite verortet. So beklagen sich viele internationale Angestellte in meinen Seminaren über die zu gut trainierten «Sach-Schnäbel» und «Sach-Ohren» ihrer deutschen Führungskräfte. So mancher Mitarbeiter würde da gerne einen Appell an seine Führungskraft äußern, das Beziehungs-Ohr und den Beziehungs-Schnabel stärker zu aktivieren.
2. Menschen kommunizieren, um etwas zu bewirken. Auf der Appellseite geht es um die Wirksamkeit. Was soll beim anderen erreicht werden? Was soll sie oder er tun bzw. unterlassen, denken, fühlen? Diese Wirkungsabsicht kann mehr oder weniger offen bzw. verdeckt kommuniziert werden. In nordeuropäischen Ländern beispielsweise wird Führungskräften oft empfohlen, klar Stellung zu beziehen, was sie von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwarten, um keinen Raum für Rätselraten zu bieten.
Manchmal ist solch eine klare Kommunikation allerdings mit Vorsicht zu genießen. Je größer die Beziehungsorientierung oder je indirekter der Kommunikationsstil in der jeweiligen Kultur, desto weniger direkt können u.a. auch Appelle geäußert werden. Eine offene Aufforderung, eine direkte Bitte oder gar einen unverblümten Wunsch zu kommunizieren, ist in vielen Kulturen undenkbar, ganz besonders, wenn es sich bei dem Adressaten um eine hierarchisch höhergestellte Person handelt. Das hat auch Vorteile: Ein lediglich indirekter Appell macht mein Gegenüber nicht zum Befehlsempfänger, der sich womöglich herumkommandiert oder gar kritisiert fühlt. Stattdessen kann er – in einem gewissem Rahmen – selbst entscheiden, ob er dem Appell Folge leisten möchte.
Wer nicht daran gewöhnt ist, auf der «Appell-Lauer» zu liegen, läuft allerdings tatsächlich Gefahr, indirekte Aufforderungen schlichtweg zu verpassen. Ein extrem aktives «Appell-Ohr» wiederum hört im interkulturellen Kontakt bisweilen vermeintliche Aufforderungen heraus, wo sie gar nicht gesendet wurden. Oder verdeckte Appelle werden zwar bemerkt, die indirekte Vermittlung jedoch als Unsicherheit ausgelegt oder gar als Manipulationsversuch verstanden, was unwillkürlich Widerstand auslöst.
3. Beim Beziehungshinweis geht es darum, was ich vom Gegenüber halte und wie ich zu ihm oder ihr stehe, also auch um Akzeptanz und Zugehörigkeit. Die Hamburger Kommunikationspsychologie unterscheidet auf der Beziehungsseite zwei Arten von Botschaften: Du-Botschaften (So bist du!) und Wir-Botschaften (So stehen wir zueinander!).
Sobald Menschen kommunizieren, schwingt auch immer mit, wie sie ihr Gegenüber sehen: «Du bist klug, nett, vertrauenswürdig … oder eben nicht.» Gleichzeitig machen sie ein Beziehungsangebot und verhandeln über eine geteilte Beziehungsdefinition: «Darf ich dich ansprechen? Dir in die Augen schauen? Dich duzen oder siezen? Dich kritisieren, um etwas bitten, dir etwas Persönliches erzählen … oder etwa nicht?»
Beziehungsbotschaften werden vor allem nonverbal über Mimik, Gestik, räumliche bzw. körperliche Nähe, aber auch paraverbal über sprachliche Intonation, Lautstärke und Betonung ausgetauscht. Schon kleine Kinder sind wahre Experten im Deuten dieser Signale. Weil der Blick der anderen so wichtig für uns Menschen ist, liegen wir ständig auf der «Beziehungs-Lauer»: «Wie spricht er eigentlich mit mir?» – «Wie kann sie es wagen, meinen Standpunkt zu kritisieren?» Im Grunde geht es um die Frage, inwieweit Menschen sich gegenseitig ernst nehmen, schätzen und auf Augenhöhe behandeln.