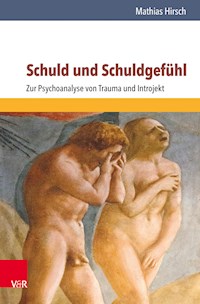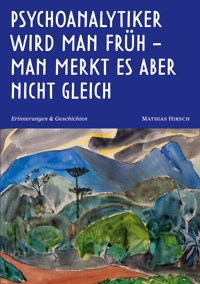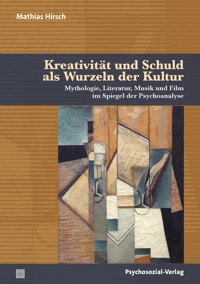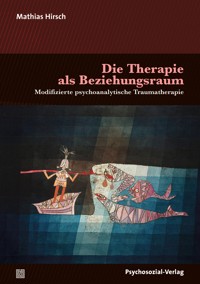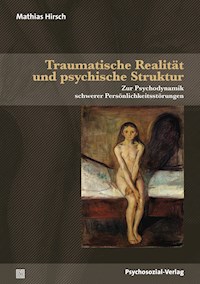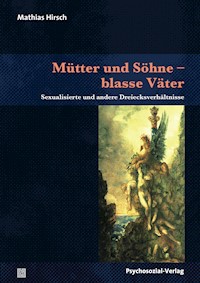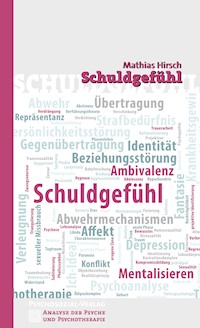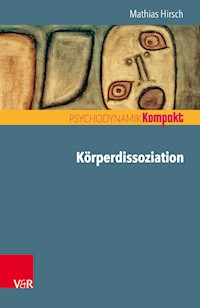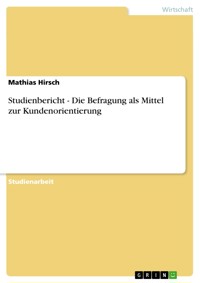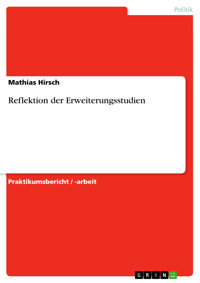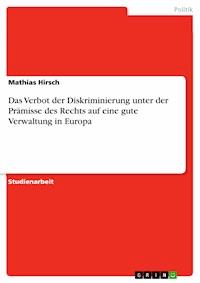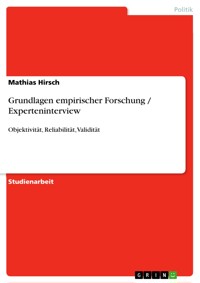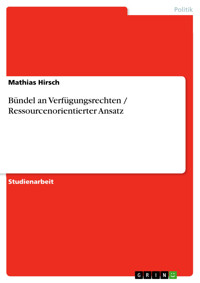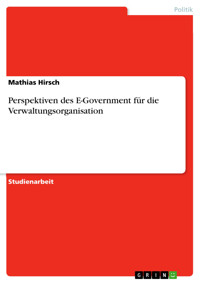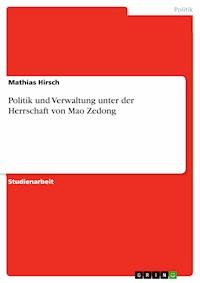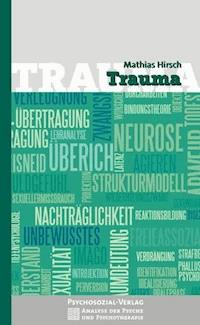
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Psychosozial-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Analyse der Psyche und Psychotherapie
- Sprache: Deutsch
Die Psychoanalyse begann als Traumatheorie, entwickelte sich zur Triebpsychologie und kann heute als Beziehungspsychologie verstanden werden, die (traumatisierende) Beziehungserfahrungen als Ursache schwerer psychischer Störungen sieht. Dabei dient die Internalisierung von Gewalterfahrungen eher der Bewältigung lang andauernder 'komplexer' Beziehungstraumata, akute Extremtraumatisierungen haben hingegen Dissoziationen zur Folge. Während eine psychoanalytische Therapie 'komplex' traumatisierter Patienten die therapeutische Beziehung ins Zentrum stellt und sich vielfältiger metaphorischer Mittel bedient, erfordern akute Extremtraumatisierungen, die zu Posttraumatic Stress Disorder führen können, ein verhaltensmodifizierendes, auch suggestives Vorgehen. Der Begriff 'Trauma' sowie der Umgang mit Traumatisierung in der Therapie werden vorgestellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mathias Hirsch
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
E-Book-Ausgabe 2012
© der Originalausgabe 2011 Psychosozial-Verlag
Walltorstr. 10, D-35390 Gießen
Fon: 06 41 - 96 99 78 - 18; Fax: 06 41 - 96 99 78 - 19
E-Mail: [email protected]
www.psychosozial-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlaggestaltung & Layout: Hanspeter Ludwig, Wetzlar
www.imaginary-world.de
Satz: Andrea Deines, Berlin
Printed in Germany
ISBN Print-Ausgabe 978-3-8379-2056-7
ISBN E-Book-PDF 978-3-8379-6510-0
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Zur Geschichte psychoanalytischer Traumakonzepte
Der frühe Freud
Das ich-psychologische Traumakonzept
Der Pionier der psychoanalytischen Psychotraumatologie:Sándor Ferenczi
Der Begriff »Trauma« in der heutigen Psychoanalyse
Akuttraumatisierung im Gegensatz zu chronisch-familiärenTraumata
Zerstörung der Symbolisierungsfähigkeit durch familiäreTraumatisierung
Transgenerationale Weitergabe traumatischer Erfahrungen
Dissoziationen
Psychoanalytische Therapie mit traumatisierten Patienten
Phasenverlauf der Therapie traumatisierter Patienten
Das Trauma in der Übertragung
Übertragung und Gegenübertragung in der Traumatherapie
Intersubjektivität
Enactment
Sexualisierung und Liebe
Aktive Psychotherapie mit traumatisierten Patienten
Benennung der Realität – der »Supervisionsaspekt« der Therapie
Schuldgefühldifferenzierung
Metaphorische Deutungen
Psychodramatisches Mitagieren
Aggression in der Gegenübertragung
Grenzen setzen
Traumatisierte Patientenin der analytischen Gruppenpsychotherapie
Die Gruppe als Container
Triangulierung und Zeugenschaft
Übertragungsspaltung
Kreuzidentifikation von Tätern und Opfern
Kombinierte Einzel- und Gruppenpsychotherapie
Schlussbemerkung
Literatur
Vorwort
Anscheinend bedarf es der Entwicklung eines gesellschaftlichen Bewusstseins, hinsehen und anerkennen zu können, dass Menschen, insbesondere Kinder in ihren Familien, durch traumatisierende Gewalterfahrungen akute und auch lang dauernde psychische Schäden davontragen. Erst 1962 »entdeckte« der Kinderarzt C. Henry Kempe und Kollegen ein neues »Krankheitsbild« mit seinen typischen Symptomen: Kindesmisshandlung (»battered child syndrome«).
Seit Mitte der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts konnte überhaupt erst (wieder) sexueller Missbrauch in der Familie gesehen, erkannt und von den Betroffenen auch berichtet werden (vgl. Hirsch 1987). Wie sehr die Augen verschlossen bleiben können und sich plötzlich aus einem nicht erkennbaren Grund öffnen, sehen wir zuletzt durch das Öffentlichmachen der massenhaften Missbrauchsfälle in katholischen und reformpädagogischen Institutionen, die bis dahin von Tätern, Mitwissern und auch von den Opfern nicht benannt werden konnten.
Die Psychoanalyse begann als Theorie der sexuellen Traumatisierung von Kindern und ihren Langzeitfolgen. In treuer Gefolgschaft haben aber die Vertreter des Mainstreams der Psychoanalyse jahrzehntelang Freuds Dogma vom Primat des ödipalen Triebkonflikts gelten lassen, und erst heute kann man aufgrund der Entwicklungen der letzten zwanzig Jahre eine Umkehr sehen (»intersubjective turn«). Gute und schlechte Erfahrungen des sich entwickelnden Kindes in Beziehungen, im Extremfall eben traumatisierende, werden heute konzeptionell in den Vordergrund gestellt und Schicksale als Zusammenspiel von Innen und Außen, Trieb und Beziehungseinflüssen verstanden.
Ansätze dafür gab es schon lange, oft den »Dissidenten« der psychoanalytischen Bewegung geschuldet wie Otto Rank, besonders auch Sándor Ferenczi. In dessen Nachfolge sind Michael Balint und durchaus auch Donald W. Winnicott zu sehen. Die Psychoanalyse als Beziehungswissenschaft wird sich eher der Dynamik und den Folgen von Traumatisierungen in Beziehungen (»komplexes Trauma«) zuwenden. So stehen auch die Schicksale verschiedener Traumatisierungen von sich entwickelnden Kindern in ihren Familien, die Abwehrdynamik von Dissoziation, insbesondere Internalisierung von Gewalt, sowie die Folgeerscheinungen im Mittelpunkt des vorliegenden Bandes (siehe auch Hirsch 1997, 2004 und 2010).
Eine Bemerkung zur Sprachregelung: Es ist üblich geworden, von »sexuellem Missbrauch« eines Kindes zu sprechen. Das impliziert, genau genommen, dass es auch einen korrekten »Gebrauch« von Kindern geben müsse. Eigentlich handelt es sich also um einen Missbrauch von Macht, die ein Erwachsener über ein Kind hat. Es wirkt aber künstlich, sich stets gegen den Sprachgebrauch zu stemmen, also spreche auch ich meist von sexuellem Missbrauch.
Ich danke wieder Bianca Grüger, die den Text und seine vielfältigen Korrekturen wie immer unermüdlich in den Computer geschrieben hat. Ich danke auch den Patientinnen und Patienten, die mir am Beginn ihrer Therapie jeweils pauschal ihre Zustimmung zu einer eventuellen Veröffentlichung ihres »Materials« gegeben haben.
Einleitung
Von der Schwierigkeit der »Bearbeitung«
Seit vielleicht 25 Jahren ist das »Trauma« in den verschiedensten Bereichen von Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychiatrie und Sozialarbeit ein geradezu inflationär gebrauchter Begriff. Er bedeutet immer – wie verschieden er auch verstanden wird – das massive Einwirken von außen auf die Psyche des Individuums, mit zerstörerischen, psychisch nicht zu integrierenden Folgen, das Notmaßnahmen erfordert.
Wir Menschen scheinen nicht immer in der Lage zu sein, zerstörerische Aggressionen gegen unser eigenes Selbst klar genug zu sehen und dann bearbeiten zu können. Immerhin aber ist es heute entsprechend der Entwicklung des gesellschaftlichen Bewusstseins möglich, psychische Störungen und Erkrankungen auf reale destruktive, also traumatisierende Einflüsse auf sich entwickelnde Kinder zurückzuführen. Viel zu lange sah sich die Psychoanalyse als Wissenschaft des intrapsychischen Konflikts (zwischen Trieb und sozialer Umwelt), als »Ein-Personen-Psychologie«, die das Individuum konzeptionell von seiner komplexen Beziehungsrealität isolierte. Und die Psychiatrie ist leider noch heute (oder heute wieder) in großem Ausmaß von biologischen, also genetischen und Stoffwechselkonzepten beherrscht. Sie reduziert den Patienten allzu häufig auf seine Gehirnphysiologie und sieht ihn nicht als Produkt komplexer lebenslanger sozialer (Beziehungs-)Einflüsse, die auf eine genetische Matrix, auf ein Entwicklungspotenzial einwirken.
Der Begriff »Trauma« ist eigentlich eine Kurzformel für ein sehr komplexes Prozessgeschehen. Ein überwältigendes Ereignis überrollt den psychischen Apparat und durchbricht den Reizschutz des Ichs, das die Gewalterfahrung nicht integrieren kann. Es ist vielmehr gezwungen, Notmaßnahmen zu ergreifen, insbesondere die der beiden vorherrschenden Bewältigungsversuche: Dissoziation und Internalisierung der Gewalt. Sándor Ferenczi hat dies als Erster als Introjektion und Identifikation mit dem Aggressor beschrieben.
Diese kaum gelingenden Abwehrmechanismen haben wiederum Folgen, die uns als Symptome der Traumatisierten begegnen: dissoziative Zustände, Intrusionen, unbeeinflussbares Wiederherstellen der traumatischen Situation, Angststörungen als Äquivalente der Dissoziation. Allerdings erzeugt die Internalisierung lang dauernde schwere Schuldgefühl- und Selbstwertprobleme, Beziehungsstörungen, Depressionen und Suizidalität, verfehlte Identitätsentwicklung und Lebensverläufe, aber auch dissoziales, gewalttätiges Verhalten in einer Täter-Opfer-Umkehr aufgrund einer Täter-Identifikation.
Ein »Trauma« ist also ein Prozess, in dem einer Gewalteinwirkung (traumatisches Ereignis) die direkte Abwehrreaktion des Opfers in der Gewaltsituation folgt und sich schließlich Langzeitfolgen einstellen. Diesen Prozesscharakter gibt der Begriff »Traumatisierung« besser wieder als die Kurzformel »Trauma«. Das »Trauma« kann also nie als ein wenn auch noch so furchtbares Ereignis allein dastehen. Und nicht jedes Ereignis wirkt auf alle gleich. Ähnliche Einwirkungen und Situationen haben auf verschiedene Individuen ganz unterschiedliche traumatische Einflüsse.
Internalisierung von Gewalterfahrung und Dissoziation markieren die beiden Pole, die das Traumaspektrum umgrenzen. Sie lassen sich den beiden grundsätzlich zu unterscheidenden Bereichen im Prinzip zuordnen: einerseits lang andauernde komplexe Beziehungstraumata, meist in der Kindheit, also in der Familie, die eher durch Internalisierung zu bewältigen versucht werden; andererseits Extremtraumatisierungen, meist im Erwachsenenalter, durch Gewalteinwirkung von Personen, zu denen vorher keine bedeutsame Beziehung bestanden hatte. Letzteres trifft umso mehr auf nicht von Menschen hervorgerufene traumatische Einwirkungen wie Naturkatastrophen zu.
Die unmittelbaren Folgen der plötzlichen extremen Gewalteinwirkung, die den psychischen Apparat überrollt (das ist das »psychoökonomische Prinzip«), sind der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) zuzuordnen. Sie sind vorrangig Gegenstand der verhaltenstherapeutisch ausgerichteten Schulen, die sich auch der »neuen Traumatherapietechniken« bedienen und die zunehmend eine Verbindung zu neurobiologischen Forschungen zu den Veränderungen der Hirnstrukturen durch traumatische Einwirkungen herstellen können.
Die Folgen chronischer familiärer Beziehungstraumata sind ganz andere und beruhen überwiegend auf Internalisierung, insbesondere auf verschiedenen Formen der Identifikation mit dem Täter bzw. dem Gewaltsystem.
Beide Traumabereiche sind nicht ganz voneinander zu trennen, denn es gibt durchaus auch in Familien entsetzliche Durchbrüche von kaum vorstellbarer Gewalt gegen Kinder, die zu Dissoziationsphänomenen führen. Ebenso existieren bei der Extremtraumatisierung Beziehungs- und Identifikationsanteile. Doch auch wenn sich beides nicht exakt trennen lässt, so halte ich es für nicht angemessen, die für Extremtraumatisierung gefundenen und wertvollen Mittel der »neuen Traumatherapien« (Übungen, Imagination, EMDR, Traumaexposition, Ausschließung von vergangenen und aktuellen Beziehungsanteilen) undifferenziert auf in der Kindheit traumatisierte, persönlichkeitsgestörte Patienten anzuwenden.
Chronisch familiäre Traumata finden immer in Beziehungen statt, mehr noch: Das traumatische Ereignis kann geradezu erst durch Beziehungsanteile zum Trauma werden: Verlustdrohung, Verrat, unterlassener Schutz durch Verweigerung der Zeugenschaft. Solche Internalisierungen gehen auch transgenerational vonstatten, das Trauma der Eltern bildet traumatische Introjekte in den Folgegenerationen. Das Introjektkonzept wirft auch ein Licht auf klinische Erscheinungen wie negative therapeutische Reaktion und Wiederholungszwang. Es ist zudem für Phänomene der außergewöhnlichen Kreativität verantwortlich wie auch für ihre Hemmung.
Für die Konzepte des therapeutischen Vorgehens in der Therapie traumatisierter Personen halte ich es also für unbedingt notwendig, zwischen chronischen familiären Traumata, die eher zu Persönlichkeitsstörungen führen, und akuten, einmaligen Extremtraumatisierungen jeden Lebensalters, die eher zu Posttraumatischen Belastungsstörungen führen, zu unterscheiden. Auf die Notwendigkeit dieser Differenzierung weist auch Otto F. Kernberg (1999) hin.
Die erste Traumaform findet in langjährigen, für das Kind lebensnotwendigen Beziehungen statt, wie es bereits Ferenczi (1933, 1985) drastisch beschrieben hat, sodass die traumatische Einwirkung, die sich überdies über die Jahre mehrfach wiederholt, nicht von den pathogenen Beziehungen und Strukturen der Familie getrennt werden kann.
Ganz anders bei Extremtraumatisierungen im Erwachsenenalter, die nur insofern Beziehungstraumata sind, als dem Täter, zum Beispiel dem Folterer, in der traumatischen Regression vom Opfer, das sich als lebensunfähiges Kind erlebt, in einer Art Übertragung Qualitäten von übergroßer elterlicher, paradoxerweise gar rettender Macht verliehen werden. Insofern halte ich es für ebenso einfach wie zwingend, dass die heute propagierten Techniken der Traumatherapie eher für extrem traumatisierte Erwachsene geeignet sind, während die Folgen langjähriger chronischer Beziehungstraumata eben im Prinzip nur durch eine langjährige Beziehungstherapie, insbesondere eine modifizierte psychoanalytische Therapie wirklich an der Wurzel zu packen sind. Die wichtige Aufgabe ist, eine sorgfältige Indikation zu erstellen, für welchen Patienten welche Behandlungsform optimal ist.
Ähnlich wie Beziehungserfahrungen grundsätzlich vom psychoanalytischen Denken lange nicht berücksichtigt wurden (bestenfalls als »akzidentelle« Einwirkung, zusätzlich zum Triebkonflikt), wurde lange Zeit der für uns heute selbstverständliche Zusammenhang von traumatisierenden Erfahrungen und Persönlichkeitsstörung insbesondere bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen nicht gesehen.
Wie in einer Ironie der Wissenschaftsgeschichte genau hundert Jahre nach dem Aufgeben der »Verführungstheorie« durch Sigmund Freud 1897 (Freud 1985, S. 283f.) konnte Kernberg (1999) feststellen, dass an der Wurzel der Persönlichkeitsstörung, zumindest in einem großen Teil der Fälle, Gewalterfahrungen, insbesondere Missbrauchserfahrungen, in der Kindheit lagen. Dabei wurde jahrzehntelang die weitgehende Überschneidung der Symptome bei persönlichkeitsgestörten und bei traumatisierten Patientinnen und Patienten übersehen. Eine Ursache dafür mag darin liegen, dass »Persönlichkeitsstörung« als klinisches Phänomen aus einer gewissen Distanz beschrieben werden kann, während ein Traumakonzept schwerer psychischer Störungen und Persönlichkeitsveränderungen ein ätiologisches Konzept darstellt. Dieses fordert schnell zu einer Identifikation mit dem Opfer heraus, wobei die Gefahr besteht, sich als Therapeutin oder Therapeut zu sehr hineinziehen zu lassen und sich selbst so zu schwächen, also selbst als Opfer zu empfinden, und die Identifikation zu verweigern. Dafür hat Hans Holderegger (1993) den Begriff der »traumatisierenden Übertragung« verwendet, deren Opfer der Therapeut werden könne und die letztlich auf projektiver Identifikation beruhe.
In den letzten Jahren ist jedoch eine weitgehende Übereinstimmung dieses Zusammenhangs von Traumatisierung und späterer Störung erreicht worden. Heute ist der Gedanke nicht mehr fremd, dass schwer und früh gestörte Patienten oder welche mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung alle massive Traumata erlitten haben (vgl. Rohde-Dachser 1991; Sachsse 1995; Eckert u.a. 2000; Paris 2000). In einer Untersuchung fanden Birger Dulz und Maren Jensen (2000) bei 82 Prozent der stationär behandelten Borderline-Patientinnen und -Patienten körperliche Misshandlung und/oder sexuellen Missbrauch. Unter Einbeziehung schwerer Vernachlässigung stieg der Anteil sogar auf 100 Prozent.
Während Traumata in der Wiederannäherungsphase im Kleinkindalter eher mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung zu tun haben, hängen narzisstische Persönlichkeitsstörungen vorrangig mit Deprivationstraumata des Säuglingsalters zusammen (etwa Modell 1976, S. 303). Damit haben wir schon die der Persönlichkeitsstörung zugrunde liegenden Traumaformen benannt; Otto F. Kernberg (1999) fügt mit Kroll (1993) noch das Miterleben körperlicher und sexueller Gewalt anderen Personen gegenüber hinzu.
Modifikationen der psychoanalytischen Psychotherapie wurden seit Langem entwickelt, auch ohne dabei unbedingt die Vorstellung der traumatisierenden Beziehungserfahrungen in der Ätiologie zu berücksichtigen. Wenn man Beziehungserfahrungen, im Extremfall eben auch traumatisierende, für die Ätiologie in den Vordergrund stellt, dann folgt daraus, dass auch das Therapiekonzept die Beziehung als Hauptmedium des therapeutischen Prozesses versteht.
Eine zeitgenössische Hauptströmung der Psychoanalyse verwendet das Konzept der Intersubjektivität. Das zu Verstehende ist nicht mehr der Patient in seinen unbewussten und unintegrierten Anteilen, sondern das von Analytiker und Analysand gemeinsam hergestellte »analytische Dritte« (Ogden 1997). Übertragung und Gegenübertragung sind nur noch das jeweils verschiedene Erleben dieses Dritten von Analysand (»Übertragung«) und Analytiker (»Gegenübertragung«). Auffällig ist es, in welchem Ausmaß sich eine solche moderne psychoanalytische »Technik« (die keine mehr ist) auf die psychoanalytische Kindertherapie bezieht. Donald W. Winnicott, dessen »Spielraum«, in dem sich beide, Analytiker und Analysand, bewegen und etwas Gemeinsames schaffen, ganz auf die psychoanalytische oder psychotherapeutische Beziehung angewendet wird. Insofern ist es für mich nicht übertrieben, dass auch auf der therapeutischen Ebene ein Anschluss an Ferenczis (1931) Kinderanalysen mit Erwachsenen erreicht wurde.
Eine psychoanalytische Psychotherapie Traumatisierter wird heute die Wiedergewinnung der Symbolisierungsfähigkeit, die das Trauma beeinträchtigt oder zerstört hatte, in das Zentrum rücken. Dadurch erhält die therapeutische Beziehung Qualitäten der entwicklungsfördernden frühen Mutter-Kind-Beziehung, mit der eine haltende Umgebung (Winnicott) und eine Symbolisierung mit dem Konzept des Containings verbunden wird: Nichtsymbolisierte Inhalte und insbesondere Affekte werden modifiziert und benannt an den Patienten zurückgegeben. Eingefrorene oder verschüttete, aber auch impulsartig unkontrollierte Affekte werden in der therapeutischen Beziehung wiedererlebt und können so nach und nach unter Ich-Kontrolle gebracht werden. Der Therapeut wird Hilfs-Ich-Funktionen übernehmen, besonders in Form des Grenzensetzens, aber auch beim Aufrichten von inneren Grenzen, nämlich den bei traumatisierten Patienten immer gestörten Selbst-Objekt-Grenzen.
Die Realität des Traumas, aber auch alltäglicher unbewältigter Lebenssituationen werden aktiv benannt, bis hin zum Coaching von interpersonellen Bereichen des Patienten. Neben Techniken der Verwendung von Bildern und Metaphern werden auch spontan psychodramatische Elemente angewandt, um ein affektives Erleben in der therapeutischen Beziehung zu fördern. Persönlichkeitsgestörte bzw. traumatisierte Patienten profitieren sehr von einer analytischen Gruppenpsychotherapie, in der gegenseitige Identifikationen, aber auch direktere Konfrontationen, auch die Möglichkeit der Übertragungsspaltung, einen fördernden Charakter auf die Persönlichkeitsentwicklung ausüben können.
Wenn heutzutage das Trauma bzw. genauer die Traumatisierung als prozesshaft auf die Psyche einwirkendes, destruktives Beziehungsgeschehen in den Sozialwissenschaften und der Psychoanalyse hochaktuell ist, dann darf nicht vergessen werden, dass in den 1960er und 1970er Jahren bereits aus ich-psychologischer Sicht eine lebhafte Diskussion stattfand, sodass man heute eher von einer Renaissance der Traumadiskussion sprechen sollte. Das verdienstvolle Buch von Sidney S. Furst(Psychic Trauma), in dem namhafte psychoanalytische Autoren Aufsätze zur Traumatheorie beitrugen, ist bereits 1967 erschienen. Sowohl im Bereich der therapeutischen Technik als auch in dem der Theorie hatte die Psychoanalyse das »Trauma« immer im Blick, auch wenn sie, zugegeben, in der Nachfolge Freuds lange Zeit die Bedeutung der Beziehungserfahrungen zugunsten der Triebschicksale vernachlässigte.
Zur Geschichte psychoanalytischer Traumakonzepte
Das Schicksal der Traumakonzepte spiegelt die Geschichte der Psychoanalyse wider: Sie begann als Theorie der Hysterie und wurde damals als Folge innerfamiliärer Traumatisierung betrachtet. Die Dominanz der Triebtheorie ließ später das Trauma nur mehr akzidentell erscheinen. Die Ich-Psychologie nahm ihm dann jede Beziehungsqualität und reduzierte es auf ein rein psychoökonomisch konzipiertes Aufbrechen eines Reizschutzes. Erst heute kann man die bahnbrechende Bedeutung Ferenczis erkennen, die Psychoanalyse als eine Beziehungspsychologie zu begründen.
Ich-Entwicklung, Bildung von Strukturen (insbesondere des Über-Ichs und andere Internalisierungsergebnisse), Kreativität und ihre Hemmung, Charakter- und Persönlichkeitsmerkmale bzw. -störungen sind im positiven wie im negativen Sinne von Beziehungserfahrungen zumindest beeinflusst. Eine ich-psychologische, psychoökonomische Richtung der psychoanalytischen Traumatologie wird sich auf das Freud’sche Denken berufen. Sándor Ferenczi dagegen sieht das Trauma immer objektbeziehungstheoretisch, immer in Beziehungen, er hat die Grundlage gelegt für eine moderne Psychotraumatologie.
Der frühe Freud
Die Psychoanalyse begann als eine Theorie der Verursachung psychischer Krankheiten durch seelisch-körperliche Traumatisierungen, die in der Familie und in der Kindheit stattfinden, nicht bewusst erinnert werden können und – deshalb – Symptome produzieren. Sigmund Freud (1896c) nahm 1896 an, dass in jedem Fall einer konversionsneurotischen Symptomatik ein reales sexuelles Verführungstrauma in der Kindheit stattgefunden habe, das verdrängt worden war und in der Adoleszenz aktualisiert in verschlüsselter Form durch die Symptomatik wieder in Erscheinung trete. Die Herkunft Freuds aus der Physiologie und Neuroanatomie lässt ihn – zusammen mit Breuer – eine Abfolge von traumatischen Reizen auf das Nervensystem annehmen, eine adäquate Abreaktion des Reizes bzw. eine Hinderung dieser Abreaktion und dadurch Verursachung von Symptomen, die in ihrer ursächlichen Qualität vorerst verschlüsselt bleiben.
»Wenn ein Mensch einen psychischen Eindruck erfährt, so wird etwas in seinem Nervensystem gesteigert, was wir momentan die Erregungssumme nennen wollen. Nun besteht in jedem Individuum, um seine Gesundheit zu erhalten, das Bestreben, diese Erregungssumme wieder zu verkleinern. Die Steigerung der Erregungssumme geschieht auf sensiblen Bahnen, die Verkleinerung auf motorischen Bahnen. Man kann also sagen, wenn jemandem etwas zustößt, so reagiert er darauf motorisch. Wenn nun die Reaktion auf ein psychisches Trauma gänzlich unterblieben ist, dann behält die Erinnerung daran den Affekt, den sie ursprünglich hatte. Und wo sich der Mensch des Reizzuwachses nicht durch ›Abreagieren‹ entledigen kann, ist die Möglichkeit gegeben, daß das betreffende Ereignis für ihn zu einem psychischen Trauma wird« (Freud 1893h, S. 192f.).
Die Abreaktion geschieht entweder durch körperliche Reaktion, durch eine Tat, also eine motorische Antwort gegen die Quelle des Traumas, oder durch »kontrastierende Vorstellungen«, mit denen der Traumatisierte sein Selbstwertgefühl (Freud sagt, seine »Würde«) wiederherstellt und den Angreifer entwertet.
»Wir kommen also darauf, […] daß es sich bei allen Anlässen, welche zu Ursachen hysterischer Phänomene geworden sind, um psychische Traumen handelt, die nicht vollständig abreagiert, nicht vollständig erledigt worden sind. Wir können also sagen,der Hysterische leidet an unvollständig abreagierten psychischen Traumen« (ebd., S. 194). Zwei Jahre später, in denStudien über Hysterie, formuliert Freud dann den programmatischen, bekannt gewordenen Satz: Wir wissen,»der Hysterische leide größtenteils an Reminiszenzen«(Freud 1895d, S. 86), weil »diese Erinnerungen Traumen entsprechen, welche nicht genügend ›abreagiert‹ worden sind« (ebd., S. 89).
Freud ist aber weit davon entfernt, die Verursachung der Neurose als einfache kausale Wirkung des Traumas auf den psychischen Apparat zu verstehen. Die Pathogenese wird komplizierter durch das Konzept der Nachträglichkeit: Nicht das reale Erlebnis allein, sondern die »assoziativ geweckte Erinnerung an frühere Erlebnisse« (Freud 1896c, S. 432) verursacht die Krankheit, die abgewehrte »Abkömmlinge unbewußt wirkender Erinnerungen« (ebd., S. 448) sind und durch ähnliche aktuelle Ereignisse wiederbelebt werden, nun aber nicht als Erinnerungen, sondern als deren Verschlüsselungen im neurotischen Symptom wieder auftauchen.
Das Zusammenwirken von realem Trauma, von durch dieses geweckten sexuellen und aggressiven Impulsen sowie der Abwehrtätigkeit der Fantasie wurde von Freud in seiner ganzen Komplexität früh gesehen, sodass Ilse Grubrich-Simitis (1987, S. 998) zu dem Schluss kommt: »Schon das Trauma-Modell in Gestalt der Verführungstheorie postuliert demnach einen komplexen kausalen Zusammenhang, in dem äußere und innere, das heißt soziale, psychische und somatische Bedingungen, vielfältig miteinander vernetzt sind.« Im Grunde kann man also eine starre Trennung von »voranalytischer Zeit« (Sterba 1936, zitiert bei Krutzenbichler 2000, S. 121) der Verführungstheorie und »analytischer« des Ödipuskomplexes nicht aufrechterhalten.
Hier lassen sich bereits die Wurzeln moderner Traumatheorien erkennen: Das überwältigend traumatische Ereignis ist nicht bewusstseinsfähig, nicht symbolisch repräsentiert, es ist verdrängt – Freud hatte noch keine weiteren Formen der abwehrenden Bewältigung zur Verfügung wie Verleugnung, Introjektion, Projektion und Verwerfung (Ausschließung, Exklusion), die alle auf Spaltung beruhen oder zu ihr führen. Das so Abgespaltene äußert sich in Symptomen, und zwar des Körpers wie der Psyche, in tranceartigen Bewusstseinszuständen, die wir heute als Traumafolge und Folge der Dissoziation kennen, in Angstformen, Aggressivität und Sexualisierung sowie ihrer Abwehr.
Freud bemerkte bereits, dass der Traumatisierte zu einer adäquaten Reaktion unfähig ist, dass er dem traumatischen Ereignis ohnmächtig gegenübersteht. »Abreagieren« und »erledigen« ersetzen wir heute durch »verarbeiten« und »integrieren«, oft genug ohne eine genaue Definition dieser Begriffe zu geben. Und man kann auch vermuten, dass Freud mit »abreagieren« eine vage Vorstellung davon verband, dass Affekte (wegen ihres überwältigenden Ausmaßes) nicht adäquat entstehen konnten, abgespalten aber ihre symptomerzeugende Wirkung hatten.
Die Verführungstheorie wurde von Freud 1897 aufgegeben; welche Gründe ihn dazu bewogen, ist vielfältig diskutiert worden (vgl. Hirsch 1987; Bohleber 2000, S. 799; Krutzenbichler 2000). Er selbst hat nie konkret angegeben, warum er von der Realität sexueller Traumata in der Kindheit seiner Patientinnen nicht mehr überzeugt war. An die Stelle der realen, traumatisierenden Einwirkung trat nun ein konstitutioneller, erblicher Faktor, der erklären sollte, warum nicht jeder Mensch Opfer seines Ödipus-Komplexes wird.
Manche empfanden es als Geburtsstunde der wahren Psychoanalyse (etwa Kris 1950), denn der Konflikt des infantilen sexuellen Triebes und der aus ihm hervorgegangene Ödipus-Komplex sollten fortan an der Wurzel der Neurose liegen. Freud hat allerdings den Einfluss einer realen äußeren traumatischen Einwirkung auf die Pathogenese der Neurosen immer mehr oder weniger gelten lassen, besonders in seinem Spätwerk, sicher unter dem Einfluss Ferenczis. Allerdings erscheint es bedauerlich, dass Freud statt der gesicherten Realität der Verführung nun einen konstitutionellen Faktor spekulativ einführte und darüber hinaus die Beziehungsdimension zugunsten des Intrapsychischen weitgehend aufgab.
Das ich-psychologische Traumakonzept
Noch vor der Formulierung des zweiten topografischen Modells (Es/Ich/Über-Ich) wurde von Freud (besonders 1920g) das Ich als Schaltstelle zwischen Triebansprüchen und Forderungen der sozialen Umwelt konzipiert, ein psychischer Apparat, der gegen traumatische Einflüsse einen Schutz entwickelt, der die Überschwemmung des Ichs (heute besser: Selbst) verhindert. Ist aber die Reizmenge, die traumatische Gewalt also, zu stark, dann versagt dieser Reizschutz: »Solche Erregungen von außen, die stark genug sind, den Reizschutz zu durchbrechen, heißen wir traumatische« (Freud 1920g, S. 29).
Freud denkt auch an einen Ansturm großer Reizmengenvon innen