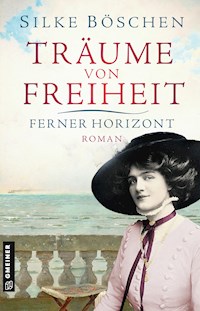
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Träume von Freiheit
- Sprache: Deutsch
Die amerikanische Kolonie im Dresden des 19. Jahrhunderts: Zu den reichen Amerikanern gehört auch Florence de Meli. Sie ist der umschwärmte Mittelpunkt der High Society. Doch ihr Ehemann tobt vor Eifersucht. Er schmiedet ein Komplott und lässt sie für verrückt erklären. Florence landet in der Irrenanstalt. Doch sie kämpft für ihre Kinder und Gerechtigkeit. Ihre abenteuerliche Reise führt sie quer durch Europa bis nach New York. Eine Scheidungsschlacht beginnt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 596
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Silke Böschen
Träume von Freiheit – Ferner Horizont
Roman
Impressum
Personen und Handlungen sind frei erfunden, soweit sie nicht historisch verbürgt sind.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Susanne Tachlinski
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Bilder von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vittorio_Matteo_Corcos_-_Dis-mois_tout.jpg
und https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lily_Elsie_LCCN2014686094.jpg
ISBN 978-3-8392-6806-3
Widmung
Für Fanny und Florentine.Ihr seid mein Glück.
1. Teil
1. Die Schlangenfrau
Dresden, 20. Dezember 1875
Der Vorhang hob sich. Es roch nach Staub und Puder. Der rote Samtstoff war an einigen Stellen fleckig. Florence saß ganz vorn und unterdrückte ein nervöses Kichern. Tiere, wie aus einer längst untergegangenen Welt, so groß, dass sie ganze Kälber verschlingen – so hatte es auf den Plakaten gestanden. Beherrscht nur von einer zarten Frau, der Schlangenbändigerin Mademoiselle Laurent aus Paris. Der Victoria-Salon war jeden Abend ausverkauft. Florence presste den Fächer vor den Mund. »Henri, meinst du, die Schlangen können von der Bühne gleiten?«, wisperte sie ihrem Mann ins Ohr. Er schüttelte den Kopf und sah sie an. Sie konnte entzückend sein! Er drückte ihre Hand. Sie war kalt.
Die Bühne lag in vollkommener Dunkelheit. Nur das Gaslicht sorgte für einen schwachen Lichtkranz vor den Bühnenbrettern. Florence hörte, wie hinter ihr ein Opernglas aus dem Karton gezogen wurde. Sie genoss die Anspannung. Eine Schlangenbezauberin – hier in Dresden! Die Frau kam von einem Pariser Theater, dessen Name ihr nichts sagte: Folies-Bergère. Henri hatte anerkennend genickt, als er es gelesen hatte. Florence starrte auf die Bühne. Sie konnte die Umrisse von vier ausladenden Körben erkennen. Leise begann eine Männerstimme zu singen. Ein klagendes Lied in einer Sprache, die Florence nicht verstand. Der Mann verstummte. Jetzt hörte sie eine Flöte. Auf Florence’ Unterarmen stellten sich die Härchen auf. Eine Trommel ertönte in einem halblauten, gleichförmigen Rhythmus. Stille. Zwei dunkelhäutige Männer, bekleidet nur mit weiten Serail-Hosen und einem Turban auf dem Kopf, betraten die Bühne. In den Händen hielten sie rußende Fackeln, die sie in schwere, gusseiserne Halterungen an den Seiten steckten. Gebannt starrte Florence auf die Männer, die wieder zu ihren Instrumenten griffen. Im Hintergrund erkannte sie das Bühnenbild – eine Art Urwald mit exotischen Schlingpflanzen und Palmen. Man hörte ein Knacken aus einem der Körbe, er schwankte ein wenig. Florence stieß die Luft aus.
Die Trommelschläge wurden schneller. In ihrem Rhythmus tanzte eine Frau in einem durchsichtigen, enganliegenden Kleid auf die Bühnenmitte zu. Sie hatte ihre dunkelblonden Haare in große Locken gelegt, die von einem bunten Tuch am Hinterkopf zusammengehalten wurden. Darunter ergoss sich noch mehr Haar, beinahe bis zur Taille hinab. Die Frau erhob ihre weichen, weißen Arme wie zu einem Gebet. In den Händen hielt sie ein Tamburin. Der Ausschnitt ihres Kostüms war gewagt. Die üppig dargebotene Weiblichkeit verdarb Florence die Stimmung. Die Schlangenbeschwörerin klopfte gegen das Tamburin und schloss die Augen. Sie war stark geschminkt. Am Hals trug sie ein schwarzes Samtband, an dem ein Kruzifix hing. Wie geschmacklos!, dachte Florence streng und blickte zu Henri hinüber. Ihr Mann starrte auf die Bühne. Die Frau machte ein paar weitere Tanzschritte, dann verstummte die Musik, und sie verbeugte sich. Henri klatsche begeistert. Florence runzelte die Stirn.
Sie nestelte an ihrem Fächer. »Ich dachte, das ist eine Tier-Schau«, flüsterte sie ärgerlich und beobachtete, wie die Frau auf der Bühne sich an einem der Körbe zu schaffen machte. Sie sah, wie die Frau unter sichtbarer Anstrengung einen Schlangenkörper hervorzog. Die dunkelhäutigen Männer halfen ihr, das massige Tier aus dem Korb zu heben. Florence hielt die Luft an. Der dunkelgrüne Leib mit dem braunen Muster wollte kein Ende nehmen. Zwei Meter? Drei Meter? Vorsichtig legten die Männer die Schlange auf die Schultern der Frau. Wie eine teure Zobelstola hielt sie das Tier, nahm die Enden und breitete die Arme aus. Florence sah, dass die Frau trotz der dicken Puderschicht Schweißperlen auf der Nase hatte. War die Schlange so schwer? Oder schwitzte sie vor Angst? Florence griff wieder nach Henris Hand. Und dann schritt die Dompteurin doch tatsächlich die Bühne ab. Ganz nahe kam sie. Das Gaslicht von unten ließ sie gespenstisch aussehen. Die Schlange wirkte noch riesiger, als sie es ohnehin war. Florence zuckte zurück.
Henri zwinkerte der Schlangenfrau zu und nickte unauffällig in Florence’ Richtung. Die Tierbändigerin zeigte keine Regung, doch dann machte sie einen kleinen Knicks direkt vor Florence und ließ die Schlange in ihrer rechten Hand hinabgleiten. Der Schlangenkopf hing keinen Meter entfernt vor Florence’ Gesicht. Sie schrie auf und presste sich an die Rückenlehne. Das Tier baumelte vor ihr. Florence konnte die Augen erkennen und sah das schuppige Muster der Haut. »Henri! Hilfe! Sie soll die Schlange fortnehmen!«, schrie sie voller Abscheu. Selbst die Sitznachbarn waren erschrocken aufgesprungen. Man hörte spitze Schreien, ein Raunen. Und ein Lachen. Ein lautes Männerlachen. Es kam von Henri. Er machte eine lässige Handbewegung. Nun ist es gut, schien seine Hand zu sagen. Mit einer tiefen Verbeugung zog sich die Frau wieder zurück in die Bühnenmitte.
Florence’ Herz klopfte wie verrückt. Tief sog sie den Duft aus dem Riechfläschchen ein. Die Angst verging. Jetzt kam die Wut. »Wie konntest du das zulassen?«, zischte sie in Henris Richtung. »Dieses widerliche Tier? Diese unmögliche Frau! Fast nackt auf der Bühne!«
Henri lächelte und wollte ihre Hand tätscheln.
»Nimm die Finger weg! Du hast mir den Abend verdorben. Und das so kurz vor Weihnachten.« Sie versuchte, ein Schluchzen zu unterdrücken.
»Nun beruhige dich, Darling. Ein kleiner Spaß. Es ist doch nichts passiert. Mach bitte keine Szene. Das ist doch lachhaft!«
»Ich gehe gleich nach Hause. Dann kannst du dir die nackte Französin mit ihren fürchterlichen Schlangen allein ansehen.« Florence wischte sich eine Träne aus den Augen.
Hinter ihnen war Gemurmel zu hören. »Ruhe da vorn!« – »Psst!«
Unsicher strich sich Henri über den Kopf und ordnete sein Haar. Die kahle Stelle am Hinterkopf wurde seit Monaten größer. Florence guckte starr geradeaus.
In der Pause standen Florence und Henri umringt von Freunden und Bekannten aus der amerikanischen Kolonie im Foyer. Florence trank bereits ihr zweites Glas Champagner.
»Wie konntest du das nur aushalten, liebe Flo? Ich wäre direkt in Ohnmacht gefallen«, staunte Minna von Funcke.
»Sehr tapfer. Sehr tapfer!« Anerkennend tätschelte Dr. Jenkins, der bekannte Zahnarzt in Dresden, Florence’ Arm. Er zwinkerte in Henris Richtung. »Deine kleine Frau so zu erschrecken …«
Henri prostete ihm zu. »Ein kleiner Spaß.« Er zog genüsslich an seiner Zigarre. »In den Armen dieser Dame aus Paris wäre ich auch gern eine Schlange …«
Newell Sill Jenkins lachte, dann zog er Henri beiseite und wurde leise. »Die Dame ist mir anvertraut worden. Kein Scherz. Mein Kollege Dr. Evans aus Paris hatte mir geschrieben, dass ich mich um sie kümmern solle, hier in Dresden. Das Fräulein ist … wie sag ich es am besten? Also, sie ist seine Geliebte. Evans sagt, Méry – so heißt sie – sei sehr kultiviert …« Er räusperte sich und sah sich um. Die beiden Männer standen an die Wand gelehnt, während Florence sich ein paar Meter entfernt mit Clara, der Ehefrau von Jenkins, und ihrer Freundin Minna unterhielt.
Henri blickte einem Rauchkringel seiner Zigarre nach. »Aber warum muss sie dann als Schlangenfrau auftreten?«
»Sie ist wohl von Haus aus Schauspielerin und Tänzerin und liebt es, auf der Bühne zu stehen. Das hat mir Evans geschrieben.« Der zweite Gong ertönte. Die Pause ging zu Ende.
»Auf den Plakaten stand, sie kommt vom Folies-Bergère«, erwiderte Henri. »Man hört viel von diesem Theater! Da treten die schönsten Frauen auf. Sieht man ja.«
Jenkins seufzte. »Aber wir sind hier in Dresden. Nach der Schau bitten wir die Dame auf ein Glas Champagner in eine Weinstube, schicken unsere Frauen nach Hause und sagen, dass wir zwei noch etwas zu besprechen hätten.«
Henri nickte und strich über seinen schwarzen Vollbart.
Die beiden Männer schlenderten zurück.
»Na, was habt ihr zwei da ausgeheckt?« Clara Jenkins zog eine Augenbraue in die Höhe.
»Gar nichts, mein Darling. Aber Henri und ich müssen noch etwas besprechen. Wir wollen uns nach der Vorstellung kurz zusammensetzen. Dann nimmst du dir mit Florence eine Droschke, und ihr fahrt schon einmal nach Hause.«
Florence drehte sich um. »Nein, Henri soll mit mir kommen. Sonst wird es wieder so spät. Und dann trinkst du so viel.« Sie hakte sich bei ihrem Mann ein.
»Flossie, bitte überlass das mir!« Henris Stimme klang streng.
»Es geht um die Sache mit dem Ehepaar Thomas«, sprang ihm Newell Jenkins bei.
Florence blieb stehen. »Cecelia? Die Arme kann sich nirgends mehr blicken lassen.«
»Na, arm dran sind doch wohl eher die vielen Toten und Verwundeten, die ihr Mann auf dem Gewissen hat«, sagte Henri.
»Ja, grauenhaft. Man macht sich gar keine Vorstellung«, murmelte Florence. »Aber Cecelia bleibt meine Freundin. Sie kann nichts dafür, dass ihr Mann ein solcher Schuft ist und so viele Menschen mit seinem Bombenfass in den Tod gerissen hat.«
»Das müssen wir hier nicht klären. William King Thomas hat mit seiner Tat ein ganz schlechtes Licht auf uns alle hier geworfen. Die gesamte amerikanische Kolonie in Dresden muss nun ausbaden, was sich dieser Bösewicht ausgedacht hat«, erwiderte Henri und seine Stimme wurde lauter: »Da müssen wir uns positionieren. Als Amerikaner in dieser schönen Stadt. Sonst stehen wir alle unter Generalverdacht, so wie man es in den vergangenen Tagen schon in den Zeitungen nachlesen konnte. Jedenfalls wollen Newell und ich gleich noch überlegen, was wir als amerikanische Gäste in Deutschland machen können, um zu zeigen, dass wir alles andere als Schwerverbrecher und Massenmörder sind.«
Die Paare trennten sich und gingen zurück in den Saal.
Die traurige Flöte setzte ein. Und die Trommel.
Die Schlangenbeschwörerin trat langsam in die Mitte der Bühne. Dieses Mal bestand ihr Kostüm aus einem grobmaschigen Netz – verziert mit funkelnden, hellgrünen Steinchen und einer Haube auf dem Kopf aus lauter glitzernden Perlen. Florence schnappte nach Luft. In ihren Schläfen klopfte es. Das war nicht der Champagner, das war diese unmögliche Frau mit ihren widerlichen Schlangen. Sie fühlte, wie eine Migräne herannahte. Wie eine von diesen Riesenschlangen, dachte sie und betupfte ihre Stirn mit etwas Pfefferminzöl. Henri bekam davon nichts mit. Seine Augen waren fest auf die Tierbändigerin gerichtet. Er bewunderte den unbekannten Zahnarzt in Paris, der sich eine solche Geliebte leisten konnte.
Es schneite. Die meisten Droschken vor dem Varieté-Theater in der Waisenhausstraße hatten sich schon in Bewegung gesetzt. »Henri, es wäre mir wirklich lieber, du würdest mit mir kommen. Sieh doch nur, wie es schneit.« Florence hakte sich bei Ihrem Mann unter.
Clara Jenkins steckte ihre Hände vorsorglich in den Pelzmuff. »Newell, ich bin ganz Florrys Meinung. Ich weiß nicht, was es Bedeutendes gibt, dass ihr unbedingt heute zu später Stunde noch besprechen müsst. Vertagt es! Lass uns aufbrechen!« Sie sah ihn streng an.
Newell Jenkins wischte über den Rand seines Zylinders. Er seufzte. »Ihr habt ja recht. Es ist nur so …«, er warf Henri einen zerknirschten Blick zu. »Wir müssen uns um jemanden kümmern.« Und er erzählte von der Bitte seines Kollegen aus Paris, sich der schönen Schlangenfrau anzunehmen.
Florence war mit einem Schlag hellwach. Ihr Kopf dröhnte noch immer. Jetzt wollten sich die beiden Männer doch allen Ernstes mit dieser Halbwelt-Dame durch Dresden schlagen. Auch Clara Jenkins schlug die Hand vor den Mund. »Newell. Ich bin entsetzt!«
Der Zahnarzt war zerknirscht. »Aber was soll ich denn tun? Thomas Evans hat mich ins Vertrauen gezogen. Ich kann ihn nicht enttäuschen. Er ist in Paris eine absolute Instanz, was zahnmedizinische Belange angeht. Er behandelt die Zarenfamilie, den bayerischen König und andere gekrönte Häupter in ganz Europa. Clara, vielleicht öffnet er auch mir die Tür zu solch hochkarätigen Patienten.«
Clara schüttelte den Kopf: »Bei dir sperrt die gesamte sächsische Königsfamilie den Mund auf. Reicht das nicht?«
»Pscht. Nachher hört uns noch jemand! Es ist sozusagen eine kollegiale Anfrage. Man muss da gar nichts hineingeheimnissen.«
»Mit einem so prominenten Kollegen sollte man es sich nicht verscherzen«, sprang ihm Henri bei, der darauf hoffte, den Abend in französischer Gesellschaft fortsetzen zu können.
Die Runde schwieg betreten. Florence fröstelte. Sie überlegte. Natürlich war die Heimlichtuerei der Männer empörend, gleichzeitig war sie neugierig, einen Blick in eine gänzlich verbotene Welt zu werfen. Sie räusperte sich. »Henri, Newell, ich habe einen Vorschlag zur Güte. Solange die Dame ihre Schlangen nicht dabeihat und sich etwas mehr überwirft als auf der Bühne, könntet ihr doch in den Rats-Weinkeller gehen. Und um euren Ruf nicht in Misskredit zu bringen, werden Clara und ich euch begleiten.«
Clara Jenkins warf einen überraschten Blick auf ihre Freundin. »Mit diesem Vorschlag kann ich mich einverstanden erklären«, sagte sie dann etwas förmlich.
Die Herren sahen einander an. Der Abend nahm eine unerwartete Wendung. Jetzt waren sie unter der Aufsicht ihrer Ehefrauen. Henri musterte Florence ärgerlich.
Doch die lächelte. Ihre Kopfschmerzen schienen nachzulassen. »Wie gut, dass meine Eltern immer Wert auf französische Konversation gelegt haben. Das wird sich jetzt hoffentlich bezahlt machen.« Sie strahlte Henri an. »Wo bleibt die Schlangendame?«
Und tatsächlich dauerte es nur ein paar Minuten, bis eine ganz und gar in Fuchspelz gehüllte Schönheit suchend durchs Foyer kam. Newell Jenkins eilte zu ihr und geleitete sie zu der Runde. Mit einem freundlichen Nicken stellte sie sich vor: Méry Laurent sei ihr Name. Sie lächelte charmant. Ihre Stimme war angenehm, etwas tiefer als die der meisten Frauen. Noch immer trug sie Schminke im Gesicht. Aber nicht mehr in so auffälligen Farben wie eben noch auf der Bühne. Sie wirkte jünger als während der Vorführung und gleichzeitig sehr erwachsen, dachte Florence, die es aufregend fand, einer solchen Frau gegenüberzutreten. Clara Jenkins blieb zurückhaltend, wenngleich sie sofort ins Französische wechselte, um dem Besuch aus Paris die Beklommenheit zu nehmen.
Henri de Meli ließ Méry kaum aus den Augen. Doch seine Französischkenntnisse waren bescheiden. Bis auf ein paar Höflichkeitsfloskeln konnte er wenig zur Unterhaltung beisteuern. Ganz anders Florence. Sie verlor die Scheu vor der eleganten Zahnarzt-Geliebten und ließ sich berichten vom Salon der Méry Laurent, in dem Dichter und auch Maler verkehrten. Sie wolle damit eine Stätte schaffen, erklärte die Französin, wo sich die verschiedenen künstlerischen Bereiche gegenseitig befruchten könnten. Ab und zu sei sie selbst noch auf Tournee. Doch sie würde zunehmend in Paris verlangt.
»Von Mr. Evans, nehme ich an«, bemerkte Clara Jenkins knapp.
Méry Laurent lächelte und warf ihre Locken zurück. »Ja, was wäre ich ohne Thomas?«, antwortete sie. »Er ist ein wahrer Gentleman. Und ein großartiger Arzt! Wussten Sie, dass er seit Neuestem die russische Zarenfamilie behandelt?«
Newell Jenkins nickte beeindruckt. »Ein herausragender Kollege. In jeder Hinsicht.«
Henri saß schweigend vor einem großen Krug Bier. Als er versuchte, die Runde zu einem deutschen Schnaps zu überreden, blieb er erfolglos. So trank er das Kirschwasser allein.
»Stört es Sie, wenn ich rauche?«, fragte Méry.
Clara Jenkins hüstelte, wurde aber überhört. Florence begann in ihrem Beutel nach ihrer eigenen Zigarettenspitze zu suchen. Wenn diese Dame rauchte, durfte sie es ebenfalls.
Henri beobachtete sie. »Muss das sein?«
»Ja, eine Zigarette wirst du mir doch wohl gönnen?«
»Hattest du nicht vorhin noch über Migräne geklagt?«
»Die Kopfschmerzen sind abgeklungen. Ich denke, es war der Schreck wegen der Schlange vor meinem Gesicht«, entgegnete sie schnippisch.
»Dank Thomas verstehe ich ein bisschen Englisch. Ich muss mich vielmals entschuldigen«, sagte Méry und legte eine Hand auf Florence’ Arm. Ein prächtiger Diamant funkelte mit dem passenden Armband um die Wette. »Es tut mir so leid. Das wollte ich nicht. Ihr Mann hatte so eine kleine Andeutung gemacht, und ich dachte mir nichts dabei!«
Florence lachte auf. »Ach, eigentlich ist es eine tolle Geschichte. Die kann ich morgen meinem Sohn erzählen. Aug in Aug mit einer Riesenschlange!« Sie zündete sich eine Zigarette an und blies den Rauch aus.
Henri verzog das Gesicht.
»Gaunerchen, nun guck nicht so böse. Unser Gast raucht schließlich auch!«
Henri schwieg und bestellte eine weitere Runde.
Es ging auf Mitternacht zu. Clara drängte zum Aufbruch. Méry Laurent schien ebenfalls müde zu werden. »Leider fahre ich morgen schon weiter. Wir haben noch einen Auftritt in Berlin. Dann geht es zurück nach Paris«, erzählte sie und sah Florence aufmerksam an. »Sind Sie manchmal in Paris?«
Florence schüttelte den Kopf. »Ich war nur ein einziges Mal dort. Aber das ist schon lange her. Mit meinen Eltern.«
»Dann sollten Sie wiederkommen. Hier ist meine Karte. Bitte besuchen Sie mich doch, wenn Sie einmal da sind!«
Florence blickte auf das cremefarbene Papier. »52, Rue de Rome, Paris«, las sie und verstaute die Karte in ihrem Beutel. »Wer weiß? Vielleicht machen wir einmal eine schöne Reise nach Paris, was, Henri?«
Henri de Meli hob langsam den Kopf. Eine Haarsträhne hatte sich gelöst und klebte an seiner Stirn.
»Gaunerchen, was ist mit dir?« Florence sah ihn erschrocken an.
»Nichts. Nichts. Au revoir! Es war mir ein Vergnügen«, er beugte sich zu Méry Laurent und wollte ihr einen Handkuss geben, dabei geriet er ins Schwanken.
Schnell griff ihm Jenkins unter den Arm. »Na, das waren wohl doch ein paar Gläser zu viel, alter Junge.«
Henri schnaufte.
Als Florence und Henri die Treppenstufen zu ihrer Wohnung in den zweiten Stock der Lüttichaustraße 10 hinaufgingen, musste Florence ihren Mann stützen, weil er so betrunken war. Vor der Wohnungstür angekommen, suchte er nach dem Schlüssel.
»Jetzt sei still, du weckst noch alle auf!« Florence versuchte, ihm den Schlüssel abzunehmen und selbst aufzuschließen.
Henri stieß die Luft aus. »Ich bin der Herr im Haus. Nur weil du ein bisschen Französisch parlieren kannst, brauchst du dich hier nicht aufzuspielen! Und als Frau de Meli mit einer Dame aus der Halbwelt am Tisch zu sitzen und zu rauchen! Wenn ich das am Sonntag nach der Kirche meiner Mutter erzähle…«, sagte er mit schwerer Zunge.
Florence schnaubte empört und wollte sich an ihm vorbeidrängen.
»Nichts da! Du lässt gefälligst deinem Mann den Vortritt!« Er schob sie taumelnd zur Seite.
Florence stolperte. Ihr Beutel fiel zu Boden. Die Visitenkarte aus Paris glitt heraus. Vorsichtig hob sie das Kärtchen auf. Erst jetzt bemerkte sie die kleine, zusammengerollte Schlange auf der Rückseite. Die winzigen Schlangenaugen schienen zu glühen. Florence strich über das geprägte Papier. Diese Karte würde sie aufbewahren.
2. Zigaretten und Absinth
Dresden, 19. Februar 1881
Die Zigarettenspitze lag achtlos neben der Mokkatasse. Das Mundstück aus weißem Meerschaum war noch warm vom Rauch. Henri sah missbilligend auf das Utensil seiner Frau. Er verabscheute es. Dazu dieses Lachen. Es hatte etwas Aufreizendes, ja Frivoles. Zu Hause hatte er ihr das Rauchen verboten. Doch er wusste, dass Florence heimlich auf dem Balkon stand und seine Anweisungen ignorierte. Spätestens wenn sie danach in den Duft von Bitterorangen gehüllt wieder vor ihm stand, war ihm klar, dass sie geraucht hatte. Mittlerweile hasste Henri beides – die Zigaretten und das Parfüm der Pomeranzen.
»Was machst du für ein Gesicht, mein alter Gauner? Hast du schon wieder schlechte Laune?«, fragte Florence eine Spur zu laut. Ihre Tischnachbarn – das Ehepaar Smith – hielten inne und sahen fragend zu ihnen hinüber. Florence lächelte ihnen zu.
Henri sprach leise. »Du weißt, dass ich den Zigarettenrauch nicht vertrage. Dazu noch von einer Dame. Ich …«
»Henri, jetzt geht das wieder los!« Sie verdrehte die Augen. »Herr Smith, sind Sie auch so streng mit Ihrer Gattin? Mein Henri lässt mir aber auch gar keine Freude. Dabei raucht er selbst Zigarren.«
»Ach, wissen Sie, Frau de Meli, rauchende Damen sind für mich eine Modeerscheinung. Wenn es Ihnen gefällt! So ist das mit den jungen Frauen, sie tanzen uns auf der Nase herum, nicht wahr?« Er nickte Henri verständnisvoll zu.
Henri spürte, wie sein Hemdkragen feucht wurde. Er schwitzte. Wie konnte dieser alte Smith so leutselig sein und sich auf die Seite von Florence schlagen? Er lächelte gequält.
»Da hast du’s! Gaunerchen!« Triumphierend strich Florence ihm über seinen Bart.
Henri musste sich beherrschen. Jetzt wollte sie ihn wohl gänzlich zum Narren machen – hier in der Gesellschaft des Amerikanischen Clubs. Zwischen all den honorigen Exil-Amerikanern, zu denen er selbst nun auch schon etliche Jahre gehörte. Manche taten furchtbar vornehm, so wie Theodore Smith und seine blasse Ehefrau, andere waren kaum zu ertragen in ihrer Kulturbeflissenheit in Dresden. Immer unterwegs zwischen Gemäldegalerie, Semperoper, Klavierabend oder Lesung. Versuchten sogar, sich auf Deutsch zu unterhalten. Lachhaft.
Henri bestellte ein weiteres Bier und warf einen Blick auf seine Taschenuhr. Gleich war es halb elf. Vielleicht sollten sie heute einmal früher aufbrechen, überlegte er, doch im nächsten Moment, als der Kellner ein frisch gezapftes Bier vor ihm abstellte, verwarf er den Gedanken.
»Wunderbar. Dann machen Sie mir doch bitte noch einen Absinth!«
Der Kellner eilte mit der neuen Bestellung davon.
»Aber, Gaunerchen, du wolltest doch keinen Absinth trinken! Das hattest du mir versprochen. Ein paar Tage einmal ohne dein grünes Gift«, sagte Florence und stupste ihn am Arm.
Diesmal hörten es nicht nur die Smith’, auch Witwe Clarkson und ihr redseliger Begleiter, Jonathan Baker sahen plötzlich in seine Richtung. Henri spürte die Hitze. Und die Wut. Seine Frau machte ihn lächerlich. Vor allen Leuten. Sein Atem ging schwer. Er stürzte sein Bier hinunter und zischte: »Florence, bitte! Benimm dich! Vergiss nicht, dass ich dein Ehemann bin. Und als solcher muss ich dir gegenüber überhaupt keine Rechenschaft ablegen.«
Florence legte ihren Kopf zur Seite und pustete ihm noch einen Rauchkringel ins Gesicht. »War doch gar nicht ernst gemeint. Natürlich kannst du machen, was du willst!« Sie küsste ihn auf die Wange. »Lass uns den schönen Abend genießen! Prost, Darling!«
Henri reagierte nicht, sondern konzentrierte sich darauf, kaltes Wasser in das Glas mit dem Absinth vor ihm zu gießen. Das leuchtende Grün wurde milchig. Er probierte die Mischung. Dann trank er das Glas zügig leer. Auf sein Handzeichen hin brachte der Kellner noch mehr von dem giftgrünen Alkohol. Henri atmete aus. Das Schwitzen ließ nach.
Sollten die Leute doch denken, was sie wollten. Er war wahrscheinlich der reichste Mann hier im Saal. Man wusste es nicht genau. Mit irgendetwas hatten sie alle ihr Geld gemacht. Ihr Dollarvermögen. Und das war hier, in der deutschen Provinz, gleich doppelt so viel wert. Ob es immer mit rechten Dingen zugegangen war beim Vermögensaufbau oder ob die Vorfahren tatsächlich schon mit der »Mayflower« nach Amerika gekommen waren, wer wollte das überprüfen? Ihm fiel William King Thomas ein. Vor ein paar Jahren war er der Vize-Präsident im Anglo-Amerikanischen Club gewesen. Ein großzügiger Gastgeber mit einer eleganten Ehefrau. Die Thomas’ waren unermesslich reich, hieß es immer. Henri hatte gleich seine Zweifel gehabt. Dann platzte die Bombe! Wortwörtlich. Der feine Mr. King Thomas war ein gedungener Massenmörder. Hatte ein Schiff versenken wollen mit einem Fass Sprengstoff. Nur um die Versicherungsprämie zu kassieren, für seine Ladung, die in Wirklichkeit wertlos war. Das Fass explodierte schon im Hafen und brachte Dutzenden Menschen den Tod. Unzählige andere wurden verletzt. Der Gipfel war, dass sich der Mann anschließend das Leben nahm. So ein feiger Hund! Und Florry, dieses unbedarfte Ding, war gut befreundet mit der Ehefrau dieses Massenmörders! Wie lange war das jetzt her? Fünf Jahre? Oder sechs?
Henri starrte auf die hellgrüne Flüssigkeit in seinem Glas. Angeblich hatte die Ehefrau – wie hieß sie doch gleich? Cäcilie? Celia? Nein, Cecelia – nichts geahnt von den üblen Machenschaften ihres Mannes. Und trotzdem war sie nur wenige Wochen nach der abscheulichen Tat aus Dresden geflohen. Alle hatten den Kontakt zu ihr abgebrochen. Nur Florry nicht. Henri wusste, dass sie heimlich Briefe nach New York schickte. Angeblich an ihre Brüder. Aber eines der Dienstmädchen hatte ihm die Wahrheit erzählt. Henri stöhnte auf. Würde Florence denn nie erwachsen werden? Gut, sie war erst 15 Jahre alt gewesen, als sie sich vor zwölf Jahren kennengelernt hatten. Aber mittlerweile war sie Mutter zweier Kinder, die Ehefrau eines der reichsten Männer in der Stadt und eine »de Meli«. Hätte er doch nur auf seine Mutter gehört. Sie war gleich gegen diese Verbindung gewesen.
»Henri! Henri!« Atemlos plumpste Florence auf ihren Stuhl. »Der Kapellmeister hat mir versprochen, das Lied ›Oh, Dem Golden Slippers‹ zu spielen. Wir wollen singen!«
Henri seufzte. Sie war so hübsch! Diese Mischung aus Anmut, Fröhlichkeit und Schönheit. Florence redete weiter. Er sah, wie sich ihr Mund bewegte. Dieser Kirschenmund. Aber er hörte nicht, was sie sagte. Sah die flinken braunen Augen, das feine Gesicht. Immer in Bewegung. Sie lachte und warf den Kopf zurück. Ein grüner Schleier hatte sich über seinen Blick gelegt. Der Absinth machte ihn wehrlos. Aber er legte auch die Wahrheit offen. Ja, seine Flossie war von Anfang an die Schönste gewesen. Und unbekümmert wie ein Kind. So wie er nie war. Wie niemand war bei den de Melis. Erst recht, nachdem sein Vater aus dem schlichten »Melly« ein »de Meli« gemacht hatte – angeblich stammte die Familie von italienischen Adeligen ab. In Wirklichkeit kamen ihre Vorfahren aus der Schweiz. Tüchtige Uhrmacher. Doch das sollte niemand wissen. Offiziell waren sie seit ein paar Jahren Familie de Meli. Von denen lachte niemand mit entblößten Zähnen und sang hemmungslos mit, wenn die Kapelle das Lieblingslied anstimmte.
Henri nippte an seinem Glas. Der Keller war zuverlässig und diskret. Henri zahlte ein großzügiges Trinkgeld. Langsam verlor er den Überblick über die Menge des grünen Wundermittels, die er schon getrunken hatte. Angeblich wurde es als Medizin benutzt. Henri hatte vergessen, wogegen es half. Ihm half der Absinth ebenfalls. Er brachte ihm Ruhe. Und machte ihn gelassen. Und manchmal zeigte ihm der Alkohol auch, was er liebte. Diese Frau dort, in ihrem sahnegelben Kleid und den schimmernden Perlenohrringen. Wie sie dort stand – umringt von einem kleinen Pulk anderer Gäste, wie sie lachte und lauthals sang. Was für eine Frau! Seine Frau. Henri schluckte. Er strich sich durch den Bart und zündete sich eine Zigarre an. Seine Augen begannen zu tränen. Es war der Rauch. Es war der Rauch. Es war … der Anblick seiner Frau.
Florence war vergnügt. Endlich wieder unter Menschen! Und sie sang so gern. Im Chor der All-Saints-Kirche – das war das eine. Aber hier im Ballsaal von Webers Hotel zwischen all den eleganten Frauen, den charmanten Männern, der Musik. Sie fühlte sich großartig. Der Kapellmeister erwiderte ihren Blick mit einem Schmunzeln und wies seine Musiker an, ein weiteres »da capo!« zu spielen. Als sie die ersten Takte noch einmal hörte, warf sie Henri eine Kusshand zu. Er lächelte. Gott sei Dank, er war nicht mehr böse auf sie.
»Mein Darling, die Musik ist wundervoll. Ich muss singen!«
Henri nickte. Seine Augen waren rot. Er lächelte und tätschelte ihren Arm, als sie nach ihrer Zigarettenspitze griff. Florence küsste ihn auf seinen kahlen Kopf und eilte zurück zu den anderen, die immer noch vor dem Podest mit der Kapelle standen und zu den Takten der Musik schunkelten. Baron von Geyso hielt ihr galant eine Hand entgegen. Er zwinkerte ihr zu. Der Baron mochte sie. Manchmal konnte man denken, er mochte alle Frauen. Florence warf ihm einen tiefen Blick zu, dann sprang sie behände auf die Bühne neben den Kapellmeister und erhob ihre Zigarettenspitze.
»Jetzt unterstütze ich Sie!«, rief sie. »Das ist mein Taktstock!«
Die anderen lachten, während sich Florence mit dem Kapellmeister einen gespielten Wettstreit lieferte. Sogar der alte Smith und seine Frau wollten sich diesen Spaß nicht entgehen lassen und traten zu den Sängern. »Da capo! Aber etwas schneller!«, rief Florence und fuchtelte mit ihrer Zigarettenspitze in der Luft.
Nur die Witwe Clarkson hielt sich bedeckt. Argwöhnisch beobachtete sie das Treiben. Die junge Frau de Meli umringt von Männern und Frauen. Ihr Ehemann nur umringt von zu vielen leeren Gläsern. Sie schüttelte den Kopf. Das konnte nicht gut gehen. Sie sang mit Florence im Kirchenchor und kannte sie aus der Arbeit für den Wohltätigkeitsbasar im Advent. Eine Frau in ihrer Position muss doch irgendwann einmal erwachsen werden, dachte sie. Zwei Kinder, ein Ehemann, ein Name – und was für einer! Eine feine Adresse, dazu eine Schwiegermutter, die ihr mit Rat und Tat zur Seite stand. Witwe Clarkson dachte an Antoinette de Meli. Sie waren befreundet. Ob sie ihr von diesem Auftritt ihrer Schwiegertochter heute Abend berichten sollte? Ja, besser sie würde es von ihr erfahren als von irgendjemand anderem.
Denn glücklich war diese Ehe nicht. Das konnte jeder sehen. Der arme Henri. Er ließ sich gehen. Das konnte eine junge Frau auf die Dauer nicht aushalten. Witwe Clarkson überlegte. Vielleicht würde sie gegenüber Antoinette eine winzige Anmerkung machen über den vielen Alkohol. Dieser Absinth war das reinste Gift in ihren Augen. Warum musste Henri nur immer so viel trinken? Plötzlich fasste ihr jemand an die Schulter. Erschrocken sah die alte Dame auf. Sie sollte sich einreihen – eine Polonaise zog durch den Saal, angeführt von Florence de Meli. Witwe Clarkson schüttelte den Kopf und ließ die Tanzenden an sich vorüberziehen. Wie konnte Gott nur zwei so unterschiedliche Menschen zusammenführen? Sie seufzte. Morgen würde sie mit Antoinette sprechen.
3. Mutter und Sohn
Dresden, 20. Februar 1881
Die Türklinke wurde langsam nach unten gedrückt. Ein Spalt öffnete sich. Das Kind stand in der Tür und bewegte sich nicht. Es legte beide Hände zusammen und wartete im Halbdunkel. Die Vorhänge waren noch zugezogen. Es roch nach Bitterorangen, dem Parfüm seiner Mutter. Vorsichtig betrat der Junge das Schlafzimmer. Florence lag im Bett und schlief. Der Junge trat näher und streichelte ihre Hand.
»Mommy, bist du wach?« Seine Stimme war kaum zu hören.
Florence drehte sich zur Seite. »Oh, Henry, mein Liebling. Lass mich noch ein wenig schlafen. Es war so spät gestern.«
Der Junge schwieg, rührte sich aber nicht vom Fleck.
»Wie spät ist es überhaupt?« Langsam richtete sie sich auf und rieb sich die Augen.
»Mommy, darf ich ganz kurz zu dir kommen? Nur kurz! Heute ist Sonntag.«
Florence klappte ihre Bettdecke hoch, Henry schlüpfte zu ihr.
»Bei dir ist es immer so schön kuschelig.« Er schmiegte sich an seine Mutter. »Aber nichts Papa sagen, ja?« Seine Stimme klang ängstlich.
»Natürlich nicht. Ich würde ja auch Ärger bekommen.« Florence drückte ihren Sohn an sich. »Mein großer Schatz, du! Wir halten zusammen. Aber in den Gottesdienst müssen wir trotzdem. Und später zum Mittagessen zu Großmutter Antoinette.«
Sie spürte ein leichtes Pochen in den Schläfen. Sie sah auf die kleine verzierte Konsolenuhr auf dem Kamin. Es war kurz nach sieben. Wann waren sie nach Hause gekommen? Es war lange nach Mitternacht gewesen. Ein herrlicher Abend! Sie schloss die Augen und summte die Melodie von »Oh, Dem Golden Slippers« vor sich hin. Sie seufzte. Zum Glück war Henri zum Schluss so betrunken gewesen, dass er ihr keine Vorhaltungen mehr machen konnte. Der Absinth ist mein heimlicher Verbündeter, dachte sie kurz. Unsinn! Wenn Henri nicht immer so viel trinken würde, wäre er viel umgänglicher. So wie im Sommer 1869, als sie sich kennengelernt hatten.
Florence erinnerte sich an den Mann mit dem vollen schwarzen Haar. Ja, er hatte damals wirklich ausgesehen wie ein italienischer Graf. Und wie charmant er gewesen war! Hatte allen Frauen den Kopf verdreht. Aber sie war es, die er wirklich gewollt hatte. Alle anderen waren doch nur Zeitvertreib gewesen. Das hatte Henri selbst gesagt. Und sie hatte ihn hinreißend gefunden. In seinem eleganten Mantel, dem Hut. Ein vollendeter Gentleman. Sie war so naiv gewesen! Florence erinnerte sich an die Reaktion ihrer Eltern, als sie davon erfuhren, dass Henri de Meli ihr den Hof machte. Die Drapers waren zurückhaltend gewesen, empfanden ihre Tochter als zu jung für eine Ehe. Doch dann hatte es gar keine andere Option mehr gegeben.
Denn sie wusste doch nichts. Rein gar nichts. Nie hatte ihre Mutter sie ins Vertrauen gezogen. Die Freundinnen hatten nur gekichert, wenn das Thema auf die Liebe kam und auf die Wünsche eines Mannes. Und Florence selbst? Sie hatte Henri vertraut. Sich ihm anvertraut. Die heimlichen Küsse, seine zärtlichen Berührungen, wenn er sie bei Spaziergängen – weit genug entfernt von den Argusaugen seiner Mutter – an die Hand fasste oder ihren Hals liebkoste. Florence erinnerte sich, wie liebevoll er gewesen war und wie romantisch. Doch dann war da dieser Abend gewesen. Mit einem Mal war Florence hellwach. Die Kopfschmerzen wurden stärker.
Es war der Karnevalsball gewesen. Ihr erster Kostümball. Der Höhepunkt der ausklingenden Wintersaison. Sie hatte sich als Marie-Antoinette verkleidet. Ihre Mutter war mit ihr im Petit Bazar gewesen, um die passenden Stoffe auszusuchen. Die Schneiderin hatte daraus ein Traumkostüm genäht – Florence fühlte sich wahrhaftig wie eine französische Rokoko-Königin. Die Haare waren gepudert und hochfrisiert. Und schminken durfte sie sich! Das weiß gepuderte Gesicht mit Schönheitsfleck und schwarz umrandeten Augen, dazu der zinnoberrote Mund. Henri war begeistert gewesen. Den ganzen Abend lang wollte er immerzu mit ihr tanzen, dabei hatten sich viele Verehrer in ihr Tanzkärtchen eingetragen. Aber Henri gelang es, seine Konkurrenten auszustechen. Und ihr war es ganz recht gewesen. Henri war als Pirat verkleidet – in einem weißen Rüschenhemd, ein buntes Tuch um den Hals, die Haare nach hinten gekämmt. Sogar eine Augenklappe hatte er aufgetrieben. Florence war hingerissen.
»Du bist meine schöne Beute«, hatte er ihr ins Ohr geflüstert, sie von der Champagnerbar weggezogen und war lachend mit ihr ein Stockwerk höher geeilt in einen langen dunklen Flur. Unter sich hörten sie die Musik und die Stimmen aus dem Ballsaal. Florence fühlte sich verwegen an seiner Seite. Das hier hatte nichts zu tun mit ihren Gesangsstunden bei Frau von Hohenstein von der Semperoper. Oder dem langweiligen Deutschunterricht bei den unverheirateten Schwestern Baumann. Die meisten ihrer Mitschülerinnen mussten an diesem Abend zu Hause bleiben. Florence dagegen hatte ihren Vater so lange bekniet, bis er ihr erlaubt hatte, zum Ball zu kommen. Schließlich war sie schon 16! Es war herrlich, erwachsen zu sein.
Henri hatte sie geküsst. Ihre rote Lippenfarbe hatte sich auf seinem Mund verteilt. Er hatte sich an sie gepresst, ihr etwas ins Ohr geflüstert, was sie nicht verstand. Florence hatte versucht, sich aus seiner Umarmung zu lösen. »Oh, Henri, es ist alles so aufregend!«, begann sie. Es war das erste Mal in ihrem Leben, dass sie drei Gläser Champagner getrunken hatte. Doch Henri schien gar nicht zuzuhören. Er war stark. Viel stärker als Florence. Sie hatte Angst bekommen. Und sich selbst gleichzeitig kindisch dabei gefunden. Sie dachte, so sei das wohl zwischen Mann und Frau. Der Mann hat dieses innere Feuer, das nur eine Frau zügeln kann. So ähnlich hatte sie es einmal in einem Roman gelesen, den ihr ihr Bruder Thomas heimlich ausgeliehen hatte. Als Henri ihre Röcke hob, hatte sie ihn fortschieben wollen. Aber Henri war wie von Sinnen gewesen. Was war nur mit ihm los? Er tat ihr weh. Sie schrie. Doch keiner hörte sie.
Florence behielt das Erlebnis im dunklen Flur für sich. Am nächsten Tag hatte Henri ihr ein herrliches Blumenbouquet schicken lassen, dazu eine Karte mit innigen Worten der Zuneigung. Die alten Drapers waren beeindruckt gewesen. Nur ihre Brüder Thomas und Theodore mochten den Verehrer ihrer Schwester nicht. Florence brauchte ein paar Tage, bis sie ihre alte Unbekümmertheit zurückerlangte. Die Schmerzen waren vergangen. Das Blut an ihren Unterröcken hatte niemand entdeckt, sie selbst hatte sich eines Abends in die Waschküche geschlichen und die Flecken herausgeschrubbt. Seit diesem Karnevalsabend fühlte sie sich anders, beschmutzt. Es verwirrte und beschämte sie. Und Henri? Er schickte kleine schmeichelhafte Billets, lud sie zu einem Spaziergang ein – natürlich in Obhut ihrer Mutter – und gab sich weiterhin charmant. Und dennoch, er schien ihr eine Spur zurückhaltender, unverbindlicher. Plötzlich war er häufig verhindert.
Florence war ratlos gewesen. Genauso ratlos war sie immer dann, wenn wieder dieses Ziehen im Bauch einsetzte. Zuerst hatte sie geglaubt, ihre Periode kündige sich an. Doch sie blieb aus, die Bauchschmerzen nicht. Und sie hasste auf einmal den Geruch von frischem Kaffee. Eines Morgens konnte sie den Ekel nicht länger unterdrücken und stürzte vom Frühstückstisch, um sich über ihrer Waschschüssel zu übergeben. Ihre Mutter war argwöhnisch geworden. »Was ist los, Flossie, hast du dir den Magen verdorben?« Ihr Blick war durchdringend.
Florence hatte geweint und ihr erzählt, dass sie auf einmal keinen Kaffeeduft mehr vertrug und dass ihr morgens, gleich nach dem Aufwachen, schon schlecht wurde. Elizabeth Draper hatte den Hausarzt kommen lassen. Ihr Verdacht wurde bestätigt: Das Mädchen war schwanger.
Florence setzte sich auf und schüttelte die Kopfkissen aus. Dann sank sie zurück. Zum Glück hatte sie ihr eigenes Schlafzimmer. Jeden Morgen neben einem schnarchenden, nach Schnaps riechenden Ehemann aufzuwachen, war kein Vergnügen. Aber der kleine Henry hier, der sich so selig an ihre Seite schmiegte, der war ein Glück! Sie streichelte über seinen Kopf.
»Jetzt müssen wir zwei aber wirklich aufstehen«, sagte sie leise. »Gleich kommt Adele mit dem Kaffee. Und dein Vater darf nicht herausfinden, dass du hier bei mir bist.«
Der Junge ließ sich noch tiefer ins Bett sinken. »Ach, Mommy, ich mag aber nicht. Daddy wird sowieso wieder einen Grund finden, auf mich wütend zu sein.«
»Ja, ich weiß.« Bekümmert strich sie ihrem Sohn über die Wange. »Ich wünschte, er würde mich schlagen, aber das wagt er nicht. Mein armer Junge! Wir dürfen deinen Daddy nicht zornig machen. Hörst du?«
Das Kind nickte. »Aber ich habe manchmal so eine Angst vor ihm, dass ich gar nicht mehr antworten kann, wenn er mich etwas fragt. So wie gestern, bevor ihr ausgegangen seid. Ich sollte Vokabeln aufsagen. Aber mit einem Mal fielen mir die Wörter nicht mehr ein.« Er begann zu weinen.
»Sschh, sschh, beruhige dich, mein Kleiner. Ja, ich weiß, ich weiß. Es ist schlimm. Ich wünschte, ich könnte dich besser vor ihm beschützen.« Auch Florence’ Stimme klang auf einmal dünn. Sie sah die Szene vor sich, Henri kommandierte seinen Sohn vor sich wie einen Zinnsoldaten. Das Kind wurde von ihm selbst unterrichtet. Er wisse genug, um den Jungen auf das Leben vorzubereiten, hatte Henri erklärt und kategorisch ausgeschlossen, dass ein Privatlehrer ins Haus kam oder der Junge eine Schule besuchte. So hatte ihr Ehemann wenigstens eine Aufgabe, dachte Florence grimmig. Henri hatte nie in seinem erlernten Beruf als Bergbau-Ingenieur gearbeitet, sondern lebte vom Geld seiner Mutter. Er war Privatier. Vielleicht war das der Grund für seine dauernde Unzufriedenheit. Gestern war es besonders schlimm gewesen. Vielleicht hatte Florence ihn gereizt – mit ihrer guten Laune, der Vorfreude auf den Abend. Als der kleine Henry dann verzweifelt nach der richtigen Antwort suchte, hielt sein Vater das hölzerne Lineal drohend in der Luft. Er wartete gar nicht mehr auf eine Antwort, sondern ließ das dünne Stück Holz niedersausen. Der Vater packte seinen Sohn und schlug auf ihn ein. Das Kind schrie. Florence wollte ihm zur Hilfe eilen, in dem Moment zersprang das Lineal in drei Teile. Der Junge stürzte weinend in die Arme seiner Mutter.
»Ja, geh nur zu deiner Mutter! Wenn du so werden willst wie sie, Lieder trällern und feiern – mehr wird aus dir auch nicht, wenn du nicht endlich deine Hausaufgaben machst«, brüllte Henri mit rot angelaufenem Kopf und schwenkte den letzten Rest des Lineals in der Luft.
»Henri, wie kannst du so grausam sein?«, schrie Florence, außer sich vor Wut. »Was machst du denn, hm?! Was kannst du denn? Ich wünschte, du hättest eine Anstellung, dann würdest du uns endlich in Ruhe lassen.«
Henri atmete schwer. »Ah, jetzt halten Mutter und Sohn wieder zusammen. Das ist ja wunderbar. Da ist es doch gut, dass der Junge ab und zu eine Tracht Prügel bekommt, damit ihr zwei euch dann wieder in den Armen liegen könnt.«
Florence warf ihm einen verächtlichen Blick zu. »Komm, mein Schatz, ich bringe dich zur Kinderfrau. Minnie und du – ihr müsst zu Abend essen. Dein Daddy und ich sind heute Abend auf ein Fest eingeladen.«
Vorsichtig zog Florence die Bettdecke zur Seite und strich ihrem Sohn über den Rücken. »Tut es noch sehr weh?«
Der Junge nickte.
Die Kinderfrau soll dir wieder ein paar Umschläge mit kaltem Essigwasser machen. Dann wird es schnell wieder gut.«
Es klopfte. Vor der Tür stand das Dienstmädchen mit einer dampfenden Tasse Kaffee. »Guten Morgen, gnädige Frau. Welches Tageskleid möchten Sie heute zum Gottesdienst anziehen? Ich soll Ihnen vom gnädigen Herrn sagen, dass Sie alle heute den gesamten Tag bei seiner Mutter verbringen werden.«
Florence rollte mit den Augen. »Vielen Dank, Adele. Ich werde das grüne Kleid nehmen. Bitte legen Sie es heraus mit dem passenden Hut und den Handschuhen. Ach, und bitte bringen Sie mir noch ein wenig ausgepresste Zitrone für den Kaffee. Vielleicht kann ich damit die Kopfschmerzen verscheuchen.«
Das Dienstmädchen knickste und verschwand, um die Aufträge zu erledigen.
»Oh, Henry, mein Schatz, da hat sich Daddy gleich etwas Passendes überlegt, um uns den kompletten Sonntag zu verderben. Den ganzen Tag bei Großmutter Antoinette, wie soll ich das aushalten?« Sie ließ sich auf ihr Kopfkissen zurückfallen.
»Aber, Mommy, du hast doch mich!« Henry drückte sich an sie.
Florence rückte ein wenig von ihm ab und betrachtete ihren Sohn nachdenklich. Dieses Kind war ihre Freude. Ihr Glück. Aber dieses Kind war auch der Grund, weshalb sie heute Frau de Meli war – gefangen in einer Ehe, die beide Seiten unglücklich machte. Sie rieb sich die Schläfen. »Komm, mein Schatz, wir müssen uns fügen.«
4. Ein gewöhnlicher Sonntag
Dresden, 20. Februar 1881
Die alte Frau de Meli war stolz auf ihre biegsame Taille. Eng geschnürt, hatte sie sich bis heute eine schlanke Silhouette bewahrt. Das hatte Antony, ihrem Ehemann, gefallen. Er hatte sich gut ausgekannt mit »biegsamen Taillen« und schmalen Hüften. Zu gut. Und dennoch. Er fehlte ihr. Gerade erst war sein erster Todestag gewesen. Antoinette de Meli seufzte. Antony war immer diskret gewesen. Trotzdem war der Gedanke, dass er mit dem angeheirateten Vermögen ihrer eigenen Familie abwechselnde Liebschaften finanzierte, ein scharfer Stachel für Antoinette de Meli gewesen. Aber eine Scheidung kam für sie nicht infrage. Was Gott zusammengeführt hat, darf der Mensch nicht trennen, daran musste man sich halten. Leider galt dieser Grundsatz auch für die unglückliche Verbindung ihres Sohnes mit Florence.
Antoinette seufzte, als die Kammerzofe ihr die langen, grauschwarzen Haare kämmte.
»Oh, gnädige Frau, habe ich zu fest gebürstet?« Elsbeth war erst vor ein paar Monaten in den Rang einer Kammerzofe aufgestiegen, nachdem sich ihre Vorgängerin in die sächsische Schweiz verheiratet hatte.
»Nein, nein. Sie machen das sehr gut! Ich war in Gedanken.«
Erstaunlich, dass immer noch nicht alle Haare grau waren, dachte sie bei ihrem eigenen Anblick. Die Haare fielen wie ein schwerer Vorhang auf ihre Schultern. Die Dienstbotin kämmte weiter. Ganz gleichmäßig, von oben nach unten, immer wieder. Pro Strähne 50 Mal. Das hatte ihr die Herrin so eingeschärft. Es sei gut fürs Haar und für die Kopfhaut. Diese gleichförmige Tätigkeit erinnerte Elsbeth an ihr Zuhause. Dort, auf dem Bauernhof bei Meißen, hatte sie immer die Pferde gestriegelt – bis das Fell glänzte. Jetzt waren es die Haare einer alten Dame. Aber sie glänzten nicht. Sosehr sie auch bürstete.
Antoinette de Meli schloss die Augen und genoss die Zuwendung. Diese Momente waren die einzigen körperlichen Berührungen, die sie noch bekam. Ja, wenn die Enkelkinder zu Besuch waren, dann küssten sie sie auf die eingefallenen Wangen. Aber besonders innig waren diese Begegnungen nicht. Das lag an der Mutter. Florence war schuld. Sie trieb einen Keil zwischen die Großmutter und die Enkelkinder. Antoinette öffnete die Augen. Schon der Gedanke an die Schwiegertochter machte sie bitter. Schnell schloss sie die Augen wieder und überließ sich der französischen Bürste mit den Wildschweinborsten, die unermüdlich durch ihr Haar glitt.
Eine knappe Stunde später saß die Hochsteckfrisur von Antoinette de Meli perfekt. Mit etwas Talcumpuder hatte Elsbeth die schweren Haare griffig gemacht und zu angedeuteten Kränzen auftoupiert und festgesteckt. Nur die Brennschere durfte sie nicht mehr benutzen, nachdem sie ihrer Herrschaft mit dem glühend heißen Gerät einmal ein Brandmal hinter dem Ohr zugefügt hatte. Aber Antoinette de Meli hatte sich bald beruhigt und dies als Zeichen gesehen, von nun an auf kokette Löckchen an der Schläfe zu verzichten. Mit 64 Jahren brauchte sie diese eitle Spielerei nicht mehr. Außerdem verdeckten die Locken ihren Ohrschmuck. Heute hatte sie sich für hellblauen Aquamarine entschieden.
Gleich würde sie ihre Schwiegertochter in der Kirche sehen. Zusammen mit den Enkelchen. Und Henri natürlich. Ihrem Sohn. Ihrem Augenstern. Doch diese Frau trieb ihn in den Abgrund. Der viele Alkohol, die düsteren Momente, sein Jähzorn. Was machte Florence aus ihm? Die Leute tuschelten schon. Nur Florence war überall gern gesehen. Die fröhliche, junge Frau de Meli – immer für einen Spaß zu haben. Dabei benimmt sie sich wie ein Kind, dachte Antoinette grimmig. Oh, hätte Henri diese Frau doch niemals kennengelernt! Hätte sie selbst doch nicht auf die Drapers gehört, die zu einer Vermählung drängten. Schließlich konnte doch Henri nichts dafür, dass Florence ein solches Flittchen war und sich ihm an den Hals geworfen hatte. Es war natürlich das Beste, was dieser Familie passieren konnte. Hatten zwar ihren Namen, ja, »Draper«, an sich keine schlechte Familie. Aber von denen gab es unzählige in den USA. Ausgerechnet die Drapers hier in Dresden gehörten zu der ärmlichen Verwandtschaft. Jetzt hatten sie ihre Tochter gut verheiratet. Das frühreife Ding – Millionärsgattin. Antoinette merkte gar nicht mehr, wie sich ihre Mundwinkel immer weiter nach unten zogen. Wie ihr ganzer Ausdruck verkniffen wurde, wenn sie nur an Florence dachte.
Die Wintersonne schien. Der Platz vor der Kirche füllte sich. Die Glocken läuteten noch nicht, noch war ein wenig Zeit zum Plaudern. Über den gestrigen Abend zum Beispiel. Was für ein gelungenes Fest, lautete die einhellige Meinung. Einige Männer lachten verlegen bei dem Gedanken an die ausgelassenen Stunden. Die Abende im Anglo-Amerikanischen Club gehörten normalerweise nur ihnen. Ehefrauen und Töchter waren einzig zu besonderen Anlässen zugelassen. Gestern war so ein Anlass gewesen. Ein Ball! Sogar gesungen wurde, und ach, ein Zwinkern, ein Räuspern, die Polonaise erst! Ein Heidenspaß! Wo steckte sie denn, die kleine Anführerin des lustigen Tanzvergnügens? Wo war denn die junge Frau de Meli?
Florence stand etwas abseits von der immer größer werdenden Menschenmenge. Trotz der Kopfschmerzen, trotz der zu kurzen Nacht sah sie fabelhaft aus in ihrem grünen Samtkleid, das so gut zu ihren braunen Augen und den brünetten Haaren passte. Witwe Clarkson musterte die junge Frau aus sicherer Entfernung. Donnerwetter, eines musste man ihr lassen, sie sah gut aus. Die Jugend, die Jugend, dachte Witwe Clarkson und seufzte. Die Jugend verzeiht champagnerselige Nächte. Na, das wird sich schon noch ändern. Man brauchte ja nur einen Blick auf ihren Gatten zu werfen. Und tatsächlich, Henri de Meli sah mitgenommen aus. Die Krempe seines Zylinders war viel zu schmal, um das fahle Gesicht mit den Augenrändern zu verdecken. Immerhin war sein gewaltiger schwarzer Bart gewachst und ordentlich gestutzt.
Witwe Clarkson hielt sich das Lorgnon unauffällig vor die Augen und tat so, als suche sie die Gegend nach jemandem ab. In Wirklichkeit starrte sie immer wieder zu den de Melis. So ein hoffnungsvoller junger Mann war er gewesen, die Witwe schüttelte missbilligend den Kopf. Und jetzt? Sein Gesicht sah aufgedunsen aus, überhaupt war er in letzter Zeit sehr rund geworden. Hatte gar nichts Vitales, nichts Zupackendes mehr. Und die Schulterpartie erst! Es war kein Schwung in dem Mann, das konnte jeder sehen. Es war, als würde seine Frau alle Kraft aus ihm herausziehen. Die Witwe grübelte über den Verfall und kam zu dem Schluss, dass jeder Mann eine Aufgabe benötigte. Henri de Meli hatte keine Aufgabe. Er musste nicht arbeiten. Selbst um das gewaltige Vermögen musste er sich nicht selbst kümmern. Kein Wunder, dass man da zum Alkohol greift, setzte die Witwe ihren inneren Monolog fort.
Die Glocken begannen zu läuten. Langsam setzten sich die Menschen in Bewegung und suchten ihre Plätze in der Kirche. Florence hielt ihren Sohn Henry und die kleine Minnie an der Hand. Ihr Mann ging zwei Schritte vor ihnen gemeinsam mit seiner Mutter. Florence setzte sich zusammen mit den Kindern auf die Bank, auf der schon ihre Schwiegermutter und Henri Platz genommen hatten. Sie bekreuzigte sich.
»Minnie, zappele bitte nicht so mit den Beinen. Wir sind hier in der Kirche«, ermahnte sie ihre kleine Tochter.
Minnie stoppte das Schaukeln. »Dann setz ich mich zu Granny. Da darf ich schaukeln«, gab die Kleine zurück.
»Nein, du bleibst, wo du bist«, zischte Florence.
Und Minnie gehorchte beleidigt, bis sich die alte Frau de Meli einmischte: »Mein Schätzchen, nach der Kirche kommst du mit zu Granny. Da habe ich eine schöne Überraschung für mein kleines Mädchen!«
Minnie strahlte.
Florence zwang sich, ihre Schwiegermutter anzulächeln. Doch Antoinette de Meli würdigte Florence keines Blickes. Nervös suchte Florence die Hand ihres Sohnes. Ein zarter Druck, eine Vergewisserung. Der Junge lehnte sich noch enger an sie.
Die ersten Töne der Orgel erklangen. Henri de Meli richtete sich auf und faltete die Hände über seinem Bauch. Er fühlte sich elend. Der viele Absinth gestern. Doch die Abläufe an einem Sonntag waren unumstößlich. Gottesdienst, danach gemeinsames Mittagessen mit der ganzen Familie bei seiner Mutter und anschließend ein Spaziergang entweder an der Elbe entlang oder durch den Großen Garten. Nur bei schlechtem Wetter blieben sie in der Wohnung von Antoinette in der Lüttichaustraße 16 und legten Patiencen oder spielten eine Runde Bridge. Dann wurde Kuchen serviert, und zum Abschluss musste Henry junior am Hammerklavier zeigen, was er in der vorangegangenen Klavierstunde gelernt hatte. Henri stöhnte leise. Wahrscheinlich würde der Junge sich wieder verspielen oder vor lauter Aufregung gleich zu weinen anfangen. Es war ein Kreuz mit diesem Kind. Er lugte zur Seite und betrachtete seinen Sohn, der sich an seine Mutter schmiegte. Von Anfang an hatte ihm dieser Junge den Platz an der Seite von Florence streitig gemacht und ihn fortgedrängt. Henri dachte an das zersprungene Lineal. Er spürte, wie der Zorn zurückkehrte.
Florence’ Gedanken schweiften ab. Sie dachte an den Abend. Warum konnte nicht jeder Tag so wunderbar enden wie der gestrige? Mit Tanz, mit Musik, mit Lachen? Ach, um wie vieles leichter wäre doch das Dasein! Sie seufzte. Über ihren Sohn hinweg hörte sie ein tiefes, gleichmäßiges Atmen. Unauffällig blickte sie zur Seite. Henri war eingeschlafen. Sein Mund war halb geöffnet, der Kopf leicht zur Seite gefallen. Seine Mutter schien nichts zu bemerken. Florence griff über ihren Sohn hinweg an die Hüfte ihres Ehemannes und versetzte ihm einen kleinen Stoß. Henri schlug die Augen auf. Er lächelte ihr zu. Verschwörerisch. Sie zwinkerte zurück. Manchmal war das Gefühl wieder da, das Gefühl vom Anfang. Dann sah sie Henri an und war froh, dass er ihr Ehemann war. Er hatte seine guten Seiten. Henri streckte vorsichtig seine Hand nach ihr aus. Ihr Sohn saß zwischen ihnen. Sie drückte seine Hand und nahm den schwachen Alkoholgeruch wahr, den er noch immer ausströmte. Dann versuchte sie sich auf die Predigt zu konzentrieren, doch sie hatte längst den Faden verloren.
Antoinette de Meli überlegte kurz, ob sie den Wein beim Essen heute einmal weglassen sollte. Henri zuliebe. Damit er gar nicht erst damit anfing, doch dann kam es ihr seltsam vor. Ein Mittagessen – zumal an einem Sonntag – und keinen guten Tropfen Riesling? Warum sollten alle darben, nur weil ihr Sohn sich nicht unter Kontrolle hatte? Selbstbeherrschung war leider nie seine Stärke gewesen, dachte sie enttäuscht und gab dem Diener mit einem Kopfnicken zu verstehen, die Gläser aufzufüllen. Florence nippte nur an ihrem Glas. Sie sah unauffällig zu Henri. Ihm schien der Wein gutzutun. Seine Züge entspannten sich.
»So, mein Junge, probier einmal! Damit später ein echter Weinkenner aus dir wird.« Henri schob seinem Sohn das halbvolle Glas zu.
Antoinette de Meli zog die Augenbraue hoch. »Meinst du wirklich, der Junge muss jetzt schon daran gewöhnt werden?«
»Ja. In seinem Alter konnte ich schon den Unterschied zwischen einem Chardonnay und einem Rheinwein herausschmecken.«
Das Kind sah fragend zu seiner Mutter. Florence seufzte. »Henri, vielleicht sollten wir alle an diesem Tag eher Wasser trinken als Wein. Es war spät gestern.«
»Nein, nein. Lass nur! Prost, mein Junge!« Erwartungsvoll sah er zu seinem Sohn, der die Augen niederschlug und dem Wunsch seines Vaters entsprach. Nach wenigen Schlucken stellte er den Kelch wieder ab. Sein Gesicht färbte sich rot, er versuchte einen Hustenanfall zu unterdrücken. Schnell nahm Florence die Damast-Serviette und hielt sie schützend über seinen Mund. Der Junge keuchte und prustete.
Sein Vater lachte. »So schlimm schmeckt dieser Tropfen nun wirklich nicht. In diesem Weinkeller werden nur gute Weine verwahrt, nicht wahr, Mutter?«
Antoinette de Meli ignorierte ihn und schwieg. Florence antwortete an ihrer Stelle. »Henry ist noch ein Kind. Er verträgt keinen Alkohol.« Und leise fügte sie hinzu: »Sein Vater auch nicht.«
Henri funkelte sie böse an. Die Wut war wieder da. Wie diese Frau ihn nur immer wieder provozierte!
Florence drehte sich zu ihrer Schwiegermutter. »Wie geht es Mary? Ich habe sie seit bestimmt zehn Tagen nicht gesehen. Und heute ist sie leider auch nicht bei uns.«
»Auch wenn man bei Tisch nicht über Krankheiten und Gebrechen spricht«, dieser Tadel musste sein, fand Antoinette, »kann ich dir sagen, dass sie sich auf dem Weg der Besserung befindet. Aber sie muss weiterhin das Bett hüten. Sie bedauert sehr, dass sie nicht hier bei uns sitzen kann«, antwortete sie spitz. »Am Freitag war Dr. Zumpe noch einmal bei ihr. Mit jedem Tag wird es besser, ich bin sehr erleichtert.«
»Wie schön, dies zu hören!« Florence hatte die Kritik an ihrer Frage sofort verstanden und ärgerte sich über sich selbst, dass sie ihrer Schwiegermutter wieder Anlass für Kritteleien gegeben hatte. Aber sie vermisste das freundliche Gesicht ihrer Schwägerin in dieser Runde. »Gern würde ich sie in der nächsten Woche besuchen kommen, wenn es erlaubt ist«, fügte sie hinzu.
»Wir sollten besser noch eine Woche warten, denke ich. Mary hat eine schwache Konstitution. Schon als Kind musste ich mich mehr um sie kümmern als um meinen Henri. Sie gleicht ihrer Großmutter väterlicherseits nicht nur äußerlich – auch, was das Zarte angeht«, antwortete Antoinette und erinnerte sich kurz an ihre eigene Schwiegermutter, die selten das Haus verlassen hatte und früh verstorben war. Vor drei Wochen erst war Mary 42 Jahre alt geworden. Sie würde nicht mehr heiraten. Es hatte sein Gutes, eine Tochter bei sich zu behalten. Sie könnte sich um mich kümmern, wenn ich alt bin, so hatte es sich Antoinette vorgestellt. Doch nun war es umgekehrt. Auch weitere Enkelkinder konnte sie nicht erwarten. Nicht von Mary. Ein Jammer.
Antoinette tupfte sich die Lippen mit der Serviette ab. Gott machte es ihr nicht leicht. Der Ehemann – ein Tunichtgut, der jedem Rock nachgestiegen war. Die einzige Tochter – schwach und blass daheim. Der Sohn – gefangen in einer Mesalliance. Die Schwiegertochter eine Erbschleicherin mit unstetem Charakter. Nur die beiden Enkelkinder gaben ihr Anlass zur Freude. Besonders die kleine Minnie, benannt nach ihr. Antoinette de Meli. Ein entzückendes kleines Mädchen, zum Glück ganz anders als die flatterhafte Mutter. Antoinette betrachtete das Kind mit tiefer Zuneigung. Die dunklen Locken, die großen Augen – eine kleine Schönheit wuchs hier heran.
Florence beobachtete ihre Schwiegermutter unauffällig. Sie wusste, wie sehr die alte Frau an Minnie hing. Zu ihr war sie zärtlich, liebevoll und nachsichtig.
Das Essen war beendet. Nun noch ein Tässchen Mokka. Die Etagere mit dem Vanillegebäck stand wie von Zauberhand auf dem Tisch. Der Haushalt von Antoinette de Meli funktionierte geräuschlos und perfekt. Bei den jungen de Melis in der neuen Wohnung in der Räcknitzstraße ging es etwas anders zu. Gott sei Dank wohnten sie jetzt nicht mehr in derselben Straße, dachte Florence oft. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätten sie ruhig noch ein bisschen weiter wegziehen können. Doch Henri war dagegen gewesen. Und so lebten sie nun in zwei Parallelstraßen. Immer noch ein Katzensprung für Antoinette de Meli, die viel zu oft vorbeikam, um nach dem Rechten zu sehen, fand Florence.
Sie schaute aus dem Fenster. Zwischen den französischen Vorhängen mit den aufgestickten Pfauen war ein Stück blauer Himmel zu sehen. Immerhin – dann könnten sie wenigstens einen Spaziergang machen. Sie mochte die viel zu große Wohnung ihrer Schwiegermutter nicht. Die Vorliebe für strenge dunkle Möbel nach gotischem Vorbild stieß sie ab.
Nur einmal fand Florence Gefallen an neugotischen Möbeln. Im Restaurant »Hubertus« in Pillnitz, wo sie mit Baron von Geyso im vergangenen Sommer einmal zum Essen verabredet gewesen war. Sie hatten sich blendend verstanden, der Baron und Florence. Endlich einmal ein Mann, der genauso gern lachte wie sie. Er könnte ihr Vater sein vom Alter her. Aber ein fröhlicher Charakter ist keine Frage des Alters, dachte sie versonnen. Es war alles ganz harmlos. Es war alles ganz wunderbar gewesen …
»Na, freust du dich schon auf den Spaziergang? Du scheinst ja bester Stimmung zu sein«, hörte sie die Stimme von Henri. Und ihr wurde schwer ums Herz.
5. Arztbesuch
Dresden, 04. Oktober 1881, am Nachmittag
Florence stand auf dem Balkon und rauchte. Henri war im Club. Wahrscheinlich würde er erst spät am Abend nach Hause kommen. Doch ihre Schwiegermutter war schon wieder in der Wohnung und blieb einfach, auch wenn Henri gar nicht da war. Mittlerweile kam Antoinette fast täglich vorbei und verbrachte die Nachmittage in der Räcknitzstraße. Sie hatte ihr Stickzeug dabei oder etwas zum Lesen. Manchmal beschäftigte sie sich mit den Enkelkindern. Dann wieder ließ sie sich in der Küche blicken und warf einen kritischen Blick in die Planung der Mahlzeiten. Florence seufzte. Zum Glück hatte sie jetzt gerade ein paar Minuten Ruhe vor ihr. Hier, auf dem schmalen Balkon, der zum Hof hinausging, würde sie niemand sehen, glaubte sie.
Sie hörte ein Klopfen. »Gnädige Frau, hier ist der Aschenbecher, ich habe ihn sauber gemacht.« Es war die Stimme von Adele, dem Dienstmädchen. Was musste sie sich nicht alles anhören, nur wegen ein paar Rauchwölkchen am Tag. Sogar die Kaiserin von Österreich sollte eine starke Raucherin sein. Die berühmte Elisabeth mit ihren prachtvollen Haaren – Florence hatte neulich erst ein Bild von ihr in einem Modemagazin gesehen. Sie überlegte, wer ihr erzählt hatte von dem Laster der Kaiserin. Irgendjemand vom Hof des sächsischen Königshauses hier in Dresden. Florence kannte einige deutsche Herzoginnen und Gräfinnen, die im Dienste der königlichen Familie standen. Florence’ Deutsch war gut, ihre Stellung durch die Heirat mit Henri herausragend. Die de Melis wurden auch unter den Deutschen als schwerreiche, adelige Familie aus New York betrachtet. Dabei gab es das doch gar nicht. Adel in Amerika.
Sie stieß die Luft aus. Wie unwürdig, dass sie hier stehen musste für diesen kleinen Moment der Entspannung. Wenn Henri am Abend seine Zigarren rauchte, saß er im Salon und musste sich nicht rechtfertigen. Eine Frau hatte es nicht leicht, dachte sie und erinnerte sich an ein Gespräch mit ihrer Freundin Minna von Funcke, die ihr von der Frauenbewegung berichtet hatte. Unvorstellbar, was diese kämpferischen Frauen forderten: Wahlrecht, Mitbestimmung, eine richtige Ausbildung, vielleicht sogar den Zugang zur Universität. Nun, bestimmt nicht für mich, überlegte Florence. Aber vielleicht für Minnie? Wer wusste schon, was die Zukunft brachte? In einem Punkt würde sie ihrer Tochter jedoch unbedingt helfen, sie sollte einen guten Mann heiraten. Nicht nur eine gute Partie, nein, einen guten Mann. Genügend Geld war wichtig, Bildung und Stand auch. Doch es durfte nicht an Herzenswärme und Güte fehlen, fand Florence und fragte sich zum x-ten Mal, warum diese Seiten bei Henri so im Verborgenen lagen.
Wieder klopfte es zaghaft von innen an die Glasscheibe. Adele knickste. »Gnädige Frau, Dr. Zumpe ist da.«
»Dr. Zumpe? Ich habe ihn nicht herbestellt. Wollte er zu Henri? Der ist im Club.«
Adele zuckte die Schultern. »Was soll ich ihm ausrichten?«
»Ach, ist schon gut, Adele. Bitte führen Sie ihn in den Salon. Ich bin gleich so weit. Und sagen Sie doch bitte der Kinderfrau, dass sie die Kinder zurechtmachen soll. Ich möchte mit den beiden zur Brühl’schen Terrasse und einen Kakao trinken.«
Das Dienstmädchen machte sich auf den Weg, und Florence ging in den Salon, nicht ohne sich noch einmal etwas von dem Orangenparfüm aufzutragen.
Der Arzt saß zusammengesunken auf dem Sofa und schien seinen Gedanken nachzuhängen. Als Florence den Raum betrat, erhob er sich schnell. »Meine liebe Frau de Meli, wie schön, Sie zu sehen!«, begrüße er sie galant und deutete einen Handkuss an.
Sie tauschten ein paar Höflichkeiten aus, bis Florence direkt nachfragte: »Wer hat nach Ihnen schicken lassen? Wenn Sie zu meinem Mann wollen, müssten Sie morgen noch einmal wiederkommen. Henri ist im Club.«
Der Arzt schüttelte den Kopf. »Nein, nein. Ich wollte tatsächlich zu Ihnen, meine liebe Frau de Meli. Gucken Sie nicht so überrascht! Ganz harmlos, ganz harmlos«, sagte er mit einem Lächeln.
»Dann klären Sie mich doch bitte auf! Ich fühle mich sehr gut. Kommen Sie in einer anderen Angelegenheit?«
»Nun«, fing Carl Julius Zumpe an. »Manchmal hat man selbst das Gefühl, man sei in ausgezeichneter Verfassung. So will ich es einmal vorsichtig formulieren.«
Florence runzelte die Stirn. »Ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen …«





























