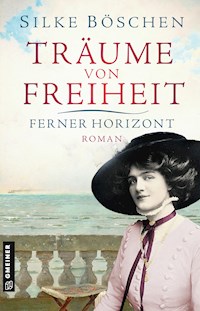Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Träume von Freiheit
- Sprache: Deutsch
Schön. Reich. Begehrt. Die Millionenerbin Mary Knowlton gehört 1892 in New York zur High Society. Durch die Heirat mit einem deutschen Grafen wird sie in den USA zum Star. Aber der Adel in Berlin ist skeptisch. Jahrelang kämpft Gräfin Mary um Anerkennung. Sie kauft ein Schloss in Schlesien, und als Kaiser Wilhelm II. hier zu Gast ist, hat sie es geschafft. Jetzt gehört sie auch in Deutschland dazu. Doch der Erste Weltkrieg setzt dem Glück ein jähes Ende. 1918 erklären die USA die amerikanische Gräfin zur Staatsfeindin …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Silke Böschen
Träume von Freiheit – Fünftausend Fasane für den Kaiser
Roman
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2024 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Susanne Tachlinski
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Bilder von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Virg._Valli_LCCN2014715533.jpg und Library of Congress, Prints & Photographs Division, [LC-B2- 403-15]
ISBN 978-3-8392-7810-9
Widmung
Für Fiete. Den besten Dackel.
Teil I
Prolog
Die alten Dielen knarren. Mit jedem Schritt wirbelt Staub auf. Der junge Mann vor mir dreht sich kurz um, zeigt warnend auf den Untergrund im nächsten Zimmer. Hier liegen keine Dielen mehr, nur die Holzkonstruktion darunter. »Vorsicht!«, mahnt er. Ich balanciere auf den Balken, muss aufpassen, dass ich nicht danebentrete. Stopp. »Hier oben, das ist Original!« Er weist auf Stuckarbeiten über dem nächsten Durchgangsportal. Dunkelgrau von Staub, aber gut erkennbar wölbt sich eine Flinte gekreuzt mit einer Patronentasche und einem Waldhorn aus der Wand – eingerahmt von Eichenlaub. Symbole für die Jagd. »Jetzt kommt das Zimmer, in dem der Kaiser gewohnt hat.« Eine Art Erkerzimmer, fast rund. An der Decke überkreuzen sich Ornamente. Wie ein Zeltdach aus Gips. Eine Nacht hat Kaiser Wilhelm II. hier verbracht. Im November 1911.
Damals ging für die Schlossherrin ein Traum in Erfüllung. Einer der mächtigsten Männer war ihr Gast. Der Kaiser. Sie war Amerikanerin. Und Gräfin in Deutschland. Sie ließ ein amerikanisches Thanksgiving-Dinner mit Truthahn und Cranberrys servieren. Für den Monarchen war es nur eine kleine Jagdgesellschaft, der »Reisekaiser«, wie er genannt wurde, brach am nächsten Tag gleich wieder auf. Zur nächsten Jagd auf das nächste Schloss. Für Mary Gräfin von Francken-Sierstorpff, geborene Mary Knowlton aus Brooklyn, aber war sein Abstecher auf ihr Schloss der gesellschaftliche Höhepunkt in ihrem Leben. Nach beinahe 20 Jahren in Deutschland hatte sie es geschafft: war Gastgeberin im eigenen Schloss und tischte ein amerikanisches Nationalgericht für den deutschen Herrscher und andere namhafte Mitglieder des Hochadels auf. Auf der anderen Seite des Atlantiks, in Amerika, überschlugen sich die Zeitungen mit Berichten über dieses Ereignis.
Mein Baustellen-Führer mahnt zur Eile. Das Schloss sei groß, wenn ich noch mehr sehen wolle … Natürlich! Deshalb bin ich 700 Kilometer weit gefahren, um hier in Polen, in Oberschlesien, das Schloss zu finden, in dem »Mae«, Gräfin von Francken-Sierstorpff, gelebt hat. Sie wollte unbedingt ein eigenes Schloss, hier fand sie es – in einem kleinen Dorf zwischen weiten Feldern und Wäldern. Schloss Zyrowa, ein altes Barockgemäuer. 1899, als sie, die neue Herrin von Zyrowa, begann, das Gebäude zu restaurieren, sah es vielleicht so ähnlich aus wie jetzt. Keine Zeit, darüber nachzudenken. Schnell weiter in den Innenhof. Quadratisch liegt er vor mir. Die überdachten Gänge wirken beinahe wie Kreuzgänge oder Arkaden. Bestimmt ist sie hier gewandelt. »Das ist der direkte Weg zur Kirche«, erklärt mein Begleiter in klarem Deutsch. Und ja, unmittelbar neben dem Schloss steht die Kirche. Leider verschlossen. Der Pfarrer ist nicht auffindbar. Er hat den Schlüssel. In der Kirchengruft liegt Mary, die amerikanische Gräfin, bestattet. Zusammen mit ihrem Mann und ihrem ältesten Sohn. Draußen scheint die Sonne. Ein warmer Oktobertag. Man hört das Hämmern aus den verschiedenen Stockwerken. Eine Bohrmaschine rattert. Aus dem Schloss soll ein Luxushotel werden. Unter Denkmalschutz-Bedingungen, erzählt der Bauherr mit einem Stöhnen. Seine »rechte Hand« übersetzt es für mich. Jetzt hätten sie noch andere Dinge zu erledigen. Ich dürfe mich allein umschauen. Aber immer vorsichtig! Es ist eine Baustelle. Ich weiß.
Langsam gehe ich zurück in das Gebäude. Ich muss mich kurz orientieren. Lange Gänge. So viele Zimmer. Noch einmal durchwandere ich das Schloss. Die Bauarbeiter unterbrechen ihre Arbeit, wenn ich vorbeimuss. Ein weiterer Gang. Staubige Holzdielen. Aber keine offenen Bereiche, in die man stürzen könnte. Doch ein großes Hindernis liegt auf dem Weg. Ein Flügel, auf die Seite gedreht, vom Staub fast weiß, die hölzerne Abdeckung ist abgebrochen und verrutscht. Die Tasten sind noch da. Nicht mehr vollständig. Das Instrument wird von einem Eisengerüst gehalten, damit es nicht ganz umkippt oder damit niemand mit einer Schubkarre mit Zementsäcken dagegenfährt. Vielleicht hat Mae auf dem Flügel gespielt? Vielleicht gehörte er ihr? Welche Musik mochte sie? War sie eine gute Klavierspielerin? Hatte sie eine schöne Singstimme? Hat sie deutsche Lieder gesungen mit amerikanischem Akzent?
Zwei Monate später stehe ich wieder vor einem Flügel. Dieser hier ist auf Hochglanz poliert, in seinem schwarzen Lack kann ich mich spiegeln. Ich bin in den Geschäftsräumen von Steinway and Sons in Manhattan. Dem berühmtesten Klavierbauer der Welt. Eine berufliche Reise nach New York hat mich hierhergeführt. Der CEO der Firma ist da, es gibt Häppchen, eine Pressekonferenz und ein Privatkonzert. Vor 130 Jahren lebte Mae hier ganz in der Nähe. Nur eine Viertelstunde zu Fuß entfernt wohnte sie kurz vor ihrer Hochzeit 1892 ein halbes Jahr im Hotel »Cambridge«, Fifth Avenue, Ecke 33th Street. Gleich beim Empire State Building, aber das gab es damals noch nicht. Nach Brooklyn, wo ihr Elternhaus stand, schaffe ich es nicht. Die Tage sind verplant. Der Verkehr ist chaotisch. Nicht einmal ein Krankenwagen kommt trotz heulender Sirene vom Fleck. Es laut und voll. Auch zu Maes Lebzeiten war es das schon. 1890 lebten in New York 1,5 Millionen Menschen. Die Straßen waren auch verstopft – aber mit Kutschen, Fuhrwerken, Pferdebahnen und Fußgängern.
Und dann verschlug es Mae nach Zyrowa. Ein winziges Dorf. Ein paar Hundert Einwohner. Kopfsteinpflaster.
Die Bäume im Schlosspark rauschen im Wind. So wie vor über hundert Jahren. Zeitsprung. Aus einem geöffneten Fenster erklingt eine Melodie. Jemand spielt Klavier. Eine Amsel im Baum hält inne. Es riecht nach Heu. Die Rasenflächen im Schlosspark sind gemäht worden. Eine Frau mit Kopftuch und sonnengegerbtem Gesicht harkt die Halme zusammen. Leise summt sie zu den Klängen aus dem Schloss. Die Gräfin musiziert. Vielleicht war es so.
1. Am Vorabend
Brooklyn, 26. April 1892
Es klopfte leise an der Tür.
»Hallo? Wer ist da?«
Mae sprang auf und versuchte hastig, den Paravent vor die Schneiderpuppe zu ziehen. »Einen Moment!«
Die lackierten Holzelemente mit den chinesischen Malereien darauf begannen zu wanken. Das Kleid! Der Bräutigam durfte das Kleid nicht sehen! Mae riss so heftig an dem Raumtrenner, dass zwei Flügel zusammenklappten. Sie war nicht schnell genug. Zwei Finger klemmten zwischen den Holzplatten. Sie schrie leise auf vor Schmerz. Die Zimmertür öffnete sich.
»Nein!« Mae schluchzte. »Mein Kleid …«
»Oh Gott, Mae, was machst du da?« Madame de Meli schloss schnell die Tür und befreite Maes Hand aus dem hölzernen Ungetüm. Die Finger der rechten Hand waren geschwollen, an einem Nagel trat Blut hervor. Die Gesellschafterin zog ein Taschentuch aus ihrem Ärmel und legte es um die Verletzung. Mae weinte.
»Ich wusste ja nicht, dass Sie es sind. Ich dachte, es wäre Johannes oder mein Vater.«
»Beruhige dich. Nein, die Männer sind doch gar nicht im Hause. Dein Vater ist mit Johannes noch einmal in den Hamilton Club gegangen.« Kopfschüttelnd läutete Florence de Meli nach einem Dienstmädchen und verlangte nach einem kalten Wickel und Eisstücken.
Wenig später saß Mae mit blassem Gesicht und verbundener Hand auf dem Sofa. Der Paravent stand wieder an seinem Platz und schirmte den Blick ab von dem Wunder, das auf der Schneiderpuppe auf seinen Einsatz wartete. Das Kleid war vor einem Monat aus Paris angekommen. Ein Traum aus weißem Seidensatin, über und über mit Volants aus Tüll und Spitze versehen. Die Ärmel, die jetzt auf dem toten Puppenkörper seltsam abgespreizt im Raum standen, waren noch einmal hier in Brooklyn von der Schneiderin nachgebessert worden, auf die Madame de Meli für solche Zwecke schwor.
Die Ärmelöffnungen bestanden aus hauchdünner Spitze, die auf die Hände der Braut fallen sollte. Morgen am Tag ihrer Hochzeit. Wenn Johannes Mae den Ring überstreifen würde, würde sich dieser Spitzenvorhang öffnen, und sie würde ihm die Hand darreichen. Der Ring. Das Symbol der Unendlichkeit. Der unendlichen Liebe. Mae tastete nach ihrer verbundenen Hand und zuckte zusammen. Das Blut pochte und der Schmerz war wieder da. Madame de Meli sah Mae an und dann die bandagierte Hand. »Ich weiß, woran du denkst. Darf ich? Ich bin ganz vorsichtig.«
Behutsam löste sie den Verband. Die Finger waren geschwollen.
»Oh nein, da passt kein Ring drüber!« Mae starrte entsetzt auf ihre verletzte Hand.
»Wir kühlen sie weiter. Du wirst sehen, morgen ist davon nichts mehr zu sehen. Und falls doch, wird Johannes dir den Ring auf die linke Seite stecken. So wie man das in Amerika macht. Es muss nicht alles nach deutschem Brauch passieren.« Florence de Meli strich ihrem Zögling beruhigend über den Arm. »Ein Schlückchen Champagner wird unsere Nerven beruhigen«, bestimmte sie und läutete abermals nach dem Dienstmädchen.
Die Gläser klirrten. Florence de Meli nahm einen großen Schluck. Mae zögerte.
»Was ist, mein Engel? Bist du so kurz vor deiner Hochzeit unter die Guttempler gegangen? Das wäre sehr schade, bei all den Kisten mit den feinen Weinen und der Ladung Champagner, die dein Vater für deinen großen Tag geordert hat.« Madame de Meli lachte leise.
Mae schüttelte den Kopf. »Ich denke, als Braut sollte ich einen klaren Kopf behalten. Ich möchte keinen Fehler machen.«
Ihre Gesellschafterin schnalzte mit der Zunge. »Ach, Mae. Jetzt beruhige dich bitte. Es ist alles vorbereitet. Weißt du, wie viele gute Geister seit Tagen hier in diesem Haus unterwegs sind und alles dafür tun, dass morgen der schönste Tag deines Lebens stattfinden wird? Allein, was Charles Thorley angestellt hat … Er ist wahrhaftig ein Künstler mit all den Blumen! Das ganze Haus duftet nach seinen Kreationen. Man ist wie im Rausch, wenn man nur die Treppe hinuntergeht. Überall Lilien und Rosen. Ein Traum!«
Mae nickte. »Unser Haus sieht aus wie ein riesiger Garten. Mitten im April.«
»Wie ein Paradies, würde ich sagen … Und in der Küche duftet es genauso gut. Nicht nach Blumen, aber nach Köstlichkeiten.« Die Gesellschafterin seufzte etwas theatralisch. »In letzter Zeit landet jeder Bissen bei mir direkt auf der Hüfte. Das ist wohl das Alter. Ansonsten würde ich mich nur da unten in der Küche tummeln und alles probieren.«
Mae sah sie an. »Aber Sie sind doch gertenschlank, Madame! Wie immer.«
Florence de Meli lächelte geschmeichelt und leerte ihr Glas. »Aber sag einmal, du wirst jeden Tag schlanker. Wir mussten dein Kleid schon zweimal enger machen. Das ist die Aufregung, nicht wahr? Ach, ich weiß noch, damals bei meiner Hochzeit. Oh Gott, war ich jung. 16 Jahre alt. Verrückt. Dagegen bist du als Braut mit deinen 21 Jahren schon ganz erwachsen. Hast viel mehr von der Welt gesehen als ich damals.«
Mae atmete aus. Der Schmerz in ihrer Hand schien nachzulassen. Oder lag es am Champagner, dass sie sich besser fühlte? Sie lehnte den Kopf zurück. Das Sofa war trotz seiner zierlichen Beine und der steifen Polsterung halbwegs bequem. Sie würde es mitnehmen nach Deutschland, dachte sie. Sie musste ein paar vertraute Dinge um sich haben, wenn sie dort ganz allein war, ganz allein mit ihrem Ehemann. Sie richtete sich wieder auf. Ihr Rücken wurde steif. Ihr Ehemann. Eheleben. Ehebett. Sie nahm die eiskalte Flasche aus dem silbernen Kühler und schenkte die Gläser noch einmal voll.
»Na, siehst du? So ein Schlückchen tut manchmal gut.« Florence de Meli setzte sich zu ihr und sah sie von der Seite an. »Trotzdem … du siehst blass aus. Die Hand?«
Mae schüttelte den Kopf. »Ach, ich mag gar nicht darüber sprechen. Aber …«
»Was ist los? Bekommst du kalte Füße so kurz vor dem Jawort?«
»Nein, nein. Ich dachte nur gerade an Deutschland.«
»Aber Mae, du magst doch Deutschland! Wir haben so eine schöne Zeit dort verbracht. Erinnerst du dich nicht mehr? In Berlin, in Heidelberg, im schönen Dresden … Und dann Hamburg! Dort hast du Johannes kennengelernt!«
Mae nickte, Madame hatte recht. Es war herrlich gewesen. Und dank ihrer Gouvernante war sie sogar in der Lage gewesen, sich auf Deutsch zu verständigen. Was für ein Glück! Sonst hätte sie gar nicht mit Johannes ins Gespräch kommen können. Seine Englischkenntnisse waren damals bescheiden gewesen. Mittlerweile hatte er aufgeholt. Wie würde er sich sonst unterhalten im Hamilton Club? Heute Abend. Zwischen lauter Amerikanern. Lauter Männern. Ihr Unwohlsein wurde größer.
»Jetzt aber heraus mit der Sprache!« Florence de Meli klang bestimmt.
Dieses Strenge, Unnachgiebige sah Mae selten an ihr. Schließlich gab sie ihr kaum Anlass dafür. Und Madame war doch eigentlich bei aller Etikette ein lebhafter Mensch. Mae erinnerte sich an einen Abend in Dresden im Sommer 1889. Sie saßen in einem Restaurant auf der Terrasse mit herrlichem Blick auf die Elbe. Zwei langjährige Freundinnen ihrer Gesellschafterin waren gekommen. Und Madame wurde immer ausgelassener mit jedem Glas Wein. Irgendwann begann sie sogar zu singen. Zum Glück war die Terrasse zu dem Zeitpunkt schon halb leer gewesen. Die Freundinnen hatten gelacht und sich vielsagend angesehen.
Mae blickte zu Boden.
»Bitte, Mae, keine Geheimnisse!« Florence de Meli berührte sie am Kinn und drehte ihren Kopf in ihre Richtung. »Was bewegt dich?«
»Also … also … ich habe Angst davor, mit Johannes allein zu sein. Ganz allein, meine ich. Am Abend …«
»Du meinst die Liebe? Zwischen Eheleuten?«
Mae nickte heftig. Sie liebte ihn! Ja, sie liebte ihn wirklich. Seine braunen Augen, die dunkle Stimme, den gezwirbelten Schnurrbart, seine Hände, sein Temperament. Oh Gott! Sein Temperament! Sein Spitzname war »Sturm«. Wenn er in allen Lebensbereichen so ungestüm war …
»Aber wir hatten doch schon darüber gesprochen. Und wo ist dieses Buch, das ich dir zum Lesen gegeben habe? Hast du nicht hineingesehen?«
»Doch. Ich habe es hier.« Mae zog es hinter einem Sofakissen hervor, wo es gut versteckt und harmlos in einem karierten Stoffeinband lag. Sie nahm ein Lesebändchen heraus und las mit stockender Stimme vor:
»Zuweilen geschieht es, dass die Vollendung der Ehe auf Schwierigkeiten stößt. In diesem Fall muss man stets mit Vorsicht, Klugheit und Nachsicht zu Werke gehen und alle Hast und Gewalt vermeiden. Nur die Folgen ungezügelten Ungestüms sind zu fürchten.«
Sie klappte das Buch wieder zu.
»Glauben Sie, dass Johannes ungezügelt ist? Und was bedeutet die Vollendung der Ehe denn nun wirklich? Ich werde aus dem Buch nicht schlau.«
Madame de Meli stand auf und ging langsam zum Kleiderständer mit dem Brautkleid darauf, dem Symbol von Maes neuem Lebensabschnitt. Von der Jungfrau zur Ehefrau. Sie musste jetzt etwas sagen. Das war sie Mae schuldig, die manchmal fast wie eine Tochter für sie war. Die Gesellschafterin drehte sich langsam um. Ihr Kleid raschelte leise. Sie knetete die Hände. »Wie ein Mann aussieht, weißt du. Ich meine, ohne Kleidung.«
Mae nickte. »Ja, ich habe eine Zeichnung gesehen.«
»Gut.« De Meli suchte nach Worten. »Also, das Geschlecht des Mannes ändert durch Erregung seine Gestalt.«
Mae riss die Augen auf.
Jetzt nur schnell weitererzählen, dachte Florence de Meli. Mit Schaudern erinnerte sie sich an ihre ersten eigenen Erfahrungen. Das hätte Mae nicht verdient. Keine Frau hätte das.
Sie fuhr fort. »Nun, wenn es geschieht, kommt es zur körperlichen Vereinigung.« Kleine Schweißperlen traten auf ihre Oberlippe. Wie sollte sie es nur erklären, ohne dass das Mädchen vor Schreck in Ohnmacht fiel?
»Liegen wir dann nebeneinander im Bett?«
Madame de Meli schüttelte den Kopf. »Nein, äh, Mann und Frau liegen ineinander verschlungen, sonst … sonst funktioniert es nicht.«
»Was?«
»Die Vereinigung. Der Samen des Mannes muss in den Körper der Frau gelangen. Schließlich wollt ihr eine Familie gründen.« Sie schritt auf das Sofa zu und suchte in dem karierten Buch nach der passenden Passage.
»Hier steht es: Der große Zweck der ehelichen Verbindung ist die Fortpflanzung – eine Pflicht, welche notwendig ist, um die beständigen Verheerungen durch den Tod auszugleichen und so die Race zu erhalten. In der Erfüllung dieser erhabenen Aufgabe spielt das Weib die Hauptrolle, da sie der Ursprung und die Bewahrerin des künftigen Wesens ist.«
Mae spürte ihre verletzte Hand kaum noch. Ja, sie wollte Kinder haben, und Johannes auch. Sie hatten darüber gesprochen. Über einen kleinen Stammhalter, der eines Tages den Grafentitel weitertragen würde, aber dafür diese Ungeheuerlichkeiten auf sich nehmen? Wenn selbst eine so erfahrene Frau wie Madame de Meli kaum darüber sprechen konnte … Das Blut unter dem kalten Wickel um ihre Hand pochte deutlich. Der Schmerz war noch da.
»Mae, hier steht es! ›Sei so behutsam wie eine Mutter zu ihrem Kinde!‹ Das rät der Autor dem Mann. Bestimmt wird dein Johannes ein zärtlicher Ehemann sein.«
Sie hoffte es selbst sehr für ihren Schützling. Aber zart und behutsam? Der Leutnant hatte ein energisches Auftreten.
Madame de Meli klappte das Buch zu. »Papperlapapp! Kindchen, jetzt mach dich nicht verrückt. Die Menschheit wäre längst ausgestorben, wenn das Beisammensein zwischen Mann und Frau so schlimm wäre, wie du es dir gerade ausmalst. Denk immer daran, er liebt dich! Und wenn ich dir noch einen Tipp geben darf: Leg nach und nach deine Zurückhaltung ab. Das wird er mögen. Sonst sucht er sich seine Erfüllung anderswo …«
Florence de Meli erinnerte sich an ihren geschiedenen Ehemann Henri, der irgendwann in den Armen der eigenen Köchin gelandet war. Zum Glück war sie zu dem Zeitpunkt schon auf und davon gewesen.
»Hast du etwas dagegen, wenn ich mir eine Zigarette anzünde?«
Mae schüttelte den Kopf. Sie stand auf und holte den kleinen kristallenen Aschenbecher, den sie in ihrem Sekretär aufbewahrte.
Mit ihrer unverletzten Hand griff sie nach dem Arm ihrer langjährigen Gouvernante. »Madame, bitte verschweigen Sie mir nichts! Ich habe das ganze Buch durchgelesen. Da steht auch etwas von unnatürlichen Positionen, die man vermeiden soll, sonst kann man blind werden oder wahnsinnig oder man stirbt.« Ängstlich sah sie ihre Ratgeberin an.
Florence de Meli musste husten. Sie hatte sich am Rauch ihrer Zigarette verschluckt. »Mein Gott, Mae, bitte glaub nicht jedes Wort, was darin steht.« Sie atmete aus. »Vermutlich hat dein Johannes schon Erfahrung, und er wird ganz vorsichtig mit dir umgehen. Du wirst weder blind noch verrückt. Und sterben wirst du davon auch nicht.« Sie nahm einen tiefen Zug von ihrer Zigarette. »Lass uns setzen, und ich versuche es noch einmal und erkläre dir alles.«
Beide Frauen nahmen wieder auf dem Sofa Platz.
»Du hast wunderschöne Nachthemden. Und davon wirst du eines in der Hochzeitsnacht tragen, ja?«
Mae nickte.
»Er wird dich küssen und zärtlich zu dir sein. Ich bin mir sicher.« Sie redete schneller. »Dann legst du dich auf den Rücken, und er legt sich auf dich und wird in dich dringen.« Sie klang kurzatmig. Zu viele Zigaretten! Madame de Meli nahm einen Schluck Champagner und strich Mae über den Unterarm. »Es soll auch Frauen geben, denen es gefällt.«
»Ach, ist es nicht automatisch so?« Wieder diese schreckhaft aufgerissenen Augen.
Florence de Meli ärgerte sich über ihren letzten Satz, damit hatte sie das arme Mädchen erneut verängstigt.
»Doch, normalerweise schon«, beruhigte sie Mae. »Viel wichtiger ist jetzt, dass die Verletzung deiner Hand schnell abheilt.«
Mae strich über ihren Verband und nickte beklommen. Ihr schwirrte der Kopf, und die Finger schmerzten. Aber bis morgen würde alles gut werden, bestimmt.
2. Ein Blumenmeer
Brooklyn, 27. April 1892
Der linke Schuh drückte entsetzlich. Die zarten Satinschuhe aus Paris waren sehr knapp geschnitten. Am rechten Fuß ging es, aber links … Mae stöhnte. Wie sollte sie damit die Treppe herunterkommen und lächeln?
»Der Schuh ist zu eng! Mir tut alles weh.«
»Einen Moment, bitte, ich sage Madame de Meli Bescheid.« Sophie, das irische Dienstmädchen, verabschiedete sich mit einem Knicks und lief eilig davon auf der Suche nach der Gouvernante. Sie nahm die Dienstbotentreppe. Denn der breite Aufgang für die Herrschaften war über und über mit Rosen, Lilien und Tuberosen geschmückt. Der Duft war überwältigend. Und auch der Geräuschpegel im Haus stand dem in nichts nach. Die junge Dienerin war beeindruckt von der Zahl der Gäste, die sich im Erdgeschoss versammelt hatten. Noch nie hatte sie so viele Menschen in dem Haus der Knowltons erlebt, und schon gar nicht so viele ausladende Hüte mit wippenden Federn und prächtigen Bändern oder Frisuren, in denen glitzernde Diamantspangen und -kämme steckten. Sie beeilte sich. Zum Glück war sie hier nur das Dienstmädchen und nicht die Braut.
Mit Schwung riss Florence de Meli die Tür zu Maes Zimmer auf. Drei Frauen wirbelten um die junge Braut herum, darunter die Friseurin, die Maes dunkelblondes Haar zu einer kunstvollen Frisur hochgesteckt hatte. Die letzten Haarnadeln wurden gesetzt. Der Schleier saß fest. Das Brautkleid floss über das Sofa, auf dem Mae mit unsicherem Blick saß.
»Wie kann ich helfen, liebste Mae? Ist es der Finger?« Florence sah skeptisch auf Maes rechte Hand, die immer noch leicht geschwollen aus dem Ärmel lugte.
»Nein, der Finger tut fast nicht mehr weh. Aber mein Schuh, sieh nur, er ist zu eng.« Ihr war zum Weinen zumute.
»Nanu, das ist ja wie im Märchen. Aschenputtel. Aber du bist doch die Braut und keine böse Schwester.« Florence lachte. »Das haben wir gleich.«
Sie verschwand so schnell, wie sie gekommen war, und kehrte mit einer Flasche Whiskey zurück. »Gib mir den Schuh.« Florence goss schwungvoll den Alkohol hinein. »Jetzt wird es besser gehen.« Der nasse Schuh kehrte an den Fuß zurück.
Mae rümpfte die Nase. »Jetzt rieche ich nach Whiskey! Was soll Johannes denken? Und die Gäste?« Ihre Stimme zitterte. Es war alles zu viel. Seit Tagen bebte das Haus, 201 Columbia Heights, Ecke Pierrespont Street, wegen der Vorbereitungen. Es war nicht mehr wiederzukennen. Und Mae selbst auch nicht. Dabei war sie schon auf manchem Ball in aufwendiger Garderobe erschienen. Selbst auf Maskenbällen hatte sie ihre Auftritte in exotischen Verkleidungen gehabt, aber heute … Heute war nicht nur ihr Äußeres verändert. Es ging um viel mehr: In weniger als einer Stunde würde sie Gräfin Mary von Francken-Sierstorpff heißen. Sie hatte die Unterschrift gestern noch einmal geübt.
»Vielleicht sollten wir nicht den ganzen Inhalt in deinen Schuh gießen, sondern uns selbst noch ein Gläschen gönnen wegen des Trubels, was denkst du?« Florence wartete keine Antwort ab, sondern wies ein anderes Dienstmädchen an, zwei Gläser zu holen.
Ohne zu protestieren, trank Mae das kleine Glas leer. Es brannte im Hals. Sie hustete. Dann spürte sie, wie sich die Wärme in ihrem Bauch ausbreitete. Sie atmete tief aus.
»Und hier habe ich noch eine Veilchenpastille, da wird dein Bräutigam gar nichts merken.«
Florence schien wirklich an alles zu denken. Mae richtete sich auf. Der linke Fuß fühlte sich feucht an, aber er schmerzte nicht mehr. Vorsichtig ging sie ein paar Schritte. Der Whiskey hatte geholfen. Doppelt.
Er klopfte an der Tür. Edwin Knowlton wartete auf seine Tochter. Sie war seine ganze Familie, seitdem seine Frau vor 14 Jahren gestorben war. Erst vor ein paar Tagen war er noch einmal auf dem Friedhof gewesen. Im Zwiegespräch mit Ella, seiner verstorbenen Frau, und dem Söhnchen, das doch die Hutfabrik hätte übernehmen sollen und doch keine zwei Jahre alt geworden war. Und nun gab er noch seine Tochter fort. So weit fort. Nach Deutschland. In ein fremdes Land. Zu einem fremden Mann. Er strich sich über das Haar. Ob das alles richtig war? Madame de Meli hatte ihm gut zugeredet wegen dieser Verbindung. Und auch Mae schien den jungen Grafen wirklich zu mögen.
Er klopfte ein weiteres Mal. Langsam drückte er die Klinke hinunter. »Darf ich hineinkommen? Wir sind vollzählig. Der Reverend bat darum, pünktlich zu beginnen.«
Seine Tochter stand verdeckt von Florence und den anderen Helferinnen in der Mitte des Raumes.
»Ach, Papa!« Mae drängte sich aus dem Kreis der Frauen heraus und fiel ihrem Vater um den Hals. Zwischen dem betörenden Duft der Orangenblütensträußchen, die überall auf dem Brautkleid mit Diamantennadeln befestigt waren, nahm Edwin Knowlton einen zarten Alkoholgeruch wahr. Sicher von einem der Dienstmädchen, dachte er. Oder von der Schneiderin. Deren rötliche Nase war ihm schon neulich aufgefallen. Dann betrachtete er seine Tochter. Groß war sie und schlank. Wie ihre Mutter. In dem Brautkleid sah sie wunderschön aus. Wie gut, dass Madame de Meli ihre Kontakte zu dem Pariser Edelschneider Charles Worth hatte spielen lassen. Meine Mae … wie eine Prinzessin, dachte er gerührt. Und wirklich, gleich würde sie eine Gräfin sein. Die Ehefrau eines Mannes, dessen Familie schon seit Jahrhunderten eine bedeutende Rolle in Schlesien spielte. Vielleicht würde er selbst eines Tages einmal dorthin reisen. Nach Schlesien … Kohle gab es dort. Und Landwirtschaft. Zu dumm, dass sein zukünftiger Schwiegersohn nichts davon besaß. Weder Minen noch Ländereien. Aber er sah gut aus in seiner blauen Uniform, und er war liebenswürdig und charmant zu Mae.
»Gefalle ich dir? Du sagst ja gar nichts …«
Die Diamantohrringe blitzten. Erbstücke ihrer Mutter. Edwin Knowlton schluckte.
»Du siehst wunderschön aus, mein Liebling! Die schönste Braut, die ich je gesehen habe!«
Mae küsste ihn auf die Wange. »Ich muss auch gleich weinen«, schniefte sie, als sich eine Hand zwischen Tochter und Vater schob. Es war Florence de Meli.
»Meine Lieben, bitte richtet euch. Es geht los …«
Florence stellte sich an Maes linke Seite, während der Vater seiner Tochter den rechten Arm reichte. Noch einmal wurde der Schleier zurechtgezupft. Die Friseurin hauchte mit dem Pinsel etwas Reispuder auf Maes Gesicht. Doch die aufgeregten roten Wangen konnte sie damit nicht überdecken.
Mae ließ alles über sich ergehen. Dann holte sie tief Luft und ging gemessen zwischen den beiden Menschen, die ihr am meisten bedeuteten, auf die Treppe zu. In dem Moment setzte die Musik ein. Das ungarische Orchester – verborgen hinter einer spanischen Wand, die über und über mit Rosen und Stechwinde verziert war – begann, das Brautlied aus der Oper »Lohengrin« zu spielen. Die Gespräche im Vestibül und in den angrenzenden Räumen verstummten.
Maes Herz klopfte. Ihre Hände waren eiskalt. Langsam schritt sie die Stufen hinab. Sie sah blaue Uniformen. Johannes? Nein, es waren seine Trauzeugen, die in einer kleinen Gruppe zusammenstanden. Die Deutschen. Alle in Blau. Und da war auch Johannes. Er sah prächtig aus in seiner Uniform. Ihre Blicke begegneten sich. Er lächelte. Maes Lächeln war angestrengt. Zu groß war die Angst, irgendetwas falsch zu machen, sodass der Schleier und die fast fünf Meter lange Schleppe des Kleides in Unordnung gerieten. Oder dass sie gar die Treppe hinabstürzte. Die elfenbeinfarbenen Satinschuhe waren unter dem Saum des mehrlagigen Kleides nicht zu sehen. Sie trugen Mae sicher die Stufen hinunter. Die Pariser Schühchen machten alles richtig. Ihre Besitzerin auch.
Man hörte Räuspern von Männern, die zu viele Zigarren geraucht hatten. Frauen seufzten und murmelten Ahs und Ohs. Maes Anblick war perfekt. Das bauschige Kleid wie eine Wolke aus Seide von glitzernden Diamantensplittern übersät. Die Taille eng geschnürt. Mae Knowlton hielt sich kerzengerade und bewegte sich doch anmutig. Dazu das junge, hübsche Gesicht, das vor Aufregung glühte. Und der Bräutigam? Der deutsche Graf? Johannes von Francken-Sierstorpff drückte das Kreuz durch. Es war spät geworden gestern Abend. Später als geplant. Sein letzter Abend als Junggeselle. Er hatte sich hinreißen lassen, die Runde im Hamilton Club war ausgelassen gewesen. So etwas kannten die Amerikaner gar nicht, dass die Deutschen so vergnügt sein konnten, hatte ihm George W. Vanderbilt zugenuschelt. Man musste beides beherrschen. Das Vergnügen. Und die Pflicht. Und manchmal kam beides zusammen. So wie jetzt: Diese junge Frau, die ihn beim Herabsteigen der Treppe nicht aus den Augen ließ, würde gleich seine Ehefrau sein. Alles richtig gemacht, hatte sein Bruder Adalbert gestern Abend gesagt. Ja, sie war bezaubernd. Und sie war reich. Er fühlte, wie sein Herzschlag schneller wurde. Mit Mae würde er glücklich werden, das spürte er. Und finanziell müsste er sich nie wieder Sorgen machen. Sofern Edwin Knowlton sein Misstrauen ihm gegenüber endgültig überwinden könnte. Er würde seinem Schwiegervater schon zeigen, dass er kein Mitgiftjäger war. Obwohl seine eigene Mutter ihm die Reise nach Amerika nahegelegt hatte, um sich nach einer guten Partie umzuschauen. Als viertgeborener Sohn bekam er nur eine kleine Apanage. Dieses ewige Gezänk ums liebe Geld würde mit diesem Tag der Vergangenheit angehören.
»Du siehst wunderbar aus!«, raunte er, als Mae neben ihm vor dem marmornen Altar stand, der extra für diesen Anlass aus einer Kirche in Mailand herbeigeschafft worden war. Mit Geld war so viel möglich … Und hier, in der feinen New Yorker Gesellschaft, schien jeder aus dem Vollen zu schöpfen. Nun – manches war für Geld nicht zu haben: ein Adelstitel, ein Familienstammbaum, eine jahrhundertealte Geschichte. In Deutschland hätte er niemals eine Bürgerliche geheiratet, egal wie reich ihr Vater gewesen wäre. Aber Amerika war weit weg. Johannes strich sich mit der Hand über den Schnurrbart. Die Musik verstummte.
Father Ward, der katholische Geistliche, begrüßte die Gemeinde und das Brautpaar, während sein Kollege Reverend Hall von der Episkopal-Kirche aufmunternd zu Mae blickte, die wie betäubt vor dem Altar Platz genommen hatte. »Die Liebe spricht die Sprache des Herzens«, sagte der Geistliche. »Sie ist universell – Sprachbarrieren, Grenzen und Unterschiede überwindet sie«, setzte er fort. Madame de Meli starrte auf den Mund des Pfarrers, hörte aber seine Worte nicht. Ihr eigenes Herz raste, als sei sie selbst die Braut. Dieser Tag war einer der Höhepunkte ihres Lebens! Ohne ihr Zutun hätte es dieses Fest, diese Hochzeit nicht gegeben. Sie hatte Mae dem Grafen vorgestellt, hatte im Hintergrund die Fäden gezogen, als deutlich wurde, dass sich die beiden mochten. Sie seufzte, überwältigt von ihren eigenen Gefühlen. Tränen standen ihr in den Augen. Mae war erst vor ein paar Wochen aufgenommen worden in die »Liste der 400«. Und es war ihr Verdienst gewesen – die Arbeit von Florence de Meli. Unauffällig tupfte sie sich eine Träne fort. Was für ein Triumph!
Dabei war Florence vor etwas mehr als zehn Jahren selbst völlig mittellos in New York angekommen, aus Deutschland geflüchtet vor dem eigenen Ehemann. Wie beschwerlich waren die ersten Jahre in Amerika gewesen: die Scheidung, diese bösartige Schlammschlacht im Gerichtssaal, dann die Niederlage und der Verzicht auf ihre Kinder, die in Dresden bleiben mussten … Tränen rollten über ihre Wangen. Doch Florence hatte nicht aufgegeben. Hatte die Schlagzeilen und das Gerede überstanden, hatte sich am eigenen Schopf aus der Misere gezogen. War sogar berufstätig geworden. Ihre alte Tante Lizzy war entsetzt gewesen über diesen Schritt. Doch Florence wusste es besser. Ihr Start bei den Knowltons vor drei Jahren als Gouvernante für Mae, später umgemünzt in »Gesellschafterin«, war auch der Start ihres eigenen gesellschaftlichen Aufstiegs gewesen. Bisheriger Höhepunkt: Der 16. Februar 1892. Die »Liste der 400« wurde in der New York Times veröffentlicht, und unter den Namen der führenden Männer und Frauen in New York und damit von ganz Amerika stand Miss Mae Knowlton! Mehrere Ausgaben hatte Florence nach Dresden geschickt an ihren Sohn Henry und an ihre Freundinnen Clara und Minnie. Sie alle wussten, wer hinter dem Erfolg von Mae steckte: Florence. Sogar der zurückhaltende Edwin Knowlton lud sie ein paar Tage später zum Lunch ins Delmonico’s ein und überreichte ihr zum Dank eine goldene Brosche mit Amethysten in Form eines Blumenbuketts. Die lilafarbenen Blüten glitzerten heute an ihrem Revers. Florence atmete tief ein und aus. Die Amethyst-Veilchen mit den winzigen Diamanten in der Mitte hoben und senkten sich.
Florence musterte Edwin Knowlton, den Brautvater. Er saß versunken auf seinem Stuhl und schien seinen eigenen Gedanken nachzuhängen. Dachte er an seine verstorbene Frau? Ihr Todestag war erst vor ein paar Wochen gewesen, erinnerte sich Florence. Sie wusste aus vielen Gesprächen, wie sehr er sie geliebt hatte und wie sehr ihn ihr früher Tod mit nur 36 Jahren noch immer schmerzte. Florence faltete ihr spitzenbesetztes Taschentuch zu einem kleinen Quadrat zusammen. Mae hatte immer wieder Andeutungen gemacht … Vielleicht könnte sie, Florence de Meli, Edwin von seinem Kummer befreien und sein Witwerdasein beenden? Doch immer mit der Ruhe, ermahnte sie sich, ein Schritt nach dem anderen. Jetzt ging es erst einmal um Mae.
Lauter als gedacht setzte das ungarische Orchester ein. Ein Kirchenlied. Father Ward zeigte, wie textsicher er war. Seine Stimme übertönte alle anderen. Die jungen Männer aus Deutschland in ihren blauen Uniformen mühten sich, doch ihr harter deutscher Akzent gab dem feierlichen Lied eine fast komische Note. Mae hörte es nicht. Ihre eigene Stimme war ein leises Zittern, nur mühsam hielt sie die Tränen zurück. Sie war so gerührt von allem. Johannes drückte unauffällig ihre Hand. »Mein Schatz, du machst mich so glücklich!«, flüsterte er auf Deutsch. Mae warf ihm einen schnellen Seitenblick zu und gab den Händedruck zurück. Sie verstand jedes Wort! Die täglichen Deutschstunden zahlten sich aus. Sogar die Staats-Zeitung konnte sie mittlerweile ohne Probleme lesen und verstehen. Nur mit dem Sprechen haperte es noch. Die Aussprache und die Grammatik machten ihr zu schaffen. Da konnte Madame de Meli so oft sagen, wie sie wollte, dass »es sich perfekt anhörte«. Mae wusste, dass es nicht stimmte. Und auch die deutsche Aussprache ihrer Gesellschafterin war häufig nicht ganz ohne Fehler, schließlich lebte sie nun schon zehn Jahre nicht mehr in Dresden, sondern in Amerika. Dennoch … Madame de Meli hatte ihr so viel beigebracht wie kaum jemand zuvor, selbst im Farmington Institut hatte Mae nicht so viel fürs Leben gelernt wie durch Florence de Meli. Und die wichtigste Lektion erfüllte sie gerade in diesem Moment. Die Hochzeit mit einem Grafen aus Europa.
Das Lied war vorbei, nun sprach Reverend Hall. Der Bruder des Bräutigams, Adalbert, war an die Seite des Geistlichen getreten und hielt das kleine Samtkissen mit den Eheringen bereit. Johannes räusperte und sagte dann wieder auf Deutsch: »Mary, ich nehme dich zu meiner angetrauten Frau aus Gottes Hand, ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens, in guten und in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit. Dazu helfe mir Gott. Nimm diesen Ring als Zeichen meiner Liebe und Treue!«
Sie würde die Handschuhe erst nach der Zeremonie wieder anziehen, so hatte es ihr Madame de Meli eingeschärft, sonst würde es zu kompliziert werden mit dem Ehering. Sie streckte ihm die rechte Hand entgegen – sie würde es so machen wie die Deutschen und den Ehering an der Rechten tragen. Ihre Hand war eiskalt, die Finger immer noch rot, aber nicht mehr geschwollen. Johannes steckte ihr den Ring an. Mae hörte ein Schluchzen, es klang nach Madame de Meli. Dann sagte sie ihr Eheversprechen auf und steckte Johannes den Trauring auf. Der Segen beider Geistlichen folgte. Aus Mae Knowlton war in diesem Moment Gräfin Mary von Francken-Sierstorpff geworden! Johannes beugte sich zu ihr und küsste sie zart auf den Mund. Mae war schwindelig. Sie hätte ein Riechfläschchen vertragen können.
»Das Frühstück war köstlich«, zwitscherte Cousine Ella fröhlich. »Hoffentlich werde ich auch eines Tages so eine herrliche Hochzeit feiern können!« Begeistert betrachtete sie Mae in ihrem Kleid mit den Orangenblüten und den funkelnden Diamanten.
»Sicher wird es bei dir auch wunderbar werden.« Mae genoss die Bewunderung. Ella war die Tochter von Ebenezer Knowlton – ihrem Onkel. Zusammen mit Maes Vater Edwin leitete er die Strohhut-Fabrik in Upton. Nun, da sie bald nach Deutschland entschwinden würde, sollte Madame de Meli sich um Ella und ihre Schwester Grace kümmern. Damit auch die beiden Cousinen ihren Weg in die Society machten.
»Wo hast du gesteckt?« Johannes ergriff ihre Hand.
»Ich bin aufgehalten worden«, murmelte Mae und setzte sogleich ein strahlendes Lächeln auf, denn vor ihr stand Mrs. Fish. Die scharfzüngige Mamie Fish hatte sich in ein brombeerfarbenes Kleid gezwängt. Aufgeregt wippte der Hut auf ihrem dunklen Haar, das von grauen Strähnen durchzogen war. »Muss ich jetzt einen Hofknicks machen?« Sie tat so, als würde sie gleich zusammensacken.
»Aber nein, verehrte Mrs. Stuyvesant Fish! Die Francken-Sierstorpffs sind kein regierendes Geschlecht.« Johannes lachte.
Mae fühlte sich durch die Bemerkung seltsam bloßgestellt. Sie wusste selbst noch gar nicht, wie sie sich als »Frau Gräfin« nun eigentlich genau zu verhalten und was sie von ihrem Gegenüber zu erwarten hatte. Außerdem war Mamie Fish heute, in Abwesenheit von Mrs. Astor, die sich wie in jedem Frühjahr in Paris aufhielt, die tonangebende Dame der New Yorker Gesellschaft auf dem Fest.
»Du siehst prächtig aus, mein Mädchen! Gräfin hin oder her. Dass du schnell weg sein würdest vom Heiratsmarkt, war mir von Anfang an klar. So hübsch, wie du bist!« Mamie Fish tätschelte Maes Wange. »Aber du bist ja auch eine gute Partie – das haben sogar ein paar Herrschaften in ihren alten, muffigen Schlössern irgendwo in Germany mitbekommen …« Sie zwinkerte dem Bräutigam zu.
Johannes’ Lächeln war dünn geworden. Er verstand zwar nicht jedes Wort, hatte aber die Bedeutung dieser zweideutigen Bemerkung erfasst.
»Jaja, meine Mae, jetzt bist du eine Gräfin. Und dein Bräutigam hat ausgesorgt, stimmt’s?« Mamie Fish lachte über ihre eigenen Frechheiten.
»Verehrte Mrs. Fish, wir freuen uns, dass Sie mit Ihrer Anwesenheit diesem Fest noch einen zusätzlichen Glanz verleihen.« Der Tonfall war entschieden und unmissverständlich. Madame de Meli war unbemerkt herangeglitten und hatte die letzten herzlosen Bemerkungen mitgehört. Sie stellte sich eng an die Seite von Mae und funkelte Mamie Fish kämpferisch an, während sie ihr mit sanfter Stimme Komplimente zu ihrem Kleid machte. »Kommen Sie, meine Liebe, wir haben uns ein Gläschen Champagner verdient«, damit wies sie Mamie Fish aus dem Vestibül in einen der Salons, aus dem lautes Stimmengewirr ertönte.
»Was hat sie genau gesagt? Meint sie, dass ich nur auf dein Geld aus bin?«, fragte Johannes aufgebracht. Mae machte eine beschwichtigende Handbewegung.
»Mamie Fish ist bekannt für ihre Respektlosigkeit. Wahrscheinlich benimmt sie sich nur deshalb so, weil ihre eigene Tochter noch immer nicht verheiratet ist.«
Sie hatte nur halblaut gesprochen, doch George Vanderbilt schien sie gehört zu haben. »Ich verstehe zwar kein Deutsch, gratuliere aber sehr herzlich zur Vermählung!« Er lachte. Sein schwarzer Schnurrbart sah beinahe aus wie aufgemalt. Tadellos. Sein Sinn für Ästhetik machte nicht einmal davor halt.
»Oh, wie schön, dass Sie gekommen sind!«, erwiderte Mae mit roten Wangen. Der Name Vanderbilt war in ihren Ohren wie ein Donnerhall. Astor, Vanderbilt, Goelet oder Oelrich – Namen, so klangvoll wie die von gekrönten Häuptern in Europa. Und sie gehörte dazu! Madame de Meli war wieder zurückgekehrt zum Brautpaar. Sie nippte nur kurz an ihrem Glas Champagner und war wie berauscht von der Tatsache, dass ihre Mae, ihr Schützling, hier ganz selbstverständlich stand, als Gastgeberin inmitten der feinsten Kreise der Stadt. Ohne ihr Zutun hätte Mae in Brooklyn zur Spitze der feinen Gesellschaft gehört. Aber eben nur in Brooklyn. Doch durch ihr geschicktes Vorgehen hatte sie Mae den Weg in die Liste der Besten geebnet, der »Four Hundred«! Und dann erst diese Vermählung … Johannes von Francken-Sierstorpff verkehrte mit dem deutschen Kaiser! Mae war ihr Meisterstück! Florence de Meli seufzte zufrieden und lauschte den Gesprächen.
»Aah, Mister Rhinelander!«
»Verehrteste Mae, liebe Fürstin! Das sind Sie doch nun, nicht wahr?«
Mae schüttelte den Kopf. »Nein, nein, eine Gräfin bin ich, keine Fürstin.«
Thomas Jackson, genannt »T. J.« Rhinelander, gab auch dem Bräutigam die Hand und gratulierte – auf Deutsch. Seine Vorfahren stammten aus Deutschland, und gerade erst hatte er sich eine alte Burgruine am Rhein gekauft, die er nun zu einem Familienstammsitz ausbauen wollte.
»Erzählen Sie uns von Ihrem neuen romantischen Zuhause in Deutschland!« Mae sah ihn neugierig an.
»Ich habe eine Fotografie dabei. Schauen Sie! Hinreißend, nicht wahr? Es steckt eine Menge Arbeit darin, bis ich als frischgebackener Burgherr einen Teil des Jahres auf einem Rheinfelsen thronen werde.« Er lachte zufrieden.
Mae blickte andächtig auf das Bild. So etwas kannte sie nur aus Büchern.
»Ich war früher oft in der Gegend unterwegs«, erzählte Johannes. »Ich habe in Bonn studiert. Einige meiner Corpsbrüder stammen aus der Region. Alte Familien. Aber besser noch als die Burgen ist der Wein von dort.« Er winkte einen Diener herbei für weiteren Champagner.
»Prost!«, rief Rhinelander und verbeugte sich. Hinter der spanischen Wand ließen die unermüdlichen Ungarn ihre Geigen leise schluchzen.
Mae wusste gar nicht mehr, wie spät es war. Nur ab und zu hatte sie zu einem Glas Wasser gegriffen, die meiste Zeit perlte der Champagner in ihrer Sektschale. Sie war nicht betrunken, aber auf eine angenehme Weise leichtfüßig und redegewandt wie selten sonst. Die Menschen waren so freundlich, so zuvorkommend, sie wurde mit Komplimenten überschüttet. Selbst Mamie Fish zeigte sich im Lauf des Nachmittags von ihrer herzlichen Seite. Und drei Einladungen nach Newport waren ausgesprochen worden, in die schönsten Häuser dort. Sobald sie wieder in Amerika sein würde. Doch erst einmal würde sie nach Deutschland aufbrechen. Sie atmete aus. Dort hatten sie noch kein richtiges Zuhause. Das Familienschloss der Francken-Sierstorpffs gehörte Johannes’ Bruder. Mae dachte an die Fotografie von der Burg am Rhein, die T. J. Rhinelander so stolz gezeigt hatte. Sie wollte auch in einem Schloss wohnen. Schließlich war sie doch jetzt eine Gräfin!
Wo war überhaupt »ihr« Graf? Wo steckte Johannes? Sie verließ die kleine Runde, mit der sie gerade noch geplaudert hatte, und sah sich suchend um. Da hörte sie seine Stimme. Er lachte laut und vergnügt. Umringt von seinen deutschen Trauzeugen, seinem Bruder und seinen Freunden. Die Deutschen in ihren Uniformen. Schade, dass seine Mutter nicht zur Hochzeit gekommen war, aber sie war von schwacher Konstitution, hatte Johannes erklärt. Wollte keine Reise über den Ozean wagen. Bald würden sie sich kennenlernen, dachte Mae. In Schlesien oder in Berlin. Hoffentlich würden sie ein freundliches Verhältnis zueinander finden. Eine mütterliche Stütze in der Fremde.
»Mae, mein Kind, da bist du ja!« Florence de Meli nahm ihre Hand. »Der Zug geht in anderthalb Stunden. Die Kutsche steht schon bereit. Du musst dich noch umziehen, das Reisekostüm liegt in deinem Zimmer. Eure Flitterwochen beginnen jetzt gleich.« Die Gouvernante legte ihren Arm um Maes Taille. »Und dann zeigst du deinem deutschen Mann einmal die schönen Seiten im Süden von Amerika. Ach, ich beneide dich! Savannah muss herrlich sein, und dann New Orleans und anschließend bis hinunter nach Florida.«
Florence bemerkte den ängstlichen Ausdruck in Maes Gesicht.
»Es wird alles gut werden, glaube mir, mein Schatz! Johannes hat Achtung vor dir, das spürt man. Und er wird dich wie ein guter Ehemann behandeln – das hat er deinem Vater versprochen. Und mir auch!«
Mae drückte die Hand ihrer Gesellschafterin. Warum sehnte sie sich nach einer unbekannten Schwiegermutter, wenn sie doch hier jemanden an ihrer Seite hatte, der sie unterstützte und beinahe liebte wie eine Mutter? »Madame, Sie kommen uns ganz bald in Berlin besuchen?«
Florence nickte. »Ja, ich komme nach Deutschland. Ich möchte dich schließlich sehen! Meine kleine Gräfin!« Sie lächelte.
Mae hätte weinen mögen. Wie sollte sie ohne Madame de Meli zurechtkommen? Ganz allein in der Welt.
3. Hohe See und hoher Einsatz
Auf dem Atlantik, 3. Juni 1892, an Bord der »Fürst Bismarck«
»War alles zu Ihrer Zufriedenheit, verehrte Frau Gräfin?« Die Kammerstewardess räumte das silberne Teekännchen und die Etagere mit den liegen gebliebenen Biskuitkuchen geräuschlos auf das Tablett. Mae legte eine Dollarnote auf den Tisch.
»Oh, das ist nicht nötig, vielen Dank, Frau Gräfin, Sie sind sehr großzügig!«
»Bitte sorgen Sie dafür, dass ich in der nächsten Stunde nicht gestört werde. Ich habe dringende Korrespondenzen zu erledigen. Danke!«
Dora, so hieß die Stewardess, zog sich mit einem Kopfnicken zurück.
Mae stand auf und sah aus dem Fenster ihrer Luxuskabine auf das vordere Promenadendeck. In einiger Entfernung waren Dampfstühle aufgestellt. Die Wolldecken darauf waren sorgfältig gefaltet, aber niemand hatte Platz genommen. Ein grauer Himmel und der aufkommende Wind lockten nur wenige nach draußen. Später würde sie noch einen Spaziergang an Deck machen, wenn Johannes nach seinem Termin beim Barbier und dem anschließenden Besuch des Baderaums zurückgekehrt wäre, überlegte Mae, die sich den Kaschmirschal um die Schultern zog. Der flaschengrüne Schal war ein Geschenk von Mrs. Astor gewesen. Sie hatte ihn aus Paris mitgebracht und ihn zusammen mit einer herzlichen Karte nachträglich zur Hochzeit bringen lassen. Eine noble Geste, fand Mae, die den Schal und die Glückwünsche in Ehren hielt. Johannes konnte die allgemeine Ehrfurcht gegenüber Mrs. Astor in New York nicht ganz nachvollziehen. Er hatte sie zwei- oder dreimal persönlich erlebt und zeigte sich Mae gegenüber unbeeindruckt von dieser mächtigen Dame der feinen Gesellschaft. Aber er war eben ein Deutscher und kannte die Spielregeln in der High Society von Manhattan nicht, dachte Mae und spürte wieder einmal, wie fremd ihr der frischgebackene Ehemann so manches Mal war. Sie legte sich das Briefpapier mit der blau-weißen Flagge und dem gelben Schild der Hapag – der Hamburg-Amerikanischen Packetfahrt-Actiengesellschaft – zurecht und schraubte die Hülle des Füllfederhalters ab. Auch er war ein Geschenk zur Hochzeit gewesen. Schwarz mit rotgoldenen verschlungenen Ornamenten. »My Darling Mae« war vorn in kleiner Schrift eingraviert. Mae strich sanft über die verschnörkelten Buchstaben. Madame de Meli hatte ein so sicheres Empfinden für Schönheit … und für praktische Ideen. Sie begann zu schreiben.
Liebe Florence,
ich zögere kurz, denn es ist noch immer ganz ungewohnt für mich, das schöne »Madame de Meli« wegzulassen und Dich nun mit dem Vornamen anzusprechen. Für das Zeichen Deiner innigen Zuneigung und unserer Vertrautheit danke ich Dir sehr. Es war ein solches Glück für mich, Dich vor unserer Abfahrt in Hoboken noch einmal an der Seite meines lieben Vaters in Brooklyn zu sehen. Nun sind drei Tage vergangen nach dem Ablegen der »Fürst Bismarck«, und Dein treues Gesicht ist schon so weit entfernt, dass mir ganz weh ums Herz wird. Johannes gegenüber zeige ich mich stark und hoffnungsvoll dem neuen Lebensabschnitt in Berlin zugewandt. Doch wenn ich ein paar Momente für mich habe, weine ich manche Träne dem lieben Amerika, meiner Heimat, nach. Bitte sei nicht enttäuscht darüber, ich werde meinen Weg gehen, auf den Du mich geführt hast, und ich kann sagen, dass ich sehr dankbar darüber bin – wie es gekommen ist und was für ein Glück ich mit meinem Ehemann habe!
Mein Deutsch wird von Tag zu Tag flüssiger, ich lerne fleißig weiter mit der Fibel. Johannes lobt meine Fortschritte! Ohnehin macht er mir gern Komplimente. Ihm gefällt anscheinend alles an mir. Meine Haare, meine Augen, mein Hals und meine schlanke Taille. Es lässt mich erröten, wenn er so zu mir spricht. Wie ich schon vor unserer Abreise berichtet hatte, beruht die Zuneigung auf Gegenseitigkeit. Es ist so aufregend, eine Ehefrau zu sein! Allerdings tue ich mich noch immer ein wenig schwer mit den Stunden der Zweisamkeit … Für Männer scheint dies etwas Unvermeidliches zu haben, ich sehe dem Ganzen mit gemischten Gefühlen entgegen. Doch häufig sind meine Befürchtungen am Abend unbegründet, denn das Bordleben fordert seinen Tribut, sodass Johannes manches Mal erschöpft von den vielen anregenden Gesprächen im Rauchsalon oder nach einem ausdauernden Einsatz am Spieltisch in den Schlaf sinkt. Ganz und gar ohne Avancen. Ein gesunder Schlaf ist sicher das Beste, was man für seinen Körper tun kann.
Mae ließ den Füllfederhalter sinken. Wolken jagten am Himmel vorbei. Sonnenstrahlen huschten durch das Fenster. Sie lehnte sich zurück und las das Geschriebene. Konnte sie so direkt sein und der ehemaligen Gesellschafterin in dieser Form über ihr Eheleben berichten? Was, wenn jemand Unbefugtes den Brief in die Hände bekam? Nein, das war unmöglich. Johannes hatte extra einen Siegelring für sie anfertigen lassen mit dem Wappen der Familie darauf. Den dazugehörigen Lack hatte sie auch. Damit konnte sie einen Umschlag versiegeln. Sie begann nach der kleinen Stange Lack zu suchen, als sie ein Klopfen an der Kabinentür hörte. Schnell schob sie alle Papiere zusammen, legte sie in die lederne Mappe und ließ diese in der Schublade verschwinden.
»Einen Moment, bitte!« Sie strich sich über die festgesteckte Frisur und atmete aus.
»Habe ich dich bei einem Nickerchen gestört?« Johannes sah sich um.
»Nein, ich habe gelesen.« Sie wurde rot. »Und dann wollte ich noch einen Brief schreiben. Aber das kann ich auch später noch tun.« Sie lächelte. Ihre Augenlider flatterten.
Johannes kam mit schnellen Schritten auf sie zu und drückte sie an sich. »Ich fühle mich herrlich. Könnte Bäume ausreißen!« Er wirbelte herum. »Schau einmal, der Barbier an Bord ist wirklich ein Könner seines Fachs. Hat in Berlin gelernt bei Francois Haby. Der frisiert auch den Kaiser. Wenn ich in Berlin bin, gehe ich auch regelmäßig in seinen Salon in der Mittelstraße. Gleich hinterm Stadtschloss.« Und atemlos ging es weiter: »Und dann hatte ich ein herrlich-heißes Vollbad. Dr. Tietze saß nebenan in der Kabine. Wir trafen uns anschließend auf einen Mokka und einen Portwein. Gleich ist es Zeit für das Gabel-Frühstück.«
Seine Wangen waren gerötet, die Haare mit Makassar-Pomade streng zur Seite gescheitelt. Er küsste sie. Der Duft des Rasierwassers umwehte ihn. Mae rang unauffällig nach Luft. »Johannes, nicht so stürmisch!«
Die Strenge war gespielt, glaubte er und ließ sich lachend auf einen Sessel fallen. »Später haben wir eine Verabredung mit Baron von Tritzau und seiner Frau zu einer Partie Whist.«
Mae runzelte die Stirn. Sie dachte an ihren Vater. Er lehnte Glücksspiele jeder Art ab. Aber war Whist ein Glücksspiel? Eher doch ein Zeitvertreib. Erst recht an den langen Tagen einer Atlantik-Passage. Ihr Vater war nur wenige Male über den Ozean gefahren. Er kannte nur die Arbeit. Die Fabrik in West Upton und das Büro in Brooklyn. Schade, dass er so wenig Sinn für die angenehmen Seiten des Lebens hatte. Aber seit er Witwer war, drehte sich für ihn alles um die Strohhüte und um sie – seine Tochter. Mae lächelte versonnen. Und sicher hätte er nichts dagegen, wenn sie ab und zu eine Partie Whist spielte.
»An wen denkst du, wenn du so ein Lächeln im Gesicht hast?« Johannes strich zärtlich über ihren Handrücken.
»An meinen Vater.«
»Ein sehr guter Geschäftsmann. Und ein guter Vater, wenn ich dich so ansehe …«
»Ich wünschte, er hätte auch etwas mehr Sinn fürs Private. Immer bloß die Fabrik! Wenn er doch endlich merken würde, wie gut Madame de Meli, ich meine Florence zu ihm passt. Die beiden mögen sich, das weiß ich. Und Onkel Ebenezer ist ja schließlich auch noch da und kann sich um die Fabrik kümmern.«
Johannes sah aus dem Kabinenfenster. Der Himmel war weit. Dahinten, noch hinter dem Horizont, lag Amerika. Maes altes Zuhause. Ihr Vater. Die Hutproduktion. Und die Fabrik zusammen mit seinem nimmermüden Schwiegervater sorgten dafür, dass er sich nie wieder würde Sorgen machen müssen wegen der Finanzen. Zum ersten Mal in seinem Leben belasteten ihn keine Verbindlichkeiten. Er seufzte erleichtert. Edwin Knowlton hatte Großes geleistet. Und wenn es nach ihm ginge, konnte er damit ruhig noch eine Weile weitermachen.
Knapp drei Stunden später saßen sich die Ehepaare Francken-Sierstorpff und Tritzau am Tisch gegenüber. Amalie von Tritzau war eine Frau von knapp 50 Jahren, klein und von starker Statur. Sie kleidete sich geschickt und wusste ihre Vorzüge ins Bild zu setzen. Die dunklen Locken, bei denen sie mit der Brennschere nachhalf, umrahmten ihr Gesicht mit den freundlichen Grübchen in den Wangen. Sie stammte aus dem Mecklenburgischen. Mae hatte keine Ahnung, wo das war. Der Norden Deutschlands war ihr nicht vertraut, nur Hamburg kannte sie.
»Meine Liebe, ich habe schon mit Ihrem Gatten gesprochen, sobald Sie sich in Berlin ein wenig eingewöhnt haben, kommen Sie zu uns. Eine Sommerfrische an der Ostsee! Die meisten Berliner verlassen ihre Stadt in den heißen Monaten. Die Großstadtluft ist so stickig …«
Die Baronin verzog den Mund. Dass das Leben in ihrem Schloss nur ein paar Kilometer hinter der Küste häufig entsetzlich eintönig und langweilig war, verschwieg sie vorsorglich.
»Wenn mir nach der Stadt zumute ist, fahre ich nach Schwerin. Wir sind dort auch häufig zu Gast beim Großherzog«, deutete sie an.
Mae machte ein interessiertes Gesicht. Sie kannte weder Schwerin noch einen Großherzog. Doch das sollte niemand wissen.
»Ach, dann sind Sie mit Großherzog Friedrich Franz III. gut bekannt?«, mischte sich Johannes ein. »Ich habe mit seinem Bruder Johann Albrecht studiert. Ein feiner Kerl. Er hat uns einmal nach Ludwigslust in die Sommerresidenz eingeladen. Leider war es an dem Wochenende furchtbar verregnet und kalt. Und dann ist es in dem alten Kasten ganz schön zugig. Na, wir haben uns dann mit dem Inhalt des Weinkellers gewärmt.« Er lachte bei der Erinnerung. Mae gefielen die vielen Geschichten, die Johannes zu fast jedem Thema beisteuern konnte. Er war so anders als ihr Vater. Wer »Sturm« genannt wurde, der musste Energie haben und Feuer. Sie betrachtete ihn von der Seite. Sein Profil, der entschlossene Mund, der schwarze Schnurrbart. Sein Lachen war laut und dunkel. Ansteckend. Mae hatte schon bemerkt, dass er manchmal die Blicke anderer Frauen auf sich zog. Immer dann, wenn er so ausgelassen war wie jetzt gerade.
»Die Stimmung ist ausgezeichnet, merke ich! Passt denn da eine kleine Partie Whist hinein? Ich habe die Karten dabei«, meldete sich Baron Tritzau zu Wort. Er war ein gutmütiger Mann mit breitem Akzent. Ein Backenbart sollte die schwindende Haarmenge auf seinem Kopf wettmachen. Mit einem leisen Ächzen legte er den Stapel Karten auf die Tischmitte.
»Eine ausgezeichnete Idee!«, rief Johannes und rieb sich die Hände. Mae stellte ihr Glas Sherry zur Seite. Bevor sie Johannes kennengelernt hatte, hatte sie sich nichts aus dem Glücksspiel gemacht. In den Sommermonaten in Newport wurde am Abend gern gespielt. Oft saßen die Männer zusammen. Für Frauen galt es als wenig schicklich. Doch furchtbar streng war niemand. Bloß ihr Vater missbilligte diese Art von Vergnügen, erst recht, wenn es ums Geld ging. Aber das machte doch den Reiz aus, hatte ihr Johannes erklärt. Einfach nur so zu spielen, sei auf Dauer öd und ließe den Esprit am Tisch erlahmen.
Die ersten Male hatte Mae neben ihrem zukünftigen Mann gesessen und durfte ihm in die Karten gucken, damit sie die Regeln lernte. Sie war schnell und hatte eine gute Auffassungsgabe. Als sie bald darauf ihre eigenen Karten in der Hand hielt, gewann sie gleich zweimal hintereinander. »Die einzige Frau, die immer gewinnt und noch nie verloren hat!«, schwärmte Johannes vor Freunden in New York und merkte gar nicht, dass das Lachen in der Runde nur verhalten war. Mae hatte die Irritation zwar gespürt, ihre Zweifel aber beiseitegeschoben. Es war allein ihre Angelegenheit, ob sie gern am Spieltisch saß oder nicht. Sollten ihre Freundinnen die Zeit doch mit dem Stickrahmen verbringen!
Sie nahm noch einen Schluck Sherry und begutachtete ihr Blatt. Kein leichter Beginn, dachte sie zögernd, als Johannes mit der flachen Hand auf den Tisch schlug. »Donnerwetter! Da haben Sie eine schöne Runde zusammengemischt!« Er bestellte noch ein Bier und vertiefte sich in die Karten. Der Baron zuckte mit den Schultern und strich sich amüsiert über den Bart. Seine Frau zog die Augenbrauen hoch und seufzte. »Zum Glück spielen wir nur mit kleinen Summen, ich müsste wohl sonst meine Ohrringe hergeben.«
Johannes lachte. »Nicht so pessimistisch, liebe Baronin, vielleicht ist Ihnen Fortuna hold und Sie gewinnen am Schluss, sodass Sie sich später ein paar schöne neue Stücke beim Goldschmied in Schwerin anfertigen lassen können.«
Mae befühlte unauffällig die Perlenkette, die Johannes ihr zur Hochzeit geschenkt hatte. Die eigenen Juwelen verspielen – man hörte so allerhand. Auch Mae hatte über Johannes nicht nur Gutes vernommen, was seine Spielleidenschaft betraf. Kurz vor ihrer Abreise hatte ihr Vater sie noch einmal zum Gespräch unter vier Augen gebeten und sie eindringlich gewarnt, dass ihr frischgebackener Ehemann möglicherweise eine zu starke Neigung zu Karten und dem Roulettetisch hatte. Nicht zuletzt deshalb hatte Edwin Knowlton einen Gutteil von Maes Vermögen – das auch aus dem Erbteil ihrer Mutter bestand – in einen Fonds in den USA angelegt. Das Geld war sicher, egal wie sehr sich der Schwiegersohn am Spieltisch verausgabte. Das hatte Edwin Knowlton mit fester Stimme verkündet und seine Tochter sorgenvoll angesehen.
»Mae, mein Liebling, du bist an der Reihe! Wovon träumst du?« Johannes tippte sie an den Arm.
»Oh, da sind meine Gedanken abgeschweift, Verzeihung!« Sie legte die Karodame auf den Tisch, und der Baron blies seine Backen in gespielter Verzweiflung auf.
»Da setzen Sie mir aber zu, das hätte ich von einer so jungen, charmanten Dame gar nicht erwartet, Verehrteste …« Er lachte gutmütig. »Ich dachte, liebe Gräfin, Sie seien ein ›Greenhorn‹, wie es in Ihrer Sprache heißt …« Der Baron tätschelte kurz ihre Hand.
Seine Frau stieß die Luft aus. »Eduard, wenn du nichts unternehmen kannst, dann bin ich ja auch noch da«, sagte sie und schob Piksieben und Piksechs zur Karodame.
»Man darf die Frauen nicht unterschätzen!« Baron Tritzau prostete Johannes zu.
Und die eigene schon gar nicht, dachte Amalie von Tritzau mit zusammengepressten Lippen. Doch niemand schien die zunehmende Gereiztheit der Baronin zu spüren.
Johannes drückte Maes Hand, ohne sie anzusehen. Endlich war er an der Reihe. Er konnte seine Freude kaum unterdrücken. Mit einer großen Bewegung legte er seine Karten auf den Tisch: Fünf Punkte! Gewonnen! »Jetzt habe ich nicht nur Glück in der Liebe, sondern auch im Spiel, das ist kaum zu fassen!« Er zeigte auf den Haufen mit den Dollarnoten. »Das habe ich jetzt ehrlich eingenommen, korrekt?« Ohne eine Antwort abzuwarten, griff er nach dem Geld, strich die Scheine glatt und steckte sie in seine Geldbörse.
»Ich glaube, du hast eine Glückssträhne«, flüsterte Mae.
Johannes küsste sie auf den Mund. »Da wollen wir einmal sehen, ob du recht hast.«
Baron von Tritzau bestellte zwei weitere Humpen Bier und für die Damen Rieslingsekt. »Köstlich, sehr erfrischend«, raunte die Baronin, ohne eine Miene zu verziehen.
Mae nickte. Sie fühlte sich beschwingt und voller Tatendrang. »Jetzt werde ich meinen Mann ablösen auf dem Siegerpodest«, rief sie lauter als beabsichtigt. An den Nachbartischen verstummten die Gespräche und die Mitreisenden blickten neugierig zu der ausgelassenen Runde mit den Karten auf dem Tisch. »Aber vorher sollten wir den Einsatz erhöhen!«, verkündete sie und zog ein Bündel Zehn-Dollar-Scheine aus ihrer bestickten Handtasche.
»So gefällst du mir!« Johannes strich über ihre Wange und legte seine gerade gewonnenen Scheine dazu.
Die Baronin sah ihren Ehemann fragend an. Dieser brummte etwas Unverständliches in seinen Backenbart und holte dann ebenfalls ein schmales Bündel Scheine aus seinem Portemonnaie. Seine Frau übernahm es, die Spielkarten zu mischen. Und die Runde wurde fortgesetzt.