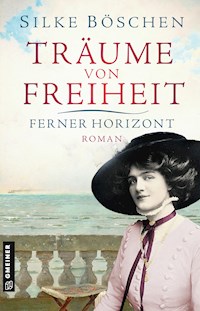Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Träume von Freiheit
- Sprache: Deutsch
An einem sonnigen Wintermorgen 1875 herrscht großer Andrang im Hafen von Bremerhaven. Gleich wird die »Mosel« ablegen. Ihr Ziel: New York. Plötzlich zerreißt ein Knall die Luft. Menschen, Tiere, ganze Fuhrwerke werden durch die Luft geschleudert. Eine Dynamit-Explosion mit vielen Toten und Verletzten. Die »Thomas-Katastrophe« macht weltweit Schlagzeilen. Beim Begräbnis stehen sich zwei Frauen gegenüber. Die eine hat gerade fast ihre gesamte Familie verloren. Die andere ist die Ehefrau des »Dynamit-Teufels«. Beide Frauen beginnen ein neues Leben, bis die eine, Jahre später, unvermittelt in New York vor der Tür der anderen steht …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Silke Böschen
Träume von Freiheit – Flammen am Meer
Roman
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Personen und Handlungen sind frei erfunden, soweit sie nicht historisch verbürgt sind.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Susanne Tachlinski
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Bilder von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ladies_at_Longchamp_1908.jpg
und https://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/010019001853
ISBN 978-3-8392-6080-7
Widmung
Für Leiwi. In Liebe.
Vorangestellt
Allmächtiger, ewiger Gott, Du bist unsere Zuflucht für und für. Deine Hand hat uns getroffen. Bewahre uns in Gnaden vor aller Bitterkeit, allem Trotzen und Murren. Hilf, dass wir uns von ganzem Herzen unter Deine gewaltige Hand bemüthigen. (…) Erbarme Dich, lieber Vater im Himmel, der Hinterbliebenen. Gieße den Trost Deiner ewigen, unwandelbaren Liebe in ihre Herzen. (…) Erbarme Dich, oh Herr, über uns alle, dass wir nicht als Tote die Toten begraben.
Gebet von Pastor Heinrich Wolf vor der Abfahrt des Leichenzuges mit 41 Särgen am 14. Dezember 1875 in Bremerhaven.
Teil I
1. Die Explosion
Bremerhaven, 11. Dezember 1875
Eine Locke hüpfte auf die Stirn. Eine blonde, unartige Locke. Johanne stöhnte. Nun hatte sie das Haar schon so streng zurückgekämmt, und immer noch widersetzten sich ihre Haare allen Versuchen, Teil einer damenhaften Erscheinung zu sein. Mit einer weiteren Klemme stopfte sie die Strähne zurück unter den Hut. Er passte so gut zu dem neuen Paisleyschal, den ihr Christian geschenkt hatte. Trotz der Kälte entschied sie sich gegen einen Muff. Mit Elschen auf dem Arm brauche ich nur Handschuhe, überlegte sie und riss die Schublade an der Garderobe auf. Leer.
»Gesine! Gesiiinne! Wo sind meine Handschuhe?«
Das Dienstmädchen kam aus der Küche gelaufen. »Gnädige Frau, ich habe gestern Abend alles zum Trocknen vor den Herd gehängt. Hier, bitte sehr!«
»Wie umsichtig, Gesine. Vielen Dank.« Sie schenkte dem Mädchen ein herzliches Lächeln.
Gesine freute sich über das Kompliment ihrer jungen Herrschaft. Sie hatte Glück mit der Anstellung bei den Claussens mit ihrem Baby. Hier wollte sie länger aushalten.
»Nun muss ich aber los. Ist Elschen noch in der Küche?«
»Ja, ich habe sie in ihr Kinderstühlchen gesetzt, sie ist aber schon zurechtgemacht.«
Johanne zog die kleine Elisabeth vorsichtig aus dem Stuhl. Das Mädchen war jetzt neun Monate alt. Und Gesine hatte sich alle Mühe gegeben, sie warm anzuziehen. Zwei Schichten wollene Wäsche, die selbst gestrickte rote Mütze mit den passenden Handschühchen, dazu der dicke, viel zu große Kindermantel – das Baby ähnelte vom Umfang einer kleinen Robbe. Johanne musste lachen.
Gesine beobachtete sie. So fröhlich und so hübsch, wie die junge Frau Claussen da vor ihr stand. Mit geröteten Wangen und diesem Ausdruck von Arglosigkeit in den blauen Augen.
»Bis später, Gesine, die ›Mosel‹ müsste so gegen halb zwölf ablegen. Dann komm ich direkt wieder nach Hause!«
Die Tür fiel ins Schloss, und Gesine begann in der Küche, den Kohl für das Mittagessen zu rupfen.
Die Wintersonne blendete. Ein wolkenloser Himmel in einem leuchtenden Blau erstreckte sich über den Deich hinaus auf die Weser und die beginnende Nordsee. An Land war alles weiß. In der Nacht hatte sich eine geschlossene Schneedecke gebildet. Durch den Schnee wirkte alles gedämpft, selbst die Betriebsamkeit des Hafens wirkte langsamer als sonst, dachte Johanne, als sie am Alten Hafen vorüberging. Ein ungewöhnlich schöner Tag für diese Jahreszeit. Der Dezember war im Norden üblicherweise ein Monat mit grauen Tagen und viel Regen. Doch jetzt war die Luft eisig und ließ Johannes Wangen brennen vor Kälte. Diese Winterstimmung versetzte sie in ein Hochgefühl. Auch Elsie lugte aus ihrer Umklammerung hervor und lachte ihre Mutter an. Johanne gab ihr einen Kuss auf die kalte Kindernase und drückte das Baby an sich. Jetzt waren es keine zwei Wochen mehr bis Weihnachten. Das erste Weihnachtsfest mit ihrer eigenen Familie! Die selbst gebastelten Strohsterne lagen schon bereit, und Christian hatte ihr einen schönen Baum versprochen.
Was würden ihre Eltern sagen und die Geschwister? Sie alle sollten kommen am ersten Weihnachtstag. In Johannes neues Zuhause. Doch da verdüsterte sich ihre gute Stimmung. Gustav würde nicht dabei sein. Ausgerechnet Gustav, ihr Lieblingsbruder. Jetzt gleich musste sie Abschied nehmen. Johanne schluckte. Im Dezember nach Kalifornien aufzubrechen, so etwas Verrücktes. Gestern Abend noch hatte sie mit Christian darüber gesprochen. Es war die schlechteste Jahreszeit für eine Atlantik-Passage. Raue See. Stürme. Vielleicht sogar Eisberge. Wie schnell konnte da ein Schiff untergehen. Gerade erst war die »Deutschland« gesunken. Was für ein Drama vor der Küste Englands. Wohl über hundert Menschen waren dort ertrunken im eisigen Wasser. Bei dem Gedanken daran blieb Johanne abrupt stehen. Ihr Herz schlug schneller. Sie hatte Angst um Gustav. Aber so etwas hatte es noch nicht gegeben, dass zwei Dampfschiffe kurz hintereinander Schiffbruch erleiden, beruhigte sie sich. Außerdem war die »Mosel« ein Dampfer des Norddeutschen Lloyd. Die Schiffe waren solide, technisch auf dem neuesten Stand. Sie überlegte. Dennoch. Auch die »Deutschland« gehörte zur Flotte des Norddeutschen Lloyd.
Eine kreischende Möwe riss sie aus ihren Gedanken. Johanne musste sich beeilen. Die »Mosel« hatte das Hafenbecken schon verlassen und lag abfahrbereit an der Südkaje. Der schwarze Schornstein rauchte, die Brücken waren noch nicht eingeholt. Die letzten Passagiere gingen an Bord, und Hafenarbeiter schleppten Koffer und Kisten auf das Schiff. Johanne sah, wie sich die meisten Passagiere schon an der Reling aufgestellt hatten und den Zurückbleibenden zuwinkten, die sich vor dem Schiff versammelt hatten. Johanne hörte einen Kutscher schreien. Er trieb zwei Pferde an, die nur langsam mit ihrem schwer beladenen Leiterwagen vorankamen. Der Kutscher ließ seine Peitsche knallen. Einige Umstehende zuckten zusammen, endlich kam das Fuhrwerk an der Bordwand zum Stehen. Nur Minuten später wurden Truhen und Kisten mit einer Winde auf das Schiff gezogen und auf der »Mosel« in Empfang genommen.
»Johanne! Da bist du ja!« Christian bahnte sich einen Weg zu ihr. Erleichtert drückte er seine Frau an sich.
»Sei vorsichtig, ich habe doch Elsie dabei!«
Er blickte direkt in die graublauen Augen seiner Tochter. »Komm, ich nehme sie dir einmal ab. Dann kannst du dich in Ruhe von Gustav verabschieden. Deinen Vater habe ich auch schon gesehen. Er steht mit Auguste dort hinten, siehst du?«, rief er.
Gemeinsam drängten sie sich an den anderen vorbei, bis sie bei ihrer Familie angekommen waren. »Hanni, wie schön, dass du es noch geschafft hast!« Gustav lächelte.
Johannes Hals wurde eng, nur mit Mühe konnte sie ein Schluchzen unterdrücken. Die beiden Geschwister hatten von den fünf Etmer-Kindern das innigste Verhältnis zueinander. Der frühe Tod ihrer Mutter vor elf Jahren hatte sie zusammengeschweißt. Gemeinsam mit ihrer ältesten Schwester Catharine hatten sie sich damals um die jüngeren Geschwister gekümmert, bis auch Catharine ein paar Jahre später starb.
»Nun guck nicht so traurig! Ich werde schon wiederkommen. Und wenn nicht, dann kommst du eben nach Amerika«, versuchte Gustav, sie aufzumuntern. Seine Fröhlichkeit war aufgesetzt.
»Ja, du hast recht. Dann fahre ich eben nach Amerika«, auch Johannes Lächeln war etwas schief. Sie log. Was sollte sie in Amerika? Hier, in Bremerhaven, war ihr Zuhause. Hier war auch Gustavs Zuhause. Wenn er es doch nur bald merken würde, dachte Johanne und wischte sich über die Augen.
»Ach, meine Große, jetzt bist du traurig, was?« Philipp Etmer drückte seine älteste Tochter etwas ungelenk an sich.
Johanne sah ihren Vater prüfend an. Alt war er geworden, dachte sie. Jetzt, an der Seite seiner zweiten Frau, die mehr als 20 Jahre jünger war als er, fiel es ihr viel stärker auf als vorher. Die Hochzeit war erst im August gewesen. Niemand hatte mehr damit gerechnet, dass er sich nach dem Tod von Johannes Mutter noch einmal eine Frau suchen würde. Doch bei einer Geschäftsreise nach Hamburg hatte er Auguste Fuhrer kennengelernt, und sie dann – kein Jahr später – geheiratet.
Johanne tat sich schwer mit der neuen Frau an seiner Seite. Vom Alter her hätten sie beinahe Schwestern sein können oder Freundinnen. Doch das Verhältnis blieb kühl. Zu sehr betonte Auguste ihre Hamburger Herkunft und behandelte Bremerhaven und die Menschen hier immer mit einer Spur Herablassung. Johanne blieb in der Nähe ihrer Stiefmutter meistens zurückhaltend und still. Auch heute zwischen all den Menschen ragte Auguste heraus. Nicht weil sie größer war als der Rest, sondern lauter und bestimmter. »Viel Erfolg, Gustav! Bring den Namen Etmer in die Neue Welt!«, rief sie ihm nach.
Er drehte sich um und lüftete den Zylinder: »Ja, das werde ich. Versprochen!«
Wie schneidig er aussah in dem neuen Ulstermantel, dachte Johanne. Und in den Abschiedsschmerz mischte sich Stolz auf den großen Bruder.
Gustav war tatsächlich der erste Etmer, der sich auf den Weg nach Amerika machte. Alle hatten mit dem Auswanderer-Geschäft zu tun, doch bislang hatte es keinen von ihnen selbst über den Atlantik gezogen. Und so war die gesamte Familie vollzählig erschienen. Johannes Schwestern – Henriette mit ihrem Ehemann Wilhelm Glauert und dessen Familie. Sophie war da, die jüngste Schwester, die sich gerade erst mit Ludwig Bomhoff verlobt hatte. Und völlig außer Rand und Band sprang Johannes jüngster Bruder Philipp junior an der Kajenmauer entlang.
»Fall nicht ins Wasser«, rief sie ihm zu. Als älteste Schwester fühlte sie sich immer verantwortlich.
Der Junge sah gar nicht auf. »Natürlich nicht! Bin ja nicht zum ersten Mal hier.«
Johanne schüttelte den Kopf. »Dann lass dir von Vater erklären, wie gefährlich es hier ist.«
Sie berührte den Arm ihres Vaters und wollte ihn zu seinem Jüngsten ziehen. Erst da bemerkte sie, dass dem alten Mann die Tränen über das Gesicht liefen. Johanne erschrak. Dass ihm der Abschied von Gustav so nahegehen würde, hatte sie nicht gedacht. Ihre Hand sank herab. Auch ihre Augen brannten.
Das Horn der »Mosel« ertönte. Das Signal für den endgültigen Abschied. Gustav stand an der Reling und winkte noch einmal hinüber zu seiner Familie. In dem Moment fing ein Baby an zu weinen. Johanne erkannte sofort die Stimme ihrer kleinen Tochter. Suchend sah sie sich um. Christian war mit Elsie im Arm ein paar Meter aus der Menschenmenge herausgetreten und wiegte sie etwas ungelenk. Vergeblich. Es dauerte nicht lange, und Elsie schrie aus Leibeskräften. Sie strampelte und versuchte, sich aus ihrer warmen Hülle zu befreien.
»Gib sie mir! Vielleicht hat sie Hunger, oder ihr ist kalt.« Johanne hatte sich einen Weg zu ihrem Mann gebahnt und nahm ihm ihre Tochter aus dem Arm. Beruhigend flüsterte sie auf sie ein. Doch es half nicht. Elsies Gesicht war rot vor Anstrengung. »Ich bringe Elschen nach Hause, das hat ja keinen Zweck«, entschied Johanne.
Christian nickte verständnisvoll. »Zum Mittagessen bin ich da«, versprach er und küsste sie auf die Wange. Ein schneller Abschied.
Denn das brüllende Bündel namens Elisabeth Claussen ließ keine innige Verabschiedung zu. Umstehende drehten sich zu Johanne um. Einige begannen zu murmeln, und eine Frau verzog missbilligend das Gesicht mit Blick auf das Kind. Trotz der Temperaturen traten Johanne Schweißperlen auf die Oberlippe. Warum musste Elsie ausgerechnet hier, ausgerechnet in diesem Moment so schreien? Hastig schob sie sich aus dem Gedränge. Nach ein paar Metern wurde das Baby ruhiger. Johanne atmete tief aus und blieb stehen. Sie drehte sich noch einmal um und versuchte, Gustav zwischen den anderen Reisenden auf dem Schiff auszumachen. Es gelang ihr nicht. Ihr Blick glitt hinüber zu zwei Hafenarbeitern, die sich abmühten, einen Riemen um ein Fass zu legen, das sehr schwer zu sein schien. Endlich war auch dieses letzte Stück verschnürt und hing an der Winde, um verladen zu werden. Sie sah, wie das Fass in der Luft schwebte. Sah, wie die Männer Handzeichen gaben, und sah auch, wie eines der beiden Pferde, die vor den Leiterwagen angespannt waren, Atemwolken aus den Nüstern stieß und mit dem Huf aufstampfte. Auch später sollte sie sich immer daran erinnern. Ein Pferd, das in der Dezemberkälte schnaubt und dampfenden Atem ausstößt. Die letzten Bilder aus ihrem alten Leben, das am 11. Dezember 1875 um 11.20 Uhr endete.
Das Fass war schwer. Fast 700 Kilogramm hingen in der Luft. Ein Seil riss, das andere rutschte ab. Wie in Zeitlupe sah Johanne, wie das Fass hinabfiel und auf den gefrorenen Boden vor dem Schiffsrumpf krachte. Der Knall war ohrenbetäubend. Das Geräusch schoss durch Johannes Gehörgang und schien ihren Kopf von innen zu zersprengen. Es war, als drückte es ihre Augen aus den Höhlen. Sie schnappte nach Luft und presste instinktiv ihr Kind eng an sich. Ein stechender Schmerz zuckte von den Ohren durch ihren Kopf. Sie schrie und sah, wie direkt vor der »Mosel« eine meterhohe Feuersäule emporschnellte. Orangerote Flammen hoch wie ein Haus in scharfem Kontrast vor dem blauen Winterhimmel. Das Feuer loderte genau dort, wo eben noch all die Menschen gestanden hatten. Christian, ihr Vater, Gustav, die Schwestern – Johanne wollte schreien, aber in dem Moment spürte sie, wie eine gewaltige Welle aus heißer Luft auf sie zurollte, ihren Körper umhüllte und dann wie mit einer riesigen Faust auf ihre Brust und ihren Bauch schlug. Sie konnte nicht mehr atmen.
Nur sehen konnte sie. Sehen, wie Menschen wie Zinnfiguren durch die Luft wirbelten, ein ganzes Pferd wie ein Spielzeugtier aus seinem Gespann gerissen wurde. Und sehen, wie Körperteile und einzelne Gliedmaßen durch die Luft geschleudert wurden. Johanne schrie – vor Schmerz, vor Entsetzen, vor Angst. Dann wurde auch sie von der Kraft der Druckwelle gepackt und in die Luft gehoben. Mit einem harten Schlag fiel sie auf das kalte Pflaster. Sie hatte Elsie nicht losgelassen. Und auch jetzt, im Moment des Aufpralls, reagierte sie instinktiv so, dass sie nicht mit ihrem Gewicht auf das Baby fiel. Brennende Holzstücke rasten wie Geschosse durch die Luft. Glasscherben, schwarze Klumpen, Pflastersteine. Und über allem verstreut die Überreste von Menschen. Arme, Beine, manchmal ein Rumpf, der noch in glimmende Kleidung gehüllt war, oder ein Kopf.
Zusammengekrümmt lag sie im Schnee, spürte die Kälte auf ihrer Wange und hielt die Augen geschlossen. Sie fühlte sich leicht, merkte, wie sie davonglitt. In eine barmherzige Ohnmacht. Plötzlich schlug etwas Hartes auf ihre rechte Hand, die ausgestreckt neben dem Bündel mit Elsie lag. Ein Stück glühendes Eisen war mit voller Wucht auf die Hand gefallen. Ein neuer Schmerz durchfuhr sie. Sie schrie auf – und konnte sich dabei selbst nicht hören. Die Ohren taub, die Hand zerschmettert.
Johanne verlor das Bewusstsein. Und sehr viel Blut. Es sickerte aus ihrem rechten Mantelärmel. Eine Lache bildete sich, durch die andere Menschen achtlos liefen. Die roten Schuhabdrücke waren überall im Schnee zu sehen. Denn es war nicht nur das Blut von Johanne. Der gesamte Platz war zu einer einzigen, riesigen Blutlache geworden.
Verstörte Überlebende kletterten über Leichen, wollten fliehen, andere versuchten zu helfen. Kaum jemand wusste, was er in diesem grauenhaften Durcheinander tun sollte. Jemand fand einen kleinen, blutüberströmten Pelzmuff, wie Kinder ihn trugen. In ihm steckten noch die abgerissenen Hände eines Mädchens. Gleich daneben krümmte sich ein Hafenarbeiter und starrte fassungslos auf die Stelle, wo eben noch seine Beine gewesen waren. Er schrie vor Entsetzen. Eine Frau, die ihr Schultertuch vor den Mund gepresst hielt, um gegen die aufkommende Übelkeit anzukämpfen, kniete sich zu ihm und versuchte, den Mann zu beruhigen. Doch er starrte weiter auf das Blut, das aus seinem Unterleib strömte, fiel nach vorn und starb.
An der Stelle, wo das Fuhrwerk gestanden hatte, klaffte ein vier Meter breites und etwa zwei Meter tiefes Loch. Ein Schlund, in dem Flammen loderten. Eines der beiden Pferde lag mit zerschmettertem Leib und ohne Beine auf der Erde. Von dem anderen Tier war nichts mehr zu sehen. Ein einzelnes Rad fand man später mit gebrochenen Speichen im Hafenbecken. Das war alles, was von dem Wagen übrig geblieben war. Rings um die Stelle der Explosion lag eine Mischung aus Trümmerteilen, menschlichen Überresten, Asche, Toten und Verwundeten. Ein eiserner Laternenpfahl war in der Mitte umgeknickt wie ein Streichholz.
War der Anblick schon entsetzlich, kam auch noch der Geruch dazu. Verbranntes Fleisch, versengtes Haar, der scharfe Gestank von Lithofracteur, eines Sprengstoffs, der noch stärker als Dynamit war. Um den Leuchtturm und das Leuchtturmwärterhaus herum glitzerte der Boden. Es waren Glasscherben von den Fensterscheiben, die allesamt durch die Druckwelle aus den Fassungen gesprungen waren. Am Fuße des Turms fand jemand ein Bündel. Es war der tote Körper eines kleinen Jungen.
Auch die »Mosel« war stark beschädigt. Die Schiffsbrücke hing in Einzelteilen über dem Wasser. Der Rumpf war eingedrückt. Die schwere Eisenwand durchbohrt. Keine Glasscheibe war heil geblieben. Ein Matrose hielt einen toten Mannschaftskollegen im Arm und weinte. Aufgelöste Passagiere suchten ihre Angehörigen zwischen leblosen Körpern und Schwerverwundeten. Frauen klagten in fremdländischen Lauten, rissen sich die Kopftücher herunter und rauften sich die Haare. Egal, wohin man sah, das Grauen, das qualvolle Sterben war überall. Auch im Wasser. Direkt zwischen Mole und Schiff schwammen Leichen. Ein Frauenrumpf, dessen Wollkleider sich mit Wasser vollgesogen hatten, begann zu sinken.
Elsie schrie. Sie schrie aus Leibeskräften. Der leblose Körper ihrer Mutter lag halb auf ihr. Das Kind versuchte, sich zu befreien, und strampelte hilflos in seinem wollenen Bündel. Es schrie, bis es vor Erschöpfung immer leiser wurde. Und aus dem Schreien ein Schluchzen wurde.
»Oh Gott, noch eine Tote!«, rief eine Frauenstimme.
»Aber sie weint doch noch. Hilf mir, sie umzudrehen!«, sagte ein Mann mit bleichem Gesicht.
Vorsichtig bewegten sie Johanne. Noch immer sickerte Blut aus ihrem Ärmel. »Oh, nein. Die Hand! Oh mein Gott, das ganze Blut!«, rief die Frau und schlug entsetzt ihre Hand vor den Mund.
Johannes Gesicht war aschfahl, ihre Kleidung nass und schmutzig. Selbst das Bündel, in dem Elsie steckte, war mittlerweile rot eingefärbt. »Oh Gott, das Kind weint. Es ist das Kind!«, vorsichtig nahm der Mann das Baby aus Johannes Umklammerung.
»Hier, nimm du das Kind, ich suche einen Arzt«, schrie er und drückte der Frau Elsie in die Arme. Er begann zu laufen. Dann drehte er sich noch einmal um: »Und die Mutter? Ist sie tot?«
Die Frau strich über Johannes Gesicht. »Nein, sie lebt!«, rief sie ihm hinterher. »Sie atmet.«
Die fremde Frau legte Elsie vorsichtig neben sich in den Schnee und riss sich ihr Tuch von den Schultern, um Johannes blutendes Handgelenk zu verbinden. Dann nahm sie Elsie in den Arm und wiegte das wimmernde Kind, bis ein Arzt kam.
2. Verlassen im Schnee
Strehlen bei Dresden, 11. Dezember 1875
Cecelia hasste dieses Wetter. Schon seit Tagen schneite es. Die Villa Thomas in der Residenzstraße 14 wurde förmlich erdrückt von den Schneemassen. Dieser deutsche Winter hatte in Cecelias Augen nur einen Vorteil: Sie konnte – nein, sie musste – Pelz tragen, um nicht zu erfrieren. Das Feuer im Kamin brannte schwach. Nicht einmal für Feuerholz war genügend Geld da. So hatte sie sich das nicht vorgestellt, als sie vor zwei Jahren zusammen mit ihrem Mann William und den drei ältesten Kindern in das Haus gezogen war. Mittlerweile war noch Töchterchen May dazugekommen.
Cecelia seufzte. Vier Kinder, das Jüngste erst neun Monate alt, und dann allein. Sie konnte den Ärger nur schwer unterdrücken. Diese Winter in Deutschland zerrten an ihren Nerven. Doch noch schlimmer war die Tatsache, dass William sie nun schon wieder zurückgelassen hatte und sie kaum wusste, wo er war oder was er vorhatte. Sie ging zum Sekretär und zog den letzten Brief ihres Mannes heraus, den sie gestern bekommen hatte.
Mein liebes kleines Hühnchen! Du darfst nicht böse sein mit mir, jetzt wo Du schon zwei Wochen lang so geduldig auf mich wartest. Ich schwöre Dir, nächste Woche bin ich wieder bei Dir! Die Rechnung von Gottschalk ist noch nicht fällig, nicht vor Weihnachten. Gottschalk wird Dich nicht belästigen. Mach Dir bitte keine Sorgen wegen der Rechnungen, ich werde sie bald bezahlen. Im Moment haben wir nun einmal nicht viel. Egal, sag den Leuten, wenn ich wieder da bin, werde ich alles bezahlen. Hab keine Angst, ich werde Weihnachten bei Dir sein. Schon am nächsten Donnerstag bin ich wieder bei Euch, versprochen! Ich brauche nur noch ein paar Tage. Ich habe mir überlegt, dass es besser ist, zu den Noacks nach Leipzig zu ziehen. Da würde es Dir besser gehen, und Du hättest auch nicht mehr den ganzen Ärger mit den Dienstboten. Das einzig Dumme wäre die Packerei und der Umzug ausgerechnet jetzt, so kurz vor Weihnachten. Aber Du könntest ja schon einmal mit den Kindern zu den Noacks gehen, und ich würde mich dann um den Umzug und alles Weitere kümmern. Was hältst Du davon? Lass es mich nur bald wissen, dann kann ich alles in die Wege leiten. Für den Moment habe bitte noch ein wenig Geduld, dann wirst Du Dein Dickerchen wieder bei Dir haben, den ganzen Winter lang! Alles Liebe und ganz viele Küsse – für Dich, Blanche, Willie, May und natürlich für Klina, Dein William
PS: Dies ist die Antwort auf Deinen Brief von Dienstagabend. Am selben Abend habe ich Dir übrigens 200 Mark geschickt. Da haben wir beide das Gleiche gedacht …
Cecelia atmete tief durch. »Mein kleines Hühnchen!« So nannte er sie. Ein Kosename, den sie früher gern gemocht hatte. Dein »kleines Hühnchen« ist nicht dumm, dachte sie mit Bitterkeit. Er wollte sie in Sicherheit wiegen. Doch sie glaubte ihm nicht. Zehn Jahre waren sie nun verheiratet. Zehn Jahre, fünf Schwangerschaften, unzählige Ortswechsel – all das hatte Spuren hinterlassen. Cecelia stand auf. Mit dem Brief in der Hand ging sie zu dem prächtigen Spiegel, der über dem Kamin hing. Zwischen den Deckelvasen und Porzellanfiguren auf dem Sims betrachtete sie sich. Grau war sie geworden. Das Haar war zwar noch kräftig, trotz aller Schwangerschaften, aber es leuchtete nicht mehr in dem dunklen Ebenholzton, der ihr so gut stand. Und dann erst die Augen! Wie viele Männer hatten von ihnen geschwärmt, ihren großen, dunklen Augen. Cecelia seufzte ernüchtert. Jetzt sahen sie müde aus, umringt von kleinen Falten und dunklen Schatten. Sie trat noch einen Schritt näher an ihr Spiegelbild. Selbst in der matten Dämmerung des Raumes waren die Linien auf der Stirn und neben den Mundwinkeln nicht zu übersehen. Cecelia Thomas war an diesem Morgen gewiss keine strahlende französische Schönheit.
Hier stand eine Mutter, allein gelassen, mit vier kleinen Kindern, unwilligen Dienstboten, die seit Monaten auf ihre Bezahlung warteten, und ungezählten offenen Rechnungen in der Schublade. Mit einem Mal bekam Cecelia Mitleid mit der Frau im Spiegel. Und es war alles noch schlimmer. Sie war eine betrogene Ehefrau, das spürte sie. Grimmig malte sie sich aus, wie es William wohl erging im fernen Bremen. Ein bisschen Abwechslung gab es dort bestimmt: jünger, schöner, williger. Eine Träne tropfte auf das dunkelgrüne Samtkleid. Cecelia wischte über den Stoff und berührte dabei die auffällige Brosche. Wie drei Erntegarben waren die Blüten aus Rubinen angeordnet, in ihrer Mitte leuchteten Diamanten. Wenigstens habe ich den Schmuck. Den kann mir keiner mehr nehmen, dachte sie mit Genugtuung. Heutzutage konnte William keiner Geliebten, wo auch immer sie sein würde, eine solche Kostbarkeit schenken. Alles Geld war weg, die Miete hatten sie seit zwei Monaten nicht bezahlt. Kein Wunder, dass Herr Gottschalk, der Vermieter, so schlecht auf sie zu sprechen war. Aber er war nicht der Einzige. In Dresden selbst konnte sie sich kaum noch blicken lassen, überall hatten sie Schulden. Sie wusste ja nicht einmal, was sie den Kindern zu Weihnachten schenken sollte. Selbst im Spielwarengeschäft hatte sie schon anschreiben lassen.
Wieder kam die Wut hoch. Wie konnte William sich in einer solchen Lage mit einer anderen vergnügen? Woher hatte er das Geld, um eine andere zu bezahlen? Hier war doch seine Familie, hier war doch sein Zuhause! Ja, bei den Noacks in Leipzig wäre es wirklich besser, da hatte er recht in seinem Brief. Ein großes Apartment im Hotel de Pologne, mit genügend Platz für die Kinder. Die freundlichen Noacks, die sich um alles kümmerten. Leipzig gefiel ihr ungleich besser als dieser Vorort von Dresden. Strehlen, ein besseres Bauerndorf, aber der einzige Ort, an dem sie sich eine Villa leisten konnten.
Zum Glück hatte William die 200 Mark mitgeschickt. Das Geld musste sie sich gut einteilen. Am besten schnell wegschließen, damit es die Dienstboten gar nicht erst zu sehen bekamen. Cecelia rollte die Scheine in ihrer Hand zusammen und ging zurück zum Sekretär.
Auf einmal wurde die Tür aufgerissen. Ein atemloser William stand hinter ihr, das Haar zerzaust, eine lange Schramme auf der linken Wange. Schnell drehte sich Cecelia um. »Was ist denn jetzt schon wieder?«
Ihr siebenjähriger Sohn japste nach Luft. »Blanche hat mich gekratzt! Es blutet«, heulte er los.
In dem Moment kam seine Schwester. Nur ein knappes Jahr älter als ihr Bruder überragte sie ihn doch um einen halben Kopf. »Er hat selber schuld!«, schrie sie. »William hat meine Puppe kaputt gemacht. Mommy, schau nur!« Anklagend hielt sie die Puppe in die Höhe, an der ein Arm fehlte.
»Nun seid endlich still! Ihr weckt noch das Baby!«, zischte Cecelia ihre beiden Ältesten an.
Zu spät, man hörte schon das Wimmern aus dem Schlafzimmer. Cecelia schob sich an den beiden vorbei zur kleinen May. »Wo ist denn überhaupt Louise? Wo ist euer Kindermädchen?«
Blanche schob die Unterlippe vor. »Die ist mit Klina unterwegs«, antwortete sie. »Klina musste aufs Töpfchen.«
Cecelia stöhnte. Das Weinen wurde durchdringender. Schnell nahm sie ihre jüngste Tochter aus der Wiege und begann leise, ihr ein französisches Wiegenlied vorzusingen. Doch die kleine May blieb unversöhnlich. Ihr Geschrei zerrte an Cecelias Nerven. Sie spürte, wie das Blut in ihren Adern pochte. »Louise? Wo stecken Sie?« Ihre Stimme klang beinahe so schrill wie die des Säuglings.
Endlich kam das Kindermädchen mit Klina an der Hand angelaufen. Die Wärterin entschuldigte sich und nahm das Baby entgegen. Doch auch in ihren Armen gab May keine Ruhe. »Ich glaube, die Kleine hat Hunger«, sagte Fräulein Stern unterwürfig und gab Cecelia das schreiende Kind zurück.
Mit einem Seufzer nahm Cecelia auf dem Schaukelstuhl vor dem Kamin Platz, schickte die anderen aus dem Zimmer und begann, May zu stillen. Keines ihrer Kinder hatte sie jemals zu einer Amme gegeben. Ihre Freundinnen und sogar das eigene Personal schüttelten nur den Kopf. Es schien ihnen primitiv, ja, animalisch, den Kindern die Brust zu geben. Der einzige Mensch, der für ihre Haltung Verständnis hatte, war ihr eigener Mann. William liebte seine Kinder abgöttisch. Wie andächtig er ihr so oft zugesehen hatte, so voller Stolz und Zärtlichkeit, wenn sie wieder mit einem neuen Baby im Arm auf diesem Schaukelstuhl saß! Manchmal wechselte er den Kleinen sogar die Windeln. Cecelia schloss kurz die Augen und träumte sich in diese Zeiten zurück. Ihr Kopf sackte zur Seite und sie schlief ein.
Als sie wach wurde, fiel ihr Blick auf das Foto ihres Mannes, das im vergoldeten Rahmen auf der Kommode stand. Ein kräftiger Mann. Ein Mann, an dessen Seite sie sich sicher und beschützt fühlte. Der sauber gestutzte dunkle Vollbart, in dem bereits das erste Grau zu sehen war. Erst vor ein paar Wochen hatten sie seinen 48. Geburtstag gefeiert. Zu Hause mit ein paar Gläsern Rheinwein. Gäste waren keine da. Wie hätten sie sie auch bewirten sollen bei dieser kümmerlichen Ausstattung der Speisekammer und des Weinkellers? Wie anders war es noch vor ein paar Jahren gewesen. Da hatte es Hummer, Austern, geräucherten Lachs, Gänseleberpasteten aus Straßburg, exotische Früchte und französisches Konfekt gegeben. Die Feste bei den Thomas’ waren berühmt gewesen. Und zu beinahe jedem Fest, im Grunde schon zu jeder größeren Soirée trug Cecelia ein neues Kleid. Eine perfekte Gastgeberin, die mühelos auf Deutsch, Englisch oder Französisch parlieren konnte. William war stolz auf sie gewesen. Manchmal war er, kurz bevor die Feier begann, zu ihr ins Ankleidezimmer gekommen und hatte sie mit einem Schmuckstück überrascht. Sie sollte noch mehr funkeln, hatte er dann gesagt. Und dass sie für ihn das größte Juwel sei. Ach, William. Cecelias Blick glitt wieder über das Foto.
Ernst sah er aus auf dem Bild, ernst und seriös. Die feine Goldrandbrille stand ihm gut, ebenso der tadellos sitzende Anzug mit der großen Perle als Anstecknadel. Ein Geschenk von ihr. Plötzlich fühlte Cecelia eine tiefe Sehnsucht. Vielleicht war er gar nicht bei einer anderen Frau. Vielleicht stimmte alles, was er schrieb, und er hatte geschäftlich in Bremen zu tun. Sie brauchten schließlich Geld, und William hatte viele Verbindungen in Europa und in die alte Heimat Amerika. Vorsichtig legte Cecelia May zurück in die Wiege. Noch einmal ging sie im Geiste die Briefe durch, die er ihr in den vergangenen Wochen geschrieben hatte. Zärtlich und besorgt klang er, nie ausfallend oder vorwurfsvoll, so wie ihre eigenen Briefe häufig endeten, dachte sie beschämt. Wahrscheinlich war es etwas ganz anderes, was ihn in Bremen festhielt. Vielleicht war er krank? Vielleicht brauchte er ihre Hilfe? Ganz allein, in einer fremden Stadt. Mitten im Winter. Oh Gott, wenn sie ihm unrecht getan hatte? Es überhaupt keine andere Frau gab? Unruhig ging sie im Schlafzimmer auf und ab. Vielleicht konnte William aus der Ferne ihre Situation nicht richtig einschätzen? Cecelia setzte sich und begann zu schreiben.
Mein lieber William! Wenn Du wüsstest, wie ich mich nach Dir sehne! Und wie einsam ich bin – und die Kleinen, hier so allein in dem Haus, ohne ihren Vater. Die Dienstboten fürchten sich bei uns zu Tode, wenn sie abends unten in der Küche schlafen gehen. Sie glauben, dass sie alle eines Nachts ermordet werden bei uns. Sie sagen, dass sie dauernd unheimliche Geräusche hören würden. Ich verliere langsam die Geduld, am liebsten würde ich sie rausschmeißen. Wenn ich doch nur anständige Dienstboten finden würde. Und dann sind wir auch noch von der Welt abgeschnitten. Der Schnee liegt einen Meter zwanzig hoch! Zum Teil kommt gar kein Licht mehr durch die Fenster. Stell dir nur einmal vor, es fängt irgendwann an zu tauen, dann kann man sich das ganze Frühjahr nicht mehr aus dem Haus rühren … Du weißt ja, wie schlecht die Anbindung hier ist, aber mittlerweile sieht man überhaupt keine Droschke mehr auf der Straße. Morgen sind wir alle bei Funckes eingeladen zur Geburt der kleinen Tochter. Aber wir werden nicht hingehen können. Der Weg ist zu weit zu Fuß, und der Schnee liegt so hoch, da kann ich den Kinderwagen nicht benutzen. Außerdem ist es viel zu kalt, wir brauchen eine Droschke. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich keinen Fahrer finden werde. Nach Anbruch der Dunkelheit fährt niemand mehr ganz hier raus nach Strehlen. Und es ist im Moment um vier Uhr am Nachmittag stockfinster! Seit Du fort bist, habe ich das Haus nicht verlassen. Nur einmal war ich kurz bei den Funckes. Ein anderes Mal hatte ich mich gerade fertig gemacht, aber es war so furchtbar kalt und der Schnee lag so hoch, dass ich wieder umgekehrt bin. Es macht mich verrückt, die ganze Zeit ans Haus gefesselt zu sein. Ich brauche LUFT und sehne mich danach – genauso wie ich Fleisch brauche zum Essen.
Cecelia hielt inne und überflog die Zeilen. Sie konnte ihre eigene Schrift kaum lesen. Sie überlegte kurz, ob sie noch einmal von vorn beginnen sollte. Aber nein, William sollte nur alles wissen, wie schlecht es ihr erging und den Kindern, wie unerträglich ihre Lage war. Cecelias Blick verfinsterte sich. Die Wut war wieder da. Sie schrieb weiter:
Ich möchte jetzt endgültig wissen, ob Du bis Weihnachten nach Hause kommst oder nicht. Sage mir jetzt endlich die Wahrheit! Ich ertrage sie mit Sicherheit besser als diese Ungewissheit. Du machst einen großen Fehler, mich im Unklaren zu lassen und zu behandeln wie ein kleines Kind. Ich bin alt genug! Sage mir ehrlich, wie lange Du noch fort sein wirst. Ich will gar nicht wissen, was Dich noch aufhält. Weihnachten ist schon in ein paar Tagen. Und wenn Du nicht rechtzeitig hier sein wirst, nehme ich die Kinder und gehe!
So hatte sie ihm noch nie gedroht. Aber es war vielleicht das Einzige, was er verstand. Und Cecelia wusste, dass sie ihn damit treffen würde. Mit einem tiefen Seufzer lehnte sie sich zurück. Natürlich konnte sie nicht einfach gehen, mit den Kindern. Wohin denn? Mit welchem Geld denn? Und trotzdem. Anders würde William nie begreifen, was sie hier durchmachte.
3. Adventsspaziergang
Dresden, 12. Dezember 1875 – am frühen Nachmittag
Langsam rollte die Droschke durch die Seestraße auf den Altmarkt zu. Die Straßen waren gefegt, links und rechts lag der Schnee aufgehäuft. Die Fußwege waren mit Asche bestreut für die vielen Spaziergänger, die an diesem Sonntagnachmittag an den festlich geschmückten Schaufenstern vorbeiflanierten. Keine zwei Wochen mehr bis Weihnachten. Was Cecelia den Kindern dieses Jahr unter den Tannenbaum legen sollte, es war ihr ein Rätsel. Wie sollte sie Geschenke besorgen, wenn doch das Geld so knapp war? Der Kutscher brachte das Pferd zum Stehen.
Aufgeregt sprangen die Kinder von den Sitzen. »Mommy, essen wir jetzt Stollen?« William schaute seine Mutter bittend an.
»Willie, wir sind doch gerade erst angekommen«, tadelte ihn Cecelia. »Geduld, Geduld!«
Die hatte keines der Thomas-Kinder. An der Seite ihrer Mutter und der Kinderfrau, die die kleine May auf dem Arm trug, hüpften sie über den Altmarkt. Die Kinder überhörten die Ermahnungen ihrer Wärterin, und Cecelia ließ sie gewähren. Sie war selbst so erleichtert, dem ungeliebten Strehlen einmal zu entkommen und endlich wieder in Dresden zu sein. Cecelia hatte sich herausgeputzt für den Spaziergang durch die weihnachtliche Stadt. Sie hatte das dunkelrote Promenadenkleid mit dem Überwurf aus Robbenfell gewählt – dazu den passenden Hut, ebenfalls mit Fell verziert. Niemand sollte bei ihrem Anblick auf die Idee kommen, dass die Familie kurz vor dem Bankrott stand.
Ihr Blick ging hinüber zur Fassade des Tuchwaren-Geschäfts an der Ecke zur Baderstraße. Elegante Morgenkleider und Schlafröcke waren im Schaufenster drapiert. »Kinder, wartet einmal!« Cecelia betrachtete die Auslagen interessiert.
Als gelernte Hutmacherin hatte sie ein gutes Auge für Stoffe und Schnitte. Sie sah sich selbst darin, in diesem Traum aus ganz zarter, cremefarbener Baumwolle mit der hübschen Spitze an den Ärmeln. Früher hätte sie sich gleich mehrere Modelle auf einmal gekauft. Doch die Zeiten waren vorbei. Sie hatte kein Geld, und im Moment noch nicht einmal einen Mann, jedenfalls nicht hier. Sie seufzte. Langsam gingen sie weiter. Da riss sich Klina los und rannte davon, bis sie zwischen zwei Hauseingängen zum Stehen kam. Dort saßen zwei ärmlich gekleidete Kinder. Das Mädchen trug ein schmutziges Kleid, das viel zu dünn war für dieses Wetter. Auch der Junge fror in seinen zerrissenen Hosen und dem fleckigen Umhang. Seine nackten Füße steckten in Holzschuhe. Cecelia schauderte es.
»Guck doch mal, Mommy, die Kinder verkaufen diese lustigen kleinen Männer zum Essen!«
Cecelia warf einen schnellen Blick auf den Bauchladen des Jungen. Dort lagen eine Handvoll Männchen, die aus getrockneten Pflaumen zusammengesteckt waren.
»Kann ich so einen haben? Bitte! Die Kinder sind so arm. Wir müssen ihnen Geld geben!« Auch Blanche sah ihre Mutter mit großen Augen an.
Cecelia reichte dem schmutzigen Mädchen ein paar Pfennige. Das Kind murmelte einen Dank und verstaute das Geld schnell unter seiner Schürze. Am liebsten wäre Cecelia sofort weitergegangen, aber nun hielt ihr der Junge seine klebrige Ware unter die Nase. Sie sollte sich ein Männchen aussuchen.
Hastig wickelte sie einen dieser Pflaumentoffel in ein Taschentuch und verstaute ihn in ihrem Beutel.
Klina guckte erwartungsvoll.
»Den gibt es später!«, erklärte sie ihrer Tochter. Eilig zog sie ihre Kinder weiter. Diese zerlumpten kleinen Gestalten kamen ihr vor wie ein schlechtes Omen. Cecelia wollte dieses ungute Gefühl abschütteln und beugte sich zu ihren Kindern hinab. »Wollen wir jetzt Stollen kaufen?«
Im Nu waren der Pflaumenmann und seine armseligen Verkäufer vergessen. Ausgelassen zogen die Thomas-Kinder weiter zu Hermann Königs Conditorei und Stollenbäckerei. Es war ein ganzes Stück zu laufen, aber das wollte Cecelia auf sich nehmen. Alle waren warm eingepackt, selbst die kleine May guckte zufrieden mit roten Winterbäckchen über die Schulter ihrer Wärterin. In der Konditorei gab es jedes Jahr eine große Weihnachtsausstellung. Um den Christstollen aus der eigenen Backstube wurden Christbaum-Konfekt und Makronen drapiert. Es gab Marzipan aus Königsberg und aus Lübeck. Dazu üppige Torten aus Marzipan und Kakao. Vor der hell erleuchteten Konditorei hatte sich bereits eine Schlange gebildet.
Cecelia reihte sich ein und versuchte, ihre Kinder zu beruhigen, die direkt hineinstürmen wollten. »Halt, Willie! Bleib bitte bei mir. Und du auch, Blanche!« Ihr Tonfall war streng.
In dem Moment drehte sich die junge Frau vor ihr mit dem großen Hut um. »Cecelia! Deine Stimme habe ich doch sofort erkannt!«, rief sie erfreut.
Es war Florence de Meli. Eine auffällige Erscheinung in ihrem petrolfarbenen Winterkleid zwischen all den dunkel gekleideten Menschen. Florence war zwar erst Anfang 20, trotzdem gehörte sie zu Cecelias besten Freundinnen in Dresden. »Wie gut, dass ich einfach losgegangen bin. Da sehe ich dich endlich einmal wieder! Die Kinderfrau ist mit Minnie und Henry auch da drüben«, sie zeigte auf die Wärterin, die mit dem Baby im Kinderwagen und dem fünfjährigen Henry ein paar Meter entfernt stand. »Ich hab’s zu Hause nicht mehr ausgehalten. Ich musste frische Luft schnappen! Und außerdem ist Henri gerade wieder unausstehlich«, Florence verdrehte die Augen. »Du kennst ihn ja.«
Cecelia nickte und umarmte ihre Freundin herzlich. »Meli, du siehst fabelhaft aus! Ist das Kleid neu?« fragte sie und strich bewundernd über die pelzverbrämten Ärmelöffnungen.
»Ja! Gefällt es dir? Ich habe es mir im ›Petit Bazar‹ anfertigen lassen. Echter Nerz. Aber sag mal, was machst du hier? Wo steckt William? Wieder irgendwo unterwegs? Ach, ich wünschte, mein Henri wäre auch so viel auf Reisen wie dein Mann«, stöhnte Florence.
»William hat gerade in Bremen zu tun. Aber er hat mir versprochen, dass er auf jeden Fall zu Weihnachten zurück ist«, antwortete Cecelia und versuchte, sich ihren Ärger über das lange Wegbleiben ihres Mannes nicht anmerken zu lassen.
»In Bremen? Hoffentlich nicht in Bremerhaven«, antwortete Florence aufgeregt.
Cecelia schaute sie fragend an. »Es kann schon sein, dass er auch dorthin muss. Warum?«
»Henri hat mir vorhin aus der Sonntagszeitung vorgelesen. In Bremerhaven gab es wohl eine schlimme Katastrophe. Ein Schiff ist explodiert oder so. Jedenfalls sind ganz viele Menschen gestorben«, berichtete sie.
Cecelia wurde blass. »Was sagst du? Ein Schiff ist explodiert? Das ist ja schrecklich!«
»Aber dein Mann ist doch in Bremen. Mach dir also keine Gedanken!«, versuchte Florence, Cecelia zu beruhigen.
»Oh, Gott. Wenn William etwas zugestoßen ist …« Cecelia schlug die Hand vor den Mund. Sie spürte, wie ein Schluchzen in ihr aufstieg.
»Bitte, Cecelia, beruhige dich doch!« Florence strich ihr über die Schulter.
Die Wartenden ringsherum beobachteten neugierig die Szenerie. Die Ersten begannen, hinter vorgehaltener Hand zu tuscheln. Florence blickte missbilligend um sich. »Cecelia, vielleicht solltest du nach Hause fahren. Bestimmt liegt dort schon eine Nachricht von William«, tröstete sie ihre Freundin.
Cecelia tupfte sich die Augen ab. »Louise, bitte kaufen Sie etwas Stollen für die Kinder. Und passen Sie auf sie auf. Ich bin gleich wieder zurück. Ich will nur schnell eine Zeitung holen.«
Wie betäubt lief Cecelia durch die Straßen. Die Menschen auf den Gehwegen waren in aufgeräumter, fast feierlicher Stimmung. Weihnachten war nahe, die Auslagen in den Geschäften versprachen eine großzügige Bescherung, jedenfalls für diejenigen, die es sich leisten konnten. Cecelia hatte keinen Blick mehr für die kunstvoll drapierten Kleider, Hüte und Juwelen. Wo war nur so ein verdammter Zeitungsjunge? Sonst standen sie doch überall herum und fuchtelten mit ihren Blättern.
Endlich erblickte sie einen Jungen, der einen Stapel Zeitungen in der Hand hielt. Den Dresdner Anzeiger. Cecelia nahm sich ein Exemplar und gab dem Kind ein paar Münzen. Und tatsächlich, da stand es:
Ein dem Norddeutschen Lloyd zugegangenes Telegramm aus Bremerhaven meldet: »Nachdem der nach New York bestimmte Dampfer Mosel (dem Norddeutschen Lloyd gehörig) die Passagiere im Vorhafen an Bord genommen, explodierte der Kessel des Schleppdampfers Simson, der vor der Mosel lag. Es sind durch den Unglücksfall wenigstens 50 Menschen ums Leben gekommen, und eine große Anzahl ist verwundet. Die Mosel ist beschädigt und kann heute nicht abgehen. Nach einem anderen Telegramm explodierte nicht der Kessel, sondern eine am Landungsplatz stehende mit Sprengstoffen gefüllte Kiste.«
Sie las den Text gleich ein zweites Mal. Um Gottes willen, eine mit Sprengstoff beladene Kiste! Das war ja entsetzlich!
Atemlos kam Cecelia wieder bei Louise und den Kindern an. Zum Glück fand sich kurz darauf eine leere Droschke, und die Familie konnte sich auf den Weg zurück nach Strehlen machen.
Die Kinder starrten ihre Mutter ängstlich an. Keines traute sich, etwas zu sagen. Endlich schob Klina ihre Hand in die ihrer Mutter. »Mommy, was ist los? Warum bist du so traurig?«
Cecelia schluckte. Sie konnte ihrer Tochter nicht in die Augen blicken. »Ach, es ist nichts. Ich hatte nur gerade wieder einmal so schreckliche Schmerzen. Weißt du, mein Rheuma kommt eben immer wieder. Und manchmal ist es nicht zum Aushalten«, log sie. Die Kinder sollten nichts mitbekommen. Cecelia richtete sich in ihrem Sitz auf. »Es ist alles schon wieder gut«, sagte sie mit einem gezwungenen Lächeln. »Jetzt fahren wir nach Hause und essen Stollen.«
Es begann schon zu dämmern, als sie vor der Villa Thomas ankamen. Die Kinder freuten sich über den Stollen und eine Tasse heiße Schokolade. Cecelia setzte sich ins Schlafzimmer mit der Zeitung auf den Knien und weinte.
4. Im Lazarett
Bremerhaven, 12. Dezember 1875 – am Nachmittag
Johanne versuchte, die Augenzu öffnen. Sie blinzelte. Selbst diese winzige Bewegung ihrer Augenlider war kaum auszuhalten. Ihr Kopf war schwer, fühlte sich dumpf an. Sie konnte sich nicht umdrehen. Am liebsten wäre sie wieder eingeschlafen, um fortzukommen von den Schmerzen. Doch da hatte sich schon der Geruch in ihre Nase gesetzt, eine Mischung aus Alkohol, Blut und menschlichen Ausdünstungen. Sie war wach und roch nasse Kleidung, muffige Feuchtigkeit und etwas unangenehm Süßes, das sie nicht zuordnen konnte. Es war Chloroform.
Johanne wurde schlecht. Sie spürte, wie die Übelkeit in ihr aufstieg. Ruckartig drehte sie sich zur Seite und übergab sich. Erst jetzt merkte sie, wo die eigentliche Ursache ihrer Schmerzen lag, in der rechten Seite, in ihrem Arm, ihrer Hand.
»Hier ein Tuch! Bitte bleib liegen, Hanni, du darfst dich nicht bewegen«, hörte sie die Stimme ihrer Schwester Sophie.
Johanne blickte auf und sah in ein Paar rot geweinte Augen. Sie wollte sprechen, aber es gelang ihr nicht.
Sophie nahm ein anderes Tuch und wischte ihr das Gesicht ab. »Ach, Hannchen, es ist alles so furchtbar!«, sagte sie leise.
Johanne schaute sie fragend an.
»Hier, versuch, ein wenig zu trinken!« Sophie reichte ihr einen Becher mit Wasser. Doch Johanne konnte den Kopf kaum anheben. Sofort riss sie ein stechender Schmerz herunter. Es war die rechte Hand. Sie schrie auf. Dieser Schmerz nahm ihr beinahe die Luft. Sophie strich ihr über die Stirn und glättete ein paar verklebte Haarsträhnen. Dann versuchte sie, ihrer älteren Schwester mit einem Esslöffel ein paar Schluck Wasser einzuflößen. Doch das meiste davon lief an Johannes Hals hinab. Ihre Stimme war heiser und sehr leise. Sophie konnte sie kaum verstehen.
»Was mach ich hier? Was ist passiert? Wo ist Elsie? Wo ist Christian?«
Sophie nahm vorsichtig Johannes linke Hand und streichelte sie. Dann begann sie zu weinen.
Johanne wurde unruhig. »Bitte sag mir, was passiert ist!«
»Es gab ein Unglück«, begann die Schwester zu erzählen. »Eine furchtbare Explosion. Zuerst haben alle gedacht, dass es der Kessel vom Schleppdampfer war.« Ihre Stimme wurde immer leiser. »Hanni, da war ein riesiges Feuer. Alles ist verbrannt, alles ist kaputt«, flüsterte sie unter Schluchzen.
»Aber wo ist Elsie? Wo ist Christian?« Trotz der Schmerzen versuchte Johanne, sich aufzurichten. »Wir waren zusammen am Schiff. Ich hab doch Elsie im Arm gehalten. Wo ist mein Kind?« Jetzt schrie sie beinahe.
»Elsie geht es gut. Beruhige dich. Sie ist bei euch zu Hause. Gesine kümmert sich um sie. Ihr ist nichts geschehen. Du hast sie gerettet, weil du sie so gut festgehalten hast!« Wieder schluchzte Sophie. »Aber die anderen …«, sie verstummte und streichelte Johannes gesunde Hand immer hektischer.
»Ja? Was ist mit den anderen?«
Sophies Stimme war kaum noch zu verstehen. »Die anderen sind tot.«
Johanne lag ruhig da. Hörte, wie das Blut in ihren Ohren rauschte, spürte ihren Herzschlag, war ganz ruhig und starr und sah ihre Schwester an, als sei sie eine Fremde. Eine fremde Frau, die über fremde Menschen sprach. Sie atmete schwer: »Wer ist tot?«
»Alle sind tot, Hanni, alle.«
»Und Christian?«
Sophie konnte ihrer Schwester nicht in die Augen sehen und nickte nur. Die Tränen strömten über ihr Gesicht.
Johannes Augen weiteten sich. Der Schmerz in ihrer Hand breitete sich im ganzen Körper aus. Sie zitterte und schrie so laut, dass Sophie ihr erschrocken das Taschentuch vor den Mund presste.
Als Johanne das nächste Mal erwachte, war ihr Mund trocken. Sie versuchte, sich aufzurichten, um an den Krug Wasser neben ihrem Lager zu kommen. Unmöglich. Der Schmerz an ihrem Handgelenk machte es unmöglich. Mit einem Stöhnen ließ sie sich zurücksinken. Zum ersten Mal versuchte sie, ihren verletzten Arm zu betrachten. Alles war in grau-weißes Leinen gewickelt, an der Spitze, dort, wo die Hand sein musste, sah sie getrocknetes Blut. Der Verband war nicht mehr ganz sauber. Die kleinste Regung ließ sie vor Schmerz aufschreien. Sie begriff, dass sie ernsthaft verletzt war. Vorsichtig strich sie mit der linken Hand über den Verband. Dann starrte sie verwirrt auf ihre Arme. Der linke war länger als der rechte. Das konnte nicht sein! Noch einmal ein prüfender Blick. Tatsächlich, der linke Arm war länger als der rechte. Waren es die Schmerzen? Hatte man ihr Medizin gegeben, die den Geist vernebelte? Johanne glitt erschöpft auf ihr Kissen zurück.
In dem Moment trat ihre Schwester an ihr Bett.
»Sophie, was ist mit meinem Arm? Der eine ist kürzer als der andere«, flüsterte Johanne.
Sophie seufzte tief und setzte sich zu ihr. Sie presste ein Taschentuch vor ihren Mund, versuchte, das wieder aufkommende Weinen zu unterdrücken. »Du hast dich verletzt«, sagte sie leise.
»Aber warum sind meine Arme unterschiedlich lang?«, fragte Johanne und wehrte sich mit aller Macht gegen die Ahnung, die in ihr aufstieg.
»Hanni, ich weiß gar nicht, wie ich es dir sagen soll. Bei der Explosion ist etwas gegen deine Hand geschleudert worden. Mit voller Wucht. Es hat sehr geblutet. Hörte gar nicht wieder auf. Wir dachten schon, du überlebst es nicht«, antwortete ihre Schwester. »Aber zum Glück hast du es überlebt!«
»Und werde ich wieder gesund?«, fragte Johanne.
»Ja, das wirst du. Aber du wirst lernen müssen, alles mit deiner linken Hand zu machen.« Sophies Stimme zitterte.
Johannes Gehirn weigerte sich zu begreifen, was ihre Schwester ihr sagen wollte. Was war mit ihrer rechten Hand? War sie gelähmt?
Sophie blickte ihr direkt in die Augen: »Deine Hand musste amputiert werden. Die Ärzte konnten nichts anderes mehr tun.«
Ein paar Sekunden herrschte Stille. Johanne wirkte ganz ruhig. Es schien, als würde sie darüber nachdenken, über das, was sie gerade erfahren hatte. Dann bahnte sich ein Schluchzen den Weg ihre Kehle hinauf. Johanne weinte. Sie weinte lange – um ihre verlorene Hand und um ihren toten Mann.
Es war kalt und zugig. Johanne versuchte, die Decke hochzuziehen, bis unter das Kinn. Dann lag sie da. Regungslos. Sie lauschte ihrem eigenen Atem. Und sie hörte diesen hellen Ton. Dieses schrille Fiepen in ihren Ohren. Was war das? Die ganze Zeit war dieses Geräusch in ihren Ohren, in ihrem Kopf. Erschöpft drehte sie den Kopf zur Seite. Vielleicht würde es dann aufhören. Jemand schrie nach einem Arzt, sie hörte das Weinen einer Frau. Zum ersten Mal nahm sie ihre Umgebung wahr. Seit knapp 24 Stunden lag sie in einem Lazarett. Eigentlich war es nur ein Hafenschuppen, der notdürftig für die vielen Verletzten umgerüstet worden war. Es war dämmrig. Johanne drehte langsam den Kopf zur anderen Seite, ohne ihren Körper zu bewegen. Sie musste so ruhig wie möglich liegen – jede ihrer Bewegungen übertrug sich sofort auf den rechten Arm. Und wie ein Messerstich kam die Antwort aus dem Handgelenk zurück.
Sie versuchte zu erkennen, was um sie herum geschah. Sie sah eine Art Gang. An einem Holzbalken hing eine Petroleumlampe, die rußiges Licht verbreitete. Links und rechts des Ganges waren Betten aufgestellt. Einige Patienten hatten keine Betten, sondern lagen auf Strohsäcken und Decken, die in der Eile herangeschafft worden waren. Ein Mann, dessen Kopf von einem Verband umwickelt war, schlief unruhig und redete dabei. Von woanders, irgendwo aus der Dunkelheit, hörte Johanne ein Wimmern. Es klang wie ein Kind.
Schritte kamen in ihre Richtung. Eine junge Frau in Ordenstracht beugte sich zu ihr. »Haben Sie Schmerzen?«, fragte die Nonne freundlich und kleine Atemwölkchen bildeten sich vor ihrem Mund.
Johanne nickte.
Die Nonne sah sie mitfühlend an. Dann zog sie eine Flasche Laudanum aus ihrer Rocktasche. Schon nach ein paar Schlucken setzte die schmerzstillende Wirkung von Alkohol und Opium ein. Johanne schloss die Augen und schlief ein.
5. Unbezahlte Rechnungen
Strehlen bei Dresden, 12. Dezember 1875 – am Abend
Cecelia saß an ihrem Sekretär im Salon. Von draußen fiel ein schwacher Strahl durch die Samtvorhänge, die Anna nur nachlässig zugezogen hatte. Das trübe Licht der Gaslaterne, nur erhellt durch den Schnee überall. Das Haus, die Straße – alles weiß, alles still, wie betäubt. Jemand läutete an der Haustür.
Sie hörte, wie Anna die Tür öffnete, hörte eine fremde Männerstimme. Ohne auf ihr Dienstmädchen zu warten, eilte sie hinunter und erblickte einen jungen Mann in Uniform. Er hielt einen Umschlag in der Hand. Ein Telegramm. Atemlos stand Cecelia vor ihm und nahm ihm die Depesche ab. »Vielen Dank. Anna gibt Ihnen gleich etwas.«
Damit verschwand sie in den Salon. Ihre Hände zitterten, als sie den Umschlag aufriss. Eine Nachricht aus Bremerhaven! Hoffentlich hatte Gott ihre Gebete erhört.
Dann las sie. Es war ein Schreiben von der Bremerhavener Polizei. William sei schwer verwundet. Sie müsse zu ihm kommen. Gegen 11 Uhr würde sie ein Polizeiinspektor morgen Vormittag abholen und mit ihr zum Bahnhof nach Dresden und weiter nach Bremerhaven fahren.
Cecelia atmete flach. Was hatte das zu bedeuten? Wenn William so krank war. Sie las den Text noch einmal. Und zu ihrem Schutz würde sie ein Polizist begleiten, überlegte sie. Wie gut, bestimmt hatte William dafür gesorgt, obwohl es ihm so schlecht ging. Cecelia begann zu weinen. Schluchzend legte sie das Telegramm zur Seite. Ihr armer, armer William.
Ihre Gedanken rasten. Vielleicht wussten die Steuarts in Leipzig mehr über sein Schicksal. Immerhin war John Steuart amerikanischer Konsul. Und vielleicht könnten sie sich in ihrer Abwesenheit um die Kinder kümmern. »Hallo! Hallo? Junger Mann, sind Sie noch da?« Die Haustür war bereits geschlossen. »Anna, schnell, holen Sie den Mann zurück. Ich muss ein Telegramm aufgeben, es ist dringend!«
Anna rannte hinaus und keuchte dem Telegrammboten hinterher. Doch der winkte ab. »Nee, das darf ich nicht. Da muss Ihre Herrschaft schon selbst zum Postamt kommen.«
Nur zweieinhalb Stunden später stand der Bote wieder im verschneiten Garten der Villa Thomas. Nachdem sich Cecelia aufgemacht und persönlich den Steuarts nach Leipzig telegrafiert hatte, erschien der Kurier nun mit der Antwort des amerikanischen Konsuls. Ja, die Kinder könnten sie nehmen, las Cecelia erleichtert. Aber über den Verbleib von William wussten die Steuarts auch nichts.
Enttäuscht las Cecelia die Depesche noch einmal. Aber vielleicht war das ein gutes Zeichen? Sie versuchte, sich selbst Hoffnung zu machen. Wenn die Steuarts trotz ihrer Position und trotz ihrer Kontakte nichts über William gehört hatten, dann war er in jedem Fall noch am Leben. Denn sicher gab es schon eine Liste der getöteten Passagiere. William war am Leben. Und er war ein unschuldiges Opfer in dieser entsetzlichen Katastrophe am Hafen.
Die Standuhr tickte laut. Nervös sah Cecelia auf den mächtigen Kasten aus dunkler Eiche, der neben der Tür stand. Sie konnte den Blick nicht abwenden. Das Pendel holte aus, der Gong ertönte. Das Geräusch riss sie aus der Starre. Sie musste alles vorbereiten für die Reise. Cecelia fand zu ihrer gewohnten Tatkraft zurück. Sie läutete nach dem Dienstmädchen. »Anna, ich werde morgen für ein paar Tage verreisen. Holen Sie doch bitte schon einmal die beiden braunen Reisetaschen vom Speicher.«
Anna knickste und machte sich auf den Weg.
Cecelia ließ die Flamme der Petroleumlampe aufflackern. Ihr Schein fiel auf einen Stapel Briefe, Visitenkarten, ein paar Fotos, Rechnungen, Mahnungen und noch mehr Papiere. Vor der Abreise musste sie Ordnung schaffen. Alles ins Reine bringen. Ihr Leben in Ordnung bringen. Die Briefe von William legte sie ganz nach außen. Nein, jetzt nicht noch einmal lesen, ermahnte sie sich selbst. Dafür war nun keine Zeit. Der nächste Stapel bestand aus den Briefen von zu Hause. Aus St. Louis. Die schwungvolle Schrift ihrer Mutter, dann die vielen, vielen Seiten von Fanny, ihrer Lieblingsschwester. Sogar drei alte, leicht vergilbte Briefe von Carl Fröhlich waren dabei. Was wohl aus ihm geworden war? Was wohl aus ihr geworden wäre als Mrs. Fröhlich? Wahrscheinlich wäre sie dann nie aus St. Louis hinausgekommen, hätte nichts gesehen von der Welt. Nein, als Ehefrau eines kleinen Bankangestellten wollte sie nicht enden. Sie schob die Briefe ihres ehemaligen Verlobten ganz nach unten, unter den zweiten Stapel.
Jetzt Visitenkarten, Korrespondenz, Fotos – Zeugnisse ihres Lebens in Europa. Wehmütig strich Cecelia über geprägte Kronen und verschnörkelte Namens- und Titelzeilen. Schweres, teures Papier. Fotos von eleganten Frauen und von Männern, die einen weltmännischen Blick aufgesetzt hatten. Genauso wie sie selbst und William. In diesen Kreisen war sie bewundert worden für ihren exklusiven Geschmack, die aufwendigen Kleider, den wertvollen Schmuck. Ja, die anderen hatten sich selbst gern mit ihr und William geschmückt. Als William noch Vizepräsident des amerikanischen Clubs war. Dazu ihre eigenen französischen Wurzeln. Das machte Eindruck in Dresden.
Cecelia seufzte. Was für ein Aufstieg, was für ein Leben! Vom unehelichen Kind einer Putzmacherin im Elsass zu einer umschwärmten Dame der Gesellschaft in Deutschland. Mit Verbindungen bis in hohe Adelskreise und zu schwerreichen Unternehmerfamilien. Ja, so wollte sie leben. Nicht als Frau eines unbedeutenden Büroschreibers wie Carl Fröhlich, sondern als Gattin von William King Thomas, Geschäftsmann, Privatier und Inhaber eines großen Vermögens.
Nun gut, Letzteres stimmte so nicht mehr. Schon lange nicht mehr. William hatte ihr nie Einblick gewährt in das, was er tat und wofür er angeblich pausenlos in die USA reisen musste. Doch sie hatte es an seinen Reaktionen gemerkt, wenn wieder eine Rechnung kam für ein neues Kleid oder einen weiteren Hut. Seine Wutanfälle, wie er sie angeschrien hatte und zuletzt sogar am Arm gepackt und in seinem Furor geschlagen hatte. Da wusste sie, dass es finanziell nicht gut um sie stand. Früher hatte William ihr jeden Wunsch von den Augen abgelesen und sie verwöhnt mit teuren Kleidern und auffälligem Schmuck. Cecelia dachte an die unbeschwerten Jahre zu Beginn ihrer Zeit in Sachsen. Vorbei. Jetzt lagen auf dem Sekretär unsortierte Rechnungen und Mahnungen vor ihr. Es wurde der höchste Stapel.
Sie betrachtete den Rubinring an ihrer rechten Hand. Ein funkelnder Stein, ungewöhnlich groß, eingerahmt von Diamanten. Diesen Ring hatte ihr William noch zur Geburt von May geschenkt. Das war gerade einmal ein Dreivierteljahr her. Ein teures Stück, das konnte jeder auf den ersten Blick sehen. Unbezahlt, wie sie nun feststellte, die Rechnung und zwei Mahnungen vom Juwelier hatte sie bereits auf den Stapel mit den Forderungen gelegt. Egal, was der Juwelier noch dafür haben wollte, der Ring gehörte jetzt ihr. Eine Art Belohnung für all das, was Cecelia in der letzten Zeit hatte mitmachen müssen.
Fünf Kinder geboren, eines verloren, das Jüngste noch ein Säugling, die vielen Umzüge, das unstete Leben an der Seite von William, seine Wutanfälle. Jedes Schmuckstück, das er ihr geschenkt hatte, hatte sie sich redlich verdient, davon war Cecelia überzeugt. Sie stand auf, fasste sich an ihre Frisur und strich mit den Fingern über die verspielten Steckkämme, Horn mit Gold und Perlen verziert. Cecelia liebte nun einmal Schmuck, das hatte William gleich gemerkt. Ja, er war ein aufmerksamer Ehemann. Von Anfang an. Und jetzt? Jetzt war er vielleicht schon tot!
Sie starrte in die Flammen im Kamin. Eine Explosion. Irgendetwas war an dieser Meldung aus Bremerhaven, das sie unruhig machte. Es war nicht nur die Sorge um ihren Mann. Nein, es war noch etwas anderes. Eher eine Ahnung. Ein schlechtes Gefühl, das Cecelia am liebsten verdrängt hätte. Aber es gelang ihr nicht. Sie wusste, wie sehr sich William für die Kraft von Bomben und Sprengstoff interessierte. Er hatte ihr ganz zu Beginn ihrer Ehe von einem Pulverturm in seiner Heimatstadt Halifax in Kanada erzählt. Und dass dieser Turm eines Tages in die Luft geflogen war. Cecelia erinnerte sich, wie er von dem Unglück beinahe geschwärmt hatte. Und dann fiel ihr ein, wie kalt er von dem Untergang der »Deutschland« in seinen Briefen aus Bremen geschrieben hatte. Völlig unbeteiligt und gleichzeitig sensationsheischend. So als wären ihm all die armen Opfer, die in der eisigen Nordsee ertrunken oder erfroren waren, gleichgültig. Cecelia grübelte. Was war, wenn William etwas mit diesem schrecklichen Verbrechen in Bremerhaven zu tun hatte?
Schnell stand sie auf. Nein, nicht ihr William. Er liebte doch seine Kinder. Er würde doch nicht seine Familie ins Unglück stürzen. Cecelias Blick fiel auf sein Foto. Ein Geschäftsmann, der sich auf internationalem Parkett bewegen konnte. Da gab es gar keinen Zweifel. Und wie entzückend er mit den Kindern umging, er liebte sie von ganzem Herzen. Niemals würde er wollen, dass es ihnen schlecht erging. Cecelia begann zu schluchzen. Aber würde er aus Sorge um seine Familie ein Verbrechen begehen? Wieder kamen diese schrecklichen Gedanken in ihr auf. William liebte seine Familie, seine Kinder. Sie sollten ohne Sorgen aufwachsen – doch dafür brauchten sie Geld. Und das war schon lange nicht mehr da. Sie seufzte und putzte sich die Nase. Aber deswegen gleich ein Schiff in die Luft jagen? Nein, nein und nochmals nein. Nicht ihr William. Oh Gott, vielleicht war er gar selbst schon tot! Und sie, Cecelia, eine Witwe mit vier kleinen Kindern. Mit solch schändlichen Gedanken. Sie schämte sich und weinte. Nur langsam konnte sie sich beruhigen.
Nach einer Weile stand sie auf und ging mit der Lampe in der Hand in ihr Schlafzimmer. Der Raum war kalt, das Feuer im Ofen schon vor Stunden heruntergebrannt. Ärgerlich dachte Cecelia an Anna, ihr Dienstmädchen. Ja, auch sie hatte seit einigen Wochen keinen Lohn mehr bekommen, aber das war noch lange kein Grund, die Arbeit hier so schlampig zu erledigen. Schließlich hatte sie Kost und Logis frei – Cecelias Mund wurde schmal. Genau wie ihr Ehemann hatte auch sie eine Neigung zu Wutanfällen. Doch jetzt war keine Zeit, das Dienstmädchen zur Rede zu stellen. Cecelia nahm sich einen breiten Kaschmirschal aus dem Schrank und legte ihn über die Schultern. Dann ging sie zur Spiegelkommode und schloss die drei Schubladen auf, in denen sie ihren Schmuck aufbewahrte. Der Anblick tröstete sie. Ringe, Ketten, Broschen, Armbänder, Armreifen, Colliers, Zierkämme und sogar Diademe lagen hier funkelnd nebeneinander. Cecelia war nicht mehr kalt. Das alles gehörte ihr! Ein Vermögen aus Gold, Diamanten, Rubinen, Saphiren, Perlen, Granat und noch mehr Diamanten. Das, was hier ausgebreitet vor ihr lag, waren zehn Jahre Ehe. Cecelia schluckte kurz. Ihre Lippen zitterten.
Tief in ihrem Inneren hatte sie eine Ahnung, dass es einen Zusammenhang zwischen der Katastrophe am Hafen und ihrem Mann geben könnte. Schon seit Langem wusste sie, dass William Geld beschaffen wollte – um jeden Preis. Und schon bald nach ihrer Hochzeit im Sommer 1865 hatte sie gemerkt, dass dieser freigiebige und humorvolle Mann auch eine verschlagene und gewissenlose Seite hatte. Warum hatten sie damals aus Amerika fliehen müssen? Mitten in der Nacht? Angeblich trachteten ihm Gläubiger nach dem Leben. Warum verfolgten sie ihn durch halb Amerika? Warum war William damals nicht zur Polizei gegangen? Warum überhaupt »William«? Sie hatte ihn als Alexander kennengelernt. Alexander Thompson. Er hatte ihr irgendwann stolz das verschnörkelte »A« auf seinem Oberarm gezeigt, das er sich noch vor ihrer Ehe hatte tätowieren lassen. Und womit hatte er all das Geld verdient, das sie in Europa so sorglos ausgegeben hatten?
Sie durfte keine Zeit verlieren. Wenn ihr dumpfes Gefühl stimmte, dann hatte William etwas mit diesem Verbrechen zu tun. Und wenn nicht, war er vielleicht bald tot oder so schwer verletzt, dass er nie wieder würde arbeiten können. So oder so – Cecelia musste an die Kinder denken. Und an sich.
Sorgfältig räumte sie die Juwelen aus den Schubladen und verstaute sie in verschiedene kleine Säckchen, die sie anschließend in die Bibliothek brachte, wo sie sie im Geheimfach hinter dem Bücherregal verstaute. Dann ging sie zurück in den Salon. Die Flammen loderten hell, als sie Seite für Seite die Briefe aus St. Louis, die Briefe aus ihrem alten Leben in Amerika ins Feuer fallen ließ.
6. Wieder zu Hause
Bremerhaven, 13. Dezember 1875
Gesine saß am Küchenfenster