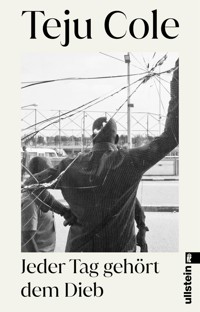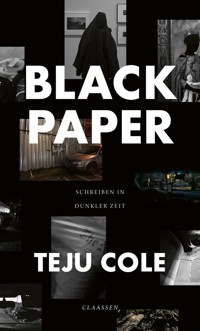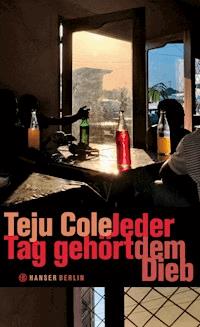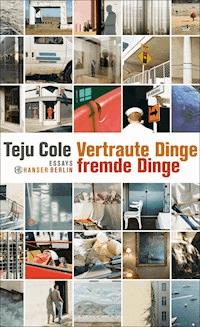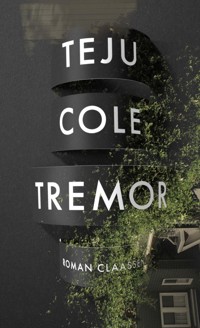
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Anleitung zur Aufmerksamkeit: Teju Coles neuer Roman Tunde lehrt an einer amerikanischen Universität Fotografie, aufgewachsen ist er in Lagos. Mit wachen Sinnen bewegt er sich über den Campus und durch Institutionen, denen er nie ganz selbstverständlich zugehören wird. In Bildern, in Filmen, in Landschaften, in der Musik findet er Schönheit, aber auch die Ablagerungen von Unrecht und westlicher Überheblichkeit. Was heißt es, richtig zu leben in einer Welt der Gewalt und der Oberflächlichkeit? Wie lässt sich der Brutalität der Geschichte bleibende Bedeutung abringen? Was schulden wir denen, die uns nahe sind, und was schulden wir Fremden? Tunde sucht nach Halt und nach Sinn: in seiner Kunst, in seinen Erinnerungen, als Freund und als Liebender. Tremor ist ein zorniges, zärtliches, tröstendes Buch. Ein Roman, dessen Schönheit gerade durch seine beunruhigende Brüchigkeit hervortritt, und der uns – wie ein Bild, das seinen Betrachter mit Fragen konfrontiert – mit geschärfter Aufmerksamkeit entlässt: für das Leiden ebenso wie für die Schönheit, die dennoch immer entsteht, und die alles ist, was wir haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Tremor
Teju Cole, geboren 1975, wuchs in Lagos auf. Er ist Schriftsteller, Kritiker, Kurator und Fotograf. Für seine Bücher, darunter der Roman Open City, erhielt er zahlreiche Preise, unter anderem den PEN/Hemingway Award, den New York City Book Award, den Windham Campbell Prize und den Internationalen Literaturpreis. Teju Cole ist derzeit Professor für Kreatives Schreiben an der Harvard University. Er lebt in Cambridge, Massachusetts.
Tunde spürt, dass er nicht selbstverständlich an diesen Ort weißer Gelehrsamkeit gehört, die Universität in Neuengland, an der er Fotografie unterrichtet. Er istin Nigeria aufgewachsen, und diese Herkunft schärft seinen Blick dafür, wie Kolonialismus und Gewalt um ihn herum fortleben. Er hat erfahren, was Verlust heißt, und er sucht nach Halt: in der Kunst, der Musik, in Freundschaften und in seiner Liebe zu Sadako, um die er nach Jahren der Ehe kämpft. Und während Tunde auf Reisen ist – in Bamako, in Lagos –, bewegt sich auch das Erzählen in neue Richtungen. Nach und nach kehren Motive wieder und verschränken sich: ein Kunstwerk, Musik, Blindheit, offene und versteckte Gewalt, Licht und Schatten.»Teju Coles Sprache begeistert mich immer wieder aufs Neue – ihre Schönheit, Intimität, Komplexität und Klarheit. TREMORist ein subtil schillerndes Buch.« Deborah Levy»Ein elegantes und aufwühlendes Prosastillleben über den Zusammenhang von Kunst, Diebstahl und Gewalt, Privatheit und Gemeinschaft.« The New Yorker»Dieses Buch ist eine Verlockung, eine formale und ethische Falle: Cole verführt seine Leser:innen mit meisterhaften Anekdoten, bevor er in die großen, manchmal beunruhigenden Themen eintaucht.« The New York Times Book Review
Teju Cole
Tremor
Roman
Aus dem Englischen von Anna Jäger
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© 2023 by Teju ColeDie Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel Tremor im Verlag Random House, New York.© der deutschsprachigen Ausgabe 2024 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinAlle Rechte vorbehalten.Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Umschlaggestaltung:Umschlaggestaltung: Nurten Zeren, zerendesign.comUmschlagmotiv: © Teju ColeAutorenfoto: © Maggie Janik, | Harvard GSDE-Book powered by pepyrus.
Die in diesem Roman dargestellten Ereignisse sind rein fiktiv. Alle Personen, Orte oder Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Ereignissen, Orten undmit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
ISBN: 978-3-8437-3118-8
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
1
1
Die Blätter sind glänzend und dunkel, aus den absterbenden Blüten steigt ein Duft, vielleicht Jasmin. Er stellt sein Stativ auf und beginnt, die Kamera einzurichten. Zweimal hat er den Auslöser betätigt, als er eine aggressive Stimme aus dem Haus zu seiner Rechten rufen hört. Es ist nicht das erste Mal, dass ihm so etwas passiert, doch es erschreckt ihn. Mit freundlicher Stimme erklärt er, Künstler zu sein und einfach nur die Hecke zu fotografieren. Das können Sie hier nicht machen, sagt die Stimme. Das ist Privatgelände. Die Muskeln in seinem Rücken spannen sich an. Er klappt das Stativ zusammen, verstaut die Kamera in der Tasche und entfernt sich.
Am Montag geht er ins Institut, wo ihn Pakete und andere Sendungen erwarten, darunter ein weißer Umschlag mit einer dicken schwarzen Linie über der Lasche. Zwei oder drei solcher Briefumschläge erreichen ihn jeden Monat, offizielle Mitteilungen über den Tod von aktuellen oder ehemaligen Mitgliedern des Instituts. Der Umschlag ist beinahe quadratisch. Er sitzt in seinem Büro und öffnet ihn. Die darin liegende Karte ist ebenfalls schwarz umrandet. Ein emeritierter Professor der Mikrobiologie ist verstorben. Niemand, den er kennt. Die Karten weichen nie vom gleichen Muster ab: Die Dekanin bekundet ihr Bedauern über den Tod des jeweiligen Professors in einer antiquierten Sprache. Ein Tod, der am »sechsten des Hartung« eintrat, ist einer, der sich am sechsten Januar ereignet hat; der »letzte Ultimo« ist der letzte Tag des vergangenen Monats. Er hatte begonnen, die Karten zu sammeln und ihre hochtrabende Förmlichkeit als ein Echo der in früheren Zeiten üblichen Trauerkleidung zu betrachten, der Seide und Grenadine der Kleider von Witwen zur Zeit des Bürgerkriegs, der schwarzen Schleier, der schwarzen Handschuhe, der schwarzen Schmuckstücke, mit denen man vor der Gesellschaft das Einhalten der Trauerzeit bezeigte. Die symbolische Zuordnung der Farben gibt es heute nicht mehr, dieses Beschreiben von schwerer, umfassender oder leichter Trauer mit der Sprache von Schwarz, Grau, Lila oder Flieder.
Zwei Bücher liegen auf seinem Schreibtisch: Calvinos Die unsichtbaren Städte und eine Übersetzung des Sunjata-Epos. Im zweiten finden sich Versionen des Epos von zwei Djelis, Bamba Suso und Banna Kanute, von denen er Bamba Susos Version kürzlich las. Im Regal steht ein Fläschchen mit dunkler Tinte, die ihm Paul Lanier zugesandt hat. Die Tinte wird aus wilden Trauben hergestellt, die rund um die Bahnschienen in St. Louis gesammelt werden. Da sie selbst gemacht ist, hat sich die Farbe verändert. In der Flasche sieht sie noch dunkel, beinahe violett aus. Auf Papier aufgetragen, erinnert die blasse Farbe nach einer Weile an die des Meeres. Aber was meint das überhaupt, die Farbe »des Meeres«? Wenn wir sagen, dass das Meer blau ist, denken wir an ein helles oder blasses Blau, eine Farbe, die dem Himmelblau nahekommt. Das Meer ist manchmal von einem dieser Blautöne und manchmal dunkler, aber meistens ist das Meer überhaupt nicht blau, sondern orange oder grau oder lila mit dem Schimmern von Homers πορφύρεος, und manchmal nichts: transparent, Wasser. In der Dämmerung verfärbt es sich von silbrig zu zinnfarben. In einer mondlosen Nacht ist es schwarz.
Er nimmt die Flasche mit der Tinte in die Hand, ein reifes Lavendel, ein Lila, das in seinen Tiefen von Indigo heimgesucht wird. Der Name stammt vom Usambaraveilchen aus der Gattung der Violen ab, und ihm gefällt das trügerische Netz aus Etymologien, zu dem der Name einlädt: die Sanftheit einer Viola, die Spannung einer Violine, ein Anflug von Violenz, von Gewalt. Nicht das Violett mittelalterlicher Bischöfe und Universitätsprofessoren, vielmehr das Violett der dunkelsten afrikanischen Haut. Gemälde von Mark Rothko, Agnes Martin, Lorna Simpson und allen voran Chris Ofili. In den unteren Lagen ist dessen Mary Magdalene von einem so tiefen Violett, dass die Augen darin ertrinken könnten, und in seinem Raising of the Lazarus setzt er ein Violett ein, so schlicht, dass es Tote wieder zum Leben erwecken könnte. Das handgefärbte, handgewobene Tuch, das Tunde wenige Monate nach dem Tod seiner Großmutter aus ihrem Kleiderschrank nahm. Grau für die Trauer, Violett für die Liebe.
Sie fahren nach Maine, um nach Antiquitäten zu suchen. Die Fahrt dauert anderthalb Stunden, und während der kurzen Fährüberfahrt nach New Hampshire tauschen sie die Plätze, und sie fährt. Sie wollen im südlichen Maine bleiben, nur bis nach Kennebunk hoch, und unterwegs verschiedene Läden aufsuchen. Sie nehmen sich den ganzen Nachmittag dafür Zeit. In einem großen Geschäft in York betrachtet er eine von einem Kind gemalte Karte Nordamerikas aus dem neunzehnten Jahrhundert. Am Stadtrand von Ogunquit stehen Schilder mit der Aufschrift »Blue Lives Matter«, die im Ortszentrum Regenbogenflaggen weichen. Schließlich kommen sie in Wells an, wo sie auf einen großen Laden in einem Gebäude stoßen, das früher eine Scheune gewesen sein könnte. Auf zwei Etagen stehen dicht an dicht Möbel, Gemälde, Glaswaren und Porzellan, das meiste stammt aus dem frühen oder mittleren neunzehnten Jahrhundert, etliches ist noch älter. Sie stöbern einzeln. Sie schaut sich einen Kolonialstil-Sekretär aus Ahornholz an. Er ist überrascht, eine Sammlung hölzerner Masken und Skulpturen zu finden, von denen drei erkennbar afrikanisch sind, die anderen scheinen pazifisch, asiatisch oder indigen nordamerikanisch. Ein eleganter Antilopenkopfschmuck mit nach oben ragenden Hörnern, eine Ci Wara, zieht ihn sofort in seinen Bann. Sie ist etwa ein Meter zwanzig hoch und scheint alt zu sein, das Holz ist dunkel gebeizt, die Angabe auf dem Schild unbestimmt. Die geschwungenen Linien und durchbrochenen Schnitzereien zeigen eine weibliche Antilope mit einem Antilopenjungen auf dem Rücken. Das Kitz ist eine Miniaturausgabe der Mutter, der Hauptunterschied besteht darin, dass seine Hörner unverhältnismäßig kürzer sind. Junge Männer, die den Kopfschmuck in der männlichen wie der weiblichen Form tragen, tanzen bei Festen zur Aussaat und Ernte mit einer Ci Wara, die den Bambara zufolge der Menschheit die Landwirtschaft gebracht haben soll.
Die beiden Männer, die das Antiquitätengeschäft betreiben, sehen aus wie Mitte oder Ende achtzig, und ihre Neckereien erwecken den Eindruck einer eingespielten komödiantischen Aufführung. Sie erzählen Tunde, dass sie Schwager seien, aber oft für Brüder gehalten würden. Der eine scherzt, dafür sei der andere viel zu alt, dieser erwidert, jener sei nicht hübsch genug, um mit ihm verwandt zu sein. Tunde fragt den etwas jünger Aussehenden nach der Ci Wara, aber außer der Annahme, dass die Skulptur »echt sein könnte«, hat der Mann keine weiteren Informationen.
Tunde fragt sich, was Echtheit in dem Fall bedeutet. Dass mit genau dieser Ci Wara bei einem landwirtschaftlichen Fest der Bambara getanzt wurde? Oder dass sie, ungeachtet dessen, ob mit ihr getanzt wurde oder nicht, nicht für den touristischen Handel hergestellt worden war? Dass sie von Bambara gemacht wurde, um von Bambara benutzt zu werden? Was auch immer ihr Ursprung gewesen sein mag, sie hatte den Weg an die Küste Neuenglands gefunden. Sie befand sich in einem Laden, einer unter vielen unzusammenhängenden Schätzen, die weiße Menschen auf der ganzen Welt mit redlichen oder unlauteren Mitteln gesammelt hatten. Im Westen bedeutet die Vorliebe für das »Echte«, dass die Kunstsammelnden es vorziehen, wenn ihre afrikanischen Objekte zweckentfremdet werden, sodass nur das real wird, was aus seinem Zusammenhang gerissen wurde. Umso besser, wenn der Name des Künstlers nicht bekannt ist, umso besser, wenn die Künstlerin bereits lange tot ist. Die Enteignung derer, die diese Objekte erschaffen haben, verleiht dem Objekt auf mystische Weise monetären Wert, und die Bedeutung des Objekts wird durch das Narrativ erhöht, das man über dessen Rolle in der Geschichte der modernen europäischen Kunst erzählen kann.
Er hat schon einmal eine weibliche Ci-Wara-Skulptur gesehen, die der vor ihm stehenden ähnelte und die bei einer Auktion für 400 000 Dollar verkauft wurde. All diese Nullen, das ist ihm klar, hängen eng mit der Wolke aus magischen Wörtern zusammen, mit der das Auktionshaus das Objekt vernebelt hat: »in situ«, »erworben«, »ausgestellt«. Je umfangreicher der Besitznachweis, desto höher die Summe, die zwischen Verkaufenden und Kaufenden ausgetauscht werden kann. Die Ci Wara, die er in Wells betrachtet, hat einen Preis von 250 Dollar, womit die Frage der Echtheit geklärt sein dürfte: Die Skulptur hat keine »Provenienz« und ist deshalb nur wenig wert. In ihm kommt das Gefühl auf, dass er sie retten sollte. Er möchte sie ihrem Zuhause näher bringen, seinem eigenen Zuhause, wo wohlwollendere Augen sie betrachten, die ihre Echtheit anders bewerten. Warum sollte die Arbeit eines zeitgenössischen Künstlers, der eine Ci Wara schnitzt, um sie an Reisende zu verkaufen, weniger ehrenvoll sein als die des »traditionellen« Künstlers, der eine Ci Wara erschafft, mit der beim Erntefest getanzt wird? Doch er will sich nichts vormachen. Geld wandert so oder so von einer Hand in die andere.
Sadako hat sich für den Ahornschreibtisch entschieden. Er ist kompakt und passt wahrscheinlich in ihren gemieteten Geländewagen. Im letzten Moment kommen ihm Zweifel an der Ci Wara, aber Sadako besteht darauf, dass sie sie kaufen. Sie gehen in den vorderen Bereich des Ladens, wo der Balken über der Kasse mit Fotos, Karikaturen und Ausschnitten von alten Anzeigen übersät ist. Hinter der Theke hängt eine von Laura Bush signierte Karte. Das überrascht ihn nicht, da sich das Anwesen der Familie Bush, nur fünfzehn Minuten entfernt, in Kennebunkport befindet und diese Gegend von Maine beim noblen Flügel der politischen Rechten beliebt ist. An einem Holzpfosten neben der Ladentheke sieht er zwischen verblassten Flugblättern und sich kräuselnden laminierten Zetteln eine kleine fotokopierte Notiz in Großbuchstaben, von der Zeit gezeichnet und undatiert:
HOF DER FAMILIE WELLS. DIESES GEHÖFT WURDE 1657 VON DR. THOMAS WELLS ERRICHTET. IM AUGUST 1703 BEGAB SICH SEIN ENKEL DEACON THOMAS AUF DIE SUCHE NACH EINER KRANKENSCHWESTER FÜR SEINE FRAU SARAH (BROWNE), DIE AM VORABEND EINE TOCHTER ZUR WELT GEBRACHT HATTE. WÄHREND SEINER ABWESENHEIT WURDE DIE STADT WELLS VON INDIANERN ANGEGRIFFEN, ZUERST DIESER HOF. SIE DRANGEN MIT ÄXTEN INS HAUS UND MASSAKRIERTEN MRS WELLS, IHREN SÄUGLING, DIE VIERJÄHRIGE SARAH UND DEN ZWEIJÄHRIGEN JOSHUA. DANN BRANNTEN SIE DAS HAUS NIEDER. NACH DIESER SCHRECKLICHEN TRAGÖDIE GING MR WELLS NACH IPSWICH, MASSACHUSETTS, UND KEHRTE NACH 1718 MIT EINER NEUEN FAMILIE ZURÜCK, UM SEINEN ANSPRUCH AUF DAS GEHÖFT ZU ERHEBEN. ES BLIEB BIS 1906 IM BESITZ DER FAMILIE WELLS.
Der ältere der beiden Schwager kassiert sie ab. Er versucht, die Mehrwertsteuer auf einem Taschenrechner mit großen Tasten auszurechnen, und vertut sich beim ersten Mal. Langsam wiederholt er die Berechnung, macht wieder einen Fehler und kommt erst beim vierten Versuch auf das richtige Ergebnis. Die Ausstattung des Ladens ist offensichtlich gewollt rudimentär. Das Kartenlesegerät, in das Tunde seine Kreditkarte einführt, piept einige Male, bevor es einen gleichmäßigen Ton von sich gibt. Der Mann stellt eine Quittung auf dünnem gelbem Papier aus, dann wickeln die Schwager die Ci Wara in weiche Papierbögen ein. Ihre zitternden, von Altersflecken bedeckten Hände scheinen die Skulptur zu streicheln und sie in das hauchzarte weiße Gewand einer Braut zu hüllen. Die Antilopenhörner ragen aus dem dünnen Papier hervor. So eingehüllt fühlt die Ci Wara sich leicht wie Luft an. Sadako trägt sie vorsichtig zum Wagen. Tunde bringt zunächst die drei Schubladen des Ahornschreibtischs nach draußen, dann den Tisch selbst.
Wildgänse ziehen, in die Abenddämmerung schreiend, über ihnen hinweg. Himmel und Klang sind eins, und gegenüber der Scheune befindet sich ein Haus mit offensichtlich modernen Erweiterungen um ein drittes Stockwerk und eine überdachte Veranda. Zwischen dem Haus und der Scheune steht der große, alte Baum, unter dem ihr Geländewagen parkt. Im Jetzt ist alle Zeit enthalten.
Die Scheinwerferlichter fallen vor ihnen auf der I-95 zusammen. »If You Don’t Believe« von Deniece Williams erfüllt das Auto mit Musik. Eins von Sadakos Lieblingsliedern. Beim Nachdenken über Wells spürt er, wie sich in seinem Gehirn ein Knoten löst. Nach fast drei Jahrzehnten in den USA wurden seine Sympathien in bestimmte Richtungen gelenkt. Er hat früh verstanden, dass eine »schreckliche Tragödie« bedeutet, dass die Opfer weiß waren. Später und durch bittere Erfahrungen musste er lernen, dass hinter jeder Tragödie mehr steckt, als erzählt wird, und dass die Erzählung nie neutral ist. Aber was ihm jetzt widerfährt, ist seltsamer: seine mangelnde Empathie für die Wells-Familie und wie schwer es ihm fällt, sie sich überhaupt vorzustellen. Eine solch heftige Gegenreaktion ist eine neue, brutale Seite in ihm. Ist es brutal? Das Einzige, woran er denken kann, ist der sogenannte dritte »Indianerkrieg«, bei dem die Abenaki von den kolonialen Siedlern vertrieben wurden, die es als ihr gottgegebenes Recht ansahen, die Ländereien der Abenaki zu beschlagnahmen und sie zu töten, wenn sie Gegenwehr leisteten.
Bei dem Text im Antiquitätenladen handelte es sich allerdings um einen Fiebertraum sinnloser Gewalt von »Indianern« gegen Leute wie »uns«. Später wird Tunde die Namen und Geburtsdaten der Kinder von Deacon Wells in den Archiven des County herausfinden: Sarah Wells, neunter März 1699; Joshua Wells, neunter Oktober 1701. Die »Indianer« blieben namenlos, sie waren mit Äxten bewaffnet aufgetaucht und hatten gemordet und skalpiert und das Haus niedergebrannt. Dennoch war Deacon Wells fünfzehn Jahre später zurückgekehrt. Seine Verluste waren ihm – wie Hiob – ersetzt worden, er kam wieder mit seiner neuen Frau, einer Cousine aus Salem, die ihm drei Kinder gebar. Allmählich wurde das Land befriedet. Das Problem mit den »Indianern« verschwand, und Deacon Wells lebte noch lange, bis er im August 1737 seine Seele dem Herrn anvertraute. Seinem letzten Willen wurde ein Monat später stattgegeben. »Ich vermache und vererbe meiner geliebten Frau Lydia Wells all mein Hab und Gut, [und] meinen negro, Jeff.«
Am darauffolgenden Wochenende sind sie zum Abendessen bei ihrer Freundin Emily Brown in der Dana Street eingeladen, ein nur zehnminütiger Spaziergang von ihrem Haus in der Ellis Street entfernt. Es ist ein warmer Abend, der sich eher nach Spätsommer als nach Frühherbst anfühlt. Beim Essen erwähnt er den Ausflug nach Wells. Seine Wiedergabe der gewaltvollen Szenen auf dem Gehöft erinnern Emilys Partnerin Mariam an ein 2007 von Susan Faludi veröffentlichtes Buch. The Terror Dream, sagt Mariam, zieht eine Verbindung zwischen dem Machismo der Bush-Präsidentschaft und der sich durch die amerikanische Geschichte ziehenden Popularität der captivitiy narratives, eines auf die frühe Kolonialzeit zurückgehenden Genres von Entführungsgeschichten, die es sich zur Aufgabe machten, weiße Frauen vor dunkelhäutigen Eindringlingen zu beschützen. Als Tunde später am Abend zu Hause über Faludis Buch recherchiert, findet er heraus, dass ein Exemplar in der Bibliothek der Kennedy School verfügbar ist.
Am darauffolgenden Dienstag durchquert er eine Stunde vor seinem Seminar zu Digitaler Farbe den Yard, läuft über den Harvard Square und entlang der John F. Kennedy Street hin zum Backsteinbau der Kennedy School. Er schaut sich in der Bibliothek um. Als er sich mit einem Stapel Zeitschriften hinsetzt, eilt eine Bibliothekarin auf ihn zu. Sie möchte wissen, ob sie ihm »helfen« könne. Er erkennt den von ihr angeschlagenen Ton. Ohne ein Wort zu erwidern, entfernt er sich von ihr. Er findet The Terror Dream und verbucht es am Selbstausleihegerät.
Während er das Abendessen vorbereitet, spielt er eine Aufnahme von Bachs Cello-Suiten ab, die er ungefähr 2001 auf deinen Rat hin gekauft hatte. Damals interessiertest du dich dafür, wie sich in Bachs Partituren erkennen lässt, dass sie aus der Improvisation entstanden sind. Du hast es als »Verkörperung« beschrieben: die multifokale Wahrnehmung eines Tieres im Wald oder die kontrollierte Intensität eines Jägers in einem anderen Abschnitt des gleichen Waldes. Du sagtest zu Tunde, dass Bach nicht einfach nur Noten arrangiert habe. Er vermittele eine lebendige, gezielte Suche, beides spüre man am deutlichsten in seinen Solowerken. Beim Zuhören könne man diesem Satz wie ein Fährtenleser folgen, von einer Phrase zur nächsten, von einem Argument zum nächsten, man könne in diesem Präsens existieren, egal, wie festlich oder feierlich die Musik werde. Und die Kunst des Cellisten Anner Bylsma, ebenjene improvisiert klingenden Linien herauszuarbeiten, brachte dich dazu, Tunde dessen Aufnahme zu empfehlen.
Zu diesem Zeitpunkt pflegte Tunde schon seit Langem eine eigene Begeisterung für Aufnahmen von Bachs Werken für Soloinstrumente. Er liebte das Soloviolinen-Debüt von Hilary Hahn, die Goldberg-Variationen auf dem Klavier von Chen Pi-hsien und Jean-Pierre Rampals Interpretation der Partita für Flöte solo. In jeder dieser Aufnahmen fand er eine gewisse persönliche Unpersönlichkeit, die Bach weniger wie einen Komponisten und mehr wie einen Philosophen, einen Ratgeber, einen Wissenschaftler, einen Architekten oder einen Propheten erscheinen ließ; alles, nur kein regionaler Hofmusiker im Deutschland des achtzehnten Jahrhunderts.
Deine Empfehlung von Bylsma, den du als jemanden mit dem Schwung eines Fechters und der Haltung eines Tanzlehrers beschrieben hattest, half ihm, diese persönliche Unpersönlichkeit auf eine neue Art zu erleben. So präzise, sagtest du, sei Bylsmas Kombination aus leichtem Anschlag und sattem Klang, dass es beinahe so wäre, als würde er zeichnen und nicht Cello spielen. Tunde hörte sich die Aufnahme damals genau an, und Bylsmas Interpretation bereicherte seine Wahrnehmung von Werken, die er bereits von verschiedenen Aufnahmen kannte.
Die besondere Bedeutung, die Bylsmas Version für dich hatte und die du Tunde vermittelt hast, hing vermutlich mit deiner eigenen damaligen Praxis zusammen, freie Improvisationen fürs Klavier zu komponieren, was weniger mit der Interpretation bereits bestehender Werke zu tun hatte als mit einem Entdeckergeist, der das Klavier dazu brachte, dir seine Geheimnisse in Echtzeit preiszugeben. Verkörperung, sagtest du, das sei nicht nur das Tier im Wald und nicht nur der Fährtenleser, der dem Tier folgt, sondern auch der Wald an sich als ein seiner selbst bewusstes System, das achtgibt auf das Rascheln seiner Blätter, die wechselnden Farben, die Luft, das Wasser, den panoptischen Blick auf die vielen beweglichen Teile, das Wechselspiel von Licht und Schatten.
Bei den zahlreichen Auseinandersetzungen zwischen amerikanischen Indigenen und Siedlern kam es häufig zu Entführungen, die später in den Dienst eines nationalen Mythos gestellt wurden. Ein ganzes Drittel der Hunderte von Frauen, die von indigenen Menschen entführt worden waren, weigerte sich später, in ihre weißen Gemeinschaften zurückzukehren. Diese Frauen zogen ihr neues Leben bei ihren mittlerweile adoptierten Familien vor, während ihre weißen Familienmitglieder weiter in dem Glauben blieben, die Rettung einer entführten Frau sei das höchste Gut, ganz gleich, was die betroffene Frau selbst wollte. Aus dieser Überzeugung entstanden Hunderte captivity narratives, deren Topos vom Ideal der heldenhaften Rettung die amerikanische Kultur nachhaltig beeinflusst hat, nicht zuletzt in Filmen wie dem John-Wayne-Streifen Der Schwarze Falke von 1956.
Der Schwarze Falke beruhte auf einer fiktiven Darstellung der Lebensgeschichte von Cynthia Ann Parker, die 1836 im Alter von zehn Jahren von Comanche-Kriegern entführt worden war. Parker lebte vierundzwanzig Jahre bei den Comanche, bis sie gegen ihren Willen zu ihrer weißen Familie zurückgebracht wurde. Der Film erzählt eine Geschichte von purem Heldentum, obwohl Parker, die von ihrer Comanche-Familie Naduah genannt wurde, die Frau eines Chiefs und Mutter von drei Kindern geworden war und sich zehn Jahre lang nicht wieder in die weiße Gesellschaft einzugliedern vermochte. Sie unternahm den Versuch, zu ihrer Comanche-Familie zurückzukehren, wurde aber ein zweites Mal gewaltsam zurückgeholt. Nachdem ihre Tochter 1871 an einer Lungenentzündung gestorben war, verweigerte sie die Nahrungsaufnahme und hungerte sich langsam zu Tode.
Viele Jahre zuvor hatte die Brutalität der Kolonisten in Neuengland Chief Metacomet dazu gebracht, zur Verteidigung des Wampanoag-Volkes in den Krieg zu ziehen. Metacomets Aufstand, von den Kolonisten King-Philip-Krieg genannt, war für alle Kriegsbeteiligten verlustreich, besonders aber für die indigene Bevölkerung in Neuengland. 1675 hatten die Kolonisten in Rhode Island sechshundert Angehörige der Narragansett bei lebendigem Leib verbrannt, die Hälfte von ihnen waren Frauen und Kinder. Scheinbar auf das Angebot von französischen Siedlern hin, Kopfgeld für Skalps von Briten zu zahlen, überfiel im März 1697 eine Gruppe von Abenaki die Siedlung Haverhill. Dabei töteten sie siebenundzwanzig Menschen und entführten dreizehn. Unter den Entführten befanden sich Hannah Duston, die erst kürzlich ein Kind zur Welt gebracht hatte, und ihre Amme Mary Neff. Ohne zu zögern, schmetterten die Angreifer Dustons erst sechs Tage alte Tochter Martha gegen einen Felsen. Zwei Wochen später und Hunderte Meilen von ihrem Zuhause entfernt wurden die beiden Frauen im heutigen New Hampshire bei einer zwölfköpfigen Abenaki-Familie auf Contoocook Island im Merrimack River festgehalten. Bei ihnen befand sich auch Samuel Lennardson, ein britischer Junge, der achtzehn Monate zuvor verschleppt worden war.
Tunde liest sich unvoreingenommen durch diesen Katalog des Grauens. Er kann in diesem Moment nicht klar benennen, wem seine Anteilnahme gilt oder ob er auf die Lektüre ebenso kühl reagiert wie auf die Geschichte des Massakers in Wells. Vielleicht hat ihn das Buch von Faludi ermüdet. Nein, nicht das Buch: Es ist die der Geschichte eigene Brutalität, die Symmetrien verweigert und keinen Trost bietet. Eines Nachts, als die Abenaki-Familie auf Contoocook Island schlief, bewaffneten sich die weißen Gefangenen mit Beilen und schritten zur Tat. Zwei der Abenaki entkamen, eine Frau und ein Junge. Von den übrigen brachte Mary Neff eine Person um und Hannah Duston neun. Von diesen Getöteten waren zwei Männer, zwei Frauen und sechs Kinder. Nachdem sie schon eine gewisse Strecke auf ihrer Flucht zurückgelegt hatten, fiel Duston und Neff die von der Verwaltung in Massachusetts ausgelobte Belohnung ein. Um sie zu erhalten, brauchten sie Beweise, also kehrte Duston auf die Insel zurück und skalpierte die Toten. Mit den grausigen Trophäen im Gepäck machte sie sich erneut auf den langen Heimweg. Sie hatte sie alle skalpiert. Ihre Namen sind nicht bekannt.
In der folgenden Zeit verbreitete sich die Nachricht über ihre Tat, was ihr die Stellung einer zweifelhaften Heldin einbrachte. Was sie getan hatte, war ungewöhnlich für eine Frau, und man war sich einig, dass sie zu barbarisch vorgegangen war. Eine Legende erfordert Klarheit: Wer ist der Feind, wer ist das Opfer, wer ist die Heldin. Wenn diese Klarheit verwischt wird, läuft alles aus dem Ruder. Natürlich müssen die »Indianer« massakriert werden, natürlich müssen sie skalpiert werden, aber das ist keine Aufgabe für eine Frau.
Bezugnehmend auf die Historikerin Mary Beth Norton stellt Faludi eine Verbindung zwischen den indigenen Angriffen und der Hexenverfolgung her. Bei den Mädchen, die im schicksalhaften letzten Jahrzehnt des siebzehnten Jahrhunderts in Salem in Massachusetts verhext waren oder für verhext gehalten wurden, handelte es sich häufig um Waisenkinder, die einen oder beide Elternteile in den kriegerischen Auseinandersetzungen verloren hatten. So beispielsweise Mercy Short, die 1690 von Abenaki-Kriegern aus Salmon Falls in New Hampshire verschleppt worden war. Beide Eltern und drei ihrer Geschwister zählten zu den vierunddreißig Dorfbewohnern, die bei diesem Überfall getötet wurden. Acht Monate später wurde sie durch eine Lösegeldzahlung befreit und begann, in Salem als Dienstmädchen bei einer Witwe namens Margaret Thacher zu arbeiten. Nach einem Botengang zum Bostoner Gefängnis, in dem einige der Hexerei Bezichtigte einsaßen, erlitt sie 1692 einen Anfall. Sie war »verhext« worden. Es kann jedoch kaum Zweifel daran bestehen, dass ihre Fantasie durch ihre noch nicht lange zurückliegende Gefangenschaft und die Gräueltaten, die sie erlebt hatte, beeinflusst worden war. Short legte dem fanatischen, in Harvard ausgebildeten Geistlichen Cotton Mather gegenüber eine Zeugenaussage ab, in der sie angab, den Teufel gesehen zu haben. Er sei, so sagte sie, »ein kleiner schwarzer Mann«. Aber er hatte, wie sie klarstellte, nicht die Hautfarbe »eines Schwarzen, sondern gelbbraun, wie die eines Indianers«.
Tunde wird aus seinen Gedanken gerissen, als Sadako von der Arbeit heimkommt. Sie sprechen kurz miteinander. Sie bleibt im Erdgeschoss. Er geht nach oben in ihr Arbeitszimmer. Der Raum wird von einer einzigen Lampe erhellt, er liest weiter. Der Konflikt zwischen den Geistern der unsichtbaren Welt und den Menschen in Neuengland hatte Mather auf den Gedanken gebracht, dass »dieser unerklärliche Krieg seinen Ursprung bei den Indianern haben mag«, unter denen er »entsetzliche Hexenmeister und höllische Beschwörerinnen« vermutete, die »mit Dämonen sprachen«. Die Angst vor dem indigenen Eindringling erfasste vor allem die Städte an den Rändern der kolonialen Siedlungsgebiete, die den Kolonisten als Grenzzone galten zwischen Ordnung und Unordnung, Christentum und Unzivilisiertheit, Gott und Teufel. Die berüchtigte Hexenverfolgung, die 1692 die Kolonie Salem erschütterte und vierundzwanzig unbescholtene Seelen ins Verderben riss, von denen die meisten Frauen waren und die meisten erhängt wurden, nahm ihren Anfang in den falschen Anschuldigungen gegen Tituba, eine versklavte Frau, die wahrscheinlich von den Taíno oder Kalihna abstammte und von ihren Nachbarn nur als »Indianerin« bezeichnet wurde. Unter Folter und Prügel gestand Tituba, eine Hexe zu sein. Ihr blieb die Hinrichtung erspart, da sie geständig war und unter Druck andere beschuldigte. Doch der Mann, der sie auf Barbados versklavt hatte und in dessen Haus sie in Salem lebte, der ebenfalls in Harvard ausgebildete, puritanische Geistliche Reverend Samuel Parris, verkaufte sie danach in ein weiteres und wahrscheinlich brutaleres Versklavungsverhältnis. Nach diesem zweiten Verkauf verlieren sich die Spuren von Tituba, die ihre kleine Tochter im Haushalt von Parris zurücklassen musste. Als Reverend Parris 1720 starb, achtundzwanzig Jahre nach den Ereignissen um Tituba, wurde ihre Tochter dessen Sohn Samuel Parris jr. vermacht, und von diesem Zeitpunkt an ist nichts weiter über sie bekannt, abgesehen von ihrem Namen, der im Testament des alten Mannes festgehalten wurde: Violet.