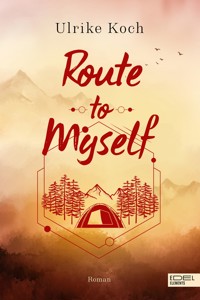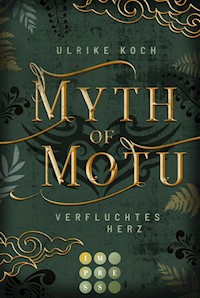7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Raya hätte nie zu träumen gewagt, einmal mit einem ausgebauten Van alleine durch die Highlands zu fahren, aber dennoch findet sie sich nach einem Schicksalsschlag genau dort wieder. Ihre Tour führt sie zum Castle of Mey, doch kurz bevor sie das Schloss erreicht, macht eine Autopanne ihr einen Strich durch die Rechnung. Glück im Unglück: George Mey, der Erbe des Schlosses, lässt sie gegen Arbeit bei sich wohnen. Allerdings erkennt Raya schnell, dass sich hinter Georges abweisender Fassade ein dunkles Geheimnis verbirgt. Schottische Wintertage vermischt mit der Geschichte eines jahrhundertealten Schlosses machen diese Reise zu einem unvergleichlichen Abenteuer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
Copyright © 2025 Edel Verlagsgruppe GmbH
Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edelverlagsgruppe.de/kontakt
Projektkoordination: Claudia Tischer
Lektorat: Dr. Rainer Schöttle
Vermittelt durch: Arrowsmith Agency, Hamburg
ePub-Konvertierung: Datagrafix GSP GmbH, Berlin | www.datagrafix.com
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
eISBN: 978-3-96215-515-5
Die Welt ist erfüllt von wundervollen Geschichten.
Danke, dass ich dir meine erzählen kann.
VIER MONATE ZUVOR
„Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du ein Esel bist?“ Ich warf ein ölverschmiertes Tuch nach Thomas, dessen kehliges Lachen daraufhin nur stärker wurde.
„Ehrlich gesagt höre ich solche schmutzigen Wörter nur aus deinem verkommenen Mund.“ Geschickt wich er aus, sodass der Lappen gegen die Wand flog und schließlich neben ihm auf der Kommode landete.
Der Raum war erfüllt von dem leichten Duft nach Benzin, Holz und geschmolzenem Metall.
Seit Monaten trafen wir uns in der Garage meines besten Freundes, um gemeinsam an unserem Projekt zu arbeiten: einem 1995er T1-Bus. Ein wahr gewordener Traum, der leider durch den Zahn der Zeit von Rost und anderen Umwelteinflüssen gezeichnet war.
„Zudem musst du zugeben, dass ich recht habe. Aaron steht total auf dich und du bist mal wieder viel zu verkopft, um es zu merken.“
Thomas hüpfte elegant von der Kommode und schlenderte dann mit den Händen in der Hosentasche in meine Richtung. Ich hatte es mir auf einem abgewetzten Ledersessel gemütlich gemacht, der früher im Haus von Thomas’ Großvater gestanden hatte. Niemand wollte irgendein Stück haben, das an diesen grantigen Mann erinnerte, aber mein bester Freund hatte darauf bestanden, den Sessel mitzunehmen. Als ich ihn zur Rede stellte, hatte er gemeint, dass in jedem Menschen, auch wenn er noch so bösartig wirkte, etwas Gutes steckte. Er verband den Sessel mit den Geschichten, die sein Großvater ihm immer erzählt hatte. Die meisten davon waren nicht unbedingt für Kinderohren gedacht, aber das störte wohl keinen der beiden. Thomas hatte mir einmal ein Foto gezeigt, wie er auf dem Schoß seines Großvaters saß und freudestrahlend in die Kamera lächelte.
„Erstens sind wir keine Teenies mehr, die bei kleinen Liebesbotschaften anfangen, verschwörerisch zu kichern, während sie im Klassenzimmer herumgereicht werden. Zweitens bin ich durchaus in der Lage, zu erkennen, wenn ein Kerl auf mich steht, und drittens habe ich gar kein Interesse an einer Beziehung. Drei gute Gründe, um nichts in unverfängliche Nachrichten und zwanglose Dates hineinzuinterpretieren.“
Thomas schüttelte den Kopf, als wären meine Argumente lächerlich. Dann beugte er sich zu mir herunter und stupste mir mit der Spitze seines Zeigefingers gegen die Stirn.
„Manchmal frage ich mich, wie du auf der einen Seite intelligent genug sein kannst, um die ersten Semester des Architekturstudiums erfolgreich zu bestehen, und dir andererseits die einfachsten nonverbalen Zeichen nicht auffallen können. Der Typ findet immer wieder einen Vorwand, um in deiner Nähe zu sein, und du siehst das nicht. Zudem zieht er dich förmlich mit seinen Blicken aus.“
Mit einer fließenden Bewegung lenkte ich Thomas’ Hand von mir weg.
„Das Studium fällt mir leicht. Das war auch ein Grund, warum ich es gewählt habe, aber so recht zufrieden bin ich nicht. Ich habe das Gefühl, mir fehlt etwas.“ Ich seufzte und blinzelte dann meinem besten Freund zu. „Also, wenn ich es nicht besser wüsste, könnte ich annehmen, dass du eifersüchtig bist“, konterte ich und streckte frech die Zunge raus. Ein unsinniger Vorwurf, denn obwohl wir zahlreiche Nächte durchgefeiert hatten, war nie etwas zwischen uns passiert. Uns beiden war die Freundschaft zu wichtig.
„Du hast mich erwischt.“ Thomas griff sich theatralisch an die Brust und entlockte mir damit ein Grinsen. Selbst wenn ich einen Tag mit schlechter Laune begonnen hatte, weil ich dank eines Regenschauers vollkommen durchnässt an der Uni ankam, nahm er mit Thomas’ Hilfe immer eine gute Wendung.
„Genug rumgealbert, lass uns jetzt weitermachen, bevor die nächste Generation sich noch an Hilde die Zähne ausbeißt.“
Den Spitznamen Hilde, besser gesagt Hildegard, hatte der rote VW-Bus seiner Widerspenstigkeit zu verdanken. Immer wenn ein Teil repariert war, streikte ein anderes. Uns beide erinnerte das an einen Terrier aus der Nachbarschaft, der immer wieder Möglichkeiten fand, das eingezäunte Grundstück zu verlassen, nur um Kinder oder den Briefträger zu jagen. Die Besitzer taten alles, um das unliebsame Verhalten abzustellen, aber Hildegard war stur, und zur Belohnung wurde sie nach ihrem Tod zur Namensgeberin unseres Busses.
„Du hast gut reden. Wer macht denn die ganze Arbeit?“ Während er diese rhetorische Frage stellte, deutete er auf sich.
„Und wer sorgt dafür, dass du immer schön motiviert bleibst?“
Ich ahmte seine Geste nach.
„Du nennst es also Motivation, mir sämtliche Süßigkeiten und Chips wegzunehmen, bis ich mein Tagessoll erfüllt habe? Die Foltermeister der Geschichte würden sich vor deinen Methoden verneigen.“
Es war gar nicht so einfach, sämtliche Versuchungen vor Thomas zu verbergen, denn sein Spürsinn für Verbotenes war unvergleichlich. Außerdem war er schon immer leicht abzulenken gewesen. Wenn wir früher Verstecken gespielt hatten, schwang immer die Angst bei mir mit, dass er irgendwann von etwas anderem fasziniert sein und mich daraufhin vergessen würde. Die zwei Mal, die es vorgekommen war, durfte er sich noch jahrelang anhören.
„Würde ein Schokoriegel deine Laune heben?“, fragte ich und blinzelte unschuldig.
„Würde es.“ Er streckte die Hand aus, als würde er hoffen, dass ich immer etwas zu essen bei mir hätte.
„Sag mir jetzt bitte nicht, dass du glaubst, ich verstecke einen in meiner Jeans.“
„Das war nur ein Bluff?“ Er verzog die Lippen zu einem schmalen Strich.
„Erschreckender finde ich den Gedanken, dass du ihn ohne Skrupel essen würdest“, entgegnete ich und schüttelte ungläubig den Kopf.
„Du bist grausam“, erwiderte er und wandte sich ab, um in den Bus zu steigen. Wir wollten heute mit der Innenverkleidung weitermachen, nachdem wir den Rost gründlich entfernt hatten.
„Der Fachbegriff lautet ‚Despotin‘“, fügte ich hinzu und folgte ihm grinsend.
Gerade als er dabei war, mit dem Zollstock die genauen Maße zu nehmen, begann er zu husten. Das Lächeln verschwand aus meinem Gesicht, als er sich unter der Anstrengung krümmte. Schnell rannte ich los, um ihm Wasser zu holen. Als ich zurück war, saß Thomas bereits auf dem metallenen Boden des Autos und hustete unaufhörlich weiter, bis ich das Glas mit Wasser an seine Lippen hielt. Erleichterung durchströmte mich, als er endlich besser Luft bekam. Bis mein Blick auf das Glas fiel, aus dem er getrunken hatte. Blut haftete an der Stelle, an der seine Lippen gewesen waren, und eine kleine Menge schwamm zusammen mit dem Wasser vermischt am Boden. Thomas’ Augen waren glasig, und es dauerte ein paar Herzschläge, ehe sein Blick wieder klar wurde.
„Wir sollten dich lieber zu einem Arzt bringen“, sprach ich das Offensichtliche aus.
„Das ist nicht nötig.“
„Vor ein paar Minuten dachte ich, du erstickst, und jetzt spielst du das herunter.“ Ich strich ihm eine der blonden Locken aus dem Gesicht.
„Ich hab mich nur verschluckt“, protestierte er, als ich ihm aufhalf.
„Ich weiß, Männer gehen nicht gern zum Arzt, aber das hier ist etwas anderes. Sobald Blut im Spiel ist, sollte man es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Lass uns fahren, und dann kannst du mir heute Abend gern jammernd in den Ohren liegen, was ich doch für eine schreckliche Freundin bin.“ Ich wandte mich ab, um nach den Autoschlüsseln zu suchen, aber Thomas hielt mich am Arm fest.
„Raya, es ist nicht nötig, zum Arzt zu fahren.“ Ich sah ihn an und öffnete den Mund, um zu protestieren, aber er unterbrach mich. „Ich war vor ein paar Wochen wegen anhaltenden Schmerzen in der Brust dort. Zuerst dachte man, es wäre ein eingeklemmter Nerv gewesen, aber nach einigen Untersuchungen war klar, dass es weitaus beschissener um mich steht.“
Er atmete tief ein und aus, während das Blut durch meine Adern rauschte wie eine tobende See. Ich war kaum fähig, ihm zuzuhören, aber die wesentlichen Worte drangen ungeschönt zu mir durch: Lungenkrebs im Endstadium.
1. KAPITEL
RAYA
Vollkommen betäubt saß ich in meinem schwarzen Etuikleid auf der Holzbank und lauschte den Worten des Redners, der Thomas nicht gekannt hatte und dennoch über ihn sprach, als wären sie Vertraute gewesen. Als hätte er an dem Sterbebett gesessen und die Hand gehalten, bis kein Funken Leben mehr in ihm gewesen war. Jede Nacht wachte ich auf und wurde von den Bildern seines geschwächten Körpers verfolgt. Eine Träne rollte stumm an meiner Wange entlang. Ich wischte sie nicht fort, sondern trug sie voller Stolz. Es war keine Schwäche, um einen geliebten Menschen zu trauern, auch wenn alle Welt einen großen Bogen um den Tod und den damit verbundenen Schmerz machte. Das hier war unser Abschied und ich würde ihn nicht dadurch schmälern, dass ich die Gefühle vor der Außenwelt versteckte.
Mein Blick fiel auf das schwarz-weiße Porträt, das vor der Urne platziert war. Ich konnte mich noch gut an den Moment erinnern, als es aufgenommen worden war. Thomas hatte gerade die Zusage für sein Maschinenbaustudium erhalten und strahlte über beide Wangen, sodass man die Grübchen erkennen konnte. Einzelne Konfettischnipsel hafteten an seinem Lockenkopf, nachdem ich einen ganzen Schwall von den bunten Punkten über ihm ausgeschüttet hatte. Kein leichtes Unterfangen, denn er war zwanzig Zentimeter größer gewesen als ich. Seine Eltern hatten ein anderes Foto nehmen wollen, aber ich war froh, dass ich sie hatte überzeugen können, das hier zu wählen.
Es war rein. Kein Vergleich zu einem gestellten Bild, auf dem künstlich gelächelt wird. Dieses Foto wurde Thomas gerecht, denn es war unverfälscht und trug eine Leichtigkeit in sich, die man nur in ausgewählten Momenten erleben durfte.
Die Rede endete mit einem Bibelvers, genauer gesagt mit dem sechsten Vers aus Psalm einunddreißig:
„In deine Hände befehle ich meinen Geist; du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.“
Auch wenn ich mich krampfhaft gegen die Vorstellung wehrte, dass es irgendein höheres Wesen gab, dem wir etwas bedeuteten, so musste ich zugeben, dass in dem Zitat ein Funken Wahrheit steckte. Thomas brauchte nicht mehr zu leiden, ganz gleich, wo er jetzt war. Ich vermisste ihn unsagbar, dennoch wäre es egoistisch gewesen, ihn unter Schmerzen am Leben zu erhalten, nur weil ich zu feige war, mich zu verabschieden.
Das redete ich mir jeden Tag ein, aber der Schmerz wurde dadurch nicht geringer.
Um mich herum erhoben sich die Trauernden, deren Zahl überschaubar war. Nur seine Familie und ich waren gekommen, denn obwohl Thomas ein großes Herz gehabt hatte, war es ihm immer schwergefallen, sich anderen gegenüber zu öffnen. Unzählige Male hatte ich ihn geradezu angebettelt, seine Wohlfühlzone zu verlassen, um mal etwas Neues kennenzulernen. Doch er lehnte jedes Mal ab, und mittlerweile fragte ich mich, ob ich mehr darum hätte kämpfen müssen. Ich setzte diesen Punkt auf die lange Liste an Vorwürfen, die ich mir seit vier Monaten machte.
An erster Stelle stand, dass ich zu unaufmerksam gewesen war, um zu bemerken, dass es ihm schlechter ging. Das Gedankenkarussell drehte sich unermüdlich und ich fand keinen Weg, um dort auszusteigen. Ganz im Gegenteil. Mit jedem Tag wurde es stärker, und langsam ging mir die Kraft aus, um weiter gegen diesen endlosen Strudel anzukämpfen. Es wäre so einfach gewesen, sich dem Schmerz hinzugeben und kein anderes Gefühl mehr zuzulassen. Doch noch war ich nicht bereit dazu, und Thomas hätte mir in den Arsch treten müssen, wenn er gewusst hätte, dass ich mich derart hängen ließ. Aber er war nicht hier. Er würde nie wieder an meiner Seite sein und ich schloss die Augen, um die aufkommenden Tränen zu unterdrücken.
Eine Hand legte sich sanft auf meine Schulter, und ich öffnete rasch die Augen.
„Ich bin froh, dass du da bist, Raya.“ Ich drehte mich zu Thomas’ Mutter um, deren strenges Parfüm mir in der Nase brannte. Ihr Make-up war makellos, als hätte sie keine einzige Träne vergossen. Es war vermessen, weil jeder Mensch auf seine eigene Weise trauert, aber sie wirkte so, als würde dieser Tag sich kaum von anderen unterscheiden.
„Selbstverständlich bin ich hier.“ Wo sollte ich sonst sein?, fügte ich in Gedanken hinzu.
„Es war gut, dass du in den letzten Stunden bei ihm warst.“ Sie nahm die Hand von meiner Schulter und ging dann zum Bestatter, der sich weiße Handschuhe übergestreift hatte, um die Urne zu tragen. Ich hatte nicht vergessen, dass sie und ihr Mann zu beschäftigt damit gewesen waren, um die halbe Welt zu reisen, anstatt ihren Sohn zu besuchen. Zwar wusste ich, dass Thomas’ Verhältnis zu seinen Eltern nur von oberflächlicher Natur war, aber wenn ich es recht betrachtete, dann war es wohl die Untertreibung des Jahrhunderts. Diese Leute waren eiskalt, und es widerstrebte mir, Thomas nur einen flüchtigen Augenblick in die Obhut dieser Monster zu geben. Zum Glück musste ich das auch nicht. Sie hatten mir diese Entscheidung abgenommen, indem sie erst vorbeikamen, nachdem sein Herz nicht mehr schlug. Wenigstens waren sie so anständig und berücksichtigten seine Wünsche bei der Beerdigung. Das machte sie zu besseren Eltern im Tod als im Leben.
Ich schloss mich als Letzte der Prozession der Trauernden an und folgte ihnen zu der ausgewählten Grabstelle. Thomas’ letzte Ruhestätte würde unter den kräftigen Ästen einer Eiche sein. Als Kinder waren wir oft zelten gewesen, auch wenn ich jedes Mal einen Schreianfall bekommen hatte, sobald ein Käfer über mich krabbelte. Ich tat das Thomas zuliebe, der in der Natur aufblühte. Das hier hätte ihm gefallen, dessen war ich mir sicher. Nacheinander warfen die Angehörigen weiße Blumen in das Grab. Die wenigsten verabschiedeten sich mit Worten, sondern wandten einfach den Blick ab und gingen, ohne sich ein weiteres Mal umzudrehen. Schließlich blieben nur noch der Bestatter und ich übrig. Er ließ gebührenden Abstand zu mir, um mich nicht in der Trauer zu stören.
„Ich weiß, man sollte Toten keinen Vorwurf machen, aber ich bin verdammt sauer auf dich. Wir hatten so viele Pläne für die Zukunft, und jetzt erscheint mir alles bedeutungslos. Du bist gerade einmal ein paar Tage fort und ich werde wahnsinnig, weil mir deine blöden Witze fehlen. Scheiße noch mal, ich würde alles für ein letztes Gespräch mit dir geben.“ Ich schluchzte auf und die Sicht vor meinen Augen wurde mit jeder Träne verschwommener. „Weißt du, was schlimmer ist als der Schmerz? Die Angst davor, dass meine Erinnerungen dir in keiner Weise gerecht werden. Dass ich irgendwann nicht mehr weiß, wie furchtbar dein Aftershave gestunken hat oder wie intensiv deine blauen Augen geleuchtet haben, wenn du dich über irgendwas gefreut hast. Aus Angst, deine Stimme zu vergessen, spiele ich jeden Tag deine letzten Sprachnachrichten ab.“
Unermüdlich liefen die Tränen an meiner Wange entlang und benetzten den schwarzen Stoff, bis ich die Flüssigkeit auf der Haut spüren konnte.
„Ich bin so unglaublich wütend, weil du mich alleingelassen hast, Thomas.“
Ein weißes Stofftaschentuch wurde mir gereicht, und ich starrte benommen darauf.
„Wenn du so weitermachst, dann wirst du noch zusammenbrechen“, hörte ich die tiefe Stimme von Thomas’ Vater. In meiner Trauer hatte ich nicht bemerkt, dass er näher gekommen war.
„Das ist mir egal“, antwortete ich, ohne nach dem Tuch zu greifen oder ihn anzusehen.
„Du bist kein kleines Mädchen mehr, Raya. Der Tod gehört zum Leben dazu, das solltest du wissen.“
Ich wollte seine Worte nicht hören. In meinem Kopf gab es keinen Platz für Rationalität. Nicht jetzt.
Es machte mich rasend, dass er selbst bei der Beerdigung seines Sohnes Haltung bewahrte, als wäre sein Herz nur ein Gesteinsbrocken, den nichts erschüttern konnte.
„Wie können Sie nur in aller Ruhe hier stehen, vollkommen regungslos, während in dieser kalten, nassen Erde ihr einziges Kind begraben liegt?“ Ich schaute ihn immer noch nicht an, aus Angst, sonst das letzte bisschen Fassung zu verlieren.
„Wie ich bereits sagte, der Tod gehört zum Leben. Niemand ist davor geschützt.“
Ich ballte die Hand zur Faust, öffnete und schloss sie wieder, um die überschüssige Energie loszuwerden. Wenn ich weiterhin der Stimme dieses Mannes zuhören musste, würde ich die Beherrschung verlieren, und das wäre Thomas gegenüber nicht angemessen. Wortlos drehte ich mich um und ging fort von der Ruhestätte meines besten Freundes.
„Raya, warte!“, forderte Thomas’ Vater harsch. Ich dachte nicht daran, diesem Klotz noch mehr Zeit zu schenken, und ging unbeirrt weiter. Bis ich fest am Arm gepackt wurde.
„Du hast Thomas sehr viel bedeutet und ich möchte dir etwas geben.“
Ich atmete tief ein und aus und blickte in blaue Augen, die mir einen weiteren Stich versetzten. Es sind nicht seine, redete ich mir ein. Dennoch versuchte ich, den Schmerz hinunterzuschlucken.
„Sie sind der letzte Mensch auf dieser Welt, von dem ich etwas annehmen würde.“
„Das kann ich verstehen, aber diese Sache wirst du wollen. Thomas hat mir von eurem Projekt mit dem VW-Bus erzählt. Natürlich habe ich interveniert und ihm gesagt, dass ein ausgebautes Wohnmobil zuverlässiger wäre. Aber wenn er einmal eine Meinung gefasst hatte, war es schwer, ihn davon loszukriegen. Wie du sicher weißt, konnte er ihn nicht mehr vollständig reparieren.“ Er holte tief Luft, und ich fragte mich, was genau er mir eigentlich sagen wollte.
„Ich musste ihm versprechen, das Auto fahrtüchtig zu machen und den Innenausbau so weit zu vervollständigen, dass du damit problemlos zu eurer Reise aufbrechen kannst.“
Fassungslos starrte ich den Mann, dessen Haare schon die ersten grauen Strähnen zeigten, an. Seine Gesichtszüge blieben ernst, doch aus irgendeinem Grund wartete ich auf eine Pointe.
„Was wollen Sie mir damit sagen? Sie hatten keine Zeit, Ihr Kind zu besuchen, aber konnten an einem alten Auto herumschrauben?“
„Ich weiß, du hältst meine Frau und mich für Monster“, entgegnete er und strich sich einen Faden von seinem schwarzen Anzug.
„Das wäre wohl eine Beleidigung für alle Monster. Schließlich gibt es die meisten Monster doch nur, weil ihnen jemand das Herz gebrochen hat.“
Thomas’ Vater seufzte, als würde er mit einem sturen Kleinkind sprechen, das nichts von der Welt und ihren Gesetzen verstand. Ich konnte mir gut vorstellen, dass er es im Gerichtssaal mit Leichtigkeit fertigbrachte, andere aus der Reserve zu locken. Er reichte mir eine Schachtel und einen Brief, die er in der Innentasche seines Jacketts aufbewahrt hatte. Auf dem Umschlag stand mein Name, und ich erkannte sofort Thomas’ Handschrift. Rasch öffnete ich das Kuvert und las mir die letzte Nachricht durch.
Ich könnte diesen Brief mit „Liebe Raya“ oder „Hallo, beste Freundin“ beginnen, aber wir beide wissen, dass keine Begrüßung der Welt widerspiegelt, was du mir bedeutest.
Du bist gerade auf dem Stuhl neben dem Krankenbett eingeschlafen und ich muss die Chance nutzen, um dir ein Abschiedsgeschenk zu bereiten. Ich habe mit meinem Vater gesprochen, und da er mir in diesem Augenblick nichts abschlagen kann, wird er sich um Hilde kümmern. Wenn er damit fertig ist, soll er dir die Schlüssel zu unserem Traum überreichen.
Raya, ich will, dass du mit Hilde nach Schottland fährst, entlang der Route, die wir gemeinsam geplant haben. Du musst dich nicht sofort ins Abenteuer stürzen, aber warte nicht zu lange. Wie man sieht, ist die Zeit schneller um, als einem lieb ist. Ich weiß, du bist gerade nicht in der Stimmung für schwarzen Humor, aber irgendwann wirst du dein Lächeln wiederfinden, und es wird echt sein. Nichts Aufgesetztes, weil du anderen vorspielen willst, dass es dir gut geht. Und wenn dieser Moment gekommen ist, denk an mich.
Es tut mir leid, dass ich nicht bei dir sein kann, und ich weiß, du hast bestimmt an meinem Grab unverhohlen geflucht, du kleines Schandmaul.
Es ist okay, wütend zu sein, denn das hier ist alles andere als fair. Lass dir von der Trauer aber nicht das nehmen, was ich so an dir liebe. Du bist ein außergewöhnlicher Mensch und ich bin dankbar für jeden Tag, den wir gemeinsam verbringen konnten. Selbst in diesem Moment, in dem mir immer mehr bewusst wird, dass die Zeit knapp ist, habe ich keine Angst vor dem Tod, weil du bei mir bist. Auf jede nur erdenkliche Weise.
Ich liebe dich.
PS: Geh unbedingt mal zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt, denn dein Schnarchen ist nicht normal.
Ich lachte auf und fing gleichzeitig an zu weinen. Natürlich erinnerte ich mich an den Moment, in dem ich ihn mit einem Schreibblock auf dem Bett erwischt hatte. Nur damals dachte ich an eine Liste mit Dingen, die er noch haben wollte. Ein Abschiedsbrief kam mir nicht in den Sinn.
Vorsichtig öffnete ich die kleine Schachtel und erkannte sofort den Zündschlüssel von Hilde.
„Das Auto gehört dir“, erklärte Thomas’ Vater. „Es war eine ziemliche Puzzlearbeit, aber ich habe es hinbekommen. Die Arbeit in der Autowerkstatt meines Vaters war durchaus hilfreich.“
Ich erinnerte mich dunkel daran, dass Thomas mal erwähnt hatte, dass er die Liebe zu alten Autos von seinem Großvater geerbt hatte, der in seiner Werkstatt regelmäßig Oldtimer restauriert hatte, bis die Arthrose ihm die Möglichkeit dazu nahm.
Mein erster Impuls war, ihm den Schlüssel augenblicklich zurückzugeben, aber dann dachte ich an Thomas’ Worte und unsere Pläne. Diese Reise wäre nicht für mich, sondern für ihn. Konnte ich dazu Nein sagen?
„Danke“, war alles, was mir einfiel. Es war das Mindeste und dennoch zu viel für diesen Mann. Ein weiteres Mal wandte ich mich zum Gehen ab.
„Ich war dabei, als er zum ersten Mal in seinem Leben die Augen geöffnet und geschrien hat. Mit knapp einem Jahr habe ich ihn dabei gefilmt, wie er die ersten, wackligen Schritte gemacht hat. An seinem ersten Schultag musste ich ihn begleiten, weil er zu große Angst hatte, und als ihm seine erste Liebe das Herz gebrochen hat, war ich da, um ihn zu trösten. Es gab unzählige erste Momente, die ich mit Thomas erleben durfte. Mir fehlte die Kraft, um bei seinem letzten anwesend zu sein. Nenn es egoistisch oder kaltherzig, aber ich habe mein Kind geliebt und brachte es nicht übers Herz, ihn leiden zu sehen.“
Ich sah Thomas’ Vater ins Gesicht und blickte hinter die Fassade. Tränen rannen an seinen Wangen entlang und zeichneten stumme Spuren der Trauer. Meine Wut war in diesem Moment verraucht, und ich schämte mich für das vorschnelle Urteil.
„Jeder von uns trauert auf seine Weise, aber sei dir gewiss, dass ich meinen Sohn vom ersten bis zum letzten Herzschlag geliebt habe.“ Er wischte sich mit einem Taschentuch die Tränen aus dem Gesicht und ließ mich dann allein auf dem Friedhof zurück.
2. KAPITEL
RAYA
Wenn ich zuvor gedacht hatte, dass die Beerdigung der schlimmste Teil von Thomas’ Tod war, dann wurde ich in den Wochen danach eines Besseren belehrt.
Es waren die alltäglichen Dinge, die mir den größten Schmerz bereiteten. Unzählige Male erwischte ich mich dabei, ihn anrufen zu wollen, um belanglose Sachen mit ihm bis ins kleinste Detail zu analysieren. Thomas hatte immer eine überaus rationale Sicht auf alles, eine Tatsache, die ich sowohl nervig als auch absolut bewundernswert fand. Doch statt seiner Stimme hörte ich nur die maschinelle Ansage, wenn ich die vertraute Handynummer wählte. Bald schon würde sie jemand anderem gehören und ich musste damit irgendwie klarkommen. Am schlimmsten empfand ich jedoch den Haufen an heuchlerischen Freunden, die mir Tag und Nacht Nachrichten schickten und ihr Beileid bekundeten für jemanden, den sie monate- oder gar jahrelang aus ihrem Leben verdrängt hatten. Zum Glück gaben sie diese Versuche schnell auf, als ich nicht darauf reagierte.
Und was mich betraf – ich wollte nur funktionieren, ohne etwas fühlen zu müssen. Ich besuchte die Seminare an der Uni, holte Hilde von Thomas’ Eltern ab und richtete sie weiter ein. Jede Aufgabe sollte mich von dem Schmerz ablenken, selbst zum Essen ließ ich mir wenig Zeit. Bis mein Körper anfing zu rebellieren und ich mir eine Auszeit nehmen musste. Ich lag auf dem Bett und starrte zur weißen Zimmerdecke hinauf. Wir hatten sie eigentlich beim Einzug in das WG-Zimmer streichen wollen, es dann aber immer wieder aufgeschoben, weil mir andere Dinge wichtiger waren als eine bunte Decke. Jetzt würde sie wohl so bleiben.
Noch Tage zuvor hatte ich allein bei diesem Gedanken angefangen zu weinen, aber jetzt war da nur noch Leere in mir.
In diesem Moment wurde mir bewusst, dass ich so nicht weitermachen konnte. Hier zu sein, wo mich alles an Thomas erinnerte, war kaum auszuhalten. Dann waren da noch die Gesichter der anderen. Voller Mitleid, und wenn sie sich umdrehten, machten sie mit ihrem Leben weiter, als hätte es Thomas nicht gegeben.
An einem Ort, wo mich niemand kannte, würde zumindest ein Teil dieser Probleme hinfällig sein. Unbewusst glitt mein Blick zu Hildes Schlüssel, der auf dem Nachttisch lag. Ich hatte die alte Lady dank der Erlaubnis meines freundlichen Vermieters im Hinterhof des Mehrfamilienhauses geparkt, sodass ich jederzeit an ihr arbeiten konnte. Ich zog Thomas’ Brief aus einer Schublade heraus und las mir die Zeilen erneut durch. Ein Ritual, dass ich beinah täglich vollzog. Manchmal fragte ich mich, ob er gewusst hatte, wie ich mich ohne ihn fühlen würde, und mir deswegen diesen Weg aufgezeigt hatte.
Schottland. Selbst in meinen Gedanken klang es irrational alles stehen und liegen zu lassen, um sich auf eine Reise zu begeben, deren Verlauf mehr als ungewiss war. Ich hatte hier Verpflichtungen – oder suchte ich nur nach einer weiteren Ausrede, um etwas Wichtiges aufzuschieben? Wenn ich alles vollkommen nüchtern betrachtete, dann war es möglich, zumindest für ein paar Monate diesen Ort zu verlassen. Dieses Semester hatte ich mir eine Auszeit genommen und dank meiner Ersparnisse konnte ich durchaus die Miete für die nächsten Monate stemmen. Wenn ich Benzingeld und Essen mit dazu nahm, würde es zwar knapp werden, aber es wäre machbar.
„Was würdest du tun, Thomas?“, fragte ich in die Stille des Raumes hinein. Keine Ahnung, worauf ich wartete, aber als kein übernatürliches Zeichen erschien, war ich dennoch enttäuscht. Es änderte nichts an der Entscheidung. Langsam stand ich vom Bett auf und ging zu meinem Bücherregal, in dem sich neben zahlreicher Unilektüre auch einige Landkarten aneinanderreihten. Von allen Orten, die wir jemals zusammen besuchen wollten, hatten wir welche gesammelt. Meine Finger glitten über die Karten, bis ich die von Schottland gefunden hatte. Ich zog sie heraus und entfaltete sie auf dem Boden. Verwundert betrachtete ich das Gebilde aus Farben und Formen. Thomas hatte mir die Karte letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt, und da dieser Tag so vollgepackt gewesen war, hatte ich vollkommen vergessen, sie mir näher anzusehen. Das war nun schon einige Monate her, sonst wäre mir sicherlich früher aufgefallen, dass er ihr seinen persönlichen Touch verliehen hatte. Die Karte war übersät von handschriftlichen Anmerkungen zu verschiedenen Orten, die bis hinauf zu den Orkney-Inseln reichten. Ehrfürchtig ging ich jede einzelne Notiz durch und staunte erneut über meinen besten Freund und sein Organisationstalent.
„Du bist der Wahnsinn, Thomas“, sagte ich mit belegter Stimme und war mir sicher, dass dies das Zeichen war, auf das ich gewartet hatte. Wieder einmal hatte er es geschafft, mir einen Weg aufzuzeigen, wenn ich selbst keinen fand. Damit stand die Route wohl fest und ich spürte, wie sich ein warmes Gefühl in mir ausbreitete. Hoffnung. Das war derart befremdlich, dass ich es zunächst nicht klar zuordnen konnte. Behutsam faltete ich die Karte zusammen und begann, eine Liste von den Dingen zu erstellen, die ich vor meiner Abreise noch regeln musste. Zumindest meine Eltern sollte ich über dieses Vorhaben informieren. Sie würden es nicht verstehen, aber mit Sicherheit die Entscheidung respektieren. Mir blieb eine Woche, bis die Semesterferien begannen, und es gab noch einiges zu tun. Froh darüber, mich in eine neue Aufgabe zu stürzen, machte ich mich daran, jeden einzelnen Punkt auf der Liste abzuarbeiten.
3. KAPITEL
GEORGE
„Du bist so ein Arschloch!“, kreischte Sophie durch die zahlreichen Zimmer, während sie sich ihren Weg nach draußen bahnte. Es kümmerte sie nicht, dass sie dabei alle Blicke auf sich zog. Ganz im Gegenteil, denn das war genau das, was sie wollte: Drama.
Genervt massierte ich mit Zeige- und Mittelfinger die Schläfen, um den pochenden Kopfschmerzen wenigstens etwas entgegenzusetzen. Ihre hohen Absätze donnerten mit jedem Schritt auf dem antiken Holzboden. Wenn Aidan das sah, durfte ich mich auf die nächste Standpauke einstellen. Die Böden des Schlosses waren ihm heilig. Unglücklicherweise machten die Rollen an ihrem pinkfarbenen Trolley, den sie hinter sich herzog, die Sache nicht besser.
„Hättest du sie nicht draußen abservieren können?“
Eine Hand legte sich auf meine Schulter. Ich drehte mich um und schaute in braune Augen, die mich mit einer Mischung aus Ärger und Belustigung ansahen.
„Ich konnte doch nicht wissen, dass sie vorhatte, hier einzuziehen“, antwortete ich schulterzuckend und war mir keinerlei Schuld bewusst.
„Ach, und das Ungetüm in Pink war kein Hinweis?“ Aidans Mundwinkel zuckten amüsiert.
„Den muss ich wohl übersehen haben, als sie gestern Abend vor meiner Tür stand.“
„Ich wette, da hat sowieso ein anderer Teil deines Körpers das Denken übernommen.“
„Ich nehme es mal als Kompliment, dass du glaubst, ich könnte noch mit etwas anderem als meinem Gehirn denken.“
Sophie hatte mittlerweile die Ausgangstür des Schlosses erreicht. Sie warf ihr dunkelbraunes Haar über die Schulter und funkelte mich dann wütend an.
„Das wirst du bereuen, George Mey. Eine Frau wie mich lässt man nicht so einfach gehen.“
Mein Verstand schrie mich an, es nicht zu tun, aber ich hatte mich in Bewegung gesetzt und war nicht mehr aufzuhalten. Als Sophie bemerkte, dass ich zu ihr geeilt kam, hellte sich ihr Gesichtsausdruck auf. Die rot geschminkten Lippen verzogen sich zu einem siegessicheren Lächeln, als hätte sie einen Wettkampf gewonnen, dessen Regeln nur sie selbst kannte.
„Ich wusste doch, dass du zur Besinnung kommst, wenn du siehst, was dir entgeht.“ Sie schmiegte sich mit ihrem durchtrainierten Körper an mich und war sich ihrer Wirkung vollkommen bewusst.
„Du hattest absolut recht. Eine Frau wie dich lässt man nicht so einfach gehen.“ Meine linke Hand legte sich auf ihren Rücken, während die andere etwas aus meiner Jeanstasche holte. Ohne das Gesicht zu verziehen, hielt ich ihr einen Zehn-Pfund-Schein hin.
„Was soll ich damit, Liebling?“, schnurrte sie.
„Ich wollte dich nicht so einfach gehen lassen. Das Geld reicht für ein Taxi, das dich von hier wegbringt. Wenn du willst, suche ich dir noch die Nummer heraus. Ich bin mir sicher, sobald du meinen Namen erwähnst, bekommst du einen Rabatt, da ich dem Unternehmen immer viel Kundschaft vermittele.“ Während meiner Erklärung verschwand das Lächeln aus ihrem Gesicht, und ein irres Funkeln erstrahlte in ihren blauen Augen. Ich sah die Ohrfeige kommen und hielt brav still, während sie ihrer Wut ein Ventil gab.
„Fahr zur Hölle!“, schrie sie und verschwand dann, ohne den Geldschein in meiner Hand zu beachten. Ich unterdrückte den Impuls, ihr hinterherzuwinken, um noch ein kleines bisschen Anstand zu bewahren.
Die Besucher des Schlosses sahen zwischen Sophie und mir hin und her, unschlüssig, was sie von diesem Streit halten sollten. Schlussendlich betraten sie jedoch das Anwesen meiner Familie und ließen sich von einem der Aushilfen herumführen. Ich lächelte ihnen freundlich entgegen, strich mir eine meiner roten Locken aus dem Gesicht und ging zu Aidan, der die Arme miteinander verschränkt hatte.
„Deinetwegen muss ich die Böden öfter wachsen lassen, als es normalerweise der Fall wäre“ Wie vorhersehbar er doch ist!
„Setz es auf die Rechnung“, sagte ich und ging in das angrenzende Arbeitszimmer, das für neugierige Touristen gesperrt war. Natürlich entging mir dabei nicht, dass Aidan mir folgte. Auf Diskretion bedacht, schloss er die Tür hinter uns, nachdem ich es mir in einem der ledernen Ohrensessel bequem gemacht hatte. Aus dem Beistelltisch holte ich eine angebrochene Whiskyflasche und zwei Gläser heraus. Mir goss ich einen kleinen Schluck ein, während Aidan kopfschüttelnd ablehnte.
„Es ist noch nicht einmal Mittagszeit“, sagte er, ohne dabei anklagend zu sein.
„Wie mein Großvater zu sagen pflegte: Es ist nie zu früh für einen guten Drink. Cheers.“ Ich trank den Whisky in einem Zug aus und genoss das warme Gefühl, das sich daraufhin ausbreitete.
„Wir sollten besprechen, wie es weitergeht.“ Aidan nahm neben mir Platz.