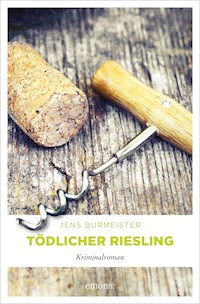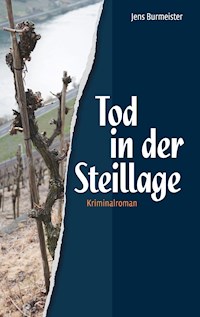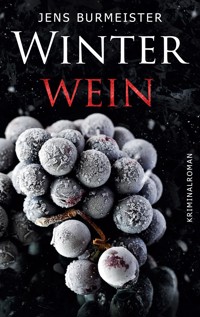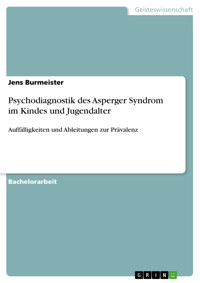4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Düstere Geschehnisse in der Toskana – der zweite Fall für Professor Tiefenthal und Commissaria Bernucci Ein sensationeller Leichenfund in der Piccolomini-Bibliothek in Siena? Das lässt der Kölner Professor Josef Tiefenthal sich nicht zweimal sagen. Sofort reist er in die Toskana, um seinem Kollegen, dem forensischen Archäologen Ernesto Carnevale bei diesem wissenschaftlichen Rätsel zu helfen und endlich Commissaria Stella Bernucci wiederzusehen. Doch dann liegt Carnevale tot in der Bibliothek und der Verdacht fällt auf Tiefenthal selbst. Gemeinsam mit der Commissaria setzt er alles daran, seine Unschuld zu beweisen, während zwischen den sanften Hügeln der Toskana weitere mysteriöse Morde geschehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Trügerische Toskana
Der Autor
Jens Burmeister studierte Chemie und arbeitete mehr als 25 Jahre in der chemisch-pharmazeutischen Forschung, bevor er sich 2020 als Autor selbständig machte. Er schreibt online den Mittelrhein-Weinführer und ist Mitglied der Verkostungsjurys renommierter Weinmagazine. Seine Kriminalromane und Kurzgeschichten haben meistens einen sowohl wissenschaftlichen als auch kulinarischen Bezug. Den Urlaub verbringt er bevorzugt in Italien und freut sich besonders, wenn ein Chianti in seinem Weinglas funkelt. Der Autor ist verheiratet und wohnt in Göttingen sowie in der Nähe von Köln.
Das Buch
Düstere Geschehnisse in der Toskana – der zweite Fall für Professor Tiefenthal und Commissaria Bernucci
Ein sensationeller Leichenfund in der Piccolomini-Bibliothek in Siena? Das lässt der Kölner Professor Josef Tiefenthal sich nicht zweimal sagen. Sofort reist er in die Toskana, um seinem Kollegen, dem forensischen Archäologen Ernesto Carnevale bei diesem wissenschaftlichen Rätsel zu helfen und endlich Commissaria Stella Bernucci wiederzusehen. Doch dann liegt Carnevale tot in der Bibliothek und der Verdacht fällt auf Tiefenthal selbst. Gemeinsam mit der Commissaria setzt er alles daran, seine Unschuld zu beweisen, während zwischen den sanften Hügeln der Toskana weitere mysteriöse Morde geschehen.
Jens Burmeister
Trügerische Toskana
Ein kulinarischer Krimi
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Originalausgabe bei Ullstein eBooksUllstein eBooks ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Oktober 2022 (1)© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2022Umschlaggestaltung: zero-media.net, München Titelabbildung: © FinePic® E-Book powered by pepyrusISBN 978-3-8437-2860-7
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
Schlussworte und Danksagungen
Pici all’aglione
Leseprobe: Mord au Vin
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
1. Kapitel
Motto
»Amici veri sono come meloni, di cento ne trovi due buoni.«
Wahre Freunde sind wie Melonen, unter hundert findet man nur zwei gute.
– Italienisches Sprichwort
1. Kapitel
Commissaria Stella Bernucci ließ ihre Finger über die Haut der tiefroten, länglichen Tomate gleiten, drückte sie sanft zusammen und nickte zufrieden. Sie hielt die Frucht dicht unter die Nase und sog den intensiven Duft ein. Sofort war sie wieder in dem kleinen Garten hinterm Haus, sah Vater vor sich. Mit einer Kiste voller reifer Tomaten stieg er die Treppe zur Terrasse herauf. Sie löste sich von dem Bild und schaute in Robertas von Falten durchzogenes, braungebranntes Gesicht. Die Marktfrau stand hinter leuchtenden Gemüsebergen und hatte die Commissaria aufmerksam beobachtet.
»Wie immer ein Pfund davon«, sagte Bernucci entschlossen.
Nieselregen trommelte auf das Tuch, das den Marktstand überspannte. Roberta beugte sich nach vorn und packte mit Händen, die nach harter körperlicher Arbeit aussahen, sieben Tomaten in eine Papiertüte, wog sie ab. Die beiden Frauen kannten sich seit über zehn Jahren. Die Commissaria hatte sich angewöhnt, sich immer am Mittwochvormittag zwei Stunden freizunehmen, um von der Questura aus direkt zu Robertas Stand zu gehen. Am Mittwoch war in Siena Markt um die Festung Fortezza Medicea herum. Über den Markt zu schlendern, war für Bernucci eine kurze Auszeit von ihrem stressigen und oftmals frustrierenden Job.
»Ende März bekommst du hier keine reiferen San-Marzano-Tomaten, Stella. Ich habe sie in meinem Gewächshaus gezogen«, sagte Roberta und reichte der Commissaria die Tüte. »Was wirst du kochen?«, setzte sie hinterher.
Bernucci nahm die Tüte entgegen und legte sie zu den anderen, die bereits den Weidenkorb füllten, den sie von ihrer Mutter geerbt hatte. Wie immer hatte sie schon viel mehr eingekauft, als sie für die nächsten Tage brauchte. Aber bei all den frisch und gesund aussehenden Lebensmitteln hatte sie einfach nicht widerstehen können. »Ach, die Tomaten brauche ich für Bruschette«, sagte sie. »Ich muss gleich noch rüber zum Stand von Alfonso. Ich liebe seine Wildschweinsalami. Am Freitagabend gibt es bei mir als Primo Pici, dicke Spaghetti mit Knoblauch und Tomatensoße, und das Secondo wird Wildschwein sein, Cinghiale alla cacciatore.«
»Gibt es was zu feiern?«, fragte Roberta vorsichtig.
»Nur einen schönen Abend. Matteo, ein paar Freunde und Arbeitskollegen kommen zu mir nach Colle di Val d’Elsa. Quatschen, zusammen lachen … endlich mal wieder Leben in der Bude. Das vermisse ich, seitdem Matteo ausgezogen ist. Manchmal komme ich mir zu Hause vor wie auf einem Friedhof.«
»Du arbeitest zu viel, Stella.« Roberta lachte ein wenig zu laut, wohl um ihrer Aussage die Schwere zu nehmen. »Wie geht es deinem Sohn? Du hast schon lange nichts mehr über Matteo erzählt.«
Die Kundin, die rechts neben der Commissaria stand, räusperte sich vernehmlich. Italiener hatten an sich sehr viel Verständnis für ein Schwätzchen während des Einkaufs, aber irgendwann wurde es selbst ihnen zu viel.
»Er ist nach Florenz in eine Wohngemeinschaft gezogen. Er studiert jetzt nicht mehr Medizin, sondern Literaturwissenschaften. Ich weiß nicht, ob das wirklich etwas für ihn ist. Von irgendwas muss er später doch leben, wenn er auf eigenen Beinen stehen will. Aber er scheint sich wohlzufühlen, ich sehe ihn nur noch selten in Colle. Und wenn ich ihn in Florenz besuche, ist es ihm peinlich gegenüber seinen Kommilitonen.«
»Deine famiglia ist ja leider sehr klein, Stella. Aber warte mal, wenn Matteo erst seine eigene Familie gründet. Enkelkinder, das wäre doch was. Und bis dahin hast du schließlich deine Freunde.«
»Und die Katzen.« Bernucci hob den Korb hoch, bezahlte, verabschiedete sich bis zum nächsten Mittwoch und gab der drängelnden Kundin hinter ihr endlich die Gelegenheit zu bestellen. Der Regen war stärker geworden, kroch ihr in die Glieder, ließ sie frösteln. Bernucci zog ihre Kapuze über den Kopf. Sie beschleunigte den Schritt und drängelte sich im Slalom vorbei an den Tuchhändlern zum Stand von Alfonso, der dichter an der Via La Lizza war.
Sie reihte sich in die Schlange vor Alfonsos Marktstand ein. »Salumi e formaggi«, hatte er passenderweise auf ein Schild geschrieben, das hinter ihm hing. In den Regalen an der Rückwand lagen angeschnittene Schinkenstücke neben Dosen und Fläschchen mit allerlei regionalen Spezialitäten. Von der Decke baumelten beeindruckende Schinken herab, auf der Theke stapelten sich ganze Laibe von Pecorino sowie winzige Käseecken. Unter dem Glas der Auslage lagen selbstgemachte Aufstriche und die Salamiwürste, die Alfonsos legendären Ruf begründeten.
Alfonso, der inzwischen die Sechzig überschritten hatte, schaute zwischen den baumelnden Schinken hindurch und winkte Bernucci fröhlich zu.
Sie grüßte zurück. Ein warmes Gefühl breitete sich in ihrer Magengegend aus. Der Markt von La Lizza war inzwischen so etwas wie ein zweites Zuhause für sie. Während Alfonso gerade in gebrochenem Englisch versuchte, einer Touristin die geschmacklichen Vorzüge der Finocchiona, einer nach Wildfenchelsamen duftenden Salamispezialität, zu erklären, dröhnte eine Lautsprecheransage von der Via La Lizza herüber. »Wählen Sie Giovanni di Rossi für die Fratelli d’Italia in das Parlament! Sienas Stimme der Vernunft für Rom. Kommen Sie um zwölf Uhr auf die Piazza del Campo und überzeugen Sie sich selbst«, tönte es blechern.
Bernucci spähte zwischen den Marktbesuchern hindurch und konnte gerade noch einen Blick auf einen schwarzen Lieferwagen erhaschen. Auf seiner Ladefläche fuhr er das überlebensgroße Porträt eines Politikers spazieren. Giovanni di Rossi blickte Bernucci direkt in die Augen. Selbstbewusst, stechend, rücksichtslos.
Ihr Magen krampfte sich zusammen.
Sofort kamen die schrecklichen Bilder vom vergangenen Sommer wieder hoch, die verkohlte Leiche und der Tote in der Badewanne mit dem blutroten Wasser. »Ich hatte völlig vergessen, dass der wieder auf freiem Fuß ist«, murmelte sie entsetzt.
Ihr Vordermann drehte sich abrupt um. Dem hochgewachsenen, schlanken Mann mit kurzrasierten Haaren stand das Erstaunen ins Gesicht geschrieben.
»Commissaria Bernucci, es ist doch immer eine Freude, Sie zu sehen«, sagte Bruno Servidio, der Leiter der Questura von Siena. »Sie haben frei … ach nein, dann wären Sie vielleicht nicht hier in Siena.«
Ich bin doch jeden Mittwoch während der Dienstzeit hier, dachte die Kommissarin. »Ich habe ein paar freie Minuten, da nutze ich die Zeit und kaufe schon mal für Freitag ein. Sie kommen doch hoffentlich?«
»Aber natürlich, meine Frau und ich haben uns sehr über die Einladung gefreut. Wir beide arbeiten schon so lange zusammen … eigentlich hätten wir Sie zuerst einladen müssen.« Servidios Augen funkelten gutmütig.
»Flache Hierarchien, sagen Sie doch immer. Sie sind nicht oft hier, oder? Wir haben uns auf dem Markt noch nie getroffen.«
»Meistens kauft meine Frau ein, aber manchmal gönne ich mir das Vergnügen und unterstütze sie mit ein paar kleineren Besorgungen. Die Salamis von Alfonso sind aber auch lecker. Und haben Sie hier schon mal den Pecorino medio stagionato probiert, den drei Monate gereiften Schafskäse? Ein Gedicht, sage ich Ihnen.« Servidios Tonfall wurde ernster, die Stimme dunkler. »Und was Ihren Ärger über Giovanni di Rossi betrifft … seine Komplizen sitzen noch hinter Gittern. Aber di Rossi, dieser mit allen Wassern gewaschene Politiker, der immer sein Fähnchen nach dem Wind dreht, der hat es geschafft, sich rauszureden. Eine Schande ist das«, flüsterte er.
»Manchmal denke ich, dass wir auch nur die Marionetten der Politiker sind.«
»Aber Commissaria Bernucci, da sprechen doch nicht Sie selbst. Sie haben es nur deshalb bei der Polizei so weit gebracht, weil Sie vor keinem Konflikt zurückscheuen und immer genau wissen, auf welcher Seite Sie stehen. Ich zähle auf Sie, die Polizia di Stato zählt auf Sie!«
Bernucci registrierte Servidios Worte mit Dankbarkeit. Der Questore kannte sie besser, als sie es selbst manchmal wahrhaben wollte. Es würde nicht mehr lange dauern, bis Servidio in Rente gehen würde. Der Gedanke, dass ein junger Karrierist ihm nachfolgen könnte, jagte ihr Angst ein.
Ihr Smartphone vibrierte. Sie zog das telefonino aus ihrer Hosentasche. Matteo hatte eine Nachricht geschrieben. Es täte ihm sehr leid, aber er könne am Freitagabend nicht dabei sein. Er habe abends noch ein Seminar, das er auf keinen Fall versäumen dürfe. Hastig steckte Bernucci das Smartphone wieder ein.
»Schlechte Nachrichten?«, fragte Servidio.
»Ach, was. Es wird am Freitag ein Treffen ganz ohne Familie. Dafür mit netten Freunden und Kollegen.«
»Die Neue ist auch dabei, habe ich gehört?«
»Wir kennen uns noch nicht so gut, aber sie macht einen sympathischen Eindruck. Im Vergleich zu ihrem Vorgänger.«
Servidio nickte und deutete ein Grinsen an. In diesem Moment war Alfonso mit der Touristin fertig. Er reichte dem Questore die Hand zur Begrüßung und schnitt sofort zwei Stücke von einem Käselaib ab. Er reichte Servidio und Bernucci je ein Scheibchen. »Meine neueste Errungenschaft. Was meint ihr?«, fragte er erwartungsvoll.
Bernucci kaute und ließ sich den cremigen, leicht salzigen Käse auf der Zunge zergehen. Sie schloss die Augen, doch statt zu genießen, fasste sie einen Entschluss. Sie würde vom Markt aus nicht direkt zur Questura zurückgehen, sondern erst noch einen Abstecher zur Piazza del Campo machen. Bruno Servidio würde schon so freundlich sein, den Weidenkorb mit in die Wache zu nehmen. Sie wollte mit ihren eigenen Ohren hören, wie di Rossi seine Anhänger aufwiegelte.
2. Kapitel
Befreit von der Last ihrer Einkäufe, stieg sie die kurze Treppe hinunter und trat heraus auf die Piazza del Campo. Es hatte aufgehört zu regnen, die Sonne versuchte, sich durch die dunkle graue Wolkendecke zu schieben, und ließ die feuchten Pflastersteine glitzern. Eindrucksvoll und schön wie immer lag der Campo vor ihr, mit den Cafés, vor denen fröstelnde Touristen saßen, dem Brunnen Fonte Gaia und dem schlanken Torre del Mangia, der sich elegant über dem Platz erhob.
Nur die lärmende Menschentraube, die sich vor der Tribüne auf der rechten Seite des Platzes drängelte, störte die Idylle.
Bernucci blieb stehen, überblickte den Campo und dachte daran zurück, wie sie hier im letzten Juli den Palio, Sienas großes Pferderennen, verfolgt hatte. Sie blickte hoch zu dem Balkon, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Sohn Matteo, dem Archäologen Josef Tiefenthal und dessen Nichte mitgefiebert hatte. Ein Tag, der ihr nicht nur wegen des tragischen Leichenfunds in Erinnerung geblieben war.
Wie es Josef wohl ergehen mochte, im fernen Köln? Ob er an sie dachte, sie vermisste? Vom ersten Moment an, als er damals beinahe schüchtern ihr Büro in der Questura betreten hatte, hatte sie ihn in ihr Herz geschlossen. Die Nächte, die sie ein paar Wochen später zusammen in ihrem Haus in Colle di Val d’Elsa verbracht hatten, waren intensiv und zärtlich gewesen. Doch dann hatte Josef wieder zurück in sein altes, sein eigenes Leben zurückkehren müssen. »Meine professoralen Verpflichtungen lassen sich nicht länger aufschieben«, hatte er betrübt zu ihr gesagt. Dann war er genauso abrupt abgereist, wie er aufgetaucht war.
Anfangs hatten sie noch täglich telefoniert, sich gegenseitig ihrer Liebe versichert. Aber dann wurden ihre Gespräche immer kürzer, immer wieder kam etwas Berufliches dazwischen. Bernucci hatte versucht, Kontakt zu halten, aber mehr und mehr bekam sie das Gefühl, dass der Professor wie von einer fremden Macht von ihr fortgezogen wurde. Und schließlich war da auch noch ihre eigene Arbeit, die sie voll und ganz forderte und ihr nur wenig Freizeit ließ.
Was sollte sie tun? Eine spontane Reise nach Colonia buchen, oder doch lieber irgendwo in der Toskana eine altertümliche Leiche entdecken, die den wissenschaftlichen Ehrgeiz des forensischen Archäologen wecken würde? Sodass ihm gar nichts anderes übrig blieb, als nach Siena zu kommen? Bei dem letzten Gedanken musste Bernucci schmunzeln.
Inzwischen drangen aus der Menge hasserfüllte Rufe zu ihr herüber. »Raus mit den Roma aus Italien!« und »Faschismus ist Revolution!«, verstand Bernucci. Sie war angewidert von dem Zorn der um die hundert Anhänger, ging aber trotzdem auf die Gruppe zu. Sie wollte hören, wollte verstehen. Angst hatte Bernucci nicht, schließlich standen drei Fahrzeuge der Carabinieri rechts neben der Menschenmenge. Zwei der stets adrett gekleideten Kollegen in ihren schicken dunklen Uniformen mit den roten Hosenstreifen und der weißen Koppel mit Schultergurt hatten sich vor der Tribüne platziert. Die anderen Carabinieri warteten in ihren Autos.
Endlich betrat di Rossi federnden Schrittes die Tribüne, gefolgt von einer Blondine in knappem, bonbonfarbenem Kostüm und farblich dazu passenden hochhackigen Schuhen. Die Blondine legte einen Stapel Papier auf ein Pult, schraubte das Mikrofon auf di Rossis Höhe und stöckelte wieder davon. Di Rossi räusperte sich ins Mikrofon und erzeugte dadurch ein unangenehm knarzendes Geräusch. Augenblicklich verstummten seine Anhänger. Der Politiker sah staatsmännisch aus, mit dunklem Anzug und weißem Hemd, aber ohne Krawatte. Völlig anders jedenfalls als vor einem Jahr, als Bernucci ihn festgenommen hatte.
Die ersten Worte seiner Rede rauschten an Bernucci vorbei, weil sie sah, dass sich von der linken Seite des Campo her Unheil anbahnte. Fünf Männer sprinteten auf die Versammlung zu. Sie trugen dunkle Kleidung, Sturmhauben und hatten Stoffbündel bei sich. Die Commissaria reagierte sofort und rannte los, in Richtung der Carabinieri, um sie vorzuwarnen. Doch dann bremste sie wieder ab, blieb keuchend stehen. Sie stützte sich auf ihre Knie und sah die Autos der Carabinieri an sich vorbeifahren. Mit quietschenden Reifen kamen sie links neben der Versammlung zum Stehen.
Di Rossi streckte den rechten Arm aus und zeigte auf die dunkel gekleideten Männer, die versuchten, sich dichter an die Tribüne zu drängeln und auf die rechten Demonstranten einschlugen. »Endlich eine Staatsmacht, die uns schützt!«, rief er wütend aus. »Schaut ihn euch an, den roten Mob, der längst die Straßen Roms übernommen hat. Und was will man hier schon anderes erwarten, nella toscana rossa, in der roten Toskana. Wenn es nach den linken Chaoten geht, dann wird Italien ein buntes Land. Ein buntes Land, was für eine Verarschung. Wir sind Italien, meine Freundinnen und Freunde! Das lassen wir uns von denen da drüben nicht nehmen!«
»Italia, Italia«, skandierte die wütende Menge. Die meisten von ihnen hatten noch gar nicht mitbekommen, worauf di Rossi anspielte. Bernucci hingegen war entsetzt darüber, dass der Politiker auch noch Öl ins Feuer goss. Sie griff nach ihrem telefonino uind wählte die Nummer der Carabinieri, während sie aufmerksam beobachtete, wie die Prügeleien zwischen den rechten und linken Demonstranten immer brutaler wurden.
Schnell meldete sie am Telefon den Vorfall und forderte Verstärkung an, die ihr sofort zugesagt wurde. Dann wählte sie die Nummer des Questore. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie die vier Carabinieri zwei der Gegendomonstranten überwältigten und in die Fahrzeuge beförderten. Die anderen drei Demonstranten jedoch fingen an, Eier und Farbbeutel auf die Tribüne zu werfen. Das Gebrüll von di Rossis Leuten wurde immer lauter.
Endlich ging der Questore ans Telefon. Hastig schilderte Bernucci die Vorgänge auf dem Campo, sagte, dass sie bereits auf Unterstützung durch weitere Carabinieri warte. Servidio wies sie an, auf die Bühne zu gehen und von dort zu helfen, die Situation unter Kontrolle zu bringen. »Sie sind genau die Richtige dafür«, motivierte er sie. Er versprach, schnellstmöglich mit einem Trupp der Polizia di Stato zur Hilfe zu kommen.
Ein Farbbeutel flog dicht an di Rossi vorbei und zerplatzte an der Rückwand der Tribüne. Er hinterließ dort einen bunten Regenbogen, der zäh nach unten floss. Jetzt enterten die beiden Carabinieri, die bisher vor dem Podium gestanden hatten, die Bühne und liefen auf di Rossi zu.
In diesem Moment fiel ein Schuss, hallte von den Hauswänden wider. Dann ein zweiter Knall.
Di Rossi brach zusammen und stürzte auf die Bretter der Tribüne. Augenblicklich wurde es totenstill auf der Piazza del Campo. Bernucci meinte, ihr eigenes Herz wild schlagen zu hören. Die beiden Carabinieri hatten sich instinktiv auf den Boden geworfen und robbten auf allen Vieren auf di Rossi zu.
Vier weitere Autos der Carabinieri fuhren auf den Campo und bremsten scharf. Das musste die Verstärkung sein, dachte Bernucci erleichtert. Acht Uniformierte, die mit ihren Maschinenpistolen martialisch wirkten, sprangen aus den Autos. Die Menge hatte die Schockstarre abgelegt, die auf die Schüsse gefolgt war. Ängstliche Schreie und Rufe waren zu hören, die Demonstranten stoben in alle Richtungen davon. Sie wollten nur noch eines: weg hier, so schnell wie möglich weg.
Bernucci versuchte, einen klaren Kopf zu bewahren, doch ihre Gedanken rasten durcheinander. Sollte sie auf die Bühne gehen, versuchen, von dort aus die Menge zu beruhigen? Woher waren die Schüsse gekommen? Waren weitere zu befürchten?
Aus dem Augenwinkel sah sie schattenhaft einen Mann aus einem der Häuser am rechten Rand des Campo heraustreten. Plötzlich fing er an zu rennen. Ohne zu zögern, sprintete sie ihm hinterher. Der Mann trug ein Gewehr bei sich und rannte pfeilschnell die Cassata di Sotto entlang, die in das Häusergewirr der Contrada Capitana dell’Onda führte. Bernuccis Knie schmerzten, ihre Lungen brannten, die Tritte ihrer Stiefeletten hallten auf dem Pflaster wider. Sie rannte an einem älteren Paar vorbei, das stehen geblieben war und wild gestikulierend auf den fliehenden Mann zeigte.
Bernucci registrierte, dass der Flüchtige merkwürdig lief, er schien sein rechtes Bein kaum belasten zu können. Trotzdem war er schneller als die Commissaria. Nach einigen Metern machte die Straße eine Rechtskurve und Bernucci verlor den Mann aus den Augen. Sie blieb stehen, keuchte und schüttelte den Kopf. Es hatte keinen Sinn. Sie war nicht trainiert genug, um den athletischen Mann einzuholen. Völlig außer Atem griff sie nach dem telefonino und wählte wieder die Nummer von Bruno Servidio.
Ein paar Minuten später betrat Bernucci wieder den Campo. Nun standen Polizeifahrzeuge der Carabinieri, der Polizia di Stato, ein Krankenwagen und ein Notarztwagen auf dem Platz. Vor den Cafés rund um den Campo drängten sich Touristen, die ihre Handys in die Höhe hielten. Carabinieri hatten sich weiträumig auf dem Platz verteilt, um zu verhindern, dass die Schaulustigen näherkamen. Die Bühne selbst war mit rotweißem Flatterband abgesperrt. Bernucci zeigte einem Polizisten ihren Ausweis. Der junge Mann hielt sofort das Absperrband hoch, ließ sie durchschlüpfen. Immer noch schwer atmend stieg die Kommissarin auf die Bühne und begrüßte knapp den Questore.
»Eine Schande für unsere ehrenwerte Stadt«, sagte Servidio. Tief schnitt die Zornesfalte in sein Gesicht. »Da kommen sie schon«, setzte er hinzu und zeigte auf die erste Fernsehkamera, die einen Trupp von Journalisten dicht vor der Absperrung aufbaute. Eine junge Frau mit grüner Jacke und dunkler Kurzhaarfrisur postierte sich mitsamt Mikrofon daneben. »Das werden wir heute Abend in der Presse rauf und runter hören. Attentat in Siena … was für eine Schande.«
»Hat er überlebt?«, fragte Bernucci. Sie konnte nicht erkennen, wie es um di Rossi stand, weil zu viele Polizisten und Rettungskräfte im Blickfeld standen.
Servidio schüttelte den Kopf.
Die Commissaria seufzte. »Von dort drüben haben sie die Farbbeutel und die Eier geschmissen. Riecht immer noch faulig.« Sie deutete nach links. »Das wirkte wie ein Ablenkungsmanöver, denn keiner hat nach rechts geschaut, von wo aus der Schuss gekommen ist. Der Typ war schnell, obwohl er unrund lief. Ich hatte keine Chance, ihn zu erwischen.«
»Dank Ihnen wissen wir zumindest, in welche Richtung er geflohen ist. Wir haben Kollegen losgeschickt, um das Haus zu durchsuchen, aus dem er geschossen hat. Da hinten kommt schon der Hubschrauber.«
Bernucci schaute in den Himmel, der inzwischen immer mehr Blau durchscheinen ließ, und beobachtete den Helikopter, der rasch näherkam. »Dann sehe ich mir das Opfer mal an. Oder hat jemand anderes übernommen?«
»Nein, Signora Commissaria, das ist Ihr Fall.« Servidio trat demonstrativ zur Seite und machte den Weg zur Leiche frei.
Bernucci bahnte sich den Weg bis zum Rednerpult, trat näher an den Toten heran. Guido Medici, der Rechtsmediziner, beugte sich gerade über di Rossi und inspizierte die Schusswunde an der linken Schläfe. Er schaute kurz hoch und begrüßte die Kommissarin. Sie ging in die Hocke und musterte das runde, blutrot umrandete Loch. »Wo ist der zweite Schuss eingedrungen?«, fragte sie.
»Hier oben in die Brust. Der Schütze wollte wohl sichergehen. Aber der Kopfschuss hätte mit Sicherheit gereicht.«
»Ein Profi?«
»Sieht ganz danach aus. Wir nehmen ihn mit und dann hören Sie wie gewohnt von mir. Immerhin fragen Sie mich heute ausnahmsweise mal nicht nach dem Todeszeitpunkt.« Er verzog den Mund zu einem schiefen Grinsen.
Bernucci richtete sich auf, drückte die Knie durch und verzog ebenfalls das Gesicht. Sie schaute auf den Toten herab. Jetzt hatte sie ein politisches Attentat am Hals. Alle würden Druck auf sie ausüben, der Questore, die Staatsanwältin, die Presse. Sie würde mehr diplomatisches Geschick aufbieten müssen, als sie sich selbst zutraute. Das Abendessen übermorgen mit ihren Freunden und Kollegen würde sie absagen. Es war wie immer: Der Job hatte sie fest im Griff.
3. Kapitel
Einen Monat später
Professor Josef Tiefenthal beugte sich weit aus dem Fenster und sog die kühle Abendluft ein. Ein süßer Blütenduft wehte ihm in die Nase. Kirschblüten konnten es nicht sein, denn die waren geruchlos. Dennoch erinnerte der Duft ihn sofort daran, dass es der Beginn der Kirschblüte war, anhand derer man den Einzug des Vollfrühlings in Deutschland feststellen konnte. Erst gestern hatten sie das im Fernsehen gezeigt. Er zog den Kopf ein und schloss das Fenster, um den Verkehrslärm, der vom Kölner Neumarkt hereindrang, aus seiner Wohnung zu verbannen. Er schritt über das Dielenparkett und blieb vor dem antiken Mahagoni-Tischchen stehen, auf dem sich die Masterarbeiten stapelten. Die musste er alle noch lesen. Aber garantiert nicht am Sonntagabend. Er schüttelte den Kopf und ging weiter in die Küche.
Kurz darauf kam er mit einem Glas Rotwein und einer unter den Arm geklemmten Zeitung zurück. Er ließ sich in seinen Sessel fallen, das braune Leder knarzte gemütlich unter seinem Gewicht. Er schlug die Beine übereinander, faltete die unpraktisch große Zeitung auseinander und suchte das Inhaltsverzeichnis.
Ein Artikel über den internationalen Archäologiepreis sprang ihm sofort ins Auge. Anfang August sollte er in Glasgow übergeben werden. Noch wusste niemand, wer der diesjährige Hauptpreisträger werden sollte. Um den Preis wurde fast ein solches Geheimnis gemacht wie um den Nobelpreis. Die Preisträger gehörten stets zu einer besonderen Riege von Wissenschaftlern. Wenn sie nach der Verleihung einen Vortragssaal betraten, wurde es andächtig still im Raum. Jeder meinte, die Aura zu spüren, die diese herausgehobenen Wissenschaftler umgab. Tiefenthal kannte alle noch lebenden Preisträger persönlich. Für dieses Jahr rechnete er sich ernsthafte Chancen aus. Schließlich hatte er vor Kurzem die älteste bislang bekannte Moorleiche entdeckt. Irgendwann würde dieser Rekord gebrochen werden, das wusste Tiefenthal, aber noch hatte er Bestand.
Er faltete die Zeitung wieder zusammen und griff nach dem Glas. Der Rotwein, ein Morellino di Scansano, roch nach Brombeeren und Gewürzen. Er nahm einen Schluck, die Gerbstoffe kleideten sanft seinen Mund aus. Der Wein stammte aus der Maremma, der südwestlichen Toskana. Tiefenthal hatte ihn bei einem Kölner Weinhändler gleich um die Ecke erstanden.
Seine Gedanken wanderten zum morgigen Montag. Abends würde seine Nichte Barbara vorbeikommen und über Nacht bleiben. Sie war für ein paar Tage in Deutschland und Tiefenthal war glücklich, dass sie ihren Onkel nicht vergessen hatte. Danach würde sie weiter zu ihrer Mutter nach Leipzig fahren und erst dann wieder zurück nach Florenz, wo sie studierte. Ob sie immer noch mit Matteo zusammen war? Bei dem Gedanken an das junge Liebespaar spürte Tiefenthal Wärme aufsteigen. Er trank noch einen Schluck Wein und fühlte, wie sich seine Gesichtszüge entspannten.
Der Professor schlug die Zeitung wieder auf und blätterte weiter. Als er das Foto aus Siena sah, stockte ihm der Atem. Er fuhr sich durch die roten strubbeligen Haare und schob die Brille dicht vor die Augen. Das Bild zeigte eine Pressekonferenz der italienischen Polizei. Hinter den zahlreichen Mikrofonen erkannte er Bruno Servidio, den Questore von Siena. Daneben Stella Bernucci. Seine Commissaria.
Fieberhaft las er den Artikel durch. Es ging um den Mord an dem ultrarechten Politiker Giovanni di Rossi, der sich vor einem Monat auf der Piazza del Campo ereignet hatte. Der Schütze war immer noch flüchtig. Die Ermittlungen der Polizei konzentrierten sich auf die linksterroristische Szene, es hatte bereits Festnahmen gegeben. Aber die Hintergründe der Tat lagen immer noch im Dunkeln. Im Artikel wurden die rechtsradikalen, fremdenfeindlichen Tendenzen in Italien dargestellt, aber auch die Gefahr von Links. Eine Staatsanwältin kam zu Wort, auch Questore Servidio. Stella Bernucci aber wurde nicht erwähnt. Weder unter dem Foto noch im Text.
Tiefenthal faltete die Zeitung zusammen und ließ sie auf den Boden gleiten. Natürlich hatte er von dem Attentat gehört, das war damals durch alle Medien gegangen. Er hatte auch mit Stella telefoniert und sie hatten über das schreckliche Ereignis gesprochen. Aber die Commissaria hatte nicht erwähnt, dass sie in diesem Fall zuständig war, womöglich die Ermittlungen sogar leitete. Wollte sie etwa nicht, dass er sich um sie sorgte? Oder wollte sie die kostbare Zeit, die sie am Telefon miteinander verbrachten, nicht mit Gesprächen über ihre Arbeit vergeuden? Tiefenthal ließ sich in den Sessel zurücksinken. Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass er seit fast einem Monat nicht mehr mit Stella gesprochen hatte. Was war mit ihnen passiert? Hatten sie einander nichts mehr zu sagen, oder waren sie inzwischen so vertraut, dass es der Worte nicht mehr bedurfte?
Er nahm einen Schluck Wein, fühlte sich bereits leicht benebelt. Die Wahrheit war, dass er hier allein in Köln ganz gut zurechtkam. Er war es auch gar nicht anders gewohnt. Abgesehen von den elf Monaten vor zwanzig Jahren, in dem er mit Christina zusammengewohnt hatte, hatte er immer allein gelebt. Sie hatten damals eine wundervolle Zeit gehabt, aber dann war sie einfach gegangen. »Es passt nicht mehr«, hatte sie nur gemeint. Es hatte nicht sein sollen. Es gibt Menschen, die sind für das Leben zu zweit nicht geschaffen, das war Tiefenthals feste Überzeugung. Und er wusste, dass er einer dieser Menschen war.
Trotzdem war ihm klar, was jetzt zu tun war.
Er stand auf und ging aus dem Wohnzimmer in den Flur, wo das Festnetztelefon auf der Ladestation stand. Bernuccis Nummer hatte er gespeichert, er würde nur auf eine Taste drücken müssen. Als er nach dem Telefon griff, klingelte es. War das Gedankenübertragung? War sie mal wieder schneller gewesen als er? Bevor er abhob, schaute er auf die Nummer, die auf dem Display angezeigt wurde. Das war Italien, sah aber nicht nach Stella aus. Verwundert hob er ab.
»Herr Kollege, wie geht es dir?«, fragte eine hohe und sehr laute Männerstimme.
»Ernesto, was für eine Ehre am Sonntagabend«, begrüßte Tiefenthal seinen Kollegen aus Florenz, den er sofort erkannt hatte. Ein leicht ironischer Unterton lag dabei in seiner Stimme. Persönlich schätzte Tiefenthal Ernesto Carnevale sehr, schließlich hatten sie im vergangenen Sommer zusammen eine Mörderbande gestellt. Aber als Wissenschaftler hatte der Italiener einen zweifelhaften Ruf.
»Diesmal bin ich wirklich an einer ganz großen Sache dran, Josef. Ich arbeite gerade in der Cattedrale Metropolitana di Santa Maria Assunta, dem Dom von Siena. Wenn meine Vermutung stimmt, muss die Geschichte der Toskana umgeschrieben werden. Und nicht nur die!«
Tiefenthal stöhnte auf. Es war nicht das erste Mal, dass Carnevale an einer ganz großen Sache dran war. Doch der Kollege war so überehrgeizig, dass er sich viel zu wenig Mühe gab, in die Tiefe zu schauen. Bisher gab es noch keine archäologische Sensation, die auf sein Konto ging. »Molto interessante, Ernesto. Worum geht es?«
»Interessante nennst du das? Ich spreche von einer Sensation. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Es geht um eine mögliche Verwandtschaftsbeziehung, da kann uns dein Computerprogramm mit Sicherheit weiterbringen. Komm so schnell wie du kannst nach Siena, Josef.«
»Schick mir doch einfach die Daten von der DNA-Sequenzierung auf einem USB-Stick. Mehr brauche ich nicht für die Analyse. Dafür muss ich mich nicht extra in einen Flieger setzen.«
»Du verstehst überhaupt nicht, worum es hier geht«, ereiferte sich Carnevale. Seine Stimme überschlug sich. »Es wäre besser, wenn wir die DNA gemeinsam entnehmen und sequenzieren würden. So wie beim letzten Mal.«
Tiefenthal konnte seine Neugier nicht im Zaum halten, auch wenn er wenig Lust verspürte, in eine windige Analyse hineingezogen zu werden. »Nun sag schon, worum es geht. Sonst bleibe ich hier in Köln.«
»Na schön. Auch wenn es mir wirklich nicht passt, das so mir nichts, dir nichts am Telefon auszuplaudern. Ich habe bisher mit niemandem darüber gesprochen. Also versprich mir erst mal, dass du es nicht weitererzählst. Und zwar niemandem!«
»Aber ja doch, ich werde schweigen wie ein Grab«, sagte Tiefenthal genervt.
»Va bene, ich vertraue dir. Du kennst doch die Piccolimini-Bibliothek im Dom von Siena?«
»Wer kennt die nicht. Was ist damit?«
»Ich habe in einem der Gemälde einen Hinweis gefunden, dass sich in der Wand ein Grab befindet. Es hat mich sehr viel Überzeugungskraft gekostet, die Erlaubnis zu bekommen, die Wandverkleidung zu entfernen, um dahinter zu schauen. Du weißt, dass ich gut vernetzt bin, eine Menge Leute kenne. Aber diesmal musste ich besonders die Kirchenmänner beknien. Seit Giovannis Tod weiß ja jeder, dass ich schwul bin, das hat mir die Diskussionen mit denen nicht gerade erleichtert.«
»Ich verstehe. Was ist denn nun mit dem Grab?«, fragte Tiefenthal. Er war nun doch elektrisiert von der Vorstellung, ein bislang unentdecktes Grab in der berühmten Bibliothek aus dem fünfzehnten Jahrhundert zu untersuchen.
»Gut, ich mach es mal kürzer. Unter der Wandverkleidung scheint sich tatsächlich ein Grab zu befinden, zumindest wurde dort etwas eingemauert. Wenn ich richtig liege, ist dort der letzte Medici begraben.« Carnevales Stimme vibrierte bei den letzten Worten vor Ehrfurcht.
»Meinst du Gian Gastone de’ Medici?« Tiefenthal grub in seinem Gedächtnis. »Das ist doch der letzte Großherzog, der keine Kinder zeugen konnte und mit dem die männliche Linie der Medici erloschen ist. Ich glaube, das war im Jahr 1737. Liegt der nicht in der Basilica di San Lorenzo in Florenz begraben?«
»Du bist wie immer exzellent informiert, Josef. Ein menschliches Wikipedia. Aber nein, den meine ich nicht. Ich vermute, dass Gian Gastone gar nicht der letzte Medici war, wie immer behauptet wird. Er hatte einen Sohn und der wurde im Dom von Siena beigesetzt. Der Sohn und sein Begräbnis wurden aus den Geschichtsbüchern getilgt. Dein Programm wird uns helfen, das zu beweisen.«
Tiefenthal pfiff durch die Zähne. Wenn das stimmte, war es tatsächlich eine archäologische Sensation. Er dachte an Glasgow und an die Preisverleihung. Was hatte er bei dieser Untersuchung schon zu verlieren? Und was zu gewinnen? »Ich bin dabei, Ernesto. Wann soll ich in Siena sein?«
»Buch deinen Flug und sag mir Bescheid, wann du kommst. Ich sorge dafür, dass die Bibliothek für Besucher gesperrt wird. Du übernachtest bestimmt in Colle di Val d’Elsa?«
»So machen wir es. Ich wollte Stella sowieso gerade anrufen.«
»Perfekt. Ciao, Josef. Gemeinsam werden wir die archäologische Welt ins Wanken bringen!«
»Ciao, Ernesto.« Tiefenthal ging, in Gedanken versunken, zurück ins Wohnzimmer und riss das Fenster weit auf. Er lehnte sich heraus und sog wieder die duftende Abendluft ein. Vielleicht würde sein Computerprogramm erneut dabei helfen, ein Geheimnis zu lüften. Und er würde Stella endlich wiedersehen.
4. Kapitel
Gleich nachdem das Flugzeug zum Stillstand gekommen war, hatte Josef Tiefenthal das Handy eingeschaltet und Stella Bernucci eine Nachricht geschrieben. Sein Hartschalenkoffer war bereits der zweite gewesen, der vom Band gelaufen war, und so strebte er nun schon am Zoll vorbei Richtung Ausgang. Auf dem Rücken trug der Professor einen großen Rucksack, in dem sich unter anderem sein Laptop befand. Den würde er für seine archäologische Arbeit brauchen. Er trat zur Seite, um den Ausgang nicht zu versperren, und musterte die bunte Schar der Wartenden. Eine grauhaarige Frau hielt ein Schild hoch, auf dem ein roter geschwungener Halbkreis, ein kurzer Querbalken und ein Punkt zu sehen waren. Das Logo eines deutschen Touristikkonzerns lächelte ihn freundlich an. Auf anderen Schildern suchten Taxifahrer nach einem Dr. Hofstätter und einem Mr. Raskolnikov.
Endlich erspähte Tiefenthal einen knallroten, herzförmigen Ballon, der von einer Frau mit leuchtenden Augen und dunkel gelockten Haaren in die Höhe gehalten wurde. In ihrem Dekolleté blitzte ein silbernes Kreuz. Sie strahlte über das ganze Gesicht und winkte Tiefenthal fröhlich zu. Schnell näherte sie sich der Absperrung. »Josef«, rief sie. »Siehst du mich denn gar nicht?«
Tiefenthal ging durch die Schwingtür, stellte den Koffer ab und schloss die Commissaria in die Arme. Sie fühlte sich weich und warm an, er presste sie dichter an sich. In diesem Moment ließ Bernucci den Luftballon los, der sofort zur Decke hochstieg.
Sie lösten sich voneinander und beobachteten das rote Herz, wie es höher flog. An der Decke waren die weißen Platten entfernt worden und gaben den Blick auf ein dunkles Kabelgewirr frei. Dort blieb der Ballon hängen. Sie sahen sich an, schüttelten gleichzeitig den Kopf und lachten schallend.
»Du hast dein Herz verloren, Stella«, sagte Tiefenthal und verursachte damit einen weiteren Lachanfall, in den sogar einige der Umstehenden einfielen. Sie küssten einander lang und innig. Wie konnte ich nur vergessen, wie schön das ist, dachte Tiefenthal und verlor sich in einem weiteren intensiven Kuss.
»Komm, wir gehen raus, Josef. Das Parken ist hier am Aeroporto sündhaft teuer. Wir sollten nicht zu viel Zeit vertrödeln«, sagte Bernucci schließlich und zog Tiefenthal samt Koffer mit sich fort.
Eine halbe Stunde später fuhren sie in Bernuccis zitronengelbem Fiat 600, ihrem geliebten Seicento, auf der Superstrada, die von Pisa nach Florenz führte. Im Radio lief das alte Partisanenlied »Bella ciao« in einer aufgemotzten, modernen Version. Die Commissaria und der Professor sangen lauthals mit, auch wenn Tiefenthal nur Fragmente des Textes kannte. Er schaute aus dem Fenster. Die Berge des Apennin lagen hinter ihnen. Sie passierten hellgrüne Wiesen, auf denen gelbe Blüten leuchteten. Selbst die ersten Mohnblumen zeigten bereits ihr zartes Rot. Jetzt schaute Tiefenthal nach links, an Bernucci vorbei, und sah einen Weinberg. Dahinter tauchten sanft gewellte Hügel, Olivenbäume und eine Reihe kerzengrader Zypressen auf. Sie markierten einen hellen, staubigen Weg, der hoch zu einem villenartigen Anwesen führte. »Zauberhaft, diese Landschaft!«, rief er begeistert aus.
»Ach, und ich dachte, du betrachtest mich von der Seite, weil du mich so sehr vermisst hast.«
»Das natürlich auch«, sagte Tiefenthal schnell und strich zärtlich über Bernuccis Oberschenkel.
»Aber eigentlich bist du nur in die Toskana gekommen, weil du wieder irgendein altes Skelett ausgraben willst.«
»Irgendein Skelett ist es diesmal hoffentlich nicht. Und beim letzten Mal ist mir die Leiche ja gewissermaßen zufällig zugeflogen. Historisch war die auch nicht.«
»Erzähl doch endlich, worum es geht. Am Telefon warst du recht kurz angebunden.«
Tiefenthal drehte das Radio leiser und fing an zu erzählen. Von Carnevales Anruf, von dessen Verdacht, dass in der Bibliothek der letzte Sohn der Medici begraben liege, und vom Archäologiepreis, der im August vergeben werde. »Du darfst das auf keinen Fall weitererzählen, Stella, das ist eine ganz heiße Sache.«
Bernucci hatte gespannt gelauscht und währenddessen das Auto ruhig und sicher über die Superstrada gelenkt. »Ich werde schweigen wie ein Grab … unfassbar, dass Ernesto Carnevale es geschafft hat, die Piccolomini-Bibliothek sperren zu lassen und darin auch noch nach einem Skelett graben darf. Im Allerheiligsten von Siena. Was ist, wenn an der ganzen Sache nichts dran ist?«
»Solange in der Öffentlichkeit nichts bekannt wird, ist das kein Problem. Nur wenn irgendjemand mit der Presse redet, dann kann es für uns beide peinlich werden. Dann war’s das für mich mit dem Archäologiepreis, und zwar für immer.«
»Verstehe«, murmelte Bernucci und überholte einen klapprigen Gemüsetransporter. In diesem Moment klingelte ihr Telefon. Tiefenthal erhaschte einen Blick auf das Display. »Giuseppina Leonardi« stand dort. Die Commissaria stöhnte auf und nahm ab. »Die Staatsanwältin«, erklärte sie leise.
»Ciao, Commissaria. Was meinen Sie, wen ich gerade gesprochen habe?«, drang eine junge, sehr entschieden klingende Stimme so laut aus dem Smartphone, dass Tiefenthal alles mithören konnte.
»Sie wollen jetzt nicht wirklich ein Ratespiel anfangen?«
»Sie haben recht, Dottoressa Bernucci, dafür ist die Lage viel zu ernst. Es war der Innenminister. Er wollte sich persönlich über den Fortgang der Ermittlungen bezüglich des Attentats auf Signor di Rossi erkundigen. Ich habe ihn auf den Stand der Dinge gebracht. Er war sehr ungehalten und drohte damit, Hilfe aus Rom zu schicken, wenn wir nicht bald zu Ergebnissen kommen.«
»Soll er doch, wenn er meint, dass das etwas ändert. Wir hängen doch nicht an dem Fall«, sagte Bernucci postwendend.
»So leicht kommen Sie mir nicht davon, Commissaria. Ich habe Sie vor dem Innenminister in Schutz genommen. Ihm erklärt, dass wir vor Ort über viel mehr Informationen verfügen und weitaus dichter an dem Fall dran sind als römische Ermittler. Es ist politisch wichtig, dass wir die Schlagkraft der lokalen Polizeiorganisation unter Beweis stellen. Think global, act local. Außerdem habe ich ihm gesagt, welchen track record Sie haben und dass Sie unsere beste Ermittlerin sind. Jetzt machen Sie gefälligst etwas aus diesen Vorschusslorbeeren. Wir brauchen vorzeigbare Erfolge, Signora Commissaria. Der Innenminister gibt uns noch zwei Wochen, dann sind wir raus aus dem Fall.«
Tiefenthal schwirrte der Kopf vor lauter Anglizismen und modernem Management-Blabla. Er sah, wie Bernucci in ihrem Sitz ein wenig zusammensackte, als ob ein tonnenschweres Gewicht auf ihre Schultern gelegt würde.
Die Commissaria atmete tief durch: »Und was sollen wir Ihrer Meinung nach tun? Die verhafteten Demonstranten schweigen beharrlich, wir können ihnen nichts nachweisen. Der Todesschütze ist über alle Berge. Ein Bekennerschreiben gibt es nicht. Morgen fahre ich nochmals zur Witwe, vielleicht finden wir etwas in di Rossis privatem Umfeld.«
»Na also, Sie verstehen mich ja doch. Mein Vorschlag: Sie konzentrieren sich auf die Privatperson di Rossi, ich übernehme das politische Umfeld. Ein Freund von mir ist ziemlich fit mit dem Computer. Er hat sich bereiterklärt, für ein kleines Entgelt das Darknet zu durchforsten. Vielleicht stößt er auf eine Spur. Wenn wir es mit einem politischen Hintergrund zu tun haben, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass er fündig wird.«
»Na dann …« Die Skepsis in Bernuccis Stimme war unüberhörbar.
»Zwei Wochen haben wir, denken Sie daran. Wir müssen jetzt richtig Gas geben.«
»Ho capito bene, Dottoressa Leonardi. Ich gebe mein Bestes.« Bernucci legte auf.
Im Seicento wurde es still, nur das Radio säuselte weiter vor sich hin.
»Du hast mal wieder Stress, Stella«, stellte Tiefenthal fest. »Ich wusste gar nicht, dass dieses Attentat dein Fall ist.«
»Egal, Josef. Jetzt sind wir zusammen. Lass uns die Zeit genießen.« Sie schaute kurz zu ihm und fuhr zärtlich durch die roten Locken des Professors.
Jeder hing seinen Gedanken nach, bis erneut das Telefon klingelte. Diesmal war es der Questore.
»Ich habe Sie vermisst, Commissaria. Wo sind Sie?«
»Auf der Strada regionale Richtung Poggibonsi«, antwortete sie wahrheitsgemäß. »Professor Tiefenthal ist auf einer Forschungsreise in der Toskana und ich habe ihn aus Pisa abgeholt.«
»Oh, das freut mich sehr, dann richten Sie ihm bitte meine herzlichen Grüße aus«, sagte Servidio gutmütig.
»Ciao, Signor Servidio«, rief Tiefenthal in Richtung des Telefons.
»Bringen Sie den Professor erst mal nach Colle di Val d’Elsa zu sich nach Hause, dabei will ich gar nicht stören.« Er machte eine Pause. »Aber dann, Signora Bernucci, brauche ich Sie dringend in der Questura. Dottoressa Leonardi macht gerade eine Menge Wind.«
»Ich weiß«, sagte Bernucci. Sie bedankte sich bei Servidio für dessen Verständnis und versprach, so schnell wie möglich in die Questura zu kommen. Sie legte auf und drehte das Radio lauter.
Eine Stunde später schloss Bernucci die Haustür auf. Der Professor stand hinter ihr. Er hatte sich geweigert, sich helfen zu lassen. Den Koffer hatte er geräuschvoll über den Kies gezogen, dabei den Rucksack möglichst lässig auf der Schulter balanciert. Kaum war die Tür offen, kam schon Lea, Bernuccis hellbraun gemusterte Katze, herangeschlichen. Sie schmiegte sich dicht an Tiefenthals Bein. Er ließ den Rucksack auf den Boden sinken und schob den Koffer beiseite, bückte sich und kraulte Leas samtiges Fell. Sie schloss die Augen und maunzte zufrieden. Jetzt kam, stolz und gemessenen Schrittes, auch Luca, der dunkle, stets wachsame Kater, herangeschlendert. Auch er wurde von Tiefenthal freudig begrüßt.
Dann aber war es die Commissaria, die die Initiative ergriff. Sie hängte ihre Jacke an die Garderobe und schlang die Arme um den Professor, als er sich gerade wieder aufgerichtet hatte. »Wir haben uns noch gar nicht richtig begrüßt.« Sie streifte seine Jacke ab und küsste ihn zärtlich auf den Mund, schob die Zunge vorsichtig zwischen seine Lippen. Tiefenthals Atem ging schneller, er erwiderte die leidenschaftlichen Küsse und hatte nur noch Augen für sie, seine geliebte Stella.
Die Commissaria knöpfte sein Hemd auf. »Komm, Josef«, hauchte sie. »Lass uns nach oben gehen. Ich glaube, der Questore muss warten.«
5. Kapitel
»Wo bleibt denn Sergio?«, fragte Ernesto Carnevale und schob das Absperrgitter beiseite. Er öffnete das Schloss der schweren Eisentür, die den Zutritt zur Piccolomini-Bibliothek versperrte, und schlüpfte hindurch. Tiefenthal folgte ihm auf den Fersen.
»Ist das der Student, der uns helfen soll?« Tiefenthal gähnte.
»Sergio ist genau der richtige für den Job … du siehst müde aus, Josef.«
»War ein langer Tag gestern.«
»Du und Stella habt bestimmt nicht viel Schlaf bekommen?« Carnevale boxte Tiefenthal freundschaftlich in die Seite. »Ihr Turteltäubchen habt euch ja so lange nicht gesehen, da kann man schon die Zeit vergessen … na, du weißt schon.«
Tiefenthal grinste, blieb stehen und ließ den Blick über die beeindruckenden Wandgemälde schweifen. Dieser Raum erschlug den Betrachter fast mit seiner bunten Ausmalung. An den Wänden prangten zehn Szenen, die von Bögen umrahmt wurden und sich auf die verschiedenen Lebensphasen von Papst Pius II. bezogen. Sein Nachfolger Pius III., selbst auch ein Piccolomini, hatte die Bibliothek nach seinem Onkel benannt. Tiefenthals Blick ging weiter zur eindrucksvollen Decke, die, wie er sich erinnerte, von Pinturicchio zu Beginn des sechzehnten Jahrhunderts ausgemalt worden war. Der Bereich unterhalb der Gemälde war mit dunklem Holz verkleidet. Hier befanden sich Schaukästen, in denen wertvolle alte Schriften ausgestellt waren.
Gerade bewegte sich Tiefenthal auf eine römische Skulptur der drei Grazien zu, die auf einem brunnenartigen Podest stand, als eine kräftige Männerstimme hinter ihm erklang. Er drehte sich um.
»Scusate mi, Professori, ich musste das Werkzeug abholen«, sagte ein untersetzter, muskelbepackter Mann Anfang zwanzig mit kurzgeschorenen Haaren und markanter Hakennase. Er trug einen abgeschabten blauen Metallkoffer, den er geräuschvoll auf den Boden stellte.
»Sergio … endlich«, sagte Carnevale erleichtert. Er schaltete den Strahler an, der nun die Stelle ausleuchtete, an der die Holzverkleidung ein Stück von der Wand abgerückt worden war. Das Licht spiegelte sich in Carnevales stets polierter Glatze.
»Wie bist du darauf gekommen, dass wir genau dort hinter der Wandverkleidung suchen müssen?«, fragte Tiefenthal.
»Schau dir das Gemälde darüber mal genauer an. Siehst du rechts an der Basis der Säule die Großbuchstaben C und M? Das ist eine Abkürzung, die bislang niemand entschlüsseln konnte. Ich aber glaube zu wissen, was die Inschrift uns sagen will. Gian Gastones Sohn sollte Cosimo der IV. de‘ Medici werden.«
Tiefenthal betrachtete das Gemälde, das die Heiligsprechung der Katharina von Siena darstellte. So viele Fragen wirbelten durch seinen Kopf. Warum sollte ausgerechnet Carnevale diese Inschrift entschlüsselt haben? Welchen Grund konnte es überhaupt geben, den letzten Sohn der Medici hier einzumauern und auch gleich noch einen Hinweis auf die Grabstätte anzubringen? Einen, den jahrhundertelang niemand verstanden hatte? Er schob die Fragen beiseite, weil er begriff, dass er inzwischen so tief in der Sache drinsteckte, dass es ohnehin kein Zurück mehr gab.
Carnevale schaltete eine Taschenlampe ein, ging hinter die Mahagoniverkleidung und leuchtete das freigelegte Mauerwerk an. Tiefenthal und Sergio traten dicht hinter ihn. »Seht ihr diesen Umriss? Dahinter liegt er. Ich bin mir sicher.«
Im Mauerwerk erkannte man tatsächlich ein helles Rechteck, etwa so groß wie eine Tür. Tiefenthal war verblüfft. »Also los, Sergio, aber vorsichtig. Wir wissen noch nicht, was uns hinter den Steinen erwartet.«
Der Student rückte dicht vor die Wand und zog seinen Metallkoffer näher heran. Das Kratzen des Koffers auf dem kostbaren Boden schmerzte in Tiefenthals Ohren.
Sergio nahm Hammer und Meißel aus dem Koffer und traktierte die Fuge, die auf seiner Brusthöhe war. Die Schläge hallten in dem prachtvollen Kirchenraum wider. Der Mörtel war brüchig, und so dauerte es nicht lange, bis der Student den ersten Stein aus dem Mauerwerk herauslösen konnte. Der Stein erwies sich als schmal und diente wohl eher dazu, etwas zu verkleiden, als das Dach der Kirche zu stützen. Carnevale leuchtete mit der Taschenlampe die Stelle aus, die bislang verdeckt gewesen war.
Tiefenthal schaute gespannt. Dann rückten die Professoren gleichzeitig vor und betasteten den nun freigelegten Untergrund mit den bloßen Fingern. Er war fest und rau, bestand aus dunkelbraunem Material. Eine Steinplatte.
»Porca puttana«, fluchte Carnevale. »Gar nichts ist darunter. Nur Stein.«
»Nicht so voreilig, Ernesto«, sagte Tiefenthal, der jetzt Blut geleckt hatte. »Sergio, mach bitte weiter, wir müssen die anderen flachen Steine herausnehmen, dann haben wir das vollständige Bild.« Tiefenthals Puls ging schneller. Vielleicht waren sie näher an einer Sensation, als Carnevale ahnte.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.