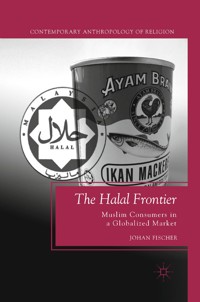Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Serie: Trugwelten
- Sprache: Deutsch
London im Jahr 1888 Leonora Barnes, Tochter aus den besten Gesellschaftskreisen, soll nach dem Willen ihrer Eltern endlich eine standesgemäße Partie auf dem Heiratsmarkt der Upper Class machen. Nicht nur Leonoras Freigeist, sondern auch ihre Vergangenheit, die noch immer ihre düsteren Schatten wirft, stehen jedoch ihrer vorbestimmten Rolle im Weg. Dann nehmen erneut unerklärliche und grausame Geschehnisse ihren unheilvollen Lauf und Leonora beginnt allmählich zu erkennen, dass nichts jemals so ist, wie es zu sein scheint - nicht einmal das Leben selbst ... Erster Band der Mystery-Trilogie "Trugwelten"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Prolog
Cornwall
Samstag, 29. August 1885, 20:03 Uhr
Nicholas Henstridge stürzte unaufhaltsam und unausweichlich dem sicheren Tod entgegen.
In den wenigen letzten Augenblicken, die sein Leben noch andauern sollte, vollzog sein Verstand eine eigenartige Teilung. Dies geschah, ohne dass er es in irgendeiner Weise mit seinem Willen hätte beeinflussen können.
Während der analytische Teil seines Verstandes noch fieberhaft versuchte zu begreifen, was geschehen war, wusste der instinktive Teil seines Verstandes bereits mit absoluter Gewissheit, dass es keine Rettung mehr für ihn gab. Dass sein Ende nun unwiderruflich gekommen war. Sein Fallen würde sogleich ein abruptes Ende nehmen, wenn sein Körper auf den Felsen weit, weit unter ihm aufschlug und zerschellte.
Aber es war doch viel zu früh zum Sterben!
Nicholas hatte immer wieder unzählige Berichte darüber gehört, dass sich die letzten Momente eines Lebens zu vielen Stunden ausdehnten, gleichsam losgelöst von der Zeit. Die Geschichten hatte er stets ins Reich der Legenden verbannt.
Nun wurde ihm schlagartig klar, dass er sich diesbezüglich geirrt hatte.
Die Wucht des rasenden Falls in die Tiefe, zerrte unbarmherzig an jeder Faser seines Körpers. Es fühlte sich an, als würden seine inneren Organe aus ihm herausgerissen, weil er ihnen einen Vorsprung voraushatte, den sie nicht mehr aufzuholen vermochten.
Allmählich verlor Nicholas die Orientierung und es fiel ihm zunehmend schwerer, oben von unten zu unterscheiden. Er sah das Leben, das er nun niemals leben würde, in all seinen grausamen, herrlichen Einzelheiten vor sich.
Seine letzten Momente fühlten sich so unwirklich an, dass er für die Länge eines Lidschlags die verzweifelte Hoffnung hegte, dass vielleicht alles nur ein böser Traum war. Er entschied, keine weitere Zeit mehr zu verlieren, auf der Stelle sein Glück mit beiden Händen zu packen und es niemals wieder loszulassen. Warum nur war er, wie die meisten Menschen auf der Welt, so unfassbar zögerlich, wenn es um das eigene Lebensglück ging? Worauf sollte man denn eigentlich warten? Was konnte verheerender sein, als das Glück in Reichweite zu haben und doch nicht die Hände danach auszustrecken? Nein, das Leben war viel zu kostbar, um auch nur einen einzigen, weiteren Moment davon zu vergeuden!
Gleich würde er grenzenlos erleichtert aus seinem unruhigen Schlaf erwachen und Leo von seinem schrecklichen Traum berichten. Sie würde ihn verstehen und sie, die weitaus weniger zögerlich war als er, würde seine begeisterte Komplizin sein. Seine starke, unbezähmbare und kluge Leonora, die mit ihrem eisernen Willen jeglichen Widerständen den Garaus machte!
Wann wachte er endlich auf? Er konnte es kaum erwarten, das Leben zu beginnen, das er sich so sehr ersehnte, gleichgültig, was es ihn kosten würde!
Aber er würde gleich sterben.
Erneut überkam ihn die brutale Erkenntnis mit voller Wucht, dass alles, was er sich jemals erträumt hatte, in eine für ihn unerreichbare Ferne gerückt war. Mit brennender Verzweiflung dachte Nicholas ein letztes Mal an Leonora. Er spürte, dass ihr Verlust ihn so viel entsetzlicher traf, als der seines eigenen Lebens.
»Für immer verloren! Und doch wird mich nichts davon abbringen, sie jemals aufzugeben - nicht einmal der Tod selbst!«
Dieser Schwur war sein letzter Gedanke. Dann riss ein unvorstellbarer, greller Schmerz die Welt in tausend Fetzen und Nicholas verschwand für immer in einer bodenlosen Finsternis.
Kapitel 1
London
Freitag, 30. März 1888, 16:55 Uhr
Leonora Barnes wartete voller Ungeduld und mit schmerzhaft fest zugekniffenen Augen darauf, dass sich die wohltuende Stille in ihr ausbreitete. Sie konnte sich sonst stets darauf verlassen, dass sich dieser Zustand augenblicklich bei ihr einstellte, wenn sie ihn nur stark genug herbeisehnte.
Besonders gerade dann, wenn sie im Damensalon ihres Londoner Familiensitzes, etwas abseits in der tiefen Fensternische saß. Verborgen hinter den schweren, sonnengelben Vorhängen, starrte sie stundenlang hinaus in den Park auf der anderen Straßenseite. Dabei erschien er ihr so manches Mal wie eine vollkommen andere Welt. Eine Welt, in die Leonora lediglich verstohlene Blicke werfen konnte, ohne sie wahrhaftig betreten zu können.
Nur das beständig andauernde, leise und wellenartige Rauschen, das die vielen schweren Stoffschichten der feinen Kleider bei jeder kleinsten Bewegung erzeugten, wogte der Meeresbrandung gleich, durch die Räumlichkeiten. Ebenso verhielt es sich mit den vielen Stimmen der anwesenden Damen, die sich durch die allseits diskret geführten Unterhaltungen zu einem tosenden Ganzen zusammenfügten.
Sie waren der scharfe Wind, der die Brandung immerfort ans Land trieb, fand Leonora.
Bei gesellschaftlichen Ereignissen in ihrem Londoner Elternhaus verbarg sie sich für gewöhnlich an einem abseitigen Ort. Mittels Imagination konnte Leonora diesen sodann in den herrlichen Strand transformieren, an dem sie ihre glücklichsten Jahre verbracht hatte. Die wogenden Geräusche um sie herum, verwandelten sich in die grollende Brandung und die allseits geflüsterten Unterhaltungen der Damen bündelten sich zu einer harten, pfeifenden Brise, die, vom Wasser her kommend, unerbittlich ans Land drängte.
Leonora konnte sich ein kleines, boshaftes Lächeln nicht verkneifen - glich der imaginäre Wind doch auf geradezu frappierende Weise den angeregten Plaudereien der Damen: Nichts als beständig zirkulierende Luft, die so manches Mal, mit klirrender Kälte, unangenehm in Leonoras Haut schnitt.
Schon seit ihrer frühesten Kindheit war sie tatsächlich dazu fähig, sich dem Hier und Jetzt zu entziehen und an andere, weit entfernte Orte zu flüchten. Allerdings war dies ihr sorgfältig gehütetes Geheimnis und niemand außer... nun, niemand auf dieser Welt wusste davon.
Leider wollte sich jedoch das erlösende Gefühl der Entrückung am heutigen Tag nicht einstellen, um sie zurück an ihren geliebten Ozean zu bringen.
Selbst der Blick in den vom Regen verwaschenen Park, der zu dieser Jahreszeit noch recht kahl anmutete, vermochte Leonora nicht vom Inhalt der geflüsterten Unterhaltung zweier Matronen abzulenken. Es handelte sich bei ihnen einerseits um Leonoras Mutter, Mrs. Barnes, die sich ausgiebig über ihre eigene Tochter ausließ. Ihr ausgesprochen dankbares Publikum bildete andererseits die alte Mrs. Grant, die ebenfalls von der englischen Küste stammte.
Die Teegesellschaft bestand aus Damen der gehobenen Gesellschaft Londons, welche überall im gelben Salon des Hauses in kleinen, illustren Grüppchen verteilt saßen. Unterdessen hatten sich diese beiden Damen für ihren vertraulichen Plausch ein etwas abgelegeneres Plätzchen ausgesucht, außerhalb der Hörweite der restlichen Anwesenden. Jenes Plätzchen befand sich in unmittelbarer Nähe zu Leonoras Fensternische und sie wusste nicht recht, ob es Fluch oder Segen war, dass sie so dem verstohlenen Gespräch ohne Schwierigkeiten folgen konnte.
Offensichtlich hatte Mrs. Barnes die Anwesenheit Leonoras völlig vergessen und sprach ungewöhnlich offen über »die Tragödie unseres Hauses«, wie Mr. Barnes es erst letzte Woche betitelt hatte. ›Haus‹ war hier selbstverständlich als Oberbegriff zu verstehen, der Verschiedenes beinhaltete, was augenscheinlich von größter Wichtigkeit im Leben war: Tradition, Erhalt des Familienerbes (was mit einer einzigen Tochter und ohne Sohn äußerst diffizil war), die Reputation der Familie Barnes und ihre gesellschaftliche Stellung, und so weiter und so fort.
Auch wenn sie dieser Themen längst überdrüssig war, konnte Leonora der Versuchung nicht widerstehen, heimlich zu lauschen. Allerdings traute sie ihrer Mutter auch durchaus zu, dieses Gespräch ganz absichtlich in Hörweite ihrer einzigen Tochter zu führen, um sie »zur Vernunft zu bringen, damit sie sich endlich auf ihre Verantwortung besinnt«, wie Mrs. Barnes es - mindestens einmal täglich - höchst eindringlich formulierte.
»Ihre Leonora besitzt wahrhaftig die Schönheit einer Englischen Rose! Es müssen sich doch eine Menge hervorragender Partien für sie ergeben!«
Wenn Mrs. Grant sprach, klang es so, als trüge eine alternde Operndiva voller Inbrunst eine viel zu sentimentale Arie vor: Sie schien ob der fortwährenden Tragik des Lebens immer ein wenig zu beben.
»Ich sage Ihnen, Mrs. Grant - ich wollte, es wäre endlich etwas von Bestand dabei! Die jungen Gentlemen sind von ihrem Anblick stets über alle Maßen entzückt, auch wenn sie etwas zerbrechlich wirkt, was sie jedoch gewiss nicht ist!« Ihre Mutter klang wie eine Schwindsüchtige auf dem Sterbebett, deren letzten Wunsch aus purer Bosheit niemand zu erfüllen geneigt war. Und das, obwohl es doch keinerlei Umstände machte, ihr diese unbedeutende Gnade zu gewähren!
»Eine Englische Rose vermag auch dem kräftigsten Wind zu trotzen, da haben Sie vollkommen Recht, meine Liebe!«
»Nun... das ist es ja, Mrs. Grant! Leonora vermag offenbar nicht allein dem Wind zu trotzen! Es verhält sich bedauerlicherweise ebenso mit sämtlichen Anwärtern auf ihre Hand. Sie ist nicht einmal bemüht, ihr gänzlich ausbleibendes Interesse an jungen Gentlemen, oder an einer vielversprechenden Verbindung, wenigstens zu heucheln, worauf sich doch eigentlich jedes wohlerzogene Fräulein meisterhaft versteht!« Leonora hörte, wie sich das Leiden ihrer Mutter von Satz zu Satz zu verschlimmern schien.
»Prächtig«, dachte sie, »ich wünschte, der Frühlingsregen könnte diese unsägliche Unterhaltung - oder viel besser, die gesamte leidige Angelegenheit - einfach hinfort spülen!«
Natürlich wusste Leonora, dass der Regen ihr diesen Gefallen keineswegs zu tun gedachte. Vermutlich wäre das äußerst plakativ zur Schau gestellte Leiden ihrer Mutter ohnehin ungleich schwerer zu entfernen, als jeder existierende Fleck im gesamten Empire!
Mrs. Grant senkte ihre Stimme noch ein wenig mehr, rückte verschwörerisch näher an Mrs. Barnes heran und flüsterte: »Diese scheußliche Begebenheit vor drei Jahren-»
Mit einem kleinen, erstickten Laut unterbrach Mrs. Barnes die vertraulichen Worte und flüsterte nun ebenfalls: »Um des Himmels Willen, ich bitte Sie, meine Liebe, darüber wird niemals gesprochen! Ihnen ist bewusst, welche Schande... wenn sich das herumspräche, würde es das Ansehen unserer Familie irreparabel beschädigen! Es war doch-»
Jetzt war es an Mrs. Grant, ihr Gegenüber hastig zu unterbrechen: »Oh bitte, vergeben Sie mir, liebe Freundin! Ich wollte Sie gewiss nicht in eine unkomfortable Lage bringen! Es ist doch aber so, dass die beiden Kinder ein Herz und eine Seele waren, bis zu jenem Tag. Und seitdem-»
Nun war wieder Mrs. Barnes am Zug. «Bitte! Ich beschwöre Sie!«, stieß sie gepresst hervor. Dabei sah sich alarmiert, mit weit aufgerissenen Augen, im Salon um und bemerkte, dass einige Damen in ihrer Nähe allmählich auf sie aufmerksam wurden.
Ohrenbetäubende Stille senkte sich plötzlich über Leonora, ähnlich einer dicken, schweren Glasglocke. Sie hatte das Gefühl, als hätte sich ihr Herz in ein panisches Rennpferd verwandelt, das im gestreckten Galopp hin und her jagte. Es schien in seinem viel zu engen Gefängnis auf der verzweifelten, kopflosen Suche nach dem rettenden Ausweg zu sein, der hinaus in die Freiheit führte. Gleichzeitig spürte Leonora die Wände des Salons von allen Seiten immer näher auf sich zugleiten, um sie in ihrer Mitte langsam zu zerquetschen.
Ein gehetzter Blick über ihre Schulter verriet ihr jedoch, dass sich die mit gelber Seidentapete veredelten, hohen Wände noch an ihren angestammten Plätzen befanden. Auch das Rennpferd in ihrer Brust verlangsamte den rasenden Galopp und versuchte nicht länger, ihrem Brustkorb zu entfliehen.
»Vor drei Jahren - ja«, dachte Leonora bestürzt, »da war mein Leben bereits zu Ende, noch bevor es recht begonnen hatte!« Unter Aufbietung ihrer gesamten Selbstbeherrschung versuchte sie, sich so damenhaft und ungerührt wie möglich, von ihrem Sitzplatz in der Fensternische zu erheben.
Die erschrockenen Blicke ihrer Mutter, und auch von Mrs. Grant, ließen nun keinen Zweifel mehr daran, dass man Leonoras Anwesenheit in der Tat völlig vergessen hatte.
»Mutter, Mrs. Grant, ich bitte Sie freundlichst, mich zu entschuldigen. Die Englische Rose sehnt sich danach, bei einem spätnachmittäglichen Spaziergang im Park das wunderbare, englische Wetter zu genießen!«, verkündete Leonora betont gelassen.
Erstaunt musterten die beiden in dunkle Stoffberge gehüllten Damen sie von Kopf bis Fuß. Die kleinen, immer etwas missbilligend dreinschauenden, Augen ihrer Mutter ruhten dabei etwas länger auf ihr.
Schließlich erwiderte Mrs. Barnes ihrer Tochter in vorwurfsvollem Ton: »Leonora, es regnet bereits seit heute Morgen ohne Unterlass, falls es dir entgangen sein sollte! Als wunderbar kann man dieses scheußliche Wetter nun beim besten Willen nicht bezeichnen!«
»Aber doch gewiss als englisch, liebe Mutter!«, versetzte Leonora blitzschnell, während sie hastig knickste und augenblicklich aus dem Salon stürmte.
Kapitel 2
London
Freitag, 30. März 1888, 17:06 Uhr
Ein zweistimmiges, mit reichlich Missfallen angereichertes »Wie, bitte!?«, geleitete Leonora äußerst schwungvoll aus dem gelben Salon hinaus.
Ihren unrühmlichen Abgang hatten sicherlich auch einige der anderen Damen mitbekommen, überlegte sie, während sie die Tür hinter sich leise schloss.
»Dieses weitere Exempel meines doch insgesamt recht undamenhaften Benehmens, sollte auch noch dazu beitragen, diese ellenlange Liste von äußerst lästigen Heiratskandidaten zu verkürzen«, dachte Leonora, ganz erfüllt von grimmiger Genugtuung.
Währenddessen schlüpfte sie behände in einen warm gefütterten, schwarzen Samtumhang, den sie dem erstaunten Dienstmädchen ohne weitere Umschweife aus den Händen genommen hatte.
»Und wieder eine kleine Revolte, die niemand niederzuschlagen vermochte«, frohlockte Leonora innerlich, voller Stolz.
Sie hasste es, von anderen Menschen angekleidet zu werden, als sei sie eine Puppe, oder gar jemand, der zu so einer simplen Tätigkeit nicht in der Lage war. Auch wenn exakt das in ihren gesellschaftlichen Kreisen zum obligatorischen guten Ton gehörte und alles andere als unschicklich galt. Dummerweise hatte Leonora zeitlebens eine starke Affinität zu ebendiesen Dingen besessen: Das vorstellbar Unschicklichste, das in ihrer Welt eine Frau imstande war zu tun, war, einen eigenen Willen zu besitzen. Besonders anstößig war es, diesen nicht mit angemessener Beschämung vor aller Welt zu verbergen. Sich gar dem Willen der Gesellschaft offen zu widersetzen, aus dem vorgezeichneten Leben auszubrechen, um lieber eigenen Wünschen zu folgen - nun, das waren bestenfalls die Anwandlungen einer Wahnsinnigen.
Hauptsächlich, so schien es Leonora, musste jede Form von Unabhängigkeit unter allen Umständen vermieden werden! Darum wohl hatte auch jedes weibliche Mitglied ihres Standes eine Zofe, die beim An- und Auskleiden jeden einzelnen Handgriff übernahm, insbesondere das ›Einschnüren‹.
Auch da bildete Leonora eine heimliche Ausnahme: Zumeist gestattete sie ihrer Zofe Annie lediglich, zum besagten Schnüren ihres Korsetts, oder beim Frisieren Hand an sie zu legen. Ein solch eigenwilliges Betragen wie das Leonoras, wäre es jemals ans Licht gekommen, hätte in den Augen der Allgemeinheit schlichtweg skandalös gewirkt.
Die Konsequenzen mangelnder weiblicher Fügsamkeit waren auf dem Heiratsmarkt schlechthin verheerend: Niemand wollte seinen Familienfrieden und seinen guten Namen mit so einer Frau als Ehefrau oder Schwiegertochter gefährden. Denn wer sich leichtfertig für eine eigenwillige Frau entschied, hatte sich entweder einen künftigen Hausdrachen oder gar eine frivole Person aufgehalst. Irreparable Schäden am gesellschaftlichen Status waren dann absehbar und nur eine Frage der Zeit.
Leonora war vor einigen Wochen zwanzig Jahre alt geworden und ihre Eltern hatten inzwischen ihre Anstrengungen mehr als vervielfältigt, um ihr einziges Kind bestmöglich zu verheiraten. Dafür war es allerhöchste Zeit, denn schon bald wäre sie endgültig zu alt, um noch eine der begehrtesten Partien abzubekommen.
Da ihre Familie zwar von altem, aber niederem und unbedeutendem Landadel abstammte - zumindest auf irgendeine undurchsichtige, dubiose und sehr weit entfernte Weise - zudem sehr vermögend und stets auf einen tadellosen Ruf bedacht war, wäre eine solche Vermählung im Grunde alles andere als ein aussichtsloses Unterfangen gewesen.
Auch ihre äußere Erscheinung war alles andere, als unprätentiös: Leonora war von sehr zierlicher Gestalt und besaß ein blasses, scharf und ebenmäßig geschnittenes Gesicht mit großen, leuchtend grünen Augen darin. Umrahmt wurde das bemerkenswerte Antlitz von einer tiefschwarzen Löwenmähne, die nun, da sie eine junge Frau geworden war, täglich aufwendig frisiert und hochgesteckt werden musste. Was wiederum nicht nur Leonoras Zofe alles an Geduld und Hartnäckigkeit abverlangte! Mr. Barnes scherzte oft, er müsse schon bald eine weitere Zofe einstellen, welche ausschließlich mit der Bändigung von Leonoras Haar betraut werden könne - und zwar täglich, den ganzen Tag lang.
Wer allerdings etwas genauer hinschaute, konnte recht häufig ein unberechenbares Blitzen in Leonoras Augen entdecken, was auch für den harten, unnachgiebigen Zug um ihren Mund galt, für den sie eigentlich noch viel zu jung war. Ein Zug, der verursacht worden war von einem Verlust, der sie ihre gesamte jugendliche Unbeschwertheit gekostet und sie für immer verändert hatte. Sie sprach generell nicht viel, war zumeist in sich gekehrt und an der Gesellschaft anderer Menschen nicht sonderlich interessiert. Nur wenn sie unter freiem Himmel war, schien Leonora durch und durch zufrieden zu sein.
Seinerzeit, als sie mit ihren Eltern noch an der Küste Cornwalls gelebt hatte, wo sie einst aufgewachsen war, hatte man das zarte Mädchen bei Wind und Wetter draußen antreffen können. Sie war unendlich viele Sunden durch die Gegend gestreift, zu Fuß oder in späteren Jahren auch oft zu Pferde.
Als Leonora dann auch noch damit begonnen hatte, sich brennend für die Jagd zu interessieren, hatten ihre Eltern größte Befürchtungen gehegt, dass ihre einzige Tochter sich zu einem völlig verwilderten Wesen entwickeln könnte. Das wiederum, hätte alle Chancen auf eine standesgemäße Verheiratung gründlich zunichtegemacht. So hatten sich die Barnes kurzerhand vor fast genau zwei Jahren dazu entschlossen, mit ihrer gerade achtzehnjährigen Tochter nach London zu übersiedeln.
Mr. und Mrs. Barnes hatten wohl außerdem angenommen, dass es ohnehin besser sei, wenn Leonora nicht mehr an jenem Ort lebte, wo es passiert war. Jenes einschneidende Ereignis, das Leonora für immer verändert hatte und das niemals Erwähnung fand, nicht einmal unter vier Augen.
Nein, London war ein ungleich geeigneterer Ort für ein junges Fräulein aus guter Familie, das sich in heiratsfähigem Alter befand. Die Auswirkungen des unglückseligen Vorfalls auf Leonora, konnten gewiss auf irgendeine Weise nahezu rückgängig gemacht werden, daran glaubten ihre Eltern fest. Denn ein Ortswechsel, noch etwas Zeit und schließlich das Leben als Ehefrau und Mutter würden Leonora guttun, da waren sich die Barnes so einig gewesen, wie niemals zuvor.
Außerdem, wenn schon der gute Name mangels Söhnen leider nicht überdauerte, konnte dieser doch mithilfe Leonoras durch einen noch klangvolleren Namen ersetzt werden. Das stattliche Vermögen der Familie Barnes stellte immerhin einen großen Anreiz für einige Dynastien dar, die zwar einen klangvollen Namen samt nicht minder klangvollen Titeln ihr Eigen nannten, aber bedauerlicherweise nicht über den dazu passenden Reichtum verfügten.
Sei es durch Glücksspiel, das jahrzehntelange Leben über die wirtschaftlichen Verhältnisse, oder unkluge Investitionen zu großer Summen in Übersee, weil die garantierten Gewinne lockten, die natürlich ausblieben - vielen hochgestellten Familien fehlte glattweg ein Vermögen. So verließ man oftmals die riesigen Landsitze und siedelte in ein elegantes Stadthaus in London um, das selbst in den exklusivsten Gegenden um ein Vielfaches günstiger im Unterhalt war. Die großen Besitztümer konnten nicht ohne beträchtlichen Gesichtsverlust veräußert werden, weil es als ehrenrührig galt, ein Anwesen, das bereits seit vielen Generationen im Besitz derselben Dynastie war, umständehalber zu verkaufen. Aber durch den Umzug in die Stadt konnte man den Familiensitz ohne allzu großen Aufwand - und ohne großes Aufsehen - mehr oder weniger sich selbst überlassen. Allerdings war das nur eine vorübergehende Lösung, denn solch ein Anwesen durfte keine irreparablen Verfallsschäden davontragen, sonst würde das gesellschaftliche Ansehen des Eigentümers unweigerlich denselben Weg gehen. Aus diesem Grund waren die Nachkommen solcher Dynastien vor allem auf eine reiche Heirat erpicht. Die Standesmäßigkeit hingegen, war in solchen Fällen eher zweitrangig. In Londons feiner Gesellschaft gab es bereits einige derartige Arrangements, von denen, für alle unübersehbar, beide Seiten zu profitieren schienen.
Was indes in Leonora vorging, wussten ihre Eltern nicht. Selbst wenn doch, so wären diese weder fähig, noch willens gewesen, ihre Tochter zu verstehen, das wusste sie ohne jeden Zweifel.
Seit Leonora in London wie ein Ausstellungsstück auf dem Heiratsmarkt der besseren Gesellschaft präsentiert, ja regelrecht feilgeboten wurde, fühlte sich ihre Situation mit jedem Tag hoffnungsloser an. Es war, als würde die ganze Welt um sie herum immer mehr zusammenschrumpfen, während Leonora jedoch nicht mitzuschrumpfen imstande war. Und so verlor sie ein Stückchen nach dem anderen ihrer ohnehin viel zu knapp bemessenen Bewegungsfreiheit. Hinzu kam, dass sie seit Nicholas' Tod nur noch den Wunsch nach friedlichem und ungestörtem Alleinsein hatte. Und nach dem weiten Himmel, unter dem sie früher so viel Zeit verbracht hatte, unbekümmert und frei. Damals war ihr nicht einen Wimpernschlag lang in den Sinn gekommen, dass all das Wunderbare in ihrem Leben jemals schwinden könnte.
In jenen unbeschwerten Jahren hatte sie sich niemals einsam gefühlt, denn sie hatte Nicholas an ihrer Seite gehabt. Ihr ›halbes Herz‹, wie sie ihn manchmal genannt hatte, um ihn zu necken. Er hatte sie daraufhin schelmisch gefragt: »Warum gehört mir nur dein halbes Herz?«
Und sie hatte ihm dann genauso schelmisch geantwortet: »Eine Hälfte für dich, die andere Hälfte für mich!«
Das hatten sie immer als Kinder zueinander gesagt, als sie die heimlich aus dem Obstgarten erbeuteten Äpfel, Frucht für Frucht, gewissenhaft in zwei genau gleiche Hälften aufteilten.
Aber eines Tages war Nicholas plötzlich gestorben. Und Leonora hatte schlagartig begriffen, dass sie fortan tatsächlich mit einem halben Herzen würde weiterleben müssen. Die andere Hälfte hatte er unwiederbringlich mit sich fortgenommen, an den jenseitigen Ort, wo er sich nun befand - unerreichbar weit entfernt von ihr.
Nicholas hatte ihr eines Tages vor vielen Jahren erzählt, dass es im Leben unumkehrbare Veränderungen gab. Einschnitte, die man im Voraus nicht einmal mit der größten Phantasie der Welt ermessen konnte. Deren absolute Endgültigkeit man erst erfasste, wenn sie wie eine Naturgewalt über einen hereinbrachen und alles unter sich begruben, das man einmal gekannt hatte. Er hatte damals gewusst, wovon er sprach.
Sie verstand es erst nach seinem Tod, der exakt diese Art von Veränderung für Leonora mit sich brachte. Obwohl sie gespürt hatte, dass etwas Gewaltiges auf sie einstürzte und tapfer versucht hatte, sich so gut es ging zu wappnen, war Leonora auf die enorme und allumfassende Wucht der Zerstörung doch vollkommen unvorbereitet gewesen.
Kapitel 3
London
Freitag, 30. März 1888, 19:51 Uhr
Nun lebte Leonora also bereits eine ganze Weile in London. Und sie war einsam inmitten der vielen, furchtbar lärmenden und beunruhigend grellen Menschen. Die Mädchen ihres Alters kannten nur das eine, universelle Konversationsthema: die gute Partie. Dieses Thema erschöpfte sich, in seinen schier endlosen Variationen, scheinbar niemals für irgendjemanden. Außer für Leonora, die diese Inbrunst von Beginn an nicht zu teilen vermochte. Vermutlich hätte sie es selbst dann nicht gekonnt, wenn sie es ernsthaft versucht hätte. Sie fühlte so furchtbar fremd, so gänzlich andersartig, und dieses Gefühl wuchs in den bunten, lauten und dicht bevölkerten Straßen Londons über die Zeit zunehmend ins Unermessliche.
»Ich habe niemandem etwas zu geben«, dachte sie oft erschöpft, »also lasst mich doch eine alte Jungfer werden, die weit weg von euch allen auf das Ende ihres Lebens wartet. Meine Tage könnte ich mit Reiten, Jagen und Umherstreifen verbringen. Allesamt Unternehmungen, bei denen ich nicht auf menschliche Gesellschaft zurückgreifen müsste. Ihr könntet meine Existenz vergessen und ich könnte dann endlich wieder ungehindert Aufatmen, gleichermaßen befreit vom Korsett, wie von der feinen Gesellschaft. Ich könnte ohnehin nicht ausmachen, was davon mich enger einschnürt und mir alle Luft zum Atmen nimmt!«
Diese Gedanken gingen Leonora wohl zum tausendsten Mal durch den Kopf, als sie durch den kalten Regen flanierte. Zwar konnte man ihre schnellen und energischen Schritte eigentlich nicht als ›flanieren‹ bezeichnen, aber so nannte man es nun einmal gemeinhin, wenn sich eine junge Dame aus gutem Hause unter freiem Himmel herumtrieb, ohne ein festes Ziel vor Augen zu haben.
Leonora wusste, dass ihre Mutter ihr den kleinen, rebellischen Ausbruch nicht nachsehen würde. Im Gegenteil - da ihre ruppige Art nicht nur aufdringliche alte Damen, sondern auch potenzielle Ehegatten verschreckte, wurde solches Betragen in keiner Weise geduldet. Aber noch hatte sie etwas Zeit bis dahin, eine kurze Galgenfrist inmitten des vom Regen verschleierten Braungraugrüns der hohen, alten Bäume, die in dem weitläufigen Park sehr zahlreich vertreten waren. Vollkommen unbeteiligt standen die stummen Riesen da, weitaus länger als ein Menschenleben lang, erhaben über alles, was sie umgab. Allein den Jahreszeiten waren sie unterworfen, nur ihnen mussten sie sich fügen, um zu überdauern, bis sie eines fernen Tages das Ende ihres Daseins erreichten. Jedermann akzeptierte ihre majestätische Unabhängigkeit ohne Klagen, es stand ohnehin in niemandes Macht, etwas daran zu ändern. Leonora hätte nur zu gern mit einem der stattlichen Giganten getauscht, denn das wünschte sie sich auch für sich selbst: Einfach nur sein zu dürfen, bis zu dem Tag, an dem ihr eigene Existenz jenes Ende finden würde, das Allem vorherbestimmt war.
Es war viel zu kalt, um in den mittlerweile vollständig durchnässten Kleidern weiter herumzuwandern. Eigentlich hätte Leonora längst umkehren müssen, aber dazu konnte sie sich nicht überwinden.
Hier, unter freiem Himmel, konnte sie annähernd durchatmen - sogar dem grässlichen Korsett zum Trotz! Sobald sie aber das Londoner Haus betrat, in dem sie nun lebte, verspürte sie stets eine diffuse Furcht, dass bei ihrem nächsten Atemzug keine Luft mehr da sein würde.
Leonora nahm mit jedem verstreichenden Moment intensiver wahr, wie die lähmende Eiseskälte durch den nassen Stoff bis auf in ihre Haut vordrang, und schließlich tiefer in sie hineinkroch, bis sie ihre Knochen erreicht zu haben schien. Sie zitterte bereits heftig und der ohnehin schwere Umhang hing, mit Regenwasser vollgesogen, um ihre Schultern, als bestünde er aus purem Blei. Die eisigen Nadelstiche in ihrer Haut ließen Leonora die Kälte an sich, zugleich intensiver und doch schwächer als gewöhnlich erscheinen. Es war alles in allem eine höchst eigenartige Empfindung, stellte sie verwundert fest. Wohl zum ersten Mal wurde ihr deutlich bewusst, dass Hitze und Kälte sich derart ähnlich anfühlen konnten, dass sie fast nicht mehr auseinanderzuhalten waren.
Leonora sank ermattet auf die Bank unter der großen Trauerweide, nah an dem kleinen Teich. Dieser verwunschen anmutende Ort erschien ihr mehr als passend zu sein! Abrupt endete das gnadenlose Zerren des bleischweren Gewichtes an ihren Schultern. Diesen verschwiegenen Platz besuchte sie gern, um allein zu sein. Sie liebte es, geschützt von dem dichten, bis zum Boden reichenden Zweigvorhang, mit ihren Gedanken für sich sein zu können. Erst jetzt bemerkte Leonora, wie unendlich erschöpft sie eigentlich war: Selbst die kleinste Bewegung verlangte schier unmenschlich große Anstrengungen von ihr. Sie musste sich unbedingt ein wenig ausruhen, bevor sie sich auf den Rückweg machen konnte!
Der wilde Strudel in ihrem Kopf beruhigte sich allmählich, wurde zunehmend langsamer und war schließlich so dickflüssig und träge, wie erkaltendes Pech. Die Kälte nahm Leonora kaum noch wahr, sie hatte sich inzwischen todmüde und ganz unbewusst in einen schützenden Kokon aus entrückter Taubheit eingesponnen.
Wie durch eine dicke Wand in ihrem Kopf bemerkte sie am Rande ihrer Wahrnehmung, dass es nachtdunkel geworden war und der helle Schein der Gaslaternen an einigen Stellen durch den dichten Vorhang aus Zweigen brach. Sie musste schon um einiges länger auf der Bank sitzen, als es ihre Absicht gewesen war! Selbst für Leonora mutete die Situation bedrohlich an, obwohl sie keine Angst vor der Dunkelheit hatte.
In den Straßen Londons jedoch, existierten nach Einbruch der Dunkelheit Gefahren, die auf dem Land nur schwerlich zu finden waren. Menschen, die nichts Gutes im Sinn hatten und die, ohne durch ein hinderliches Gewissen belastet, im Schutz der Nacht ihren höchst speziellen Geschäften und Neigungen nachgingen. Andererseits befand sich Leonora immerhin in Mayfair, einem sehr vornehmen Stadtteil Londons. Alle Menschen, die offensichtlich nicht dorthin gehörten, fielen den reichlich vertretenen Schutzmännern rasch ins Auge und wurden umgehend vertrieben. Zumindest dann, wenn nicht der Auftrag eines Anwohners ihre vorübergehende Anwesenheit in einer so erlesenen Gegend rechtfertigte. Leonora hatte schon häufig beobachtet, wie rigoros sich Mayfair gegen alles abschottete, das nicht zu Mayfair gehörte. Oder treffender gesagt: Gegen alles, was nicht mindestens genauso vornehm wie Mayfair und seine Anwohner war.
Es gab viele, unvorstellbar düstere Regionen in London, die so arm und überfüllt von Menschen waren, dass man sie mancherorts schon als ›Armenhäuser der Stadt‹ bezeichnete. Das erbärmliche Elend, in dem die Menschen dort lebten, vermischte sich auf geradezu fatale Weise mit dem grausamen Elend, das sie einander zufügten. Jedermann versuchte, irgendwie zu überleben, was es auch kosten mochte und gleichgültig, was sie dafür tun mussten - oder anderen antun mussten. Gewalt war solcher Orts die einzige Sprache, die von allen gleichermaßen verstanden wurde. Und wer sie nicht gut genug beherrschte, wurde zum Opfer, immer und immer wieder. Niemanden interessierte oder bewegte dergleichen sonderlich, denn sie alle waren viel zu sehr damit beschäftigt, immerfort die eigene Haut zu retten und dabei nichts unversucht zu lassen, um dieser Hölle doch noch zu entkommen.
Ja, jene irdischen Höllenkreise befanden sich nur eine kurze Kutschfahrt weit von Mayfair entfernt und doch lagen Welten dazwischen.
Aus dem Nichts heraus legten sich zwei große, schwere Hände von hinten auf Leonoras Schultern. Ihr Herz setzte einige Schläge aus. Trotz ihres mittlerweile nahezu gefühllosen und völlig erschöpften Zustandes fuhr sie von der Bank auf, der laute Schrei blieb ihr jedoch in der Kehle stecken und erstarb in einem Keuchen.
Leonora stockte der Atem, als sie spürte, dass sich eine der beiden Riesenpranken blitzschnell auf ihren Mund presste, während der andere Arm ihre Schultern unnachgiebig umklammerte. Sie wusste sofort, dass ihre Kraft nicht einmal annähernd ausreichen würde, um zu entfliehen, oder sich gar zur Wehr zu setzen.
Leonora stieg ein sehr exquisites Duftwasser in die Nase. Zugleich nahm sie das feine und butterweiche Leder wahr, aus dem die Handschuhe des Fremden gefertigt waren. Während ihr Körper vor Entsetzen und Schock gänzlich erstarrt war, registrierte ihr seltsam losgelöster Verstand, dass der Angreifer offensichtlich kein Eindringling in Mayfair war, sondern vielmehr Teil der exklusiven Gegend zu sein schien. Für die Dauer eines Lidschlags war sie über diese Erkenntnis furchtbar erleichtert und schämte sich innerlich sogar ein wenig für ihre hysterische Reaktion. Gewiss wollte er ihr, der durchnässt und verstört wirkenden jungen Frau, nur zu Hilfe kommen, wie es sich für einen Gentleman geziemte, schoss es Leonora durch den Kopf.
Sie bemühte sich nach Kräften, diesen Gedanken festzuhalten, sich ganz und gar darauf zu stützen, obwohl sie doch so furchtbar durcheinander war. Jedoch gelang es ihr nicht, denn ihr Instinkt war zur gleichen Zeit zu einer völlig anderen Schlussfolgerung gekommen, als ihr Verstand.
Dann vernahm Leonora eine tiefe, heisere Stimme an ihrem Ohr. So nah, dass sie seinen Atem auf ihrer Haut spürte, als er leise zu sprechen begann: »Der gute, alte Jack empfiehlt dir sehr dringend, nicht zu schreien. Niemand kann dich hören, aber das scheußliche Hurengeschrei würde ihm ganz und gar nicht zusagen.«
Er nahm sehr langsam die Hand von ihrem Mund und drehte sie dann augenblicklich mit einem schnellen, ruckartigen Griff zu sich herum. Währenddessen verlangte er mit drohender Stimme: »Lass dich einmal ansehen...«
Leonoras fieberhaft arbeitender Verstand verzeichnete, dass seine Art zu sprechen äußerst eigentümlich war. Sie konnte den Mann nicht erkennen, so sehr sie es auch versuchte! Über seine Schultern hinweg schien gleißend der verirrte Lichtstrahl einer nahen Gaslaterne in ihr Gesicht und blendete schmerzhaft ihre an die Dunkelheit gewöhnten Augen. Erschwerend kam hinzu, dass die Vorderseite ihres Angreifers somit im Schatten lag und nur dunkle Umrisse erkennbar waren.
Leonora blinzelte immer wieder krampfhaft, um ihre Augen an die veränderten Lichtverhältnisse zu gewöhnen und doch noch das Gesicht des Mannes sehen zu können. Jedoch war sie lediglich dazu in der Lage, eine sehr große und kräftige Silhouette zu erkennen.
Da geschah etwas vollkommen Unerwartetes und Unvorstellbares. Leonora spürte es mehr, als es tatsächlich zu sehen, dass der Mann beim Anblick ihres hell erleuchteten Gesichts nun seinerseits erstarrte. Im selben Augenblick hörte sie ihn schockiert nach Atem ringen.
Ihre Panik steigerte sich schlagartig zu blanker Todesangst, als der Fremde eine seiner Riesenhände zu ihrem Gesicht hob und behutsam, ja beinahe andächtig, mit ledernen Fingerspitzen über ihre Wange strich.
Leonora konnte sich nicht bewegen. Sie konnte nicht atmen. Sie konnte keinen Laut von sich geben. Sie war verloren!
Nach einem atemlosen Moment der Stille, der sich bis in alle Ewigkeit hinzuziehen schien, flüsterte er leise und seltsam zärtlich nur ein einziges Wort. Ein Wort, das ihren Verstand augenblicklich in sich zusammenstürzen ließ, als wäre er nichts weiter, als ein Kartenhaus inmitten eines heftigen Zugwindes: »Leo!«
Nur ein einziger Mensch hatte sie jemals so genannt und niemand sonst hatte davon etwas gewusst.
»Aber er ist doch tot! Er ist tot!«, schrie es gellend in ihrem Kopf, als sie ohnmächtig wurde.
Kapitel 4
London
Freitag, 30. März 1888, 21:24 Uhr
Nur mithilfe eines blitzschnellen und festen Griffes um ihre Taille konnte er verhindern, dass die Ohnmächtige auf dem Boden aufschlug.
Was in drei Teufels Namen war da gerade geschehen, fragte er sich benommen.
Leo? Dieser Name sagte ihm überhaupt nichts, er kannte das verderbte und sittenlose Ding doch gar nicht!
Nein, sie war so wunderschön, so schutzlos und verletzlich!
Was zum... stritt er etwa just in diesem Augenblick mit sich selbst? Wegen eines dummen, liederlichen Weibes, das nicht einmal genügend Tugend besaß, um zu dieser späten Stunde dort zu sein, wo sich ehrbare Frauen nach Einbruch der Dämmerung zu befinden hatten?
Woher war sie gekommen? Er musste ihr helfen!
Was ging hier vor? Was geschah mit ihm?
Noch immer stand er unschlüssig da, bewegungslos, seitdem er sie aufgefangen hatte. Ihr lebloser Körper lag erstaunlich schwer auf seinen Armen und je länger er sie betrachtete, desto weniger vermochte er es, seinen Blick wieder von ihr abzuwenden. Ihm war vollauf bewusst, dass sie noch lebte und außerdem gänzlich unverletzt zu sein schien - soweit er es unter diesen Umständen feststellen konnte.
»Ursprünglich hatte ich allerdings etwas Gegenteiliges im Sinn«, dachte er grimmig, während er den Hals seiner reglosen Fracht prüfend betrachtete. Unter der zarten, bleichen Haut konnte er ein kaum wahrnehmbares Pulsieren erahnen.
Unentschlossen hielt er weiterhin inne, aufgewühlt von dem ungeplanten Verlauf dieser Begegnung, die er sich ganz anders ersehnt hatte: Er wollte es so sehr, wollte es mehr, als er irgendetwas sonst jemals gewollt hatte!
Aber er konnte nicht, irgendetwas hielt ihn mit aller Macht davon ab.
Meldete sich etwa eine kuriose Art von Gewissen, dessen Existenz er bisher nicht bemerkt hatte? Er wusste beim besten Willen nicht, woher er etwas Derartiges auf einmal bekommen haben sollte! Vollkommen fremd fühlte sich die ungewohnte Regung in ihm an, gar nicht wie etwas, das zu ihm gehörte. Ignorieren konnte er besagte Regung dennoch nicht, denn sie stand zwischen ihm und seinem größten Verlangen, so unüberwindbar wie die Chinesische Mauer.
Oh ja, er wollte es mehr als alles auf der Welt. Aber er konnte es nicht!
Den ganzen, vorangegangenen Tag über hatte der Mann, der sich selbst insgeheim Jack nannte, selbstvergessen in dem gemütlichen, abgewetzten Lesesessel seiner ausladenden Bibliothek zugebracht. Dort hielt er sich meistens auf, was niemanden störte, denn er lebte allein und verzichtete sogar auf störendes, neugieriges Hauspersonal. Alles, was er brauchte, befand sich innerhalb jener von ihm präferierten Räumlichkeit.
Nun ja, zumindest bis zu diesem Tag.
Er hatte vor seinen mittlerweile völlig zerlesenen Anatomiebänden gesessen, die er sich erst letztes Jahr anonym aus dem Nachlass eines unbedeutenden Landarztes beschafft hatte. Diese überaus faszinierenden Werke kannte er bereits in- und auswendig, so dass er sie im eigentlichen Sinn nicht mehr studieren musste. Vielmehr blätterte er sie gern langsam und genüsslich Seite für Seite durch, bewunderte die bizarren Zeichnungen und konnte sich deren überwältigender Anziehungskraft, die sie auf ihn ausübten, nicht entziehen. Er strich dabei mit seinen Fingerspitzen, beinahe forschend, wieder und wieder über die vergilbten Seiten, erspürte jede Unebenheit und jede aufgeraute Stelle des dicken Papiers.
Jack hatte sich schließlich dazu entschieden, einen kleinen Abendspaziergang zu machen und in aller Ruhe über den Drang nachzusinnen, der bereits seit so langer Zeit in ihm heranwuchs.
Wohin mochte ihn seine ungewöhnliche Neigung wohl führen, die er gezwungen war, in seinen Gedanken unter Verschluss zu halten? Es war ihm durchaus bewusst, dass andere Menschen dergleichen höchst beängstigend fänden, sollten sie von der Existenz solcher Gedanken auch nur entfernt etwas erahnen. Immer häufiger träumte er insgeheim davon, seine Anatomiebücher zum Leben zu erwecken. Oder vielmehr davon, ihren Inhalt mit all seinen Sinnen zu erfahren.
Wie mochte es sich wohl anfühlen, das Innerste eines menschlichen Körpers zu berühren? Mit den bloßen Fingern jene geheimnisumwobenen Landschaften zu erkunden, welche von der Schöpfung niemals dazu ausersehen gewesen waren, betrachtet oder gar berührt zu werden?
In seiner Fantasie versuchte er immer wieder, sich dieses exquisite Erlebnis möglichst detailreich und sinnlich auszumalen: Eine überwältigende Komposition aus unendlich vielen verschiedenen Rottönen, die seine Sinne bis aufs Äußerste reizte und ihn an die wahrhaft geheimen Orte des Lebens führte. Deren bloße Existenz nur den wenigsten Menschen überhaupt bekannt war!
Dabei war ihm anfangs nicht aufgefallen, dass die identitätslosen Körper auf seinen Gedankengemälden immerzu weiblichen Geschlechts waren, verwegen geschwungen, wie Streichinstrumente. Reglos hindrapiert, als würden sie sich ihm vorbehaltlos ergeben. Herrlich warm, als wären sie noch immer lebendig.
Diese unbewohnten Körper, über die er ungestört und ganz nach Belieben verfügen konnte, würden keine Gegenwehr leisten, würden niemandem verraten, was er mit ihnen tat. Nein, es erschien ihm vielmehr so, als würden sie ihn Willkommen heißen! Ja, er konnte alles mit ihnen tun, denn sie gehörten nur ihm allein!
Und niemals würde jemand hinter sein Geheimnis kommen, wenn er es nur klug anstellte ...
Es gab schließlich Frauen, die niemand vermisste. Frauen, für deren Verkommenheit es eine Erlösung zu sein schien, wenn sie aus dem Besitz vieler Männer in den eines einzigen Mannes übergingen.
Ja, Huren waren die Antwort auf seine Gebete, seine Gelüste, sein innigstes Sehnen. Schmutzige, verderbte Huren, die längst nichts Menschliches mehr an sich hatten!
So war der Mann gemächlich und scheinbar selbstzufrieden durch die regnerische Abenddämmerung spaziert, bis er bald schon einen Park erreicht hatte, der zu dieser Zeit bereits menschenleer gewesen war.
Er war eingetreten und im selben Augenblick hatte sich etwas in seinem Geist verschoben. Wie ein Mosaikstück, das nach mehreren, vergeblichen Versuchen plötzlich doch in das große Ganze hineinpasste. Mit einem Mal hatte er kristallklar erkannt, warum er die fiebrigen Träume nicht mehr loswurde: Er musste tatsächlich tun, wovon er bisher nur heimlich geträumt hatte.
Ja, das war es, was er mehr als alles andere wollte!
Überwältigt von dem Hochgefühl der Erkenntnis, das ihn machtvoll durchströmte, hatte er euphorisch ein paar Zweige zur Seite geschoben, um sich auf die Bank unter der Trauerweide zu setzen. Doch dort hatte bereits jemand gesessen, wie ein unerwartetes Geschenk, das von ihm enthüllt zu werden verlangte.
Eine junge Frau, ganz allein in der Dunkelheit, die ihm arglos den Rücken zugewandt hatte - wenn das kein Zeichen an ihn war, umgehend zur Tat zu schreiten!
Entschlossen hatte sich Jack lautlos von hinten an sie herangepirscht und dann blitzschnell mit unnachgiebigem Griff ihre Schultern gepackt, damit sie ihm unter keinen Umständen entwischen konnte.
Zuerst hatte er sie genau betrachten wollen, um sich an der Angst und dem Schrecken in ihren Augen zu weiden, weil sie nicht verstand, was mit ihr geschah.
Und dann hatte er die Angst und den Schrecken in ihren Augen bis zum letzten Tropfen auskosten wollen, wenn sie schließlich doch erkannte, was mit ihr geschah.
Oh, von welch erlesener Köstlichkeit dieser Augenblick sein würde!
Bei der verheißungsvollen Vorstellung hatte sein Herz vor Erregung schneller geschlagen und seine Haut hatte so unerträglich zu prickeln begonnen, als führte sie ein Eigenleben.
Jack hatte sich selbst innerlich streng zur Ordnung rufen müssen, denn nicht im Entferntesten hatte er riskieren wollen, dass sie seine Erregung ebenfalls wahrnahm. Solch eine menschliche Regung hätte sie womöglich irrtümlich als Schwäche interpretiert, was viel zu leicht die ganze Sensation für ihn hätte verderben können. Dieses Risiko hatte er unter keinen Umständen eingehen wollen!
Kaum hatte er sie jedoch herumgedreht und geradewegs in ihr unerwartet anmutiges Antlitz geblickt, das nun hell vom Schein einer Laterne erleuchtet worden war ... Ein Gesicht, das gar nicht zu einer Hure passen wollte, hatte Jack atemlos gedacht und hatte der übermächtigen Anmutung, auf eine Engelsgestalt zu starren, nichts entgegenzusetzen gehabt. Noch bevor er den Gedanken ganz zu Ende gedacht hatte, war ihm plötzlich so gewesen, als wäre nun er selbst derjenige, der nicht begreifen konnte, was in diesem Augenblick mit ihm geschah.
Mit der gnadenlosen Schärfe eines Rasiermessers hatte ein seltsam fremdartig klingender Schrei sein Gehirn durchschnitten: »Leo!«
Im selben Moment hatte er seine eigene Stimme von weit außerhalb vernommen, die den Schrei in seinem Kopf als zärtlich flüsterndes Echo auf ihn zurückgeworfen hatte.
Sein Flüstern hatte augenblicklich bewirkt, dass die Engelsgestalt in Ohnmacht gefallen war. Wie in Trance hatte er sie auf seine Arme gehoben und das alles beherrschende Bedürfnis gehabt, sie an einen sicheren Ort zu bringen. Dorthin, wo ihr nichts Böses widerfahren konnte, weder durch ihn, noch durch irgendjemanden sonst! Jack hatte sie von nun an in Sicherheit wissen wollen, weit weg von Ungeheuern, wie ihm.
Diese höchst eigenartigen Anwandlungen waren derart fremd für ihn gewesen, dass er sich ihnen, wie unter einem überirdischen Zwang, mechanisch und nahezu willenlos gefügt hatte. Denn gerade weil er diese nicht verstanden hatte, war er auch nicht fähig gewesen, sich ihrer zu erwehren.
Nein, er hatte sie - Leo? - umgehend an einen sicheren Ort bringen müssen, bevor ihr etwas zustoßen konnte!
Der wohl sicherste Ort, der ihm eingefallen war, lag nicht allzu weit entfernt. Hinzu kam, dass es ein Leichtes war, von dort aus ungesehen im Schutz der Dunkelheit zu entkommen, bevor man ihn bei seinem Tun entdeckte.
Als er die Kathedrale von St. Mary's endlich ungesehen erreicht hatte, legte er seine stille Fracht vorsichtig auf den nassen, kalten Steinstufen ab. Durch die großen Fenster konnte Jack einen schwachen Lichtschein erkennen. Er wusste zudem, dass der Pfarrer zu dieser Zeit seinen allabendlichen Rundgang durch das Gotteshaus absolvierte, bevor er es für die Nacht zuschloss. Gleich schon würde er durch den Seiteneingang heraustreten, auf dessen Stufen Jack das Engelswesen abgelegt hatte.
Oh, er wollte sich nicht von ihr trennen! Er wollte sie nur immerzu anschauen und vor allem Übel der Welt bewahren!
In einem ungewohnten, emotionalen Kraftakt gelang es ihm im allerletzten Moment, sich von ihr loszureißen. Bereits jetzt wusste er mit Sicherheit, dass er sie nicht zum letzten Mal gesehen hatte, denn von heute an würde er persönlich sie beschützen und über sie wachen. Wer konnte sie denn besser vor Ungeheuern beschützen, als ... nun, eben ein anderes Ungeheuer? Ja, bald schon, sehr bald würde er sie wiedersehen! Sie ausfindig zu machen, war schließlich ein nur Kinderspiel für ihn - in Mayfair genauso, wie im restlichen London. Niemand hatte sich jemals dauerhaft vor ihm verbergen können.
Erleichtert und gleichsam verstört machte Jack sich in der Dunkelheit davon. Die Lektionen dieses Abends würde er wahrlich niemals wieder vergessen! Er würde sich seine Beute nicht mehr in Mayfair suchen, sondern nur noch dort, wo es geradezu wimmelte von wertlosen und verdorbenen Huren. Ob der übergroßen Auswahl, könnte er sich in aller Ruhe eine davon auswählen und sie sich in einer der zahllosen dunklen Ecken, die bei Nacht niemand freiwillig betrat, ohne jede Hast ganz und gar zu eigen machen.
Ja, es war sogar nicht einmal von Relevanz, ob man die Überreste fand! Bei dem menschlichen Unrat, der die dreckigen Straßen von Whitechapel überflutete, würde man bestenfalls einen von ihnen verdächtigen. Ohnehin interessierte es niemanden, auf den es in London ankam, was mit diesem Abschaum - der widerlichen Plage! - letztendlich geschah.
Und keine Menschenseele würde jemals jemanden wie ihn hinter solchen Taten vermuten!
Das brachte ihn auf einen sehr verwegenen Gedanken, der womöglich schon sehr lange Zeit in ihm geschwärt hatte: Warum dann nicht seine Kunst der ganzen Welt offenbaren? Ganz Whitechapel in nie gekannter Angst - allein die Vorstellung war schon über alle Maßen berauschend!
So würde er mit seiner geheimen Leidenschaft, seiner immensen Klugheit und seiner perfekten Maskerade eine ganze Welt nach seinem Willen umgestalten und dabei sogar noch von zersetzenden Elementen befreien!
Es bedurfte lediglich einer kleinen Droschkenfahrt, um in ebenjene Welt auf Beutezug zu gehen, die er von nun an als sein Jagdrevier auserkoren hatte.
Kapitel 5
London
Freitag, 30. März 1888, 22:33 Uhr
Leonora schwebte im grenzenlosen Nichts, blind und allein.
»Wo bin ich denn nur?«, fragte sie sich immer wieder beklommen und bezweifelte im selben Moment, dass sie von irgendwoher eine Antwort darauf erhalten würde.
Es vergingen diverse, schier endlos anmutende Augenblicke. Einzig erfüllt von bleischwer drückender Stille, während diese bohrendste aller Fragen um sie herum im Dunkel zu lauern schien, Leonora umkreisend, wie ein hungriges Raubtier auf der Pirsch.
Schließlich war Leonora sich selbst einzugestehen gezwungen, dass sie wohl vorerst mit dieser erschreckend allumfassenden Orientierungslosigkeit vorliebnehmen musste. Stattdessen versuchte sie behutsam, den pechschwarzen Raum um sich herum mit all ihren Sinnen zu ertasten. Einige Herzschläge lang, war dort draußen scheinbar ... gar nichts ...
Doch, halt - wenn sie sich bis zum Äußersten konzentrierte, was ihr nur schwerlich gelang, konnte Leonora aus weiter Entfernung irgendetwas wahrnehmen. Einzelne Fragmente irgendeines Geschehens drangen bis zu ihr vor und sie fragte sich erneut verwundert, wo sie eigentlich war.
Menschen schienen zu ihr zu sprechen, aber waren sie wirklich da? Leonora konnte inmitten der undurchdringlichen Schwärze noch immer nichts und niemanden erfassen. Sie wollte unbedingt dorthin zurückkehren, woher sie gekommen war, doch konnte sie sich erstaunlicherweise gar nicht mehr daran erinnern, wo das eigentlich gewesen war.
Aus sehr weiter Ferne vernahm Leonora eine Männerstimme, die sich vor Aufregung mehrmals zu überschlagen schien: »Um Himmelswillen, Leonora Barnes, die einzige Tochter meiner Gemeindemitglieder, Mr. und Mrs. Barnes! Ist sie verletzt? Atmet sie? Was fehlt ihr? Wie kommt sie denn nur auf die Stufen meiner Kirche - noch dazu in diesem entsetzlichen Zustand?!«
Unvermittelt kam ein Scherbenstück ihrer Erinnerung zu ihr zurück. Leonora glaubte, die Stimme des guten alten Pfarrer Smythe von St. Mary's zu erkennen, der etwa einmal im Monat ihre Eltern zum Tee besuchte. Sie schätzte den freundlichen alten Herrn, wenngleich sie sich für Gott und dessen Religion schon längst nicht mehr zu erwärmen vermochte.
Seitdem sie anzuerkennen gezwungen war, dass der Glaube dem Verlust von Nicholas weder einen Sinn zu geben vermochte, noch ihren Schmerz darüber mildern konnte, hatte sie sich von Derartigem abgewandt. Leonora war im Zuge dessen, was geschehen war, vielmehr zu der Gewissheit gelangt, dass der Glaube nur etwas Menschengemachtes sein konnte. Somit stand für sie ebenfalls fest, dass dieser keineswegs über eine überirdische Kraft verfügte, die das Unerklärliche für sie entwirren konnte. Pastor Smythe hatte in der Tat sein Bestes versucht, um sein junges Schäfchen nicht zurückzulassen, doch Leonora war der Herde scheinbar mühelos entflohen. Ihr Inneres war längst unerreichbar für alle Menschen um sie herum geworden. Ja, aller Freundlichkeit und Höflichkeit zum Trotz, die sie dem alten Herrn auch weiterhin entgegenbrachte, wussten sie doch beide ohne jeden Zweifel, dass der Glaube Leonora unwiderruflich verlassen hatte. Oder vielmehr war es wohl umgekehrt, dachte zumindest Leonora hin und wieder: Sie war es, die den Glauben verlassen hatte!