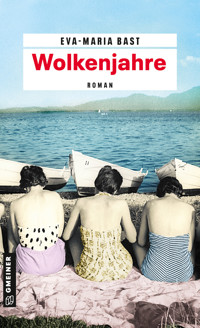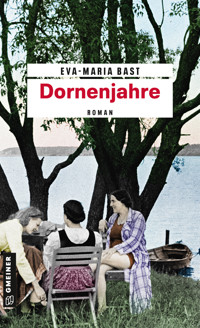Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ole Strobehn und Alexandra Tuleit
- Sprache: Deutsch
Leonhard Bux, der junge Geliebte der Firmenchefin Helena Eichenhaun, wird am Bodenseeufer tot aufgefunden. Zeitgleich verschwindet in Aalen die Pfeife des Spions - eines Wahrzeichens der Stadt. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Fällen? Alexandra Tuleit und Kommissar Ole Strobehn enthüllen eine unglaubliche Geschichte, die tief in die Vergangenheit führt. War Leonhard nicht der, für den er sich ausgab? Wer ist der Maulwurf, der Helenas Firma fast in den Ruin trieb? Und dann gibt es noch eine Leiche …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eva-Maria Bast
Tulpentanz
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Mirjam Hecht
E-Book: Julia Franze
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © suze / photocase.com
ISBN 978-3-8392-4138-7
Für meine Oma Anneliese Bast, an deren Tür auch immer ein Kehrwoche-Schild hing. Die Stunden bei der Urschwäbin mit »Greeschde Nudla ond Kardofflsalad« sind mir unvergessen. Mögest Du in Frieden ruhen, liebste Oma.
Und für meine Eltern Lena und Alfred Bast, die mich im tiefsten Schwabenland so aufgezogen haben, dass ich des Schriftdeutschen mächtig wurde. Mächtiger als des Schwäbischen, wie ich gestehen muss. Was mir, als ich ins Badische zog, eine echte Chance gab. Hätte mich mein Dialekt gleich als Schwäbin gekennzeichnet – ich weiß nicht, ob man mich dann so herzlich aufgenommen hätte, wie das der Fall war.
Erstes Kapitel
Konstanz
Er ließ das Fernglas sinken und zog die Mundwinkel in einer Mischung aus Gier, Verachtung und Faszination herab. Sie fesselte ihn ebenso, wie sie ihn abstieß: Am Fenster stand Helena Eichenhaun, 48 Jahre alt und eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen am See, ach was, in ganz Baden-Württemberg. Sein Atem malte Wolken in die Luft, die an diesem Frühlingsmorgen noch so kalt und klar war wie im Winter. Es gefiel ihm, die Wölkchen zu betrachten, die aus seinem Mund in Richtung Himmel quollen. Sie waren so real. Etwas, das man greifen konnte und das ihm zumindest einen Hauch dessen verlieh, was er nicht besaß: Identität. Fasziniert stieß er weitere Atemwolken hinterher. Puff, puff, puff.
Drüben an der Villa, einem prachtvollen Haus im Konstanzer Musikerviertel, regte sich etwas. Helena hatte die Haustüre geöffnet. Er hatte erwartet, dass sie in dem gleichen strengen Designerkostüm zur Tür heraustreten würde wie gestern. Ach was, nicht im gleichen. Frauen wie sie trugen niemals das gleiche, schon gar nicht an zwei aufeinander folgenden Tagen. Aber in einem ähnlichen. Er beobachtete sie schon eine ganze Weile. Wenn sie ins Büro ging, trug sie immer denselben Stil: Außer den strengen Kostümen befanden sich in ihrem Kleiderschrank, das wusste er aus eigener Anschauung, noch ebenso streng geschnittene Hosenanzüge. Dazu trug sie stets Pumps und manchmal, an kühleren Tagen, auch Stiefel, was ihm ausnehmend gut gefiel. Es machte sie jünger, fand er. Wobei Helena Eichenhaun ohnehin nicht aussah wie Ende 40. Vor allem dann nicht, wenn sie ihre schulterlangen, silberblonden Haare offen ließ, statt sie im Nacken zu einem strengen Knoten zu stecken. Oder wenn sie sie auf dem Hinterkopf zu einem praktischen Pferdeschwanz zusammenband, so wie jetzt.
Sie begann schon an der Haustüre zu laufen. Flüchtig blickte sie in seine Richtung und er duckte sich rasch hinter einen großen Busch. Was ein Glück, dass Helenas Haus nicht näher am Zentrum stand, sondern so abgelegen lag, dass die Bebauung lückenhafter wurde und die umliegende Natur ausreichend Möglichkeiten bot, sich zu verstecken. Kurz hinter ihrem Grundstück wurde der Uferweg zu einem weichen Waldweg – und es waren hier auch längst nicht mehr so viele Menschen unterwegs wie im vorderen Uferteil. Schon gar nicht an diesem frischen Morgen. Nur einige Frühsportler trabten durch die Kühle und erweiterten das vom See her kommende Geräuschspektrum – Möwengeschrei und das leise Plätschern der Wellen, wenn ein Boot vorüberkam – um vereinzeltes Ächzen und das rhythmische Klopfen ihrer Füße auf dem weichen Waldboden.
Bumm, bumm, bumm.
Auch Helena joggte an ihm vorbei, in Richtung Fähre. Sie hatte ihn nicht gesehen. Gott sei Dank. Es wäre schlimm, wenn sie ihn entdecken würde. Sie würde Fragen stellen, unangenehme Fragen. Erklärungen von ihm verlangen, die er ihr nicht geben konnte. Und dann würde sein Plan scheitern, verflucht noch mal. Bock darauf hatte er nicht. Er wollte keine krummen Dinger mehr drehen. Und ihn wollte er eigentlich auch in Ruhe lassen. Er war ruhiger geworden in den letzten Jahren, und deshalb tat es ihm leid, dass er ihn nun wieder piesacken musste. Aber was blieb ihm anderes übrig, das Leben hatte es nicht gut mit ihm gemeint. Und wenn er vom lieben Gott schon nicht mit Attributen und erst recht nicht mit Geld gesegnet worden war – anscheinend hatte ihn der Heiland schlichtweg vergessen –, dann musste er eben selbst dafür sorgen, dass er etwas vom Kuchen abbekam. Bisher war ihm das auch ganz gut gelungen.
Seine grauen Augen folgten Helenas schmaler Gestalt, die in Jogginghosen und einer pinkfarbenen, engen Joggingjacke steckte. Es irritierte ihn immer noch, dass sie joggte. Er hatte sie bisher nie joggen sehen. Und das, obwohl er alles über sie, die zwölf Jahre ältere Lady, wusste. Was sie am liebsten aß, wie sie tickte, welche Unterwäsche sie trug. Er strich sich durch die wilden, braunen Haare. Ob sie wegen ihm joggte? Wollte sie schöner sein für ihn? Schlanker, durchtrainierter?
Ein Lächeln spielte um seine Mundwinkel, doch gleich darauf erlosch es wieder. Die Sache war heiß, die Frau war heiß. Er durfte jetzt auf keinen Fall einen Fehler machen.
Zweites Kapitel
Friedrichshafen
»Scher dich zum Teufel!« Die eisige Stimme Helena Eichenhauns klang wie ein Peitschenhieb. Sie knallte gegen das künstlerische Herz ihres Sohnes und hinterließ dort blutige Wunden.
»Verschwinde. Und wage es nicht wieder aufzutauchen, bis du mir etwas Vernünftiges vorlegen kannst. Und nicht solche … solche … solche …« Helena betrachtete angewidert eines der Papiere, auf die Christian seine neuesten Entwürfe gezeichnet hatte. »Solche langweiligen, unkreativen, ideenlosen Schmierereien«, fuhr sie fort.
Mit spitzen Fingern, als wolle sie sich die Hände nicht mit derart niveaulosem Zeug beschmutzen, packte sie das Papier an der äußersten Ecke und ließ es in den schwarzen, glänzenden Designmülleimer segeln, der aussah wie eine edle Bodenvase.
Sodann hob sie ihr perfekt geschminktes Gesicht, zog die sorgsam ausgerissenen und mittels Stift wieder aufgemalten Augenbrauen ein paar Millimeter nach oben und richtete ihren kühlen Blick auf die zusammengepressten Lippen ihres Sohnes Christian. »Du brauchst gar nicht so beleidigt zu tun«, sagte sie streng. »Du weißt, dass wir es nur so weit gebracht haben, weil ich uns keinen, aber auch absolut keinen Fehler erlaube.«
Helena Eichenhaun stand an der Spitze der in Friedrichshafen ansässigen Modefirma Saphir!, die in einer Liga mit Gucci, Chanel und Louis Vuitton spielte. Sie hatte das Imperium aus den Händen ihres Schwiegervaters übernommen – ihr Mann, da war sie sich mit ihrem Schwiegervater einig gewesen, taugte nichts. Zwischenzeitlich war ihr Gatte Albert verstorben und sie musste ihn nicht mehr mitschleppen. In den vergangenen zehn Jahren hatte sie hart gearbeitet, jede Sekunde ihrer Zeit in ihre Firma gesteckt und die Erziehung der pubertierenden Kinder wechselnden Hausmädchen überlassen. Jetzt waren sie erwachsen und teilweise in der Firma tätig. Was sie einander keineswegs näher gebracht hatte. Helenas Verhältnis zu ihren Kindern war von jeher kühl und distanziert. Wie sie eigentlich allen Menschen kühl und distanziert gegenüberstand. Mit Ausnahme von Leonhard. Ein Lächeln spielte um ihre Mundwinkel, als sie an ihn dachte. Leonhard. Der neue Mann in der Designabteilung. Sie hatten sich auf einer Vernissage kennengelernt, seiner Vernissage.
Doch als sie dann dort war, war jede schlechte Laune vergessen. Schon als sie den Ausstellungsraum betrat, wurde sie von der intensiven Stimmung, die von den Bildern ausging, gefangen genommen. Die Werke schienen zu einem einzigen großen Gesamtkunstwerk zu verschmelzen. Einem Kunstwerk, das genau das atmete, was Helena in ihrer Firma haben wollte und nie hatte zum Ausdruck bringen können. Weder in Entwürfen, noch in Kleidern oder Accessoires und auch nicht in Worten. Sie hatte nie beschreiben können, wonach sie suchte. Sie hatte ein Bild im Kopf, eine Stimmung im Blut, aber sie konnte anderen nicht erklären, wie dieses Bild aussah und wie sich die Stimmung anfühlte, die sie in ihrer Mode widergespiegelt haben wollte. Deshalb verschlug es ihm buchstäblich den Atem, als sie es nun so deutlich vor sich sah: Lebendigkeit, Charme, Detailverliebtheit, ein Hauch von Prunk und Eleganz.
Leonhard Bux, der Künstler, war wie seine Werke. Extravagant, schmeichelhaft, anders. Sie, die eiserne Lady, schmolz unter seinem grauen, leicht verschleierten Blick und seinen warmen Worten, mit denen er sie begrüßte, regelrecht dahin. Noch am selben Abend landeten sie im Bett. Dass er zwölf Jahre jünger war als sie, störte sie nicht. Und das, obwohl sie eigentlich gesteigerten Wert auf Konventionen legte. Was die Leute dachten, war ihr wichtig, also verhielt sie sich so, dass die Leute nur das Beste dachten – oder eher: Ihr keine Verfehlungen und Ausrutscher nachsagen konnten. Denn dass viele Menschen sie wegen ihres sehr kühlen Wesens nicht mochten, war ihr klar. Und irgendwie wollte sie das auch so. Sie wollte perfekt sein. Und sie wollte die Leute auf Abstand halten. Keiner sollte ihr zu nahe kommen.
Doch dieses Mal waren ihr die Leute und der Tratsch egal. Dieses Mal ging es nur um sie selbst. Und um ihn. Vor allem um ihn.
Seither hatte Leonhard einen festen Platz in ihrem Leben. Sie hatte ihn gewollt – ihn, den Mann und ihn, den Künstler. Und sie hatte ihn bekommen. Zumindest den Künstler, Leonhard war inzwischen Mitglied der Designabteilung von Saphir! und er machte seine Sache sehr, sehr gut. Des Mannes konnte sie allerdings nicht wirklich habhaft werden. Er schaffte es wieder und wieder, sich ihr zu entziehen. Nie konnte sie ihn ganz greifen, nie das Gefühl haben, sich seiner sicher zu sein, ihn zu besitzen oder gar einen Anspruch auf ihn zu haben. Das irritierte und faszinierte sie gleichermaßen und es machte ihn umso reizvoller.
Leonhard arbeitete in der Designabteilung unter Christian. Die beiden Männer mochten sich nicht. Oder besser gesagt: Christian mochte Leonhard nicht. Er sah in ihm eine permanente Bedrohung und fand es so lächerlich wie peinlich, dass sich seine Mutter mit einem zwölf Jahre Jüngeren eingelassen und ihn obendrein noch eingestellt hatte. »Du verhältst dich wie König Karl, der hat seinen Geliebten auch immer einen Job besorgt«, ätzte er nun und deutete auf die Türme der Schlosskirche, die man vom Friedrichshafener Firmengebäude aus sehen konnte. Das einstige württembergische Königspaar Karl I. und Olga hatte das Häfler Schloss gern als Sommerresidenz genutzt und besonders Olga war bei den Einwohnern Friedrichshafens sehr beliebt gewesen – vor allem wegen ihrer sozialen Ader und weil sie schon zwei Jahre vor ihrer Thronbesteigung den Riedlewald gerettet hatte, indem sie ihn einfach kaufte und damit eine Abholzung verhinderte.
Es war klar, dass Christian auf den 30-jährigen Amerikaner Charles Woodcock anspielte, zu dem der wesentlich ältere Karl nicht nur – wie zu seinen vorigen Liebhabern – eine enge Bindung gehabt hatte, sondern den er auch zum Baron Woodcock-Savage ernannte und mit einem stattlichen Vermögen beglückte. Woodcocks Einfluss auf den König war sehr groß, was man Karl allgemein übel nahm, es kam zu einem Skandal, teils war sogar von einer Absetzung des Königs die Rede. Karl gab die Beziehung zu Woodcock schließlich auf.
»Ich nehme an, dass du die Beziehung zwischen dem König und Baron Woodcock-Savage meinst«, sagte die belesene Helena da auch schon. »Aber ich kann dich beruhigen: Erstens bin ich naturgemäß nicht schwul, zweitens habe ich nicht vor, ihn zum Baron zu machen und drittens ist der Altersunterschied zwischen Leonhard und mir geringer als der zwischen dem König und dem Baron.«
Aber ihr Sohn hatte schon recht mit seinen Sorgen, dachte Helena im Stillen. Leonhard war eine Bedrohung für Christian. Nicht weil Leonhard ihr Geliebter war. Sondern weil er der Beste war. Christian sah sich selbst zwar gern als Künstler, war aber schlichtweg keiner. Ihm fehlte der Tiefgang, er war oberflächlich und das Einzige, was ihn interessierte, war das Geld, das seine Entwürfe abwerfen konnten, weil er auf einen berühmten Namen und eine große Maschinerie zurückgreifen konnte. Und das merkte man seinen kalten, seelenlosen Entwürfen an. Jetzt presste er wütend hervor: »Würde unter diesem Entwurf Leonhard Bux stehen, würdest du ihn absegnen.«
Helena musterte ihn abschätzig. Verweilte mit ihrem kühlen Blick auf seinem sonnengebleichten, schulterlangen Haar, sah in seine wässrigen, blauen Augen, taxierte das viel zu gebräunte Gesicht – eine Bräune, die sich wie eine Plastikmaske über die Haut ihres Sohnes legte. Er wirkte unecht, stellte sie mit einem leisen Anflug von Bedauern fest. Unecht und inhaltslos.
»Irrtum, mein Lieber«, sagte sie. »Wenn Leonhard Bux mir einen solchen Entwurf vorlegen würde, würde ich ihn hinauswerfen. Und das sollte ich mit dir eigentlich auch tun.«
Christian beugte sich über die Tischplatte und sah seine Mutter drohend an. Spucketröpfchen der Empörung, leise und fein, segelten schwerelos durch die Luft und landeten kaum merklich auf Helenas Gesicht. »Das kannst du nicht, Mutter. Schon vergessen, dass du mich brauchst? Dass ich Anteile an der Firma habe? Und eines Tages werde ich auch deine erben.«
Obwohl Helena selbst kühl und berechnend war und obwohl sie die immer ein wenig anmaßende Art ihres Sohnes kannte, musste sie angesichts der Dreistigkeit seiner Worte nach Luft schnappen. Kurz tat es weh, ein scharfer Stich ganz nah am Herzen. Dann aber siegte die Wut. »So?«, fragte sie scharf und beugte sich ebenfalls über den Tisch, dem ungeliebten Sohn entgegen. »Sei dir da mal nicht so sicher. Ich habe vor, Leonhard zu heiraten. Er kann die Firma hundert Mal besser in die Zukunft führen als du. Und dann passt auch dein komischer Vergleich mit König Karl: Dann werde ich meinem Geliebten nämlich auch ein stattliches Vermögen zukommen lassen.«
»Das wagst du nicht«, zischte Christian. »Und wenn du es doch tust, dann wird dir das sehr, sehr leid tun. Und ihm auch.« Mit hastigen Fingern sammelte er die Papiere ein, die er auf dem Schreibtisch seiner Mutter ausgebreitet hatte, zumindest diejenigen, die sie noch nicht in ihrem Mülleimer hatte verschwinden lassen. Er stopfte sie achtlos in seine große, schwarze Mappe und verließ mit wütenden Schritten das Zimmer, ohne Helena noch einen Blick zu gönnen.
Helena blieb reglos sitzend zurück und starrte noch auf die weiße, gepolsterte Tür, nachdem sie sich längst hinter ihrem Sohn geschlossen hatte. Bis auf wenige Farbakzente, wie zum Beispiel den schwarzen Mülleimer oder die feuerrote Couch, war ihr Zimmer ganz in Weiß gehalten. Weiße Regale, die mit unzähligen Büchern über Mode und Design gefüllt waren, ein weißer nierenförmiger Schreibtisch, weiße Stühle. Es war, das erkannte sie jetzt voller Entsetzen, ein schrecklicher Fehler gewesen, ausgerechnet Christian von ihren Heiratsplänen zu erzählen – noch dazu, bevor Leonhard selbst davon erfuhr. Aber er hatte sie so wütend gemacht mit seiner selbstherrlichen Arroganz, so unglaublich wütend. Was hatte sie geschuftet, um die Firma dorthin zu bringen, wo sie jetzt war. Es widerstrebte ihr, sie in die Hände dieses geldgierigen Mannes zu geben. Ob er nun ihr Sohn war oder nicht. Mit seinem Talent hätte er den Laden innerhalb eines Jahres in den Ruin getrieben, da war sie sich sicher. Leonhard hingegen … Wieder malte sich dieses verträumte Lächeln in ihr Gesicht.
Die Firma war nicht der einzige Grund, warum sie ihn heiraten wollte. Sie wollte ihn besitzen. Es irritierte sie, dass er nicht nach ihrer Pfeife tanzte. So korrekt, pünktlich und zuverlässig er beruflich war – privat konnte sie ihn einfach nicht greifen. Leonhard versetzte sie, reagierte nicht auf Anrufe und SMS, um im nächsten Moment wieder unglaublich liebevoll und romantisch zu sein. Damit verhinderte er – vielleicht, nein, wahrscheinlich ohne es zu wissen, dass sie ihren Unmut ihm gegenüber zum Ausdruck brachte. Weil sie die Momente, in denen er charmant und zärtlich war, aufsaugte wie ein Schwamm und sie nicht mit ihren Vorwürfen über nicht beantwortete Mails und SMS zerstören wollte. Leonhard war ein Freiheitsvogel. Und genau das machte ihn so reizvoll.
Drittes Kapitel
Überlingen
Alexandra erwachte von einem markerschütternden Schrei. Sie fuhr auf und versuchte, sich in der Dunkelheit zu orientieren. Es war Ole, der da so herzzerreißend schrie. Schon wieder. Zum dritten Mal in dieser Woche. Sie tastete im Dunkeln nach dem Lichtschalter, knipste hastig die Lampe an, beugte sich über ihn, packte seine Schulter und rüttelte ihn sanft. »Ole, Schatz. Aufwachen. Du träumst wieder schlecht.« Ole schlug wild um sich und traf sie hart an der Wange. Erschrocken presste sie ihre Hand auf die schmerzende Stelle. Ole erwachte von dem Schlag und starrte sie aus riesengroßen, schreckgeweiteten Augen an. Es dauerte, so kam es Alexandra vor, ewig, bis das Entsetzen dem Erkennen wich und erst Erleichterung, dann Zärtlichkeit und schließlich Liebe durch seine Augen zog. All das geschah innerhalb von Sekunden. Und dann glitt jener Ausdruck über sein Gesicht, den sie so fürchtete: Oles Miene verschloss sich. Schloss sie aus, aus seiner Welt, wies sie ab, schickte sie fort.
Sie war schleichend gekommen, die Veränderung in ihrer sonst so glücklichen Beziehung. Alexandra hatte sie zunächst gar nicht bemerkt. Zu sehr, das warf sie sich jetzt vor, war sie mit sich selbst beschäftigt gewesen. Da waren die wöchentlichen Therapiesitzungen mit ihrer Psychologin, in denen sie den Mord an Elisabeth Meierle aufarbeitete, einer alten Dame, die sie im vergangenen Frühsommer mit durchgeschnittener Kehle auf einer Parkbank gefunden hatte. Dann war da ihre Arbeit an ihrem Buch ›Geheimnisse der Heimat‹. Vor zwei Wochen war das Werk herausgekommen und sie hatte in den Monaten davor wirklich schuften müssen. Ole hatte die ganze Zeit über an ihrer Seite gestanden. Ruhig, unerschütterlich und, so hoffte sie, auch ein wenig stolz auf seine erfolgreiche Freundin. Er war ihr Fels in der Brandung. Aber irgendwo in all dem Trubel hatte sie den Zugang zu ihm verloren. Wie sich ein Fels nie regt und rührt, nie etwas von den Geheimnissen preisgibt, die vielleicht in seinem großen, mächtigen Leib schlummern, hatte auch Ole immer mehr über sein Innenleben geschwiegen, war buchstäblich versteinert. An ihrer Seite. Und sie hatte es nicht bemerkt.
Etwa zu dieser Zeit hatten seine Alpträume begonnen. Wieder und wieder wachte er nachts schreiend auf und wollte ihr dann, auf ihre drängenden Fragen hin, nicht erzählen, was er geträumt hatte. Was ihn so umtrieb. Warum es ihm so schlecht ging. Warum sie dabei war, ihn zu verlieren.
Sie vermutete, dass es die Erinnerung an jene Tage war, in denen er gefangen im Keller eines Konstanzer Einfamilienhauses gelegen hatte. Ole hatte seinerzeit im Fall der toten Elisabeth Meierle ermittelt, so hatten sie sich kennengelernt. Die Mörderin der alten Dame hatte ihn in eine Falle gelockt und ihn tagelang mit der Tochter der Toten in einem Keller festgehalten. Alexandra ahnte, dass es Ole ziemlich in seinem Stolz gekränkt hatte, ihr in die Falle gegangen zu sein. Zumal er sich damals zu allem Überfluss auch noch unprofessionell verhalten und seine Kollegin nicht über seine Ermittlungen in Kenntnis gesetzt hatte. Es war ein unerlaubter und unverantwortlicher Alleingang gewesen und nur weil er ihr, Alexandra, gegenüber erwähnt hatte, wo er hingehen würde und sie dies später seinen Kollegen mitteilte, konnten er und die Tochter der Toten schließlich gerettet werden.
»Ist es wegen des Kellers?«, wiederholte sie nun die Frage, die sie jedes Mal stellte wenn er schlecht geträumt hatte, und legte vorsichtig eine Hand auf seinen Arm. Er war schlafwarm und ein wenig feucht. Ein Schweißfilm hatte sich über seine Haut gelegt, Tau der Angst und des Entsetzens.
»Nein, das habe ich dir doch schon so oft gesagt«, fuhr Ole sie barsch an. Er machte eine abrupte Bewegung und schüttelte dabei ihre Hand ab. »Es ist alles gut, es war nur ein Alptraum, okay? Mach bitte nicht so ein Theater deswegen. Und jetzt lass uns weiterschlafen, ich muss morgen früh raus.« Seine Stimme, die sonst so schmeichelnd, so weich und warm war, klang hart und aggressiv. Und sie wurde noch härter, als er anfügte: »Ich habe kein so lockeres und leichtes Leben wie ihr Redakteure, die ihr erst um halb zehn Uhr bei der Arbeit erscheinen müsst.« Alexandra spürte, wie ihr die Tränen in die Augen schossen. Es tat weh, dass er so mit ihr sprach, schmerzte, dass er sich derart vor ihr verschloss. Sie wandte den Kopf ab, um ihre Tränen zu verbergen. Er sollte nicht merken, wie sehr er sie verletzte. Vermutlich würde er sie dann für eine Heulsuse halten. Doch Ole hatte ihr ohnehin schon den Rücken zugedreht und sich die Decke über den Kopf gezogen. »Machst du das Licht noch aus?«, bat er und war Minuten später eingeschlafen.
Alexandra aber konnte nicht schlafen, zu vieles ging ihr wieder und wieder im Kopf herum. Ole und sie waren so glücklich gewesen. Sie hatte das Gefühl gehabt, dass sie einander mit Haut und Haaren gehörten, ohne sich dabei gegenseitig einzuengen. Bedingungslose Liebe, bedingungsloses Vertrauen. Und jetzt lag plötzlich ein ganz anderer Mann neben ihr im Bett. Auf ihre Verletztheit folgte Wut. Wut, dass er sich derart gnadenlos vor ihr zurückzog, Wut, dass er ihr nicht einmal die Chance gab, ihn zu verstehen. Am liebsten hätte sie ihn an der Schulter gepackt, ihn geschüttelt und ihn gezwungen, mit ihr zu reden. Doch sie wusste, dass es nichts bringen würde. So charmant Ole oft war – er konnte auch ungemein stur sein. Und er mochte es überhaupt nicht, wenn man ihn unter Druck setzte. Stattdessen musste sie versuchen, sein Vertrauen zu gewinnen. Es kränkte sie tief, dass sie es noch nicht hatte. Sie hatte eigentlich gedacht, dass sie sich alles sagten, alles voneinander wussten. Zumal sie sich in einer Zeit kennengelernt hatten, als sich ihrer beider Leben im Umbruch befanden. Ole war frisch nach Überlingen gezogen und sie hatte gerade die Leiche am Bodenseeufer gefunden. Bei ihrer ersten Begegnung war sie in Ohnmacht gefallen, bei ihrer zweiten weinend in seinen Armen zusammengebrochen. Sie war immer davon ausgegangen, dass diese schwere Zeit sie besonders aneinander geschweißt hatte. Dass die Liebe wuchs, wenn man gemeinsam, Seite an Seite, harte Zeiten durchstand. Dass es gut war, alles voneinander zu wissen und den anderen in seinen tiefsten und finstersten Stunden erlebt zu haben.
Nun gestand sie sich ein, dass eigentlich immer nur sie ihr Wesen offenbart hatte. Ole war immer da gewesen, war immer stark gewesen. Der Gestalt gewordene Beschützer. Und sie, sie hatte sich dankbar fallen lassen, sich angelehnt. Denn wenn sie eigentlich auch eine starke und selbstständige Frau war, so sehnte sie sich doch nach der starken Schulter eines Mannes. Und die hatte Ole. Definitiv.
Als der Morgen über Überlingen heraufdämmerte, hatte sie viele schlaflose Stunden hinter sich. Sie stand leise auf und ging mit nackten Füßen über den Holzdielenboden hinüber in Oles Küche. Auch wenn sie nicht zusammenwohnten, gab es kaum eine Nacht oder eine freie Stunde, die sie nicht gemeinsam verbrachten. Er lebte halb bei ihr und sie hatte die Hälfte ihres Hausrats zwischenzeitlich bei ihm deponiert. Alexandra wünschte sich, dass das so blieb. Oder dass sie sogar ganz zusammenziehen würden. Sie wollte ihn und sie liebte ihn. Über alles. Das war ihr in den langen Stunden dieser Nacht mit schmerzlicher Gewissheit klar geworden – natürlich hatte sie es auch vorher schon gewusst, aber als sie vorhin, wieder einmal von ihm zurückgewiesen, dagelegen und gegrübelt hatte, hatten sich ihre Gefühle für ihn mit einer Macht offenbart, die beinahe wehtat. Und mit der schwindenden Nacht war auch ihre Wut über sein Verhalten verraucht. Alexandra holte sich einen Beutel Yogitee mit Schokogeschmack aus dem Hängeschrank über der Spüle und setzte Wasser auf. Während der Schnellkocher die Flüssigkeit auf die richtige Temperatur brachte, trat sie ans Fenster und blickte auf die Stadt hinunter, die langsam aus ihrem Nachtschlaf erwachte. Dort unten fuhr ein Mann mit Hut auf dem Fahrrad durch das Franziskanertor und die Franziskanerstraße hinunter. Der Nachbar von schräg gegenüber, der in dem Eckhaus zur Christophstraße lebte, verließ mit seiner Aktentasche unter dem Arm hastig sein Haus und eilte in Richtung Bahnhof. Im Gehen zog er sich noch seine Jacke über, wobei ihn die Aktentasche augenscheinlich störte. Er blieb stehen, stellte sie auf dem Boden ab, schlüpfte in seine Jacke, griff wieder nach der Aktentasche und hetzte weiter. Sie wusste, dass er nach Friedrichshafen fuhr, wo er bei einer Bank als Individualkundenberater arbeitete.
Vom See her kam der orangefarbene Kleinlaster des städtischen Bauhofs – bis obenhin mit Müll beladen – gefahren. Einer der Müllmänner stand hinten auf der Ladefläche und blickte grimmig in den heraufziehenden Tag. Ich könnte mir auch etwas Schöneres vorstellen, als den Müll anderer Leute wegzuräumen. Und das dann auch noch um diese Uhrzeit, dachte Alexandra.
Hinter ihr klickte der Wasserkocher, der sich automatisch abgeschaltet hatte, nachdem das Wasser den Siedepunkt erreicht hatte. Alexandra riss ihren Blick von dem frühmorgendlichen Geschehen unten auf der Straße los und ging zur Küchenzeile hinüber. Und als sie die kochende Flüssigkeit über ihren Teebeutel goss, beschloss sie, sich nicht weiter darüber zu grämen, dass sie Oles Vertrauen anscheinend verloren hatte. Stattdessen wollte sie versuchen, es wieder zu erlangen. Es zu verdienen. Ja, sie wollte um ihre Liebe kämpfen.
Viertes Kapitel
Friedrichshafen
Helena fuhr erschrocken zusammen, als die Tür zu ihrem Büro ruckartig aufgerissen wurde. Sie hatte gerade über ihren Bilanzen gesessen und besorgt festgestellt, dass die Umsätze immer weiter in den Keller gingen. Sie musste sich etwas einfallen lassen und zwar schnell. Ihrer Assistentin hatte sie gesagt, dass sie auf keinen Fall zu sprechen wäre. Umso ungehaltener war sie nun über die Störung. Doch das änderte sich rasch. Herein stürmte Leonhard mit zerzausten braunen Haaren und blitzenden grauen Augen. Er trug, wie immer bei der Arbeit, Jeans und ein eng anliegendes Sweatshirt, das seinen flachen Bauch und seine muskulösen Oberarme betonte. An seinem Shirt hatten sich zwei Stofffetzen verfangen, die nun wie bunte Fähnchen hinter ihm herwehten. Helena konnte nicht verhindern, dass sich – trotz der offensichtlichen und beunruhigenden Verärgerung, die tiefe und dunkle Schatten in Leonhards Gesicht warf – ein strahlendes Lächeln auf ihrem Gesicht ausbreitete, als sie seiner ansichtig wurde. Und ihrer verzweifelten Sekretärin, die Leonhard ins Zimmer gefolgt war und stammelnd um Entschuldigung für dessen unangemeldetes Auftauchen bat, warf sie einen ihrer äußerst seltenen freundlichen Blicke zu. »Schon gut, Lisa«, sagte sie milde. »Lassen Sie uns allein.«
»Was kann ich für dich tun?«, fragte sie, als sich die Tür hinter Lisa geschlossen hatte. Sie stand auf, ging um ihren Schreibtisch herum und streckte die Arme nach Leonhard aus, voller Sehnsucht nach seiner starken und auch ein wenig dominanten Umarmung. Doch noch bevor sie ihn erreicht hatte, machte Leonhard eine grobe, abwehrende Handbewegung und drehte sich von ihr weg. Helena ließ die ausgebreiteten Hände wieder sinken und blieb mit hängenden Armen stehen. Eine für sie mehr als untypische Geste.
»Wann gedachtest du mir mitzuteilen, dass du mich heiraten möchtest? Sollte ich es über einen Aushang am Schwarzen Brett erfahren?«, fauchte er. »Oder wolltest du erst die Gesellschafter in der nächsten Konferenz darüber informieren?«
»Leonhard, ich …«, begann sie.
»Was?« Er fuhr herum und starrte sie finster an.
»Es tut mir leid. Mir ist das einfach so rausgerutscht. Es weiß bisher keiner außer Christian. Er hat mich so provoziert, und da …«
»Da kam ich gerade recht, um ihm eins auszuwischen, ja?«, fragte Leonhard bitter.
»Nein, so ist es nicht. Das darfst du nicht glauben«, versicherte Helena und wunderte sich selbst darüber, wie flehend, wie bettelnd ihre Stimme klang. Sie hasste sich dafür.
»Wie ist es dann?«, fragte Leonhard mit einer Strenge, die so gar nicht zu ihm passen wollte.
»Ich liebe dich«, sagte sie und ihre Stimme war leise wie ein Hauch.
Stille folgte ihren Worten. Sie dehnte sich aus, wurde breiter, größer, nahm immer mehr Raum ein, verdrängte alles andere. Helena hatte ihren Blick zum Boden gerichtet und wagte kaum zu atmen, wagte nicht, ihn anzusehen. Noch nie in ihrem Leben hatte sie diese Worte zu jemandem gesagt, nicht einmal ein ›ich hab dich lieb‹ zu ihren Kindern war über ihre Lippen gekommen. Und nun sagte sie diesem Mann, der vor zwei Monaten wie ein Wirbelwind in ihr Leben gerauscht war, dass sie ihn liebte.
Sie spürte, dass er sich ihr näherte. Und dann fühlte sie seine Finger an ihrem Kinn. »Hey«, sagte er sanft, zwang sie, den Blick zu heben und ihn anzusehen. Sie hob die Augen. Sein eben noch so hartes und angespanntes Gesicht war mit einem Mal weich und zärtlich. »Hey«, sagte er noch einmal. Dann beugte er sich vor, um sie zu küssen. Sein Kuss war hart, fordernd und besitzergreifend. Seltsamerweise gefiel ihr das, denn es trieb sie in eine Welt, die ihr bisher völlig fremd gewesen war. Eine Welt, in der jemand anderes die Führung übernahm. In der sie sich nur anzupassen, anzuschmiegen brauchte. Eine Welt, in der sie weich sein konnte. Frau sein durfte.
Helena gab sich seiner Umarmung hin – und deshalb war es, als stieße er sie ins kalte Wasser, als er sie plötzlich und unvermittelt losließ. Finster starrte er sie an. »Glaub bloß nicht, dass ich dir verziehen habe, nur weil ich dich küsse. Ich bin immer noch stinksauer.«
Mit diesen Worten drehte er ihr den Rücken zu und eilte mit großen Schritten zur Tür. In dem Geräusch, das entstand, als er sie schloss, lag seine ganze Verärgerung.
Von: Helena Eichenhaun
Gesendet: 25. April 2013, 11.18 Uhr
An: Leonhard Bux
Betreff: Heiratsantrag
Liebster, es tut mir unendlich leid, ich wollte Dich nicht verärgern. Ich wollte Dich eigentlich mit meinem Heiratsantrag überraschen. Heute Abend bei einem schönen Essen. Und dann ist mir das einfach so rausgerutscht, ausgerechnet Christian gegenüber. Machst Du mir die Freude und gehst mit mir essen? Und kannst Du dann so tun, also wüsstest Du von nichts und ganz überrascht sein, wenn ich Dir heute Abend den Heiratsantrag mache? Bitte!
Helena Eichenhaun
Saphir!
Geschäftsführende Gesellschafterin
Von: Leonhard Bux
Gesendet: 25. April 2013, 11.25 Uhr
An: Helena Eichenhaun
Betreff: Ich weiß nichts von einem Heiratsantrag
Sehr geehrte Frau Eichenhaun,
ich weiß nichts von einem Heiratsantrag, den Sie mir gemacht haben, nicht gemacht haben, zu machen geglaubt haben oder zu machen vorhatten.
Selbstverständlich werde ich Ihnen als meiner Vorgesetzten die Einladung zum Essengehen nicht ausschlagen. Ich werde pünktlich sein. Wir treffen uns um 20 Uhr. Ich hole Sie ab.
Mit freundlichen Grüßen
Leonhard Bux
Saphir!
Designer
Helena wusste nicht, ob sie verletzt sein sollte oder nicht. Sie konnte Leonhard einfach nicht durchschauen. Warum siezte er sie plötzlich? Sollte das ein Scherz sein? War es liebevoll gemeint? Oder siezte er sie, um zu unterstreichen, dass er immer noch verärgert war und sich das auch nicht so schnell ändern würde? Wie auch immer. Jedenfalls hatte er einem Treffen mit ihr zugestimmt und das war das Wichtigste. Sie würde ihre Chance zu nutzen wissen und heute früher Schluss machen. Rasch warf sie einen Blick auf die Uhrzeit, die in der rechten unteren Ecke ihres Computers angezeigt wurde. 11.32 Uhr. Um 14 Uhr hatte sie noch einen Termin, danach würde sie Schluss machen. Sie war fest entschlossen, heute Abend besonders schön zu sein. Sie würde das volle Programm durchlaufen: Friseur, Maniküre, Pediküre, neue Schuhe, neues Kleid.
Was aber sollte sie ihm antworten? Wie du mir so ich dir, dachte sie und schrieb:
Von: Helena Eichenhaun
Gesendet: 25. April 2013, 11.40 Uhr
An: Leonhard Bux
Betreff: Re: Ich weiß nichts von einem Heiratsantrag
Sehr geehrter Herr Bux,
mit Freude habe ich zur Kenntnis genommen, dass Sie die Einladung Ihrer Chefin heute Abend angenommen haben. Ich warte pünktlich um 20 Uhr vor meinem Haus in Konstanz auf Sie. Da Sie ja bereits die Gelegenheit hatten, mich in meinem privaten Wohnhaus aufzusuchen, dürfte Ihnen der Weg dorthin geläufig sein.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Chefin
Helena Eichenhaun
Saphir!
Geschäftsführende Gesellschafterin
Fünftes Kapitel
Friedrichshafen
Michael lehnte sich weit auf seinem grauen Bürosessel zurück, sodass die Lehne ein wenig nachgab und nach hinten schwang. Er steckte Daumen und Zeigefinger seiner rechten Hand unter seine Brille, kniff die Augen fest zusammen und begann, sich die Nasenflügel zu massieren.
Sina starrte ihn an. Sie hasste diese Geste. Ihr Bruder suggerierte seinem Gegenüber damit, dass er weit besseres zu tun hatte, als sich mit seinen albernen Sorgen zu befassen. Nicht zum ersten Mal stellte sie fest, dass er arrogant und verkniffen wirkte. Was war nur aus dem kleinen Jungen geworden, der lachend über die Wiese im Garten ihrer Villa gerannt war? Der mit ihr auf die Bäume im riesigen Park geklettert und bei Eiseskälte in den See gestiegen war? Der schüchterne und ehrgeizige Michael, der, wenn er mit ihr zusammen war, doch manchmal so fröhlich und ausgelassen sein konnte, war immer derjenige unter den Geschwistern gewesen, der ihr am nächsten stand. Christians Oberflächlichkeit fand sie abstoßend und Katharina mochte sie zwar eigentlich, fand aber nicht wirklich einen Zugang zu ihrer verträumten, kleinen Schwester. Katharina studierte im x-ten Semester Literatur und verdingte sich gern als Künstlerin. Sie hatte zweifelsohne eine Begabung, aber weder den Elan noch das Durchhaltevermögen, etwas daraus zu machen, geschweige denn, es für die Firma einzusetzen. Und die Affenliebe, mit der Katharina an ihrer Mutter hing und um ihre Zuneigung bettelte, fand Sina fast schon peinlich – wobei Michael das früher ebenfalls getan hatte. Auch sie, Sina, hatte die Liebe der Mutter immer vermisst, vor allem nachdem der Vater gestorben war, der in den Augen ihrer Mutter zwar ein Versager war, der seinen Kindern aber immer die Liebe gegeben hatte, die sie so dringend brauchten. Aber im Gegensatz zu ihren Geschwistern hatte sie nie um Helenas Zuneigung gefleht. Sie war zwar, das gestand sie sich ein, Modedesignerin geworden, um ihrer Mutter zu gefallen, hatte sich erhofft, dadurch ihre Anerkennung zu gewinnen. Aber nachdem diese nicht kam, hatte sie es mehr oder minder schulterzuckend aufgegeben, und weil sie feststellte, dass sie trotzdem genau den richtigen Beruf gewählt hatte, tat es auch nicht allzu weh. Es machte ihr Spaß, zu entwerfen, zu designen, mit Stoffen und Effekten zu spielen. Mehr noch, es war eine echte Leidenschaft geworden. Von der Mutter hatte sie sich immer mehr distanziert und nun den Eindruck, dass sie seither für ihre Mutter interessanter war. Plötzlich zeigte Helena Interesse an ihren Entwürfen, plötzlich wollte sie sie in der Firma haben. Aber jetzt wollte sie, Sina, nicht mehr. Zumindest noch nicht. Es ist das immer gleiche Prinzip von Anziehung und Abstoßung, wie man es auch zwischen Mann und Frau kennt, dachte sie. Das, was man nicht haben kann, was sich einem nicht zu Füßen wirft, scheint interessanter. Sie wusste sehr genau, dass das ein Gesetz war, das zwischen Mutter und Tochter keinesfalls gelten sollte. Dass es zwischen ihr und Helena dennoch bestand, machte sie traurig.
Und nun wollte ihre Mutter heiraten. Christian hatte seine Geschwister aufgeregt zu einem Treffen gebeten – Katharina war allerdings an der Uni und konnte nicht teilnehmen – und war, kaum dass sich alle in Michaels Büro versammelt hatten, empört mit jener Neuigkeit herausgeplatzt, die bei Michael zum Massieren seiner Nasenflügel führte. Michael. Eigentlich wusste sie genau, wann der kleine Junge sich zu dem verkniffenen Mann entwickelt hatte. Auch hier war der Tod des Vaters ursächlich. Der Vater war der Einzige gewesen, der Michael Respekt zollte. Die Mutter schien ihn immer nur als Schwächling zu sehen und zeigte ihm das auch. Und als ihn dann noch seine Freundin eine Woche vor der Eheschließung mit seinem besten Freund betrogen und die Hochzeit daraufhin abgesagt hatte, hatte sich Michael endgültig wie ein Versager gefühlt, was er hinter seiner arroganten Maske zu verbergen suchte. Es gelang ihm mehr schlecht als recht und sorgte eher dafür, dass Michael sich immer wieder der Lächerlichkeit preisgab. Er pflegte seinen Doktortitel stets hervorzuheben. So auch jetzt: »Leute, ich bin Wissenschaftler«, teilte er seinen Geschwistern mit.
Christian sah ihn verständnislos an. »Ja, und?«
Michael wurde rot, merkte selbst, dass dieser Satz, mit dem er sich vor allem Unangenehmen zu retten und sich eine Bedeutung zu geben versuchte, die er nicht hatte, hier fehl am Platze war. »Ich … ich meine nur, dass ich mich mit solchem emotionalen Zeug nicht auskenne«, versuchte er sich stotternd aus der Affäre zu ziehen.
»Es geht hier auch nicht um die spät pubertierenden Gefühle unserer Mutter, sondern um unsere Zukunft, um unsere Firma«, ließ Christian sich verärgert vernehmen. »Sie hat mir gegenüber durchblicken lassen, dass sie ihm alles vermachen will und wir nichts bekommen.«
Michael atmete scharf ein.
Christian registrierte es mit Befriedigung. Endlich hatte diese Trantüte begriffen, worum es hier ging. »Ich kann mir das Szenario schon ausmalen«, fuhr er genüsslich fort. »Mutter wird diesem … diesem … diesem Pseudo-Künstler die Firma überschreiben und wir haben dann hier drin absolut nichts mehr zu melden.«
»Moment!«, schaltete Sina sich ein. »Wir haben alle unsere Anteile von Vater. Schon vergessen? Ich weiß gar nicht, warum ihr euch so echauffiert.«
Christian sprang auf und funkelte seine Schwester erbost an. »49 Prozent. Du weißt genau, dass wir damit keine Entscheidungen treffen können, wenn es hart auf hart kommt. Zumal wir ja ohnehin nie einer Meinung sind.«
Sina musterte ihren älteren Bruder vom blonden Scheitel bis zur Sohle seiner lächerlichen spitz zulaufenden und auf Hochglanz polierten Schuhe. »Man könnte meinen, es gehe dir gar nicht um Mutter, sondern einzig und allein um die Kohle, die sie hat. Freu dich doch, dass sie ein kleines bisschen Glück gefunden hat. Sie ist einsam.«
»Einsam!«, schnaubte Christian verbittert. »Einsam? Bei vier Kindern? Sie hätte uns ja nur mal wahrzunehmen brauchen. Wir waren auch einsam an ihrer Seite. Verdammt einsam sogar. Unsere Mutter ist eine eiskalte und berechnende Karrierefrau mit null Emotionen. Zumindest hat sie keine für ihre Kinder. Für diesen hergelaufenen … Möchtegerndesigner aber anscheinend schon.«
Sina kniff die Lippen zusammen und wandte den Blick ab. Sie wusste, dass es stimmte, was Christian sagte, aber sie konnte es trotzdem nicht leiden, wenn ihr Bruder derart über ihre Mutter herzog.
»Du hast recht«, sagte Michael in diesem Moment. »Das geht ganz und gar nicht und wir müssen das irgendwie verhindern.«
Sina sah ihre Brüder sprachlos an. »Ihr seid widerlich«, stieß sie hervor.
Aber die beiden beachteten sie gar nicht.
Christian hatte Michael fest ins Auge gefasst. »Stimmt«, sagte er langsam. »Ich bin ganz deiner Ansicht. Und ich weiß auch schon wie.«
Sechstes Kapitel
Aalen, Ostalb
»Das ist eine Unverschämtheit, Herr Oberbürgermeister.«
Klaus Schwarz verzog schmerzlich das Gesicht, als die brüllende Stimme seines Gesprächspartners in sein Ohr drang, und hielt den Hörer ein kleines Stück weg.
»Ich habe immer noch nicht verstanden, was Sie eigentlich von mir wollen«, erklärte er bemüht freundlich.
Als Klaus Schwarz vor zehn Jahren als Oberbürgermeister der Stadt Aalen angetreten war, hatte er sich geschworen, immer ein offenes Ohr für seine Bürger zu haben, ihnen zuzuhören und auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Das war freilich nicht in dem Maße möglich, in dem er sich das wünschte – und in dem das manche Bürger auch erwarteten. Schließlich musste er auch noch seinen zahlreichen anderen Amtsgeschäften nachkommen. Aber wann immer es ging, war er für seine Bürger zu sprechen. So auch heute für diesen brüllenden Herren, dessen Namen er nicht verstanden hatte.
»Des isch a Frechheit, was d’ Schdad mit m arma Schbion machd!«, ereiferte sich der Mann.
Schwarz kratzte sich verdutzt an seinem grau melierten Hinterkopf. Was meinte der Bürger nur? Waren irgendwelche Maßnahmen an der Holzskulptur auf dem Glockenturm des historischen Rathauses vorgenommen worden, von denen er nichts wusste? Er konnte nicht über jedes Detail informiert sein, das in der Stadt vor sich ging. Das aber musste der erboste Bürger nicht unbedingt wissen. »Was genau meinen Sie?«, hakte er vorsichtig nach.
»Was I moin? Hend Se des no net gsää? Irgend ebber hot em Schbion sei Pfeife g’schdola. Des war beschdimmd d’ Schadd. Ebber andersch kommt do ja gar net nauf.«
In Schwarz’ Kopf fuhren die Gedanken Achterbahn. Wollte der Mann ihn veräppeln? Dazu klang er zu ernst und zu erregt. Wenn der Aalener Spion allerdings wirklich keine Pfeife mehr haben sollte, dann war das in der Tat eine Katastrophe. Dann musste er handeln. Und zwar sofort. »Ich komme«, presste er hervor, knallte den Hörer auf die Gabel, zerrte seinen dunklen Mantel aus dem Schrank und riss die Tür zum Vorzimmer auf. »Frau Häberle, ich muss unverzüglich weg. Ich weiß nicht, wie lange es dauert«, verkündete er.
»Aber … aber die Herren vom Bauamt warten draußen. Ihre Besprechung hätte eigentlich schon vor zehn Minuten begonnen, aber Sie haben telefoniert. Und in einer halben Stunde kommt die Kämmerin«, stammelte Roswitha Häberle.
Schwarz winkte, schon rennend, ab und raste an den Herren der Bauverwaltung vorbei, die draußen vor der Tür auf den Besucherstühlen warteten, sich in Erwartung einer Begrüßung durch den Bürgermeister erwartungsfroh von ihren Plätzen erhoben und ihm, als er vorbeigerannt war, verblüfft nachsahen.
»Mitkommen«, bellte der sonst so freundliche Schwarz über die Schulter und sauste mit fliegendem Mantel die Treppe herunter. Im Laufen platzierte er noch seinen Hut auf seinem schwarzgrauen Haar.
»Was ist denn passiert, Herr Oberbürgermeister?«, fragte Stadtbaumeister Jochen Ernst, der dem Befehl seines Chefs sofort Folge geleistet hatte und ihm nun, gemeinsam mit Tiefbaumeister Matthias Kober, hinterherhetzte.
»Die Pfeife des Spions ist angeblich fort.«
Schwarz’ Worten folgte ein kollektives, ungläubiges Ächzen der Herren des Stadtbauamtes. Der Spion war Aalens Wahrzeichen. Er saß auf dem historischen Rathaus in einem Turm mit einer Uhr. Die Aalener liebten ihren Spion, denn einer Sage zufolge hatte die Stadt dem Spion ihre Rettung im Dreißigjährigen Krieg zu verdanken. Da nämlich wollte das feindliche Heer die Stadt zerstören – und die Aalener schickten einen besonders schlauen Mann aus ihren Reihen zum Feind. Seine Aufgabe: ausspionieren. Und als der Feind den Spion fragte, wer er sei und was er wolle, soll er gesagt haben: »Erschrecket net, ihr hohe Herra, i will bloß gucka, wie viel Kanone ond anders Kriegszeug ihr hent. I ben nämlich der Spion von Aale.« Der Feind war daraufhin der Ansicht, dass von Menschen, die einen derart dummen Spion schicken, nichts zu befürchten wäre, und sah von einem Angriff auf die Stadt ab. Unter die Raucher war der Spion allerdings erst im 19. Jahrhundert gegangen. Schwarz vermutete, dass man ihm, indem man ihm eine Pfeife in den Mund steckte, den Charakter eines englischen Spions, wie sie in jener Zeit in Mode gekommen waren, hatte geben wollen. Die jetzige Generation der Aalener jedenfalls kannte den Spion nur mit seiner Pfeife. Und nun sollte sie plötzlich verschwunden sein?
Schwarz sauste über den Marktplatz und spähte angestrengt zum Glockenturm hinauf. Der Spion drehte sich in einer langsamen Bewegung von links nach rechts und zurück. Im Profil konnte man es besonders gut erkennen: Der Bürger hatte recht. Den Mund des Aalener Spions zierte keine Pfeife mehr. Auch die Herren des Bauamtes hatten sich davon inzwischen überzeugt, was Schwarz an dem scharfen Einatmen des einen und einem spontanen »Ach du Scheiße« des anderen bemerkte.
»Ja. Ach du Scheiße. Das können Sie aber laut sagen«, bekräftigte Schwarz und drehte sich zu seinen Männern um. »Was in aller Welt machen wir jetzt?«
Siebtes Kapitel
Überlingen
»Morgen!«, muffelte Ole, als er das Polizeigebäude betrat. Monja Grundel, seine kleine, dicke Kollegin mit dem lustigen braunen Bürstenhaarschnitt, kam ihm schon im Flur entgegen. »Morgen, Miesepeter«, rief sie fröhlich. Unwillkürlich musste Ole grinsen. Er hatte seine Kollegin sehr ins Herz geschlossen, nachdem sie ihre Anfangsschwierigkeiten überwunden hatten. Ole hatte sich erst an ihre burschikose Art gewöhnen müssen und als er vor rund einem Jahr aus der Metropole Hamburg nach Überlingen gekommen war und gleich als Erstes zusammen mit Monja Grundel einen Mordfall zu lösen hatte, hatte ihm die Ur-Badenerin ganz deutlich gezeigt, was sie von ihm, dem nordischen Hünen hielt: rein gar nichts. Doch dann hatte er festgestellt, dass hinter ihrer rauen Schale ein sehr weicher und auch überraschend verletzlicher Kern steckte. Und schließlich hatte die Grundel ihn auch noch schätzen gelernt. Nicht dass er es verdient hätte. Ole brachte sich in der letzten Zeit viel Selbstverachtung entgegen und hatte schwer mit sich zu kämpfen. Es war nicht die Tatsache, dass er im Zusammenhang mit dem Mord an Elisabeth Meierle in die Falle gegangen war. Es war viel mehr das Gefühl, versagt zu haben.
Die Grundel hatte ihn danach beschworen, sein unprofessionelles Verhalten in seinem Bericht über den Tathergang unter den Tisch fallen zu lassen. Ole hatte sich dabei ganz und gar nicht wohlgefühlt – er wollte zu den Fehlern stehen, die er begangen hatte. Er wollte Buße tun. Doch Monja hatte regelrecht darum gebettelt, den Mantel des Schweigens darüber zu breiten. Sonst, hatte sie gefürchtet, werde man ihn vielleicht von der Zusammenarbeit mit ihr abziehen. Und sie habe ihn zwischenzeitlich sehr ins Herz geschlossen und halte ihn für einen äußerst fähigen Kollegen. Sie brauche ihn, hatte Monja schlicht gesagt. Und so hatte er ihr den Gefallen getan. Und er war gerührt gewesen.
Irgendwie hatte er gelernt, sich damit zu arrangieren, dass er seine eigene, wenig ruhmreiche Rolle in diesem Fall vertuscht hatte. Der Alltag lenkte ihn von dem nagenden schlechten Gewissen ab. Da war sein neues Leben in Überlingen, neue Freunde, neue Kollegen, Orte, die er entdecken wollte und vor allem: seine Beziehung mit Alexandra. Nie zuvor war Ole so glücklich gewesen, hatte sich so verstanden und aufgehoben gefühlt. Und nie zuvor hatte er gewusst, dass das Gefühl der Liebe eine Intensität annehmen konnte, die beinahe schmerzhaft war. Er staunte darüber und genoss es. Er war fast glücklich.
Doch dann kam der 7. Februar. Der Schmotzige Dunschtig. Seine erste Fastnacht am See. Ein Tag, den er mit Spannung erwartet hatte. Alexandra war schließlich schon Wochen zuvor ganz aus dem Häuschen gewesen, hatte ihm voller Stolz ihr knallrotes Kostüm mit dem riesigen Kopf und den blonden, langen Haaren gezeigt. Wie viele andere Überlingerinnen wollte sie als Löwe gehen. Und ihn hatte sie zu überreden versucht, sich in der Narrenzunft anzumelden und Hänsele zu werden. Der Überlinger Hänsele galt als die Traditionsfigur schlechthin. Lachend hatte er abgewehrt und argumentiert, dass er sich die Fastnacht erst einmal anschauen wolle. Wenn es ihm gefalle, versprach er, würde er darüber nachdenken, sich für das kommende Jahr ein Hänsele-Kostüm nähen zu lassen.
Doch er sollte nicht dazu kommen, die zahlreichen Narrenveranstaltungen zu besuchen, die an jenem Tag geboten waren. Weder dem Narrenbaumstellen konnte er beiwohnen, noch dem Hänselejuck am Abend, von dem ihm Alexandra so vorgeschwärmt hatte und bei dem Hänsele zu bengalischer Beleuchtung die Franziskanerstraße heruntersprangen. Den Anfang des Kinderumzugs bekam er noch mit. Die Narreneltern zeigten sich gerade am Franziskanertor, als Ole in die Bank gerufen wurde, die sich nur wenige Meter weiter befand. Ein Banküberfall. Vermutlich dachte der Bankräuber, ein überschuldeter Mittfünfziger, dem die Zwangsversteigerung seines Hauses drohte, dass alle Einsatzkräfte beim Umzug gebunden waren. Dass sie sogar schneller vor Ort sein konnten, weil sie praktisch direkt nebenan den Umzug überwachten, darauf war der Räuber nicht gekommen.
Es war eigentlich keine große Sache gewesen. Der Mann war schnell gefasst und Monja Grundel, die vom Bankräuber mit einer Schreckschusspistole bedroht worden war, hatte diese sofort als solche erkannt und war lächelnd auf den Täter zugegangen. »Machen Sie doch keinen Unsinn«, hatte sie ruhig gesagt und ihm die Waffe einfach aus der Hand genommen. Monja war toll gewesen, ganz ohne Frage. Und ganz im Gegensatz zu ihm. Er, Ole, hatte die Waffe nicht als Spielzeug entlarvt, was er als Polizist eigentlich ohne Weiteres hätte können müssen. Und wenn sie noch so täuschend echt war. Was er sich aber vor allem vorwarf, was ihn umtrieb und ihn fertigmachte: Er hatte nichts getan, um seiner Kollegin zu helfen. Er hatte versagt, wie schon einmal. Plötzlich war alles wieder da gewesen. Der schreckliche Banküberfall in Hamburg vor über einem Jahr. Das tote Kind, der tote alte Mann. Und er, der diese Leben hätte retten können, wenn er früher reagiert hätte. Denn als er den Bankräuber damals erschossen hatte, war es zu spät gewesen. Da hatte der Täter bereits das Kind und den alten Mann umgebracht. Weil Ole damit nicht fertig wurde, hatte er sich nach Überlingen versetzen lassen. Doch wie es schien, versagte er auch hier. Er, der eigentlich nicht an Schicksal glaubte, war nun überzeugt, dass dieser Überlinger Banküberfall eine Art Prüfung an ihn hatte darstellen sollen. Dass es zugleich eine Chance gewesen war, diesmal richtig zu handeln, diesmal zu retten.
Aber stattdessen hatte er dagestanden wie angewurzelt und die Szenerie mit weit aufgerissenen Augen beobachtet, während vor seinem inneren Auge eine Parallelwelt aufzog. Es waren Bilder, die ihn lähmten, ihn bewegungs- und handlungsunfähig machten, Bilder, die er so lange versucht hatte zu verdrängen, Bilder, die er erst in Alexandras Armen ein wenig vergessen konnte. Alexandra. Sie hatte etwas Besseres verdient als ihn. Sie hatte sich in einen Helden verliebt und nicht in einen Versager. Er schämte sich abgrundtief vor ihr. Gerade weil er sie so liebte, weil sie die erste Frau seit Langem war, die wirklich sein Herz berührte, weil er sich eine gemeinsame Zukunft mit ihr vorstellen konnte, ja, theoretisch sogar Kinder mit ihr wollte, durfte sie nicht wissen, was er getan hatte. Durfte nicht wissen, was er für ein Feigling war. Überhaupt: Kinder. Seit sie im Sommer im Strandbad beiläufig darüber gesprochen hatten, war das immer wieder Thema zwischen ihnen, auch, wenn sie noch nicht einmal ein Jahr zusammen waren. Und je mehr sie darüber sprachen, desto mehr wuchs Oles Zweifel. Durfte er denn überhaupt Kinder haben? War das fair? Er, der den Tod eines Kindes zu verantworten hatte, durfte er Vaterglück erleben? Er zweifelte stark daran. Nur: Wie sollte er das Alexandra sagen? Sie würde ohnehin enttäuscht sein, wenn sie erfuhr, dass er gar nicht ihr strahlender Held, sondern ein feiger Versager war. Und sie würde doppelt enttäuscht sein, wenn er ihr sagte, dass er keine Kinder haben wollte. Konnte. Durfte.
Ole hatte sich an jenem Tag des Überlinger Banküberfalls nach Feierabend in seiner Wohnung verkrochen und die Decke über die Ohren gezogen, als draußen die Hänsele den Berg vor seinem Haus herunterjuckten. Die SMS und Anrufe von Alexandra, mit der er verabredet gewesen war, hatte er ignoriert und sich am Abend, als sie besorgt und in einem roten Kostüm in seine Wohnung kam, mit plötzlichen Kopfschmerzen entschuldigt.
»Ist alles in Ordnung bei dir, Morgenmuffel?«
Von weit her drang Monja Grundels Stimme in seine Gedanken.
»Findest du die neue Farbe meiner Haarsträhne etwa daneben?«, setzte sie stirnrunzelnd nach.
»Wie?« Ole brauchte einige Sekunden, bis ihm klar wurde, dass er die ganze Zeit über auf Monja Grundels knallgelbe Haarsträhne gestarrt hatte, die aus ihrem braunen Bürstenhaarschnitt ragte und ihr in die Stirn fiel. Obwohl – oder vielleicht gerade weil – Monja Grundel ein recht unattraktives Äußeres hatte, war sie sehr eitel. Die Haarsträhne war ein vorsichtiger und zugegebenermaßen auch recht unglücklicher Versuch, etwas aus sich zu machen. Bei Oles Ankunft in Überlingen war sie blau gewesen und hatte seither über Grün und Rosa bis hin zu jenem grellen Gelb gewechselt.
Monja sah ihn zaghaft an und wartete auf eine Antwort. Ole ging das Herz auf und er empfand eine tiefe Sympathie für die kleine, verunsicherte Frau, die in Monja steckte. Die auch schön sein wollte. Und es auf ihre Art ja auch war – was man aber erst bemerkte, wenn man sich ihre oft mürrische Miene wegdachte. Auch Monja war ein Mensch, der bewundert werden wollte. Plötzlich dachte Ole: Eigentlich haben wir beide die gleichen Wünsche, wenn auch auf unterschiedliche Weise.
»Nein, die Farbe steht dir ausgesprochen gut«, sagte er herzlich. »Es ist nichts, ich … ich war nur gerade in Gedanken. Bitte entschuldige.«
»Dann ist ja gut«, grinste Monja Grundel. »Dann lass uns mal an die Arbeit gehen.«
Die Arbeit gestaltete sich ganz anders als gedacht. Die Aktenberge, derer sich Ole heute eigentlich hatte annehmen wollen, blieben liegen: Im Garten der in Konstanz lebenden Firmenchefin von Saphir!, Helena Eichenhaun, war eine Leiche gefunden worden. Ole und Monja gehörten der Sonderkommission des Polizeipräsidiums Konstanz an, die zur Aufklärung des Falls gegründet worden war.
Achtes Kapitel
Konstanz
»Bei dem Toten handelt es sich um einen gewissen …«, der schmale, diensteifrige Polizeibeamte warf mit wichtiger Miene einen geschäftigen Blick in seine Akten und fuhr dann fort: »… um einen gewissen Leonhard Bux, wohnhaft in Aalen im Ostalbkreis, seit zwei Monaten bei der Firma Saphir! beschäftigt.«
»Danke.« Ole nickte seinem Kollegen knapp zu und ging dann, Seite an Seite mit Monja Grundel, durch die Polizeiabsperrung, die das Ende der Sackgasse abriegelte. Die Villa lag im Konstanzer Musikerviertel und war das letzte Haus an einem schmalen Sträßchen, das zum See führte. Das Gebäude war riesig und herrschaftlich, die parkähnliche Rasenfläche, die sich dahinter erstreckte, beinahe unanständig groß. Sie führte bis zu einem mächtigen, schmiedeeisernen Gartenzaun, der die Villa von dem Fußgängerweg abgrenzte, der am See entlang führte. Ein kleines Bootshaus stand links, eine Pergola rechts des Eisenzauns. Ein Ruderboot lag mit der Unterseite nach oben dazwischen im Gras. Ob jemand aus der Familie es regelmäßig zum Wasser zerrte, um zu rudern? Ole ließ seinen Blick durch den Garten schweifen und verharrte an dem Punkt, auf den sich alles konzentrierte: Am rechten Ende der Wiese, vor einer dicken Wand aus hohen Bäumen, Büschen und Hecken, blühten Frühjahrsblumen in allen erdenklichen Farben. Und mitten in diesen Frühjahrsblumen, genauer gesagt, in einem Beet aus gelben Tulpen, lag die Leiche. Ein großer, schlanker Mann mit braunen, zerzausten Haaren, die jetzt allerdings von Blut verklebt waren. Er lag auf dem Bauch, deshalb konnte Ole sein Gesicht nicht sehen, aber er schätzte ihn intuitiv auf Mitte 30. Am Hinterkopf des Mannes klaffte eine große Wunde.
»Wissen wir schon etwas über die Tatwaffe?«, fragte Monja Helmut Ehrle, den Gerichtsmediziner, der neben der Leiche auf dem Boden kniete. Ehrle, semmelblond, schmal und, wie Ole fand, sehr jung, blickte kurz auf. »Es war ein stumpfer, schwerer Gegenstand«, sagte er kurz. »Mehr kann ich aber erst sagen, wenn ich ihn genauer untersucht habe.«
Ole machte den Mund auf, um zu fragen, wann man mit den Ergebnissen rechnen könne. Ehrle kam ihm zuvor. »Ich beeile mich.« Seine Antwort verriet, dass dies – obgleich er aussah, als komme er frisch von der Uni – offensichtlich nicht sein erster Fall war. Anscheinend wusste der Mediziner, dass Beamte am Tatort immer fragen, wann die Untersuchungsergebnisse vorliegen werden.
»Was aber sehr merkwürdig ist, sind die offenen Hände, sehen Sie?«
»Um Gottes willen!«, rief Monja entsetzt. »Das ist ja schrecklich.«
Auch Ole starrte fassungslos auf die Hände des Mordopfers. Die Haut war regelrecht weggeätzt.
»Wenn mich nicht alles täuscht, wurden ihm diese Verletzungen nach dem Tod beigebracht«, kommentierte der Semmelblonde.
»Aber was macht das für einen Sinn?«, grübelte Monja.
»Ob es irgendetwas mit Diebstahl zu tun hat?«, überlegte Ole. »Früher gab es ja den Brauch, Dieben die Hand abzuhacken. In Überlingen gibt es dazu am Aufkircher Tor sogar einen Stein mit einer eingemeißelten Hand. Alexandra hat das für ihr Buch ›Geheimnisse der Heimat‹ herausgefunden.«
»Aber das ist doch Jahrhunderte her«, wandte Monja ein. »Außerdem: Abgehackt wurden die Hände unseres Opfers ja wohl nicht. Eher … abgezogen.«
»Haben Sie eine Idee, wie man ihm diese Verletzungen zugefügt haben könnte?«, fragte Ole.
»Das war ganz klar eine Säure«, antwortete Ehrle stirnrunzelnd. Zum ersten Mal wirkte er nicht ganz so überheblich und selbstsicher. Der Fall schien auch ihm schwer zuzusetzen.
»Gibt es irgendwelche Spuren vom Täter?«, wandte Ole sich an zwei Kollegen der Spurensicherung, die in ihren weißen Ganzkörperanzügen auf dem Boden des Tulpenbeetes herumkrochen. Ihre Asservatenbeutel waren noch fast leer, nur in einen hatte der ältere der beiden einen Erdklumpen gegeben.
Der Jüngere zuckte die Achseln. »Jede Menge verschiedene Fußabdrücke, dort, wo blanke Erde ist, was aber nicht verwunderlich ist. Die letzten Tage waren schön, da werden sich einige Menschen hier im Garten aufgehalten haben.«
»Hautabschürfungen unter den Fingernägeln können wir aufgrund des Zustands der Hände nicht finden. Nach Fremd-DNS suchen wir«, ließ Ehrle sich vernehmen.
Ole sah sich um und deutete auf die zertretenen Blumen rechts und links der Leiche. »Sieht so aus, als habe es einen kleinen Kampf gegeben. Sonst wären die Blumen nicht so niedergedrückt.«
Monja nickte bestätigend. »Er scheint nicht einfach so hinterrücks erschlagen worden zu sein.«
»Irgendwas, das als Tatwaffe infrage kommt?«
Auch Monja blickte sich suchend um und zeigte dann mit dem Kinn in Richtung des Bootes, das einsam und verkehrt herum im Garten lag. »Ich würde mal sagen, die Ruder zu diesem Boot fehlen«, brummte sie.
»Das, werte Kollegin, haben wir auch schon bemerkt«, mischte sich Volker Nei, ein Konstanzer Kollege, der soeben zu der Gruppe getreten war, eifersüchtig ins Gespräch. Ihm gefiel die kürzlich erfolgte Polizeireform, nach der dem Polizeipräsidium Konstanz nun auch noch Kollegen der anderen Seeseite angehörten, so gar nicht. Und es passte ihm erst recht nicht, dass dieser nordische Hüne und seine kleine dicke Kollegin nun hier herüberkamen, um die Konstanzer Fälle zu lösen. Seiner Ansicht nach war das Beschäftigungstherapie für die gelangweilten Kollegen und nichts weiter. Schließlich ereignete sich in Überlingen ja so gut wie nie ein Mordfall. Bis auf diese eine Sache mit der alten Dame im vergangenen Jahr. Gut, die beiden hatten den Fall zusammen gelöst. Und deshalb meinten nun anscheinend alle, dass dieses komische Paar nur mit den Fingern zu schnippen brauchte, um Mörder zu fangen. Altgediente Kollegen wie ihn, Volker Nei, übersah man dabei einfach. Dabei gab es niemanden, der Konstanz so gut kannte wie er. Seit 25 Jahren war er Polizeibeamter in der Grenzstadt und er kannte hier jeden Winkel. Auch über die Familienverhältnisse der Eichenhauns wusste er bestens Bescheid. Mehr um sich vor den Kollegen mit seinem Insiderwissen zu brüsten, als weil er wirklich zur Aufklärung des Falls beitragen wollte, sagte er: »Die Familie bewahrt Ruder und andere Gegenstände zum Segeln, Rudern, Paddeln und Schwimmen im Bootshaus auf.« Er wies vage auf das kleine, schmucke Fachwerkhäuschen, das Ole schon aufgefallen war. »Da drin befinden sich wohl jede Menge Paddel und Ruder.«
»Haben Sie drinnen schon einmal nachgesehen?«, erkundigte sich Ole.
Nei presste die Lippen zusammen. »Ich glaube nicht, dass das meine Aufgabe ist«, schnappte er.
»Nicht?«, fragte Ole. »Warum denn nicht? Ich dachte, Sie wären, ebenso wie ich, hier, um den Fall zu klären?« Er sah seinen Kollegen stirnrunzelnd an. »Also, wenn das nicht Ihre Aufgabe ist, dann ist es meine. Ich werde mir das später ansehen. Aber erst mal will ich mit den Frauen dahinten sprechen.«
»Geh du ruhig, ich schaue mich im Bootshaus mal um«, sagte Monja und warf ihrem Kollegen Nei einen giftigen Blick zu. Eifersüchtige Platzhirsche wie ihn konnte sie gar nicht leiden. »Ich bin mir da auch nicht zu schade für. Im Gegenteil erhoffe ich mir von einem Besuch im Bootshaus wichtige Erkenntnisse.«
Unter den bösen Blicken seines Kollegen überquerte Ole die Wiese und ging zu der großen, schmiedeeisernen Hollywoodschaukel mit den dicken, weißen Sitzpolstern, auf der eine elegante, blonde Frau saß und mit starrer Miene vor sich hinblickte. Ole erkannte sie als Helena Eichenhaun, Besitzerin der Villa und des Grundstücks und außerdem viel bewunderte Chefin der Modefirma Saphir!. Rechts und links der Blonden saßen zwei jüngere Frauen, vielleicht ihre Töchter. Die eine wach, selbstbewusst und ein Ebenbild der Mutter, mit halblangen, blonden Haaren und blauen Augen, die allerdings wärmer strahlten als Helenas. Die andere wirkte eher abwesend, ihr Blick war verträumt, ihre braunen Haare flossen um ihre Schultern und bis auf den Rücken.
»Frau Eichenhaun?«, fragte Ole.