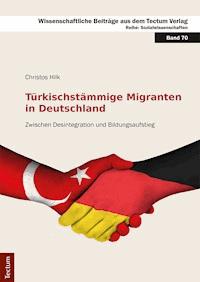
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum
- Kategorie: Bildung
- Serie: Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum-Verlag
- Sprache: Deutsch
Wie leben türkischstämmige Migranten in Deutschland? Welche Faktoren fördern den Bildungsaufstieg und welche Rolle spielen dabei das hiesige Schulsystem und die Lehrerausbildung? Gibt es einen allgemeingültigen Begriff der Integration? Der Autor spannt einen Bogen von den türkischen Gastarbeitern über die Bildungsbeteiligung ihrer Nachkommen bis hin zur lebenspraktischen Bedeutung des Islam und vermittelt so Zeitgeschichte und Aktualität der türkischstämmigen Migration. Ein wichtiger Beitrag, der Hintergründe und Lebenswirklichkeiten bisheriger Integrationsbemühungen offenlegt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag
Reihe Sozialwissenschaften
Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag
Reihe: Sozialwissenschaften
Band 70
Christos Hilk
Türkischstämmige Migranten in Deutschland
Zwischen Desintegration und Bildungsaufstieg
Tectum Verlag
Christos Hilk
Türkischstämmige Migranten in Deutschland. Zwischen Desintegration und Bildungsaufstieg
Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum VerlagReihe: Sozialwissenschaften; Bd. 70
© Tectum Verlag Marburg, 2016
ISBN: 978-3-8288-6508-2(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter der ISBN 978-3-8288-3797-3 im Tectum Verlag erschienen.)
Umschlagabbildung: shutterstock.com © Prehistorik
Umschlaggestaltung: Mareike Gill | Tectum Verlag
Satz und Layout: Mareike Gill | Tectum Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Besuchen Sie uns im Internet www.tectum-verlag.de
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Danksagung/Widmung
Frau Prof. Dr. Elisabeth Rohr danke ich vielmals für Ihre stets konstruktiven Anregungen und ihre jederzeitige Gesprächsbereitschaft. Der prägende Besuch ihrer Seminare ermöglichte mir die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Aspekten der Interkulturellen Erziehung und trug schließlich zur Erstellung und Vollendung meiner Arbeit bei.
Mein Dank gilt den Interviewpartnern: Ihre Gesprächsbereitschaft bildete einen wichtigen Bezugspunkt meines Vorgehens, auch ihre zuweilen rührend-bedrückenden Lebenserfahrungen verliehen meinem Vorhaben den notwendigen Grad an Relevanz, Tiefgang und Authentizität.
Gewidmet ist die Arbeit meinen Eltern, die mich stets unterstützt und meinen Werdegang überhaupt erst ermöglicht haben.
Inhaltsverzeichnis
1Einleitung
2Geschichte der türkischen ‚Gastarbeiter‘ in Deutschland und Aspekte des Lebens ihrer Nachkommen
2.1Türkische ‚Gastarbeiter‘ im Deutschland des 20. Jahrhunderts
2.2Die Kinder der ‚Gastarbeiter‘ – Die wissenschaftliche Diskussion um die zweite und dritte Generation türkischstämmiger Migranten in Deutschland
3Methodisches Vorgehen
3.1Vorbereitung: Forschungsabsichten und Ausgangsthesen
3.2Richtlinien zur Durchführung und Auswertung der Interviews
4Vorstellung der Interviewpartner
4.1Biografisches
4.2Situativer Kontext der Interviews
5Junge türkischstämmige Migranten in Deutschland: Bildungspartizipation und soziale Situation
5.1Bildungsbeteiligung und berufliche Positionierung unter Berücksichtigung von Benachteiligung und Diskriminierung
5.2Aufbau und Einfluss des sozialen Umfelds: Intra- und interethnische Kontakte
6Familienleben und Tradition junger türkischstämmiger Migranten in Deutschland
6.1Innerfamiliäre Lebensbedingungen und die Stellung der Frau
6.2Der Einfluss des Islam auf Familienleben und Freizeit
7Schlussfolgerungen und Fazit
Literatur- und Quellenverzeichnis
Anhang/Interviewtranskriptionen
1Einleitung
Nachfolgende wissenschaftliche Hausarbeit hat zum Ziel, fundierte Auskünfte zur sozialen Situation junger türkischstämmiger Migranten in Deutschland zu geben – unter Hinzuziehung der Ergebnisse dreier selbstgeführter, qualitativer Interviews sollen insbesondere Aspekte der gesellschaftspolitischen Platzierung, der Bildungspartizipation und des Familienlebens vorgestellt und eindringlich fokussiert werden. Die wissenschaftliche Relevanz der Thematik ergibt sich unter anderem aus der – im Vergleich zu Migranten anderer Herkunft – recht hohen Anzahl türkischstämmiger Migranten1 in Deutschland wie auch durch die anhaltende, zuweilen medial inszenierte Diskussion um mutmaßliche Probleme des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Unter Verweis auf eine vordergründig kulturell und religiös bedingte Andersartigkeit orientieren sich öffentliche und politische Debatten um Migration und Integration zusehends am Paradigma der „kulturellen Differenz“2. Die oftmals unsachlich geführten bzw. „aller Globalisierungsrhetorik zum Trotz nationalstaatlich überdeterminierten“3 Diskussionen verkennen hierbei den Umstand, dass „Integration (…) längst zum Normalfall geworden ist“4 und dass insbesondere in Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen die „kulturelle, sprachliche und religiöse Vielfalt längst Einzug (…) gehalten hat“5. Die gegenüber türkischstämmigen Migranten existierenden Vorurteile bzw. die „stereotypen Vorstellungen der einheimischen deutschen Mehrheitsbevölkerung“6 werden unter anderem gefordert und gefördert durch die weithin bekannten Thesen eines Thilo Sarrazin, welcher „die Religionszugehörigkeit als eigenständigen Faktor bei der Erklärung von Bildungsungleichheit heranzieht“7. Ebenso verstärken einige Werke der als Berufungsinstanz für ‚Islamkritiker‘ fungierenden Autorin Necla Kelek die „Legitimationsgrundlagen der islamophoben Bewegung in Deutschland“8 wie auch den „kulturalistischen Diskurs über die kulturell fremden Türken“9. Unter inflationärer Verwendung eines nicht allgemein definierten10 und zumeist normativ auf „Fragen der Kultur verengten“11 Integrationsbegriffs wird innerhalb öffentlicher Diskussionen das Bild einer – von Seiten der Migranten nicht gewollten – und insgesamt misslungenen Integration gezeichnet: Im Mittelpunkt jener teils bewusst herabsetzenden Erörterungen „stehen oftmals Personen mit einem Migrationshintergrund aus muslimisch geprägten Staaten“12. Derlei Meinungen unterschlagen jedoch jene, das multikulturelle Zusammenleben erschwerende Tatsache, dass sich die Bundesrepublik Deutschland über Jahrzehnte hinweg nicht als Einwanderungsland wahrgenommen hat13 und von einer „konsequenten Zuwanderungs- oder gar Integrationspolitik bis in die 1990er-Jahre nicht gesprochen werden kann“14. Ebenso verschweigt der öffentlich-mediale Diskurs den Sachverhalt, dass die quantitativ-empirische Sozialforschung trotz erster Anzeichen in den 1970er-Jahren15 erst ab den späten 1980er- bzw. frühen 1990er-Jahren die Bildungsbeteiligung von Migrantenkindern und -jugendlichen innerhalb des deutschen Bildungssystems erforschte.16 Die sich – im Vergleich zu Schülern17 ohne Migrationshintergrund – stellenweise durch „höhere Schulabbrecherquoten und niedrigere Schulabschlüsse“18 auszeichnende Bildungsbeteiligung von Migrantenkindern und -jugendlichen geriet erst durch die im Jahr 2000 vollzogene, erstmalige Veröffentlichung der PISA-Studie in den Fokus des öffentlichen und bildungspolitischen Interesses.19 Innerhalb jener – sich seit der Jahrtausendwende häufenden – Debatten stehen oftmals die geringere Bildungsbeteiligung von Kindern und Jugendlichen aus Migrantenfamilien türkischstämmiger Herkunft „sowohl als Forschungsgegenstand als auch in bildungspolitischen Diskussionen im Vordergrund der Auseinandersetzungen“20. Neueste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass es für die geringere Bildungsbeteiligung türkischstämmiger Kinder und Jugendlicher differenziertere Erklärungsansätze gibt, „als der öffentliche Diskurs um dieses Thema (…) vermuten lässt“21. Diskutierten Forschung und Öffentlichkeit bisher verstärkt über die „sozio-ökonomischen sowie Bildungsvoraussetzungen der Herkunftsfamilien“22, gerät die „Funktionsweise von Schulen bzw. des Schulsystems“23 zusehends in den Fokus bildungspolitischer Debatten und wissenschaftlicher Abhandlungen. Unterwurzacher 2007 stellt bezüglich jenes allmählichen Paradigmenwechsels fest:
„In der Diskussion über Bildungsbenachteiligung nehmen Erklärungsansätze, die den schulischen Kontext thematisieren, eine immer stärker werdende Rolle ein. Im Zentrum der Debatte stehen die Bedingungen des Lernens im engeren Sinn (Merkmale der Schule, der Klasse, des Unterrichts), Erwartungen und Verhalten der Lehrkräfte (institutionelle Diskriminierung) sowie die übergeordneten institutionellen Rahmenbedingungen dieser Kontextfaktoren (Verfasstheit nationaler Bildungssysteme)“24.
Demgemäß werden als Erklärungsmuster für die geringere Bildungsbeteiligung türkischstämmiger Migrantenkinder und -jugendlicher verstärkt verschiedenste, dem deutschen Schul- und Bildungssystem immanente und ausgrenzend wirkende Faktoren und Mechanismen herangezogen – vorwegnehmend genannt seien hier beispielhaft die Orientierung des Schulwesens „am Ideal des einheimischen, deutschen Bildungsbürgers“25 und die damit einhergehende Geringschätzung der Herkunftssprachen der Schüler,26 eine am „monolingualen Klassenzimmer“27 orientierte und die „Kanalisierung nach Herkunftskultur“28 fördernde Lehrerausbildung wie auch der als „frühe Selektionsschwelle“29 wirkende, den Befindlichkeiten und Bedürfnissen von Migrantenkindern und -jugendlichen nicht gerecht werdende Übergang nach der Grundschulzeit. Unter Kenntnisnahme jener – vom problemorientierten, öffentlichen Migrationsdiskurs ausgeblendeten – Umstände soll es Anliegen dieser wissenschaftlichen Hausarbeit sein, einen durch die Hinzuziehung von Fachliteratur begründeten Überblick über junge türkischstämmige Migranten in Deutschland und deren Lebenswelt zwischen Desintegration und Bildungsaufstieg zu geben. Dementsprechend widmet sich das erste, auf die Einleitung folgende Kapitel der Historie der türkischen ‚Gastarbeiter‘ wie auch verschiedenen Aspekten des Lebens ihrer Nachkommen. Innerhalb jener, die türkischen ‚Gastarbeiter‘ betreffenden Ausführungen erfolgt nebst begriffsgeschichtlichen Erklärungen eine Darstellung der türkischen Arbeitsmigration in die Bundesrepublik Deutschland samt wirtschaftlicher und gesamtgesellschaftlicher Folgen. Neben der über Jahre hinweg unbefriedigenden Betreuung und Unterbringung ausländischer Arbeitskräfte30 werden ebenso die Folgen des in gesamteuropäischer Perspektive zu betrachtenden Anwerbestopps31 wie auch die bis in heutige Zeit kaum genannte Positionierung der Gewerkschaften32 thematisiert. Das sich hieran anschließende Unterkapitel behandelt den ausgiebigen Forschungsstand und bespricht die wissenschaftliche Diskussion um die Nachfahren türkischer ‚Gastarbeiter‘. Hierbei werden zunächst Meinungen zur sozialen und beruflichen Integration wie auch Forschungsperspektiven zur Bedeutung des ethnischen Umfelds junger türkischstämmiger Migranten vorgestellt. Hieran anknüpfend erfolgt eine Vorstellung der Diskussion um die unterschiedlichen Lebensentwürfe junger türkischstämmiger Migranten und deren persönlichen Perspektiven bezüglich ihrer Einbeziehung in die Mehrheitsgesellschaft. Abschließende Darlegungen setzen sich kritisch mit der öffentlich oftmals vorzufindenden „Engführung von kultureller Identität auf das Religiöse“33 und der damit einhergehenden, zumeist zu Ungunsten der muslimischen Bevölkerung verlaufenden „Kategorisierung von Zuwanderern“34 auseinander. Insgesamt hat das erste Kapitel in seiner Gesamtheit den Anspruch, anhand ausgewählter Forschungsbeiträge die damalige Lebenswirklichkeit türkischer ‚Gastarbeiter‘ nachzuzeichnen. Ebenso soll unter Bezugnahme auf einige Aspekte, die an späterer Stelle dieser wissenschaftlichen Hausarbeit erneut aufgegriffen und intensiviert dargestellt werden, die heutige wissenschaftliche Diskussion um ihre Nachkommen veranschaulicht werden. Das hierauf folgende Kapitel widmet sich der Illustration des methodischen Vorgehens. An dieser Stelle sollen zunächst persönliche Forschungsabsichten und Ausgangsthesen, die maßgeblich zu Entstehung und inhaltlichem Aufbau der Arbeit beigetragen haben, vorgestellt werden. Im Anschluss daran folgen Erläuterungen zur Durchführung und Auswertung der selbstgeführten Interviews wie auch eine Erklärung zu deren Stellenwert innerhalb dieser wissenschaftlichen Hausarbeit. Das Hauptaugenmerk jener Ausführungen liegt hierbei sowohl auf einer komprimierten Vorstellung der „Aktualität qualitativer Forschung“35 und deren grundlegenden Prinzipien36 als auch auf der Darstellung grundlegender Kriterien qualitativer Interviews.37 Das nachfolgende Kapitel hat die Vorstellung der Interviewpartner zum Gegenstand. Auf Angaben zur Allgemein- und Bildungsbiografie folgen Schilderungen zum situativen Kontext der Interviews. Innerhalb des sich hieran anschließenden Kapitels liegt der Schwerpunkt der Betrachtung auf der Bildungspartizipation und der sozialen Situation junger türkischstämmiger Migranten in Deutschland. Unter erstmaliger Hinzuziehung ausgewählter Interviewpassagen fokussiert das erste Unterkapitel den Aufbau und Einfluss des sozialen Umfelds und damit einhergehend die Bedeutung intra- und interethnischer Kontakte. Die Auseinandersetzung mit den wissenschaftlich postulierten Vor- und Nachteilen intra- bzw. interethnischer Kontakte38 wird hierbei eingebettet in den Diskurs um die durchaus differenten Voraussetzungen und Wege erfolgreicher Integrationsprozesse.39 Das sich hieran anfügende, zweite Unterkapitel erörtert die Bildungsbeteiligung und berufliche Positionierung junger türkischstämmiger Migranten unter Konsultierung ausgewählter Beiträge und verschiedener Schulleistungsuntersuchungen wie dem Bildungsbericht und der PISA-Studie. Ebenso werden benachteiligende Diskriminierungserfahrungen im schulischen und außerschulischen Kontext besprochen.40 Komplementär zu Darlegungen bezüglich schulischer Diskriminierungserfahrungen und Ausführungen zum Begriff der „institutionellen Diskriminierung“41 erfolgen Schilderungen zu Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen auf dem Arbeitsmarkt. Das hierauf folgende, letzte Gesamtkapitel dieser wissenschaftlichen Hausarbeit behandelt das Familienleben junger türkischstämmiger Migranten in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung mutmaßlich traditionaler Einflüsse. Das erste Unterkapitel hat die Eltern-Kind-Beziehung bzw. die Charakteristika elterlichen Bindungsverhaltens zum Gegenstand. An eine Diskussion bezüglich der familialen „Traditions- und Kulturbildung im Migrationskontext“42 fügen sich Ausführungen zu den insgesamt als Forschungsdesiderat zu bezeichnenden, gestiegenen Bildungsaspirationen türkischstämmiger Familien43 an. Das hierauf folgende, zweite und letzte Unterkapitel bespricht die mutmaßlich religiösen Aspekte innerhalb des Familienlebens. Hierbei werden der Einfluss des Islam als inner- und außerfamiliäre Sozialisationsinstanz wie auch mögliche Säkularisierungstendenzen erörtert. So soll es insgesamt Anspruch dieser wissenschaftlichen Hausarbeit sein, durch Konsultierung nahezu ausschließlich neuerer und neuester Forschungsbeiträge und Studien und unter Zuhilfenahme exemplarischer Interviewpassagen einen fundierten Überblick über die bildungsbezogene und gesamtgesellschaftliche Positionierung junger türkischstämmiger Migranten in der Bundesrepublik Deutschland zu geben. Frei von einer – in Kreisen der Migrationsforschung zuweilen immer noch vorhandenen – einseitigen und unter Umständen nicht zielführenden „defizit- und problemorientierten Sichtweise“44 soll verdeutlicht werden, dass die im Titel der Arbeit genannten Begriffe der ‚Desintegration‘ und des ‚Bildungsaufstiegs‘ nicht als zwei einander ausschließende Extreme, sondern als vielschichtige Konstruktionen mit teils wechselseitigen Bedingungen zu verstehen sind. Die Benennung der einzelnen Ober- und Untergliederungspunkte ist aufgrund ihrer thematischen Bezüge zueinander bewusst offen bzw. nicht kleinschrittig gehalten, die Übergänge zwischen einzelnen Themenfeldern fließend gestaltet. Um den Erzählfluss der Arbeit zu wahren und den Rahmen nicht zu übersteigen, beschränken sich die vereinzelte Kritik an Forschungsmeinungen wie auch weiterführende Verweise auf Anmerkungen in den Fußnoten.
1Die vom Statistischen Bundesamt durchgeführte Erhebung namens Mikrozensus verzeichnet für das Jahr 2012 ca. 3 Millionen in Deutschland lebende Personen mit türkischem Migrationshintergrund (Statistisches Bundesamt 2013, S. 123). Von allen türkischstämmigen Personen in Deutschland besaßen im Jahr 2013 ca. 1,5 Millionen Personen die türkische Staatsangehörigkeit (Statistisches Bundesamt 2014, S. 37.)
2Weiss 2014, S. 71.
3Berking 2010, S. 298.
4Bade 2007, S. 44.
5Tepecik 2012, S. 126.
6Madubuko 2011, S. 25
7Canan 2012, S. 136.
8Bade 2013, S. 147.
9Pott 2009, S. 47.
10Vgl. Riegel 2009, S. 23.
11Gestring / Janßen / Polat 2006, S. 11.
12Schneider / Fincke / Will 2013, S. 6.
13Vgl. Diehm / Panagiotopoulou 2011, S. 9.
14Farsi 2012, S. 38.
15Vgl. Tepecik 2013, S. 61.
16Vgl. Diefenbach 2008, S. 221; vgl. Geisen 2010, S. 27.
17Wenn in den nachfolgenden Ausführungen von ‚Schülern‘ die Rede ist, sind damit sowohl männliche als auch weibliche Lernende gemeint. Die Einbeziehung weiblicher Beteiligter gilt innerhalb dieser wissenschaftlichen Hausarbeit selbstverständlich auch für alle weiteren Begriffsbezeichnungen.
18Sürig / Wilmes 2014, S. 21.
19Vgl. Rotter 2014, S. 23.
20Tepecik 2011, S. 23.
21Diefenbach 2010, S. 148.
22Stürzer 2014, S. 44.
23Fereidooni 2011, S. 25
24Unterwurzacher 2007, S. 76.
25Römhild 2007, S. 161.
26Vgl. Schmidt-Bernhardt 2008, S. 176.
27Kniffka / Siebert-Ott 2007, S. 26.
28Vester 2013, S. 99.
29Ditton 2010, S. 60.
30Vgl. Knortz 2008, S. 49
31Vgl. Berlinghoff 2012, S. 149.
32Vgl. Trede 2012, S. 184.
33Diehm 2010, S. 59.
34Schneider / Fincke / Will 2013, S. 8.
35Flick 2011, S. 22.
36Vgl. Helfferich 2011, S. 21.
37Vgl. Dresing / Pehl 2013, S. 9 – 14.
38Vgl. Weiss / Strodl 2007, S. 97.
39Vgl. Held 2009, S. 123.
40Vgl. Rohr 2011, S. 87 – 110: Rohr bespricht und diskutiert hier einen massiven Fall von unter anderem rassistisch konnotierten Übergriffen auf eine kurdische Schülerin samt der diesbezüglichen Handlungsunfähigkeit der Lehrkräfte gegenüber den tatbeteiligten Mitschülern.
41Gomolla / Radtke 2009, S. 35.
42Kaya 2010, S. 209.
43Vgl. Relikowski 2012, S. 32.
44Sievers / Griese / Schulte 2010, S. 14.
2Geschichte der türkischen ‚Gastarbeiter‘ in Deutschland und Aspekte des Lebens ihrer Nachkommen
2.1Türkische ‚Gastarbeiter‘ im Deutschland des 20. Jahrhunderts
Seit Beginn des 21. Jahrhunderts hat die wissenschaftliche Erforschung der Anfänge, Bedingungen und Folgen der modernen innerdeutschen Arbeitsmigration an Bedeutung gewonnen: Als hierfür verantwortliche Impulse zeigen sich – neben der Aufhebung diesbezüglicher Archivsperrfristen ab den 1990er-Jahren45 – unter anderem jene bereits angesprochenen, öffentlichen und politischen Debatten um die Integration junger Migranten wie auch die staatlicherseits organisierten Feierlichkeiten anlässlich der „Jahrestage der Anwerbeverträge der Bundesrepublik Deutschland mit Spanien und Griechenland (1960 / 2010) und der Türkei (1961 / 2011)“46. Nach Jahrzehnten der Vernachlässigung deutete sich in den 1970er- bzw. 1980er-Jahren eine zunächst zögerliche Wiederbelebung der Historischen Migrationsforschung an,47 welche zu einer – sich auch aktuell noch vollziehenden – allmählichen Annäherung von Arbeitsmarkt- und Migrationsforschung48 führte. Die Erkenntnisse der Historischen Migrationsforschung des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts integrierend, stellt Sonnenberger 2003 in präzise gehaltener und für das weitere Verständnis dieses Unterkapitels maßgeblicher Form fest:
„Eine ‚Stunde Null‘ der Ausländerbeschäftigung hat es in der Bundesrepublik nicht gegeben. Die Anfänge der Arbeitsmigration in die Bundesrepublik lassen sich vielmehr in zwei historische Entwicklungslinien einbetten: die langfristige Entwicklung Deutschlands vom Auswanderungs- zum Einwanderungsland und die Geschichte der Ausländerbeschäftigung in Deutschland als Teil der deutschen Arbeitergeschichte“49.
Die von Sonnenberger 2003 thematisierte Auswanderung aus der Bundesrepublik Deutschland erweist sich insbesondere im Rahmen öffentlicher Debatten um Migration wie auch innerhalb des kulturellen Gedächtnisses50 als kaum wahrgenommene und im Vergleich zur Einwanderung weniger ausführlich erforschte „andere Seite der Medaille Migration“51. Bezüglich des Zusammenhangs zwischen Ein- und Auswanderung innerhalb deutschsprachiger Gebiete stellt Bade / Oltmer 2004 korrekterweise fest: „Der deutschsprachige Raum war (…) in seiner Geschichte selten Aus- oder Einwanderungsland allein, sondern zumeist beides zugleich (…)“52. Als exemplarische Beispiele der im heutigen öffentlichen Bewusstsein kaum präsenten Auswanderung aus deutschsprachigen Gebieten seien etwa die vom 17. bis 19. Jahrhundert währende, mannigfaltige Ansiedlung deutscher Einwanderer in Russland,53 die millionenfache überseeische Auswanderung im 19. und frühen 20. Jahrhundert54 wie auch die mit möglichst ausgiebiger, finanzieller Ausplünderung verbundene Flucht55 vorwiegend jüdischer Bürger aus dem Deutschland der NS-Zeit genannt. Überdies sind die Auswanderungsbestrebungen zahlreicher Deutscher in der unmittelbaren Nachkriegszeit wie auch die damit zusammenhänge, bis in die 1950er-Jahre hineinreichende aktive Auswanderungspolitik der jungen Bundesrepublik in nahezu allumfassende Vergessenheit geraten.56 Komplementär zu jenen beständigen Auswanderungsbewegungen zeigte sich das deutschsprachige Gebiet ebenso als Ziel diverser, kontinuierlich verlaufender Einwanderungsbewegungen: Exemplarisch genannt seien hier der ca. ab den 1870er-Jahren beginnende, mannigfaltige Zuzug sogenannter ‚Ruhrpolen‘57, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert stark ausgeprägte Einwanderung italienischer Arbeitskräfte in den süd- bzw. westdeutschen Raum58 wie auch die zwischen 1888 und 1915 verlaufende Immigration zehntausender russlanddeutscher Siedler in das Territorium des Deutschen Kaiserreiches.59 Überdies sind der millionenfache Zwangsarbeitereinsatz ‚feindlicher Ausländer‘ im 1. Weltkrieg,60 die daraus folgende, ausländerspezifische „Verrechtlichung des Arbeitsmarktes“61 zwischen 1918 und 1933, der in den Friedensjahren des Nationalsozialismus einsetzende ‚Fremdarbeiter‘- bzw. ‚Ausländereinsatz‘62 wie auch die sich zu Kriegszeiten anschließende, millionenfache Verwendung jüdischer bzw. ‚fremdländischer‘ Zwangsarbeiter unabdingbarer Bestandteil deutscher Arbeitsmarkt- und Migrationsgeschichte. Im Rahmen der auf den Nationalsozialismus folgenden staatspolitischen und gesellschaftlichen Neuerungen sind die frühen 1950er-Jahre aus heutiger Sicht als „migrationspolitische Zeitenwende“63 zu bezeichnen: Als direkte Folge umfassender Kriegszerstörungen, neuer Grenzziehungen und millionenfacher Vertreibung entwickelte sich insbesondere Westeuropa unmittelbar nach 1945 zu einem „Kontinent wandernder Arbeitskräfte“64. Im Zuge der überwiegenden Heimkehr ehemaliger Zwangsarbeiter,65 des sprunghaften Anstiegs westdeutschen Außenhandels66 und dem damit einhergehenden Bedürfnis der jungen Bundesrepublik nach bedeutsamen außenpolitischen Kontakten67 manifestierte sich das Ansinnen der Bundesregierung, „die Anwerbung von Arbeitskräften im Ausland vorzubereiten“68. Zudem nährten das anhaltende Auswanderungsbestreben vor allem gut qualifizierter Staatsbürger und die aufgrund junger Kriegsgefallener gemutmaßte Vergreisung der Bevölkerung samt eventueller Wiedereinführung der Wehrpflicht die bundesdeutsche Vorstellung eines bevorstehenden Arbeitskräftemangels.69 Im Zusammenhang mit der bedächtig beginnenden Europäischen Integration setzte sich die Bundesregierung durch die Unterzeichnung des ‚Vertrags der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft‘ im Jahr 1952 sowie durch einen Beschluss der ‚Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit‘ (OEEC) vom Oktober 1953 erstmals auf zwischenstaatlicher Ebene mit der möglichen Anwerbung ausländischer Arbeitnehmer auseinander.70 Im Einfluss jener Entwicklungen kam es 1954 zu ersten arbeitsmarktpolitischen Gesprächen zwischen der deutschen und der italienischen Regierung, in deren Folge „am 22. Dezember 1955 (…) in Rom das deutsch-italienische Anwerbeabkommen geschlossen“71 wurde – „die Ära der ‚Gastarbeiter‘-Zuwanderung begann“72. Auf die gegenüber der Ausländerbeschäftigung hervorgebrachte Skepsis diverser Gewerkschaften73 und das stellenweise am „homogen idealisierten Vorkriegszustand“74 orientierte Denken der einheimischen Bevölkerung reagierte die Bundesregierung mit dahingehenden Verweisen, dass die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer nur vorübergehend und keineswegs auf Dauer angelegt sei.75 Bedenken der Einheimischen und verschiedener Gewerkschaftsvertreter zum Trotz bildete die Übereinkunft zwischen Deutschland und Italien die Grundlage für den sich zusehends etablierenden Gebrauch von Anwerbeabkommen als „zentralem migrationspolitischem Instrument“76. Angesichts arbeitsmarktpolitischer Interessen folgten 1960 das Anwerbeabkommen mit Spanien und Griechenland77 und mit Beginn der Einführung der „Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)“78 im Jahr 1961 schließlich das Anwerbeabkommen mit der Türkei.79 Beeinflusst von den gesellschaftspolitischen und migrationsspezifischen Veränderungen infolge des Mauerbaus80 im Jahr 1961 wie auch aufgrund außenpolitischen Kalküls81 folgten weitere Anwerbeabkommen mit folgenden Staaten: Marokko (1963), Portugal (1964), Tunesien (1965) und Jugoslawien (1968).82 Gegenüber der Türkei offenbarte sich die – am „Europäergrundsatz“83 orientierte – Anwerbepraxis der Bundesrepublik Deutschland anfangs äußerst zögerlich:84 Innerhalb offizieller diplomatischer Noten wurde statt von ‚Anwerbung‘ lediglich von der ‚Vermittlung‘ türkischer Arbeitnehmer gesprochen, ebenso wurde die Dauer des Aufenthalts auf maximal zwei Jahre beschränkt.85 Derlei Einschränkungen für türkische Arbeitnehmer entfielen erst im Jahr 1964: Nach ersten, bereits 1962 erfolgten Beschwerden deutscher Arbeitgeber bezüglich der maximal zweijährigen Aufenthaltsdauer wurde 1964 die Neufassung der deutsch-türkischen Vereinbarung, welche diverse Reglementarien aufhob, verabschiedet.86 Erleichterungen dieser Art zum Trotz sahen sich die türkischen wie auch ‚Gastarbeiter‘ im Allgemeinen bereits frühzeitig gesellschaftlichen und politischen Widrigkeiten ausgesetzt – auf politischer Weisungsebene wurde durch die Innenminister der Länder bereits 1965 abermals die Bevorzugung europäischer ‚Gastarbeiter‘ bekräftigt und unter anderem der Ausschluss ‚dunkelhäutiger‘ Portugiesen diskutiert.87 Im Verlauf der gesamten 1960er-Jahre verhinderte „der Primat des wirtschaftlichen Interesses an einem dynamischen Wirtschaftsaufschwung“88 jegliche Diskussionen um eine soziale Integration der ‚Gastarbeiter‘ – im Vordergrund politischer und öffentlicher Debatten standen vielmehr dahingehende Überlegungen, wie man den ausländischen Arbeitnehmern „ihre Rückkehr und Wiedereingliederung in die Gesellschaft des Herkunftslandes erleichtern könne“89. Die als „Konjunkturpuffer“90 fungierenden bzw. als „mobile Reservearmee des westdeutschen Arbeitsmarktes“91 betrachteten ausländischen Arbeitnehmer waren überdies teils offenen Anfeindungen der Gewerkschaften92 wie auch rassistischen Denkmustern der einheimischen Bevölkerung93 ausgesetzt. Die in der deutschen Öffentlichkeit virulente und von Seiten politischer Amtsinhaber bekräftigte Vorstellung eines nur vorübergehenden Aufenthalts ausländischer Arbeitnehmer bedingte bereits frühzeitig ein Aus- und Abgrenzungsdenken der Mehrheitsbevölkerung und schlug sich schließlich im Aufkommen von „Bezeichnungen wie ‚Gastarbeiter‘, ‚Ausländer‘, ‚ausländischer Mitbürger‘ und schließlich ‚Fremde‘“94 nieder. Bezüglich jener – den aus NS-Zeiten vorbelasteten Begriff des ‚Fremdarbeiters‘ ab 1961 verdrängenden95 – umstrittenen und daher innerhalb dieser wissenschaftlichen Hausarbeit konsequent in Anführungszeichen gesetzten Bezeichnung ausländischer Arbeitnehmer als ‚Gastarbeiter‘ führt Hunn 2005 aus:
„In der bundesdeutschen Öffentlichkeit wurden die Arbeitsmigranten (…) bis weit in die sechziger Jahre pauschal als ‚Gastarbeiter‘ wahrgenommen. Dieser Begriff implizierte, dass es sich dabei um Menschen handelte, die bäuerlich, rückständig, arm, ungebildet und anspruchslos waren. Siegfried Balke von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) beispielsweise wies 1965 darauf hin, dass die aus den Mittelmeerländern stammenden Arbeitnehmer aus verkehrsarmen, dünn besiedelten und kaum industrialisierten Gebieten (…) in eine hochindustrialisierte Gesellschaft gekommen seien – eine generalisierende Annahme, die die unterschiedlichen sozialen Hintergründe und Migrationsmotive der Migranten ignorierte“96.
Korrespondierend zu jenen Feststellungen verweist Knortz 2008 auf die – ab den frühen 1960er-Jahren einsetzende – behördliche und mediale Etablierung der Bezeichnung ‚Gastarbeiter‘ und die damit einhergehende, zusehende ideologische Determiniertheit des Begriffs.97 Die Folgen des – auf baldige Rückkehr ausgelegten – gesellschaftspolitischen Umgangs mit den ‚Gastarbeitern‘ äußerten sich unter anderem in deren zumeist unzumutbaren Unterkunftsbedingungen.98 In den 1950er- und 1960er-Jahren lebte ein Großteil der ‚Gastarbeiter‘ in Gemeinschaftsunterkünften ohne Kontakte zur einheimischen Bevölkerung.99 Insbesondere die türkischen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen,100 die zu Beginn der Anwerbung überwiegend aus Städten wie Ankara oder Istanbul stammten,101 zeigten sich aufgrund der Beschaffenheit ihrer Unterkünfte schockiert und bei weitem nicht derart anspruchslos, wie gemeinhin angenommen.102 Überdies waren vor allem die türkischen Arbeitnehmer bereits bei ihrer Ankunft in Deutschland fundierter ausgebildet als allgemein angenommen – ihr „Anteil an qualifizierten Arbeitnehmern lag (…) auch auf längere Sicht mit 30,9 Prozent deutlich höher als bei den Spaniern (7,7), Griechen (8,9), Portugiesen (22,3) oder Italienern (23,3)“103. Unabhängig ihrer nur teilweise berücksichtigten Vorqualifikationen104 wurde ein überwiegender Anteil der türkischen Arbeitnehmer in einfach gehaltenen industriellen Tätigkeitsfeldern eingesetzt und mit teils nur schwer erträglichen Arbeitsbedingungen konfrontiert.105 An die überwiegende Nichtbeachtung ihrer Vorqualifikationen und die unbefriedigende Unterbringungssituation anknüpfend, wurden türkische Arbeitnehmer zusehends als Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt106 wie auch als Ursache einer mutmaßlich gestiegenen Kriminalitätsrate betrachtet.107 Gekommen aus Motiven der finanziellen Sicherheit und bewegt durch den Wunsch nach positiven Berufsperspektiven und individueller Unabhängigkeit,108 sahen sich die türkischen ‚Gastarbeiter‘ im Rahmen der konjunkturellen Rezession von 1966 / 67 verstärkten Anfeindungen ausgesetzt: Neben einer kurzweiligen Unterbrechung sämtlicher Anwerbemaßnahmen äußerte sich dies allen voran in den aufkommenden, medialen und politischen Diskussionen „um die Kosten und Nutzen der ‚Ausländerbeschäftigung‘“109. Die zunächst noch arbeitsmarktpolitisch akzentuierten Diskussionen110 legten ihr Hauptaugenmerk auf das mutmaßlich durch den Einsatz ausländischer Arbeitnehmer verursachte Modernisierungsdefizit der Industrie wie auch auf die Kosten im Falle eines dauerhaften Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland.111 Stellenweise wurden türkische Arbeitnehmer mit kurzfristigen Gehaltskürzungen und Entlassungen konfrontiert, eine hieraus in der Türkei entstehende Debatte kritisierte,
„dass die türkischen Auslandsarbeiter wegen ihrer sprachlichen Isolierung und der Unkenntnis ihrer Rechte sowie mangels einer gewerkschaftlichen oder sonstigen Interessenvertretung dieser Situation hilflos ausgeliefert seien“112.
Nach der Überwindung der kurzzeitigen Rezession von 1966 / 67 und einem zeitweiligen Anstieg der Anwerberaten113 wurden ab Ende der 1960er-Jahre die Einreisebedingungen für ausländische Arbeitnehmer zusehends eingeschränkt.114 Verbunden mit dem allmählichen Niedergang der „alten Industrien (Eisen- und Stahlindustrie, Textilindustrie, Bergbau)“115, erfolgte zu Beginn der 1970er-Jahre eine – sämtliche Anwerbestaaten betreffende – Einschränkung der Zuzugsmöglichkeiten und ein damit einhergehender „Europäisierungsprozess der Migrationspolitik“116: Dies zeigte sich unter anderem in zuwanderungsfeindlichen Debatten in den Niederlanden und der Schweiz wie auch durch das 1971 erlassene, verschärfte Einwanderungsgesetz Großbritanniens.117 Innerhalb Deutschlands wurde die mediale und politische Diskussion um die ‚Ausländerfrage‘ unter anderem durch die Anschläge auf die Olympischen Spiele 1972, die darauf folgende, massenhafte Ausweisung mutmaßlicher Araber wie auch durch zuwanderungsfeindliche Äußerungen Willy Brandts intensiviert.118 In Folge jener Entwicklungen und der damit einhergehenden Befürchtung sozialer Unruhen119 wurde unter politischer Ausnutzung der Ölpreiskrise120 im November 1973 schließlich der „Anwerbestopp von ‚Gastarbeitern‘ aus Nicht-EG Ländern“121 erlassen: Jene Beschränkung betraf unter anderem Herkunftsländer wie Griechenland, Spanien und die Türkei und war als erste zuwanderungspolitische Entscheidung nicht von wirtschaftlichen bzw. außenpolitischen Interessen bestimmt, sondern tatsächlich „ein Ergebnis vorwiegend migrationspolitischer Entscheidungen“122. Auf die betriebliche Umsetzung der von der Bundesanstalt für Arbeit angeordneten, „strengen Beachtung des Inländerprimats“123 folgten – begleitet durch nationalistische Pressekampagnen, gewalttätige Konflikte zwischen deutschen und türkischen Arbeitnehmern124 und völkisch orientierte Forschungsbeiträge125 – Massenentlassungen türkischer Arbeitnehmer und die daraus resultierende Weigerung, Aufenthaltsgenehmigungen zu verlängern. Derartige Vorgehen wie auch die Maßnahme des Anwerbestopps im Allgemeinen führten jedoch nicht zur erhofften Rückkehr ausländischer Arbeitnehmer, die generelle Rückkehrbereitschaft war geringer als erwartet.126 Vielmehr bekräftigten die eingestellten Anwerbemaßnahmen die Bleibeabsichten ausländischer Arbeitnehmer – „denn Ausländer, die ihre Arbeitsverhältnisse beendeten, um für einige Zeit in ihre Heimat zurückzukehren, hatten meist keine Chance mehr, erneut als Arbeitswanderer zugelassen zu werden“127. Als Reaktion auf derlei Richtlinien nutzten im Verlauf der 1970er- und 1980er-Jahre allen voran die – sich besonders unsicher fühlenden – türkischen Arbeitnehmer128 die Möglichkeit des Familiennachzugs: „Aus temporär anwesenden, überwiegend männlichen und jungen Gastarbeitern wurden De-facto-Einwanderer mit Familie“129. Der sprunghafte Anstieg türkischer Zuwanderer, der durch politische Unruhen in der Türkei der 1980er-Jahre abermals verstärkt wurde,130 hatte auch deren Konzentration in diversen, zumeist preisgünstigen Stadtbezirken und Wohnquartieren zur Folge.131 Zudem übertrug sich das bisher nahezu nur innerbetrieblich ausgelebte Konkurrenzdenken zwischen deutschen und ausländischen Arbeitnehmern nun auf weitreichende gesellschaftliche Bereiche wie bspw. „Kindergartenplätze, Krankenhausbetten und Lehrstellen“132. Auf das 1973 besiegelte, vorübergehende Ende der arbeitsmarktpolitischen Migration in die Bundesrepublik Deutschland folgten bis weit in die 1980er-Jahre hinein Formen des familiären Nachzugs und die verstärkt aufkommende Asylmigration.133 Die in Deutschland verbliebenen ‚Gastarbeiter‘ sahen sich weiterhin gesellschaftspolitischen Diskriminierungen ausgesetzt: An die von 1981 bis 1984 etablierte Politik der Rückkehrförderung134 schloss sich die rigide Ausländerpolitik der Regierung Kohl samt der Nichtanerkennung der innerdeutschen Einwanderungssituation bis weit in die 1990er-Jahre an.135 Insbesondere türkische Arbeitnehmer und deren Familien wurden innerhalb medialer und politischer Diskussionen „in borniertem Beharren auf (…) der Leitkultur“136 als außerordentlich „fremd und weder integrationsbereit noch -fähig von den anderen Ausländergruppen abgesetzt“137. Auf die ausländerfeindlichen Pogrome der 1990er-Jahre und die teils hitzig geführten Debatten um das Asylrecht138 folgte die zögerliche politische Selbstanerkennung Deutschlands als Einwanderungsland ab den Jahren 2000 / 2001.139 Die folgenden Kapitel und Unterkapitel dieser wissenschaftlichen Hausarbeit sollen verdeutlichen, dass die insgesamt verspätete „Entdeckung der Einwanderung“140 und die daraus resultierende, „nachholende Integrationspolitik“141 integrationshemmende Faktoren wie beispielsweise die räumliche Segregation förderte und sich unmittelbar auf die Lebensbedingungen nachfolgender Generationen auswirkte.
2.2Die Kinder der ‚Gastarbeiter‘ – Die wissenschaftliche Diskussion um die zweite und dritte Generation türkischstämmiger Migranten in Deutschland
Nachdem sich die innerdeutsche Forschungslandschaft von der in den 1970er-Jahren aufkommenden ‚Gastarbeiter‘- bzw. ‚Ausländerforschung‘ emanzipiert und im Verlauf der letzten Jahre verschiedenste, regionalhistorische und kulturwissenschaftlich-soziologische Beiträge zur ersten Generation türkischer ‚Gastarbeiter‘ hervorgebracht hat, zeigt sich ein mindestens ebenso ausgeprägtes, öffentliches und wissenschaftliches Interesse an ihren Nachfahren. Die medialen Diskussionen wie auch die wissenschaftlichen Beiträge orientieren sich hierbei überwiegend an Aspekten der Bildungsbeteiligung, familiären Lebensführung und gesamtgesellschaftlichen Integration. Bezüglich der Bildungsbeteiligung türkischstämmiger Migrantenkinder führten der sogenannte ‚PISA-Schock‘ im Jahr 2000 und die hierauf folgenden, mannigfaltigen Forschungsbeiträge zu der wissenschaftlich mittlerweile etablierten Bewusstwerdung eines „außerordentlich strikten Zusammenhangs zwischen sozialer Herkunft, Migrationshintergrund, unzureichenden Schülerleistungen und formalen Schul(miss)erfolgen“142 innerhalb des deutschen Schulsystems. Türkischstämmige Schüler besuchen nach der Grundschule überproportional häufig zunächst eine Hauptschule,143 auch unter Jugendlichen und jungen Erwachsen weisen – wie der Bildungsbericht bzw. die Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2012 feststellt – „vor allem Migranten aus der Türkei (…) weiterhin deutlich geringere Bildungsbeteiligungsquoten auf als sonstige Migranten“144. Derartige Feststellungen haben neben der Genese medialer und politischer Debatten gleichermaßen die Herausbildung einer wissenschaftlich fundierten Ursachenforschung bezüglich der Bildungsbeteiligung türkischstämmiger Schüler bewirkt: Nebst bereits familiär bedingten Faktoren wie mutmaßlich gering ausgeprägten Deutschkenntnissen, dem selteneren Besuch von Kindertagesstätten145 und der stellenweise benachteiligenden „Ressourcenausstattung im Elternhaus (ökonomisch, kulturell und sozial)“146 werden zusehends grundlegende Mechanismen und Bestandteile des Schul- und Bildungssystems als Erklärungsmuster für ungleiche Bildungsbeteiligungen herangezogen. Unter der theoretischen Annahme einer „zentralen Strukturierungswirkung vor allem staatlicher Institutionen für individuelle Lebensläufe“147 widmet sich die Forschung seit den 2000er-Jahren ausführlich diversen Aspekten der systemimmanenten bzw. institutionellen Diskriminierung. Als diesbezüglich grundlegend richtungsweisender Beitrag gilt Gomolla / Radtke 2009: Unter exemplarischer Einbeziehung sozialpsychologischer Erklärungsansätze und historischer Begebenheiten der ausländerspezifischen Schul- und Unterrichtsentwicklung werden unter anderem die Entstehungsbedingungen und der Facettenreichtum institutioneller Diskriminierung dargestellt und begründet.148 Während Ditton 2008 in Anlehnung an Gomolla / Radtke 2009 den spezifischen Beitrag von Lehrkräften zum Fortleben der Bildungsungleichheit untersucht149 und Weber 2009 in diesem Kontext gar die innerschulische „Dramatisierung geschlechtlicher und ethnischer Differenzen“150 feststellt, untersucht Becker 2006 die innerdeutsche Bildungsungleichheit als mögliche Folge der generellen Bildungsexpansion.151 Überdies analysiert Relikowski 2012 den mutmaßlich negativen Einfluss des Migrationshintergrundes auf die schulische Übergangsempfehlung nach der Grundschulzeit,152 während Gomolla 2012 in ähnlichem Kontext die schulische Leistungsbeurteilung als selektierend und stellenweise diskriminierend herausstellt.153 Als bildungspolitische Lösungsansätze jener Diskriminierungs- bzw. Ungleichheitstendenzen werden nahezu einhellig die frühzeitig beginnende und intensivierte Sprachförderung, der Ausbau des Ganztagsschulwesens einschließlich verstärkter Einbeziehung der Eltern,154 der zu steigernde Einsatz von Lehrkräften mit Migrationshintergrund155 wie auch speziell migrationspädagogisch ausgelegte Förderansätze156 diskutiert. An Aspekte schulischer Bedingungen anknüpfend widmet sich die wissenschaftliche Diskussion zusehends der – über Jahrzehnte hinweg vernachlässigten – Auseinandersetzung mit türkischstämmigen Bildungsaufsteigern157 und den jeweiligen Bedingungen ihres Aufstiegs. In diesem Zusammenhang wird unter anderem auf die insgesamt verbesserte Bildungsqualifikation im Vergleich zur Elterngeneration,158 den signifikanten Anstieg türkischstämmiger Studierender seit den 1980er-Jahren159 und die damit einhergehenden, deutlich gestiegenen Bildungsaspirationen und -investitionen türkischstämmiger Eltern160 verwiesen. Jene Beiträge, welche als Folge der in den 1990er-Jahren eingetretenen, generellen Abkehr der Migrationsforschung von der kulturell begründeten Defizit-Hypothese161 zu verstehen sind, werden komplettiert durch Abhandlungen, die das migrationsspezifische Bildungspotential fokussieren: In diesem Zusammenhang thematisiert Tepecik 2013 unter Verweis auf eigene Studien innerfamiliäre, bildungsförderliche Ressourcen unter Berücksichtigung zwischengenerationaler Transmissionsprozesse.162 Korrespondierend dazu konkretisiert Hummrich 2009 unter Verweis auf empirisches Material die Bedingungen unerwartet positiver Bildungsbiografien und stellt gleichsam deren Relevanz für die Bildungsforschung heraus.163 Im Einfluss derartig orientierter Beiträge offenbart sich überdies die allmähliche Ausprägung einer „geschlechtsspezifischen Perspektive“164: Während sich bspw. Diefenbach 2011 dem – innerhalb der Bevölkerung mit Migrationshintergrund mutmaßlich virulenten – bildungsspezifischen „Geschlechtereffekt zu Ungunsten von Frauen“165 widmet und Granato 2014 in diesem Zusammenhang gar eine konstante „Hartnäckigkeit der Geschlechterungleichheit“166 feststellt, analysiert Pott 2009 die Bedingungen des Bildungsaufstiegs vornehmlich türkischstämmiger Migrantinnen.167 Komplementär zu Pott 2009 fokussiert Günther 2009 in geschlechtsspezifischer Perspektive Formen weiblichen Bildungsaufstiegs unter Berücksichtigung familialer Ressourcen.168 Jenen – vermehrt auftretenden – geschlechtsspezifisch orientierten Betrachtungsweisen gehen Untersuchungen zu den familiären Lebensbedingungen junger türkischstämmiger Migranten voraus: Derartige Beiträge fokussieren zumeist den eventuellen intergenerationalen Wertewandel,169 allgemeine Aspekte elterlichen Bindungsverhaltens170 und daran anknüpfend die mutmaßlich different ausgeprägten Erziehungsstile türkischstämmiger Familien.171 Zwecks der Untersuchung der Eltern-Kind-Beziehung werden hierbei oftmals Faktoren der Traditions- und Kulturbildung im Kontext der Migration bzw. der erzieherische Einfluss der elterlichen „Herkunftskultur“172 wie auch möglicherweise kulturell bedingte Erziehungskonflikte173 als Analysekategorien herangezogen. Als Folge jener – auf die Untersuchung innerfamiliärer bzw. individueller Beziehungsmuster ausgelegten – Beiträge mehren sich die Abhandlungen bezüglich der Sozialisationsbedingungen vornehmlich männlicher, türkischstämmiger Jugendlicher und junger Erwachsener: Während bspw. Römhild 2007 die Entstehungs- und Ausübungsbedingungen ethnisierender Denkmuster im Kontext der Einwanderungsgesellschaft untersucht,174 analysieren Toprak 2007 und Weber 2010 die mutmaßlich von Gesichtspunkten der Ethnisierung und Ethnizität beeinflussten Selbst- und Fremdwahrnehmungen sowie die teilweise daraus resultierenden Männlichkeitsinszenierungen junger türkischstämmiger Männer.175 Mit an solcherlei Analysekategorien orientierten Beiträgen gehen Abhandlungen bezüglich der Identitätskonstruktionen junger türkischstämmiger Migranten einher: Zumeist ausgehend von der Existenz eines identitätsstiftenden, vielschichtig konzipierten Konstrukts der „Transkulturalität“176 werden diesbezüglich die Identitätsarbeit und -entwicklung junger türkischstämmiger Migranten bzw. deren Selbstverwirklichung innerhalb transnational ausgestalteter Räume177 untersucht. Im Einfluss dieser identitätsfokussierenden Beiträge mehren sich überdies die wissenschaftlichen Auseinandersetzungen bezüglich des Begriffs des Migrationshintergrundes: Chudaske 2012 verweist in diesem Zusammenhang auf die verschiedenen Definitionen des Migrationshintergrundes innerhalb diverser Schulleistungsstudien und amtlicher Statistiken.178 Ausführlicher widmet sich Settelmeyer / Erbe 2010 der mannigfaltigen, teils verwirrenden Operationalisierung des Begriffs samt den Folgen für die Vergleichbarkeit bildungswissenschaftlicher Studien.179 Die weitergehende Auseinandersetzung mit migrationsbedingten Lebenswirklichkeiten bzw. die Erforschung differenter Identitätskonstruktionen vollzieht sich hierbei nicht selten unter Einbeziehung des sozialen bzw. außerfamiliären Umfelds – angelehnt an die Grundsatzdebatte zwischen Hartmut Esser und Georg Elwert über die integrationsspezifischen Vor- bzw. Nachteile ethnischer Gemeinschaften thematisieren diverse Beiträge die Entstehungsbedingungen und Folgen intra- bzw. interethnischer Netzwerke: Mecheril / Hoffarth 2009 verweist auf die Wichtigkeit adoleszenter Zugehörigkeitsvorstellungen im Kontext von Migration,180 während Weiss / Strodl 2007 unter Diskussion der generellen Integrations- und Assimilationsbereitschaft unter anderem die Einflussfaktoren von Freundschaftswahlen analysiert.181 Gestring / Janßen / Polat 2006 widmet sich gezielt dem Sozialleben junger türkischstämmiger Migranten und thematisiert hierbei unter anderem die generelle Funktion intraethnischer Netzwerke wie auch die möglichen Folgen für die persönliche Wohnsituation und den beruflichen Werdegang.182 An die zumeist an männlichen türkischstämmigen Migranten orientierten Beiträge um Aufbau und Einflüsse des sozialen Umfelds fügen sich – zumeist religiöse Einflüsse betrachtende – Abhandlungen bezüglich der Lebensentwürfe junger türkischstämmiger Frauen an: In diesem Kontext untersucht Migallon 2006 unter Hinzuziehung qualitativer Daten unter anderem die Bedeutung muslimischer Erziehung auf die Ausbildung weiblicher Lebensformen.183 Demgegenüber fokussiert Riegel 2010 die teils schwierigen Familienbedingungen speziell junger türkischstämmiger Migrantinnen bei gleichzeitiger Kritik an deren oftmaliger, stereotyper Viktimisierung durch die innerdeutsche Mehrheitsgesellschaft.184 Überdies setzt sich Gerlach 2006 mit dem seit Mitte der 2000er-Jahre aufkommenden, neologistischen Konstrukt der ‚Neo-Muslima‘ auseinander und diskutiert hierbei die mögliche Existenz und Formen eines modernisiert anmutenden ‚Pop-Islam‘ als alternativ-jungmuslimischer Lebensform.185 Als Ergänzung zur Auseinandersetzung um die verschiedenen Lebensstile junger Muslime zeigt sich die Frage nach der lebensweltlichen Bedeutung des Islam im Allgemeinen: Während Franz 2013 in diesem Kontext die Bedeutung des Islam für die Erforschung biografischer Prozesse thematisiert,186 setzt sich Khorchide 2007 konkret mit der alltäglichen Relevanz des Islam für junge Muslime auseinander.187 Den innerschulischen Stand des Islam bzw. mögliche, vom schulischen Islamunterricht ausgehende Modernisierungstendenzen analysiert Khalfaoui 2010.188 An die Diskussion um den Stellenwert des Islam und verschiedener Lebensformen und deren Legitimität fügen sich Abhandlungen zur Definition und Operationalisierung des Integrationsbegriffs an: Während Riegel 2009 auf die Umstrittenheit des Begriffs verweist und seinen Nutzen innerhalb der Migrationsforschung in Frage stellt,189 unterscheidet Esser 2001 zwischen System- und Sozialintegration und stellt hierbei ein konkretes Modell der sozialen Integration vor, welches die Kategorien der Kulturation, Platzierung, Interaktion und Identifikation umfasst190 und die Beurteilung verschiedener Integrationsverläufe erleichtern soll. Demgegenüber thematisiert Sökefeld 2007 die stets zu bedenkende Anfechtbarkeit diverser Integrationsvorstellungen und die damit einhergehende, generelle Problematik von Begriffen wie denjenigen der ‚Ethnizität‘, ‚Kultur‘ und ‚Minderheit‘.191 Im Einfluss jener Diskussionen um den Integrationsbegriff und damit verbundenen Vorstellungen mehren sich jene Beiträge, die von der Mehrheitsgesellschaft ausgehende Integrationsvorbehalte thematisieren: Schneider / Fincke / Will 2013 verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass einheimische Deutsche ohne Migrationshintergrund nur selten den privaten Kontakt zu Personen mit muslimischem Migrationshintergrund suchen.192 Darüber hinaus untersucht Gieler 2008 weitverbreitete Stereotype der deutschen Mehrheitsbevölkerung bzw. die ethnozentrischen Grundlagen deutschen Fremdverstehens.193 Korrespondierend dazu verweist Sentürk 2012 auf die oftmals stereotype, mediale Berichterstattung und die damit einhergehende, besonders negativ konnotierte Darstellung vornehmlich türkischstämmiger Migranten.194 So bleibt an dieser Stelle insgesamt festzuhalten, dass sich der wissenschaftliche Diskurs in stark ausgeprägter Form mit der schulischen wie auch außerschulischen Lebenswelt junger türkischstämmiger Migranten auseinandersetzt. Diese insgesamt positiv zu bewertende Entwicklung offenbart einen gesellschaftspolitischen Handlungsbedarf auf verschiedensten Ebenen interkulturellen Zusammenlebens: Neben bereits erwähnten Aspekten – wie bspw. derjenige der institutionellen Diskriminierung – verdeutlichen unter anderem die zusehende, innerdeutsche ‚Muslimisierung‘ von Migranten,195 die teils ausgeprägte Popularität der Thesen Thilo Sarrazins wie auch die Hintergründe samt Diskussionen um die terroristischen Gewalttaten des Nationalsozialistischen Untergrunds, dass stellenweise erhebliche Divergenzen im interethnischen Zusammenleben bestehen. Demgemäß soll es Anspruch der nachfolgenden Kapitel dieser wissenschaftlichen Hausarbeit sein, den bis zu dieser Stelle vorgestellten Forschungsstand bzw. die diskutierten Problem- und Sachlagen weitestgehend zu berücksichtigen und intensiviert zu analysieren. Es gilt, institutionelle wie auch gesamtgesellschaftliche Unzulänglichkeiten offenzulegen und einen fundierten Überblick zur schulischen und außerschulischen Lebenswelt junger türkischstämmiger Migranten zu geben.
45Vgl. Oltmer 2012, S. 13.
46Oltmer / Kreienbrink / Sanz Diaz 2012, S. 7.
47Vgl. Hahn 2008, S. 74.
48Vgl. Schulte Beerbühl 2011, S. 9.
49Sonnenberger 2003, S. 31
50Vgl. Welzer / Moller / Tschuggnall 2002, S. 12: Die Begrifflichkeit des ‚Kulturellen Gedächtnisses‘ wird hier definiert als „Sammelbegriff für alles Wissen, das im spezifischen Interaktionsrahmen einer Gesellschaft Handeln und Erleben steuert und von Generation zu Generation zur wiederholten Einübung und Einweisung ansteht“.
51Sternberg 2012, S. 25.
52Bade / Oltmer 2004, S. 6.
53Vgl. Kühnel / Strobl 2000, S. 20: Kühnel / Strobl verweist darauf, dass zum Ende des 20. Jahrhunderts ca. 1,8 Millionen deutsche Siedler in Russland lebten.
54Vgl. Bade / Oltmer 2004, S. 7: Bade / Oltmer weist darauf hin, dass allein zwischen 1816 und 1914 ca. 5,5 Millionen Deutsche in die USA auswanderten.
55





























