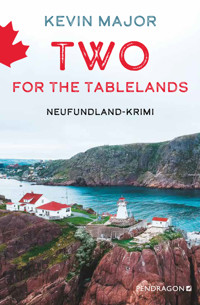
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Krimi
- Serie: Neufundland-Krimi
- Sprache: Deutsch
Crime in Canada - Synards zweiter Fall in Neufundland. Vom puren Naturerlebnis in ein mörderisches Abenteuer stolpern – typisch für Synard, diesen lässigen, aber nie nachlässigen Ermittler. In den neufundländischen Tablelands gibt es viel zu sehen: malerische Natur, jahrtausendealte Gesteinsschichten und – eine Leiche. Schnell wird klar, dass es sich bei dem toten Studenten um ein Mordopfer handelt. So stürzt Sebastian Synard, mittlerweile zugelassener Privatdetektiv, in seinen nächsten Fall. Doch er ist nicht der Einzige, der an der Aufklärung interessiert ist: Die Tante des Opfers kommt mitsamt heißer Spur aus Mexiko angereist. Sie besteht darauf, dass der Stiefvater der Täter sein muss. Mit Entschlossenheit und luftiger Kleidung im Gepäck nimmt Synard den nächsten Flieger vom windzerzausten Neufundland ins warme Mexiko. Doch was ihn dort erwartet, bringt ihn einmal mehr in große Gefahr. »Major motiviert Leser*innen in seinem amüsanten Krimi zum Mitraten – und selbst wenn man dem Täter auf die Schliche gekommen ist, dann lassen einen die guten Dialoge und interessanten Charaktere mit Freuden weiterlesen.« Bookcase | Jean Craham
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kevin Major
TWOFOR THE TABLELANDS
DER ZWEITE FALL FÜR SEBASTIAN SYNARD
Übersetzt von Norbert Jakober
Für meinen Kumpel Gaffer,der mir beim Schreibenso geduldig Gesellschaft leistet.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Es war der Unterschied zwischen Ocker und Rostrot. Zwischen gelbem und rotem Eisenoxid. Zwischen seiner Haut und dem dicken Blutfleck.
Es war Nick, der die Leiche entdeckte. Kein Anblick, dem ein Junge in seinem Alter ausgesetzt sein sollte. Ein nackter Mann, halb von Felsbrocken bedeckt, das getrocknete Blut wie Lehm auf seiner Haut.
Allem Anschein nach hatte jemand verhindern wollen, dass die Leiche gefunden wird, was auch gelungen wäre, hätte Nick sich nach dem Schwimmen nicht in der Gegend umgesehen.
Als er in seiner Panik nach mir rief, schlüpfte ich schnell in meine Wanderschuhe und hetzte über die Felsen hinweg, weil ich dachte, er sei vielleicht gestürzt und hätte sich etwas gebrochen.
Verdammt.
Ich drückte seinen Kopf an meine Brust. Zwischen den Felsen war zu erkennen, dass man dem Toten die Kehle aufgeschlitzt hatte. Die klaffende Wunde war mit eingetrocknetem Blut verkrustet. Dass die Leiche nur teilweise von Steinen bedeckt war, ließ vermuten, dass der Täter es eilig gehabt hatte. Die Szene erinnerte an einen überstürzt aufgeschichteten Grabhügel. Ein Arm ragte zwischen den Steinen hervor, ein Teil eines Oberschenkels, ein verrenktes Bein, ein Fuß. Ein halb entblößter, zerquetschter Penis.
Verdammt.
1
Meine Höhenangst hat sich dramatisch verschlimmert.
Das hat vor allem damit zu tun, dass ich letztes Jahr einen dreißig Meter tiefen, felsigen Abhang hinuntergestürzt bin. Seitdem spielen sich verrückte Dinge in meinem Kopf ab, wenn ich aus großer Höhe hinunterschaue. Im Kopf und in den Eingeweiden. Von hohen Felsklippen halte ich mich lieber fern. Was in Neufundland gar nicht so einfach ist.
Nicholas, mein dreizehnjähriger Sohn, scheint dieses Gen nicht geerbt zu haben und kommt diesbezüglich mehr nach seiner Mutter. Als Samantha noch meine Frau war, hat sie mich ständig an irgendwelche Abgründe geführt. Aber ich schweife ab.
Es hat seinen Grund, dass ich an diesem Thanksgiving-Wochenende den Gros Morne besteige, den zweithöchsten Berg Neufundlands. Obwohl Berg vielleicht ein bisschen übertrieben ist; es handelt sich eher um einen 800 Meter hohen, kahlen Hügel inmitten des Gros Morne Nationalparks. Trotzdem ist er auf seine Weise spektakulär.
Nicholas ist beeindruckt, was bei einem Dreizehnjährigen erfahrungsgemäß nicht leicht ist. Es liegt gewissermaßen in den Hormonen, die Welt betont cool zu betrachten. Als ehemaliger Lehrer weiß ich, wovon ich rede. Die achte Klasse, die Nick erst kürzlich hinter sich gebracht hat – so weit unbeschadet, obwohl das endgültige Urteil noch aussteht –, gilt in der Lehrerschaft allgemein als „verlorenes Jahr“. Die Pubertät setzt ein und sorgt dafür, dass bislang unauffällige Schüler ein höchst seltsames Verhalten an den Tag legen. Nach ein paar Monaten in der neunten Klasse sind die jungen Leute in der Regel wieder in der Lage, sich wie normale Menschen zu benehmen.
„Macht Spaß“, findet Nicholas, als wir den geröllbedeckten Hang emporsteigen, dessen Quarzitbrocken einst von Gletschern zurückgelassen wurden. „Spaß“ ist ein so allgemeiner Begriff, der alles und nichts bedeuten kann. Ich rede lieber von einem „interessanten Erlebnis“. Anstrengend, aber interessant.
Der fünfzigjährige Vater will sich nicht anmerken lassen, dass er der Aufgabe möglicherweise nicht ganz gewachsen ist. „Klar“, presse ich schwer atmend hervor. Zum Glück ist der Sohnemann – leichtfüßig wie eine Gämse – ein paar Schritte voraus, sodass er mein Keuchen nicht mitbekommt.
Wir sind bereits vier Kilometer durch Wälder und Wiesen gewandert, um zum Fuß des Hügels zu gelangen. Als wir den steinigen Aufstieg in Angriff nehmen, wird der Wind stärker, was uns wenigstens die Fliegen vom Leib hält und so einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zu meinem Wohlbefinden leistet. Wie schön wird es erst sein, wenn wir ganz oben sind.
Die anderthalb Stunden bis dahin sind allerdings hart. Kaum glaubt man, das Ärgste hinter sich zu haben, ragt der nächste geröllbedeckte Hang vor einem auf. Der Wind ist nicht mehr nur für die Fliegen unangenehm; je höher wir steigen, umso beißender und kälter fühlt er sich an. Es ist überhaupt merklich kühler geworden. Die tief hängenden Wolken deuten auf Regen hin. Die letzten Meter bis zum Gipfel werden wir im Nebel zurücklegen müssen.
Endlich erreichen wir unser Ziel, wie uns das Schild in zwei Sprachen bestätigt: Gros Morne Summit 806m/Sommet Gros-Morne 806 m. Die Tatsache, dass der Berg für Englisch- und Französischsprechende gleich hoch ist, freut den müden Wanderer.
„Können Sie ein bisschen näher herankommen?“, bitte ich den erstaunlich rüstigen Senior, der angeboten hat, die beiden Bergbezwinger mit meinem iPhone zu knipsen. Wir wollen ja, dass das Schild trotz des Nebels gut zu sehen ist.
Es folgt das unvermeidliche Grinseselfie, und danach, ebenso unvermeidlich: „Okay, jetzt wird gegessen.“
Es ist bereits erstaunlich, was ein männlicher Teenager verdrücken kann, wenn er auf der Couch sitzt und fernsieht – aber das ist nichts im Vergleich zu jetzt. Bisher haben wir uns mit Wasser und Studentenfutter begnügt. Doch nun macht Nick ernst. „Ich brauch was zwischen die Zähne“, macht er unmissverständlich klar.
Zum Glück haben unsere beiden Rucksäcke zusammen das Fassungsvermögen eines mittleren Kühlschranks. Nick hat alles, was der Magen begehrt: Würstchen, Sandwiches, hart gekochte Eier, Obst, Käse, Kräcker, Hummus, Trockenfleisch, Sellerie (schlauerweise mit Erdnussbutter gefüllt), Muffins, Kekse, Gatorade.
Das Leben ist wunderbar – umso mehr, wenn etwas Bemerkenswertes geschieht. Auch wenn es etwas sein mag, mit dem man in Neufundland immer rechnen muss. Die Rede ist vom Wetter, das sich hier auf unserer Insel erstaunlich schnell ändern kann. Der Nebel lichtet sich und die Sonne kämpft sich zwischen den Wolken hindurch. Ein prächtiges Bild entfaltet sich vor unseren Augen. Die wunderbare Aussicht auf den Gros Morne Nationalpark.
Es erfüllt mich mit Freude und Dankbarkeit, diesen Moment mit meinem Sohn teilen zu können. Wir sitzen da und genießen das großartige Panorama des Ten Mile Pond. Ein lang gezogener, in der Sonne glitzernder See, eingebettet in grüne Wälder und steile Felshänge.
„Das sind die Long Range Mountains, die nordöstliche Fortsetzung der Appalachen. Diese Felsen, die du da siehst, das ist Granit und Gneis.“
„Echt cool.“
„Der Gneis?“
„Der auch. Nein, ich meine, dass du den Reiseführer auswendig gelernt hast. Cool, weiter so.“
Immerhin vergehen zwei Minuten, ehe er dem Drang nachgibt, herauszufinden, ob er hier oben Handyempfang hat.
„Tyler, rat mal, wo ich gerade bin.“ Pause. „Nee, nichts Schweinisches.“
Gut, dass ich nicht alles höre.
„Nein, auf dem Gros Morne.“ Pause. Gelächter. „Ich rede von dem Berg, Mann.“
Wovon sonst?
„Ja, wirklich. Mit meinem Dad. Ich weiß. Ganz nett.“
Ganz nett ist okay.
„Das hättest du wohl gern. Okay, ich muss los.“ Pause. „Mach ich.“
Von nun an geht es nur noch bergab. Im wahrsten Sinn des Wortes. Der Abstieg auf der Rückseite des Berges und die Wanderung zurück zum Ausgangspunkt will kein Ende nehmen. Als wir nach über vier Stunden endlich den Parkplatz erreichen, ist unser Proviant aufgebraucht (als Letztes wurden die Selleriestangen vernichtet), aber Nick ist immer noch recht gut drauf. Hungrig, aber nicht quengelig. Ich nehme das als Zeichen, dass er kein Kind mehr ist, sondern auf dem Weg zum Erwachsenwerden.
„Yes! Geschafft!“ High Five.
„Wir haben das Ding gerockt!“ Noch mal Abklatschen. „Ich brauch was …“
Ich weiß. „… zwischen die Zähne.“
„Du sagst es.“
Das heißt, ich muss das Versprechen einlösen, das ich ihm auf halbem Weg den Berg hinunter gegeben habe. Wir werden uns heute nicht in der Küche betätigen, sondern zur Feier des Tages im Old Loft Restaurant in Woody Point essen.
Ich habe Nick dazu animiert, sich über Brathähnchen, Tacos und Pizza hinauszuwagen und seinen kulinarischen Horizont zu erweitern, auch wenn man dafür ein bisschen tiefer in die Tasche greifen muss. Wir haben es uns angewöhnt, an den Wochenenden, die er bei mir verbringt, zusammen zu kochen – nach Anweisungen aus irgendeinem Kochbuch oder aus dem Internet. Gemeinsam kochen schweißt zusammen.
Letzte Weihnacht habe ich ihm ein Kochbuch geschenkt. Im Ernst. Es war nicht das einzige Geschenk, aber ich dachte mir, das ist ein gutes Signal. Ein paar Tage später kommt er zu mir mit dem Buch in der Sporttasche, aus dem ein Stück Toilettenpapier ragt, mit dem er ein Rezept markiert hat, das er ausprobieren will. Ich bin begeistert, und statt am Silvesterabend eine Party zu besuchen und um Mitternacht vielleicht irgendeine Frau zu küssen, die meine Fantasie befeuert, bleibe ich zu Hause und koche mit Nick etwas, das sich „Double Whammy Toad in the Hole“ nennt – ein traditionelles britisches Gericht aus Würstchen, die in Pfannkuchenteig gebacken werden. Das Rezept ist von Jamie Oliver, dessen Kochbücher ich mag. Weniger begeistert bin ich von seinen Küchenmessern, vor allem, seit man mich mit einem solchen Messer bedroht hat. Ich vermute, dass Nick das Rezept ausgesucht hat, weil es ein bisschen vulgär klingt und sich unter den Zutaten auch eine Dose Bier befindet.
Aber für mich ist wichtig, dass er mit Begeisterung bei der Sache ist, und tatsächlich schmeckt unsere „Kröte im Loch“ ganz ordentlich. Während des Essens sehen wir uns im Fernsehen an, wie auf dem New York Times Square die bunte Kristallkugel an einem Fahnenmast herabgesenkt wird.
Unser Gericht schmeckt auch meinem Hund Gaffer, der immer schon eine Vorliebe für Würstchen hatte. Außerdem schätzt er Eier aus Freilandhaltung und einen gelegentlichen Schluck Bier. Da er das übliche Trockenfutter verschmäht hat, seit Nick und ich ihn aus dem Tierheim geholt haben, muss er sich an dem Abend wie im siebten Hundehimmel gefühlt haben. Es war bestimmt einer seiner denkwürdigsten Jahreswechsel.
Im Old Loft Restaurant gibt es traditionelle neufundländische Küche. Ich entscheide mich für Elchfleisch-Pastete mit Salat, mein junger Reisebegleiter wählt Fischfrikadellen, gebratene Bohnen und frisch gebackenes Brot. Das Ganze runden wir mit Eiscreme und einem ordentlichen Stück Rebhuhnbeerenkuchen ab, der sich in Kanada großer Beliebtheit erfreut. Gutes Essen ist uns beiden wichtig.
„Das wäre was für Gaffer“, meint Nick wehmütig zwischen zwei Bissen.
Er vermisst seinen vierbeinigen Freund genauso wie ich. Aber dem Hund geht es gut; mein Freund Jeremy hat ihn zu sich genommen, bis wir zurück sind.
Nick knipst ein Foto von seinem Teller und schickt es Jeremy, mit einer kurzen Nachricht für Gaffer. „Ich würde dir gern eine Portion abgeben.“
Er lässt das Foto auch seinem Freund Tyler zukommen. Zehn Sekunden später kommt die Antwort. „Tyler findet es ekelig“, sagt Nick. „Typisch Tyler. Für ihn gibt es nur Burger und Pommes. Schlimm.“
Ich bin stolz auf den Jungen. Zur Belohnung nehmen wir beim Hinausgehen noch einen Leib von dem selbst gebackenen Brot und der hauseigenen Moltebeerenmarmelade mit, für unser Frühstück morgen.
Wir fahren weiter zu der Hütte, die wir für drei Tage gemietet haben. Bislang ist es ein denkwürdiger Vater-Sohn-Ausflug.
Für den nächsten Tag haben wir uns eine Wanderung zu den Green Gardens vorgenommen, einem weiteren Juwel des Nationalparks. Es gibt zwei mögliche Wege. Da wir heute einen extrem warmen Herbsttag haben – in Neufundland bedeutet extrem, dass es auf 20 Grad zugeht – entscheiden wir uns für die kürzere Route: neun Kilometer hin und zurück. Ich habe mich immer noch nicht ganz von unserer Wanderung auf den Gros Morne erholt und letzte Nacht nicht besonders gut geschlafen. Im Traum bin ich endlos geklettert, ohne den Gipfel zu erreichen.
Die Broschüre verspricht uns eine Wanderung durch „eine kahle, von orangebraunem Peridodit-Gestein geprägte Landschaft“.
„Lesen kann ich selber.“ Er lacht. „Der war gut, Nicholas.“ Er klopft sich selbst auf die Schulter, wie Teenager es gern machen. Vielleicht, um sein Ego zu streicheln, wahrscheinlich aber eher, weil der Junge einfach Humor hat. Ganz der Papa eben.
Ja, wir haben Spaß. Auch nach einer Stunde wandern wir noch. Der Weg verläuft fast nur bergab durch dichten Nadelwald – Schwarzfichte, Balsamtanne und Lärche, dazwischen aber auch Birke und Erle und jede Menge Farn und Moos. Ein guter Boden für Wildtiere. Wir hoffen, einen Elch oder ein Rentier zu treffen, wären aber auch mit einem Fuchs oder einem Nerz zufrieden. Eichhörnchen und Spitzmäuse zählen nicht.
Und tatsächlich läuft uns ein prächtiger Rotfuchs über den Weg. Als er uns sieht, ergreift er zu meiner Überraschung nicht direkt die Flucht, sondern lässt sich ein paar Sekunden bewundern. Nick holt sein Handy hervor, um ein Foto zu schießen, aber ich signalisiere ihm, es nicht zu tun. Er zuckt mit den Schultern. Ganz still stehen wir da und beobachten den Fuchs, der uns neugierig betrachtet, ehe er im Unterholz verschwindet.
„Das wäre ein tolles Foto geworden.“
„Aber so war es noch besser. Nur Mensch und Fuchs. Auge in Auge.“
„Wenn du es sagst.“
„Das Leben ist nicht dazu da, es durch eine Kamera zu beobachten. Das ist wie eine Barriere zwischen dir und der Welt. Nimm den Augenblick, wie er sich bietet.“ Meine Weisheit des Tages.
„Ookay.“ Er klingt nicht überzeugt. Aber er ist ja auch in einem Alter, wo einen kaum etwas überzeugt. Er widerspricht mir zumindest nicht. Das ist immerhin etwas.
Wir lassen den Wald hinter uns und gelangen zu einer saftig grünen Wiese auf dem Hügel. Hier und dort grasen Schafe, die wahrscheinlich aus der umliegenden Gegend stammen und seit Sommerbeginn hier oben sind. Ein Tier ganz in der Nähe blickt kurz auf, beäugt die beiden Wanderer, dann senkt es den Kopf zurück ins Gras und kaut friedlich weiter.
„Er war eh nicht besonders fotogen“, meint Nick und verbeißt sich das Grinsen.
Klugscheißer. Ich knuffe ihn mit der Faust in den Arm.
Nick streift seinen Rucksack ab und geht in Kung-Fu-Position wie ein erfahrener Kampfsportler, dabei hat er höchstens ein paar Filme gesehen.
„Na los, komm her, wenn du dich traust. Dann werden wir sehen, was du draufhast!“ Er lässt ein paar Kampflaute und Karategesten folgen.
Mit einem breiten Grinsen nehme ich meinerseits den Rucksack ab und hebe ganz ruhig die Hände.
„Dann wollen wir mal sehen, ob hinter der Wampe auch ein paar Muckis sind!“
„Dünnes Eis, Nicky-Boy. Sehr dünnes Eis.“
Mit einem Blitzmanöver liegt er im Gras. Er ist extrem kitzlig; jetzt lasse ich ihn für seine respektlose Bemerkung bezahlen.
„Na, wie war das noch mal mit der Wampe?“
„Hey, ich hab nix gesagt über … deinen Wanst.“
Noch einmal bohre ich ihm die Finger zwischen die Rippen und er prustet vor Lachen, bevor wir weitergehen.
Über ein paar Stufen gelangen wir zum Strand hinunter. Direkt davor ragen mehrere Brandungspfeiler in die Höhe – bizarre Felsentürme, wie er sie noch nie gesehen hat.
„Jetzt wirst du mir sicher gleich von den alten Zeiten erzählen, in denen du auf diesen Felsen rumgeturnt bist, oder?“
„Okay, Torfnase …“
„Du nennst deinen eigenen Sohn ‚Torfnase‘? Was bist du für ein Vater?“
„Einer, der gleich ins Wasser springt – im Gegensatz zu dir, Torfnase.“
Ich streife den Rucksack ab und ziehe die Wanderschuhe aus.
„Das Wasser ist arschkalt. Du bist verrückt.“
„Und du bist ein feiges Huhn.“
Der Wettlauf beginnt. Am Ende planschen wir beide im eisigen Atlantik.
„Da frierst du dir glatt den Arsch ab“, stöhne ich.
„Obwohl … es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass eine Wampe ein guter Kälteschutz ist.“
Nicholas ist ein guter Junge. Manchmal ein bisschen vorlaut, aber damit kann ich leben. Hauptsache, er wächst mit dem Wissen auf, dass sein Vater immer für ihn da ist, trotz der Differenzen, die ich mit seiner Mutter hatte. Die Ehe ist in die Brüche gegangen und jeder Versuch, sie unserem Sohn zuliebe am Leben zu erhalten, hätte endlosen Streit zur Folge gehabt. Wer will seinem Kind das antun? Wir teilen uns das Sorgerecht. Es ist kein idealer Zustand, aber eine brauchbare Basis. Das Leben geht weiter. Wir machen das Beste daraus. Und im Moment friere ich mir den Arsch ab, um ihm irgendwie klarzumachen, dass ich für ihn bis ans Ende der Welt gehen würde.
Genau dort befinden wir uns an unserem letzten Tag im Gros Morne Nationalpark. In diesem Fall muss man gar nicht so weit gehen, aber wenn man durch die Tablelands wandert, ist man zwangsläufig mit dem Ende der Welt konfrontiert.
Wir sind hier an einem der wenigen Orte auf dem Planeten, wo das tiefer liegende Gestein des Erdmantels die Oberfläche durchbrochen hat. Eine 500 Millionen Jahre alte geologische Sensation. Heute präsentieren sich die Tablelands als karge, ockergelbe Landschaft aus Hochflächen, Hügeln und Tälern, in denen nur wenig wächst. Ein wüstenähnliches Bild, doch in höheren Lagen kann man selbst nach dem Sommer noch vereinzelte schneebedeckte Flecken finden.
„Ziemlich tote Hose hier.“
Ich erwarte ein bisschen mehr von meinem Sohn. Er lebt in Neufundland und findet Steine und Felsen langweilig? Wenn man hier geboren wird, sollte man die Besonderheiten der Gegend zu schätzen wissen. „Was du ‚tote Hose‘ nennst, ist für Geologen ein einzigartiges Naturphänomen.“
„Hör mal, Tyler“, gibt er sofort weiter, „wir sind hier in einer Gegend, die heißt Tablelands … einzigartig, sag ich dir.“
Schon wieder das verdammte Handy. Ich atme tief durch. Cool bleiben, Sebastian.
„Hier liegt sogar Schnee. Ja, wir klettern da hoch.“
Wird jetzt jeder Schritt kommentiert, während wir den Berg hochsteigen? Ich verstehe das nicht. Warum muss man alles in Echtzeit mit anderen teilen?
„Nick, Kumpel, steck doch mal das Handy weg. Gönn ihm auch mal eine Pause.“
Ich sehe, dass es ihm widerstrebt, aber schließlich steckt er es doch weg. Auch das nehme ich als gutes Zeichen.
Die Broschüre von Parks Canada ist zwar Steinzeit-Technologie, dafür aber federleicht und sehr informativ. Sie verrät uns, dass die beste Route zum höchsten Punkt der Tablelands am linken Ufer des Wallace Brook beginnt, an der Stelle, wo der Bach den Weg kreuzt. Der Weg ist nicht beschildert und sieht ziemlich unbetreten aus. Jedenfalls sind wir in diesem Moment die Einzigen, die hier losmarschieren. Die Wanderung führt uns über bräunlich verwittertes Peridotitgestein – äußerlich unscheinbar, und doch ein geologisches Wunderwerk.
Der Erdmantel wurde einst durch den Zusammenstoß von zwei Kontinentalplatten an die Oberfläche gehoben. Die Tablelands sind somit der lebende Beweis für die Richtigkeit der Theorie der Plattentektonik. Wobei „lebend“ vielleicht übertrieben ist, da das Einzige, was hier lebt, vereinzelte Pflanzen und Büsche in tieferen Lagen sind, die den unwirtlichen Wetterbedingungen trotzen.
„Zähe kleine Kämpfer“ nenne ich diese Pflanzen. Nick pflichtet mir bei. Ich überlege kurz, ein paar der seltenen Blümchen zu knipsen, doch es wäre keine gute Idee, jetzt das Handy zu zücken.
Nick kann meine Gedanken lesen; er weiß genau, wie interessant ich Pflanzen finde, und grinst süffisant.
Den Triumph gönne ich ihm nicht. „Im Augenblick leben“, sage ich mit einem noch breiteren Grinsen.
Einen Kilometer weiter gelangen wir zu einem Punkt namens Lower Bowl, wo der Weg durch dichtes Geröll führt, das Nick wie ein junger Ziegenbock überspringt. Diesmal ist der Anstieg jedoch etwas seniorenfreundlicher, sodass ich einigermaßen mit ihm Schritt halten kann. Einigermaßen.
Nahe dem Rand der Bowl wartet er auf mich am Ufer des Bachs, dessen Lauf wir gefolgt sind. Er nutzt die Pause für einen Snack, ohne zum Handy zu greifen. Ich gebe mich keinen Illusionen hin; vielleicht hat er noch ein paar Nachrichten abgeschickt, als ich es nicht sehen konnte.
Hier oben herrscht Pulloverwetter; man sieht noch vereinzelte Schneeflecken in der Landschaft. Trotzdem hat der Bach etwas Verlockendes an sich, vor allem an einer Stelle, wo er einen kleinen Teich bildet. Vielleicht auf dem Rückweg.
Jetzt wird erst einmal gegessen. Immerhin sind seit dem Frühstück zwei Stunden vergangen. Es gibt Cashews und proteinreiches Trockenfleisch.
Nick schnappt sich die Packung und liest die Informationen auf der Rückseite, wie ich es ihm beigebracht habe. „Dir ist schon klar, dass da jede Menge Salz, Fett und Nitrat drin ist? Alles Zutaten für einen Herzinfarkt.“
Ich glaube, ich war ein etwas zu guter Lehrer. Argumente habe ich keine. Wir prosten uns mit zwei Streifen Trockenfleisch zu, als wären es Weingläser. Als Buße verspreche ich, rohen Brokkoli zu essen.
Das Schneefeld in der Bowl ist nicht weit entfernt. Wir überqueren den Bach und Nick nutzt die Gelegenheit für eine kleine Schneeballschlacht. Das Kerlchen hat mehr Wumms im Arm, als ich ihm zugetraut hätte. Die kleinen Eisbälle fühlen sich verdammt kalt an, obwohl die Lufttemperatur recht annehmbar ist.
So verlockend es sein mag, das Schneefeld zu durchqueren, wäre es keine so schlaue Idee. Die schmelzende Schneedecke könnte einbrechen. Ich habe wenig Lust, in einem Freiluftkühlschrank festzusitzen. Also begnügen wir uns damit, am Rand entlangzuwandern und den Aufstieg fortzusetzen. Unterwegs kommen uns ein paar Leute von oben entgegen. Wir marschieren tapfer bis zum höchsten Punkt.
Die Aussicht über Bonne Bay ist überwältigend. Es ist eine der schönsten Buchten von Neufundland. An der Küste liegen mehrere Dörfer und in der Ferne können wir den Gros Morne erkennen, den Berg, den wir vor zwei Tagen bezwungen haben.
Es tut Vater und Sohn gut, zwischen den Gesteinsblöcken zu sitzen und diesen Beweis der ehrfurchtgebietenden Mächte unserer Erde zu bestaunen. Umgeben von einem gewaltigen geologischen Monument, das zu Recht in den Rang eines UNESCO-Weltnaturerbes erhoben wurde. An einem solchen Ort wird einem bewusst, dass wir selbst nur flüchtige Statisten im großen Schauspiel von Raum und Zeit sind. Während wir hier sitzen, driften wir immer noch von Eurasien weg, mit einer rasanten Geschwindigkeit von zweieinhalb Zentimetern pro Jahr!
„Ist noch was zu essen da?“
Der Magen verlangt sein Recht. Die tolle Aussicht ist anscheinend von begrenztem Interesse.
Das mit Salz und Konservierungsmitteln vollgepumpte Trockenfleisch ist längst zur Neige gegangen. Auch die Müsliriegel. Ich fürchte, es sind nur noch Trockenfrüchte und rohes Gemüse übrig. Feigen und Karottensticks, die ein gequältes Stöhnen hervorrufen.
Als Entschädigung biete ich ihm fünf Minuten Handyzeit an. Für ihn ein Geschenk des Himmels. Als hätte ich ihm einen Marsriegel auf dem Silbertablett serviert.
Bestimmt hat schon jemand eine Doktorarbeit verfasst, die den Zusammenhang zwischen Handynutzung und Nahrungsaufnahme bei Teenagern untersucht. Vielleicht liegt darin sogar eine Chance für so manchen Jugendlichen, überschüssige Pfunde loszuwerden. Die iPhone-Diät. Das hat doch was.
Der Rückweg ist zwar nicht so anstrengend wie der Aufstieg, doch das unebene, steinige Gelände ist für nicht mehr ganz so gelenkige Beine trotzdem eine Herausforderung. Vorsicht ist besser als ein verstauchter Knöchel.
Wieder einmal eilt Nick voraus. Wahrscheinlich tippt er Nachrichten in sein Handy, während er über Stock und Stein springt. Ein gutes Stück vor mir überquert er den Bach, und als ich ihn bei dem kleinen Teich einhole, an dem wir auf dem Weg nach oben vorbeigekommen sind, hat er das Sweatshirt ausgezogen, in Erwartung der Abkühlung, von der wir zuvor gesprochen haben.
Dazu müssen wir erst einmal die felsige Uferböschung überwinden, die zwar nicht besonders steil, aber dennoch tückisch ist. Für die Bergziege unter uns jedoch kein Problem.
Nick hat bereits die Schuhe ausgezogen, als ich auch endlich ankomme. Der Teich glitzert klar und einladend in der Sonne. Wir haben beide nicht daran gedacht, eine Badehose einzupacken. Wir sehen uns kurz um, bevor wir uns ausziehen. Es ist lange her, seit uns jemand begegnet ist.
Nick hält den Fuß ins Wasser und zieht ihn schnell zurück. „Also, ich weiß nicht, Dad.“
„Es gibt nur einen Weg hinein, Nick!“ Tief einatmen, über spitze Steine ins Wasser balancieren und an der tiefsten Stelle hinein ins Vergnügen.
Wie erwartet ist das Wasser so kalt, dass man sich sprichwörtlich jedes Körperteil abfriert.
Er weiß, dass ihn eine kalte Dusche von meiner Seite erwartet, wenn er nicht reinkommt. Also gibt er sich einen Ruck, springt ins Wasser und taucht sofort wieder auf – alles in einer einzigen Bewegung. Und er kreischt, was seine Lunge hergibt. „Ach du Scheiiiße!“
Ganze zehn Sekunden bleibt er im Wasser. Mission abgeschlossen, Mutprobe bestanden – nichts wie raus. Er reibt sich mit seinem Sweatshirt ab, schnappt sich die restlichen Klamotten und sucht sich ein Plätzchen hinter den Felsen.
Ich muss gestehen, dass ich nicht so viel Schamgefühl an den Tag lege. Es hat etwas Dramatisches, splitternackt auf Steinen zu stehen, die aus den Tiefen der Erde stammen. Auch wenn nur ein paar Sekunden vergehen, ehe ich meine Wandershorts anziehe. Es ist ein Augenblick von kosmischer Dimension. Etwas Ursprüngliches. Der Mensch außerhalb der engen Grenzen des Alltäglichen.
Das alles wird schlagartig weggefegt.
„DAAAD!“ Ein Schrei, der nackte Panik ausdrückt.
Verdammt, was ist passiert? „Ich komme!“ Bestimmt hat er sich wehgetan. Obwohl – es klingt nach etwas Schlimmerem. Hastig zwänge ich mich in die Wanderschuhe, weil ich weiß, dass ich es nicht schaffe, noch einmal barfuß über die Steine zu laufen.
Er steht reglos da, Gott sei Dank unverletzt. Angezogen, die Haare zerzaust, das ausgeblichene T-Shirt klebt auf der nassen Haut.
„Nick, was …“
Seine Hand umklammert meinen Arm.
„Oh Gott.“
Vor uns, zum größten Teil von Steinen bedeckt, liegt eine Leiche mit aufgeschlitzter Kehle. Ein grauenhafter Anblick. Man braucht ein paar Sekunden, um überhaupt zu begreifen, was man sieht.
Das Gesicht des armen Kerls ist bedeckt. Nicht aber sein Hals. Der ist nach hinten gekrümmt, lässt die Wunde weit auseinanderklaffen.
Die Ränder sind mit eingetrocknetem Blut verkrustet, das sich kaum vom rostbraunen Farbton des Gesteins abhebt.
Der Kontrast zwischen Haut und Fels ist so gering, dass Nick auf das Bein getreten ist, bevor er den durchtrennten Hals gesehen hat. Wer immer die Steine auf den Leichnam geschichtet hat, muss weggelaufen sein, bevor er es zu Ende gebracht hatte. So ist ein Teil des zweiten Beins, ein Arm und – zur Bestätigung, dass es sich um eine männliche Leiche handelt – die Hälfte des Penis unbedeckt geblieben.
So etwas sollte niemand sehen müssen – egal ob erwachsener Mann oder dreizehnjähriger Junge.
Ich lege Nick den Arm um die Schultern und führe ihn beiseite. Er zittert immer noch.
Ich verständige den Notruf. Spreche zuerst mit einem Cop, dann mit einem Mitarbeiter von Parks Canada, der unseren genauen Standort wissen will. Dann gehe ich mit Nick ein Stück den Hang hinauf und rede auf ihn ein, um ihn aus seinem Schockzustand zu reißen.
Ich finde einen großen Felsblock, auf den wir uns setzen und auf das Eintreffen der Cops warten.
„Bist du okay?“
Er nickt zögernd. „Krass“, murmelt er. Das Wort für alle Gelegenheiten. Wahrscheinlich hat er in Filmen oder im Internet schon Schlimmeres gesehen. So weh es mir tut, dass er so etwas erleben muss, hat es trotzdem etwas Tröstliches, dass es ihm im wirklichen Leben richtig nahegeht.
Mehr, als mir lieb ist. Er fängt an zu weinen und zittert immer heftiger. Ich hole die Windjacke aus meinem Rucksack und ziehe sie ihm über. Sie ist ihm natürlich viel zu groß und seine Hände verschwinden in den Ärmeln. Er lehnt sich an meine Brust, kämpft gegen das Schluchzen an, wischt sich die laufende Nase mit dem Jackenärmel ab. Für einen Moment ist er wieder ein kleiner Junge.
„Schon gut, Nick.“ Ich halte ihn fest und drücke meine Wange auf seinen Kopf.
Ich war dreißig, als ich zum ersten Mal einen toten Menschen gesehen habe. Es war meine Tante; sie hat im Sarg besser ausgesehen als lebendig. Was Nick mit ansehen musste, wird ihn noch lange verfolgen. Aber ich werde für ihn da sein und zusammen werden wir das durchstehen. Auch dafür sind Väter da.
2
Das ländliche Neufundland untersteht dem wachsamen Auge der Royal Canadian Mounted Police. Die Mounties, wie man sie auch nennt, sind allerdings nicht mehr so oft zu Pferd unterwegs wie in früheren Zeiten.
Constable Trottier (sie heißt tatsächlich so) kommt zu Fuß auf uns zu. „Ich bin aus Saskatchewan“, teilt sie bereitwillig mit. „Meine erste Woche hier in der Provinz.“
Ich stelle anerkennend fest, dass sie kein bisschen außer Atem ist. Sie trägt das Standardhemd unter einer gut sitzenden dunkelblauen Jacke, dazu eine Hose mit gelbem Streifen und die mit gelbem Band versehene Mütze. Am Gürtel hängt eine Pistole im Holster. Sie sieht toll aus.
Begleitet wird sie von dem cool und effizient wirkenden Staff Sergeant Todd MacAvery, allem Anschein nach ihr Vorgesetzter, der uns nicht wissen lässt, woher er stammt. Im Schlepptau haben sie zwei Mitarbeiter von Parks Canada.
Nick und ich mussten über eine Stunde warten. Ich frage mich, warum der Staff Sergeant so lange gebraucht hat; immerhin ist hier allem Anschein nach jemand ermordet worden. Das Polizeirevier befindet sich in Rocky Harbour, auf der anderen Seite der Bucht, wie man mir schließlich mitteilt. Bestimmt hat der Sergeant den Vertretern der Parkbehörde verboten, den mutmaßlichen Tatort vor ihm aufzusuchen.
„Ihr Name bitte.“ Der Staff Sergeant hat Notizblock und Kuli gezückt. Der Tote kann anscheinend warten.
„Sebastian Synard.“ Immer wieder ein bisschen peinlich. Ich buchstabiere ihm meinen Namen, bevor er fragt. „Mein Sohn heißt Nicholas.“
„Alter und Wohnort?“ Oh Gott.
Nick spricht für sich, bevor ich es für ihn tun kann. Er beantwortet MacAverys Fragen so eifrig und gewissenhaft, wie ich es noch vor zehn Minuten nicht für möglich gehalten hätte. Nein, er habe niemand anderen als seinen Vater gesehen. Nein, er habe nur auf mich gewartet. „Nein, sonst nichts.“ Er schaut mich an und fügt hinzu: „Ich bin nur so herumgegangen und habe … meinem Freund Tyler geschrieben.“
„Und dann hast du aufgehört zu tippen, als du die Leiche unter den Steinen gefunden hast?“
„Natürlich hat er aufgehört. Er war traumatisiert!“ Ich habe Mühe, mich zu beherrschen. „Sergeant MacAvery, sollten wir nicht zum Tatort gehen?“
Er schaut von seinem Notizblock auf. „Zuerst müssen wir ein paar Dinge klären.“
Wahrscheinlich will er sich vergewissern, dass wir nicht zwei Verrückte sind, die ihm Märchen auftischen und seine kostbare Zeit stehlen. Ein Cop, der sich wahrscheinlich jahrelang mit Falschparkern und illegalen Lachsfischern herumgeschlagen hat.
Ich schaue zu Constable Trottier. Sie scheint eher auf meiner Seite zu sein, hält sich aber zurück. Auch die beiden Vertreter der Parkbehörde können es kaum erwarten, den Ort des Geschehens in Augenschein zu nehmen. Wahrscheinlich hat sich seit der Ernennung zum UNESCO-Weltnaturerbe nichts derart Aufregendes hier ereignet.
Endlich machen wir uns auf den Weg. Nick und ich zwischen den Mounties und den beiden Mitarbeitern von Parks Canada, die sich als Sandy und Jean-Claude vorgestellt haben. Ein dynamisches, zweisprachiges Duo – ideal für die Tätigkeit im Nationalpark. Sandy trägt ihr sandfarbenes Haar in einem Pferdeschwanz, was sicher praktischer ist, wenn man regelmäßig über unebenes Gelände wandert. Jean-Claude hat scharf geschnittene Gesichtszüge, eine hohe Stirn und ebenfalls einen Pferdeschwanz. Der allerdings nicht so munter hin und her schwingt wie der seiner Kollegin.
Wir gehen den Hang hinunter und ich deute zu dem kleinen Teich, in dem Nick und ich uns abgekühlt haben.
„Kalt“, meint Sandy etwas missbilligend. Parks Canada sieht es anscheinend nicht so gern, wenn die Besucher von der Standardbenutzung des Parks abweichen. Den Berg hochwandern und wieder zurück – mehr ist nicht erlaubt.
„Und Nick, du bist gleich zurückgegangen und hast dich angezogen?“
„Ja, Sir.“
„Und Sie, Mr. Synard?“
„Ich bin noch kurz beim Wasser geblieben.“
„Sie haben sich hier im Freien aus- und wieder angezogen?“
„Es war sonst niemand da.“
MacAvery macht sich eine Notiz.
„Ich bin kein Exhibitionist.“ Es klingt, als müsste ich mich gegen eine Anschuldigung verteidigen.
Wieder kritzelt der Sergeant etwas auf seinen Block. Perversling. Du überreagierst, Synard. Bleib cool.
Wir gehen weiter, ich führe die Gruppe an. Schließlich bleibe ich stehen. „Nick, du bleibst hier. Alle anderen möchte ich warnen. Es ist kein schöner Anblick.“
MacAvery schätzt es gar nicht, dass ich ungefragt die Initiative ergreife. Als Leiter einer vierköpfigen Polizeiabteilung in Rocky Harbour, Neufundland, ist er es gewohnt, das Sagen zu haben. Er eilt voraus, um die Zügel wieder in die Hand zu nehmen.
Und bleibt abrupt stehen. Wahrscheinlich war es der zerquetschte Penis, der ihn in seinem Elan gebremst hat.
Die anderen bleiben links und rechts von ihm stehen.
„Oh Gott“, stöhnt MacAvery. Genau. Eigentlich könnte ich mich jetzt bestätigt fühlen, aber dafür ist die Situation zu makaber.
Constable Trottier ist sichtlich schockiert; ihr Gesicht erstarrt zu einer Maske. Sandy hält sich die Hand vor den Mund. „Tabarnak de câlice de crisse. Scheiße, Scheiße, Scheiße“, murmelt Jean-Claude in gekonnter Zweisprachigkeit.
So schockierend die Szene sein mag – immerhin sind alle Zweifel an der Richtigkeit meiner Behauptung schlagartig ausgeräumt. Allen ist sofort klar, dass sich in den Tablelands ein abscheulicher Mord ereignet hat.
Die allgemeine Aufmerksamkeit richtet sich vor allem auf die aufgeschlitzte Kehle. Seltsamerweise scheint nicht viel Blut geflossen zu sein, abgesehen von der eingetrockneten Kruste auf Hals und Brust. Keine rote Spur auf den Felsen, was mich zu der Feststellung veranlasst, dass der Tote schon hier gelegen haben muss, als man ihm die Kehle durchtrennt hat.
MacAvery hält nichts von meinem Einwurf. Spekulationen über ein Verbrechen anzustellen, ist seiner Meinung nach ein absolutes Vorrecht der Polizei.
Er kann nicht wissen, dass ich als Privatdetektiv zugelassen bin. Ja, Staff Sergeant MacAvery, es gibt auch noch andere, die ihre grauen Zellen bemühen, wenn irgendwo ein Verbrechen geschieht – nicht nur die Mounties.
„Dad“, ruft Nick hinter uns, „wissen die, dass du Privatdetektiv bist?“
Okay, jetzt wissen sie es.
„Wirklich, Mr. Synard?“ Der skeptische Unterton sagt mir sofort, von wem die Frage kommt.
„Ja, wirklich.“
„Er hat noch keinen richtigen Fall gehabt“, fügt Nick hinzu, „aber er bekommt sicher bald einen.“
Ich balle die Hand hinter dem Rücken zur Faust. Jetzt rächt es sich, dass ich meinem Sohn nicht auch ein paar bewährte Sprichwörter beigebracht habe. So was wie ‚Reden ist Silber, Schweigen ist Gold‘.
„Ich habe eben erst die Zulassung bekommen. Mein Detektivbüro ist noch nicht so präsent. Wir sind erst im Aufbau.“
„Verstehe.“
Mein Detektivbüro besteht eigentlich nur aus mir. Wenn ich „wir“ sage, meine ich damit mein MacBook und mich.
Zurück zum aktuellen Fall. Der makabre Anblick der durchtrennten Kehle geht mir nicht mehr ganz so nahe wie im ersten Moment. Es sieht fast so aus, als hätte der Täter den Hals mit Absicht nicht bedeckt; immerhin sind der Kopf und der Großteil des Körpers unter Steinen begraben. Die Haut kommt mir jetzt etwas grauer vor als noch vor einer Stunde. Heißt das, der Mann war noch gar nicht lange tot, als Nick ihn gefunden hat? Und warum hat der Täter auch noch die empfindlichen Teile des armen Kerls malträtiert?
„Sollten wir nicht den Stein von seinem Kopf runternehmen?“ Es scheint mir das Mindeste, was wir tun können, um dem Toten eine gewisse Würde zurückzugeben.
MacAvery sieht mich an, als hätte ich etwas unsäglich Dummes gesagt.
„Der Tatort wird nicht angerührt“, stellt er klar. „Constable Trottier braucht vielleicht Hilfe beim Absperren. Ich muss ein paar Anrufe machen.“ MacAvery tritt beiseite, damit niemand mithören kann. Bestimmt ruft er im Hauptquartier an, um seinen Vorgesetzten zu versichern, dass er alles im Griff hat.
Die Stelle wird mit gelbem Absperrband gesichert, mit der Aufschrift: BARRAGE POLICIER – NE PAS TRAVERSER. Von der englischen Version war anscheinend keine Rolle mehr da. Jean-Claude freut sich über die französische Aufschrift, doch Constable Trottier bemerkt es gar nicht; sie hat zu viel damit zu tun, die professionelle Fassade zu wahren während sie nach etwas sucht, woran sie das Band befestigen kann. Am Ende sieht sie keine andere Lösung, als es auf dem Boden auszulegen und in regelmäßigen Abständen mit Steinen zu beschweren. Dabei versucht sie, die Tatsache zu ignorieren, dass drei Meter entfernt eine verstümmelte Leiche liegt. Sandy, Jean-Claude und ich bieten ihr unsere Hilfe an. Wir stellen uns in die drei anderen Ecken und bilden so ein Rechteck um den Tatort. Als sie das Band ausgelegt hat, nicke ich der jungen Polizistin aufmunternd zu.
Sie entspannt sich einigermaßen, sodass ich sie endlich fragen kann, was mich beschäftigt, seit sie sich vorgestellt hat. „Sind Sie zufällig mit Bryan Trottier verwandt?“
Ich meine den Eishockeyspieler, der in den Siebziger- und Achtzigerjahren aktiv war und, so wie sie, aus Saskatchewan stammt. Einer der Helden meiner Kindheit.
„Das weiß ich selbst nicht so genau.“
Ich sehe sie etwas verwirrt an.
„Mein Dad schwört, dass wir mit ihm verwandt sind. Meine Mom sieht das anders; sie meint, er behaupte es nur, weil er es cool fände.“
„Bryan Trottier hält immer noch den NHL-Rekord für die meisten Scorerpunkte in einem Drittel.“
„Vier Tore und zwei Assists.“
Das Eis ist gebrochen, obwohl es schon schräg ist, neben einer verstümmelten Leiche über Eishockey zu plaudern. Aber so ist das nun mal in Kanada. Eishockey verbindet die Menschen auch unter den schwierigsten Umständen.
Ich sollte mich um Nick kümmern, doch dann sehe ich, dass er schon wieder am Handy hängt und schwatzt. Wahrscheinlich ist es in dieser Situation sogar gut, weil es ihn ablenkt.
„Constable Trottier …“
„Natasha Trottier.“ Sie hält mir die Hand hin.
Sehr nett. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie nicht so jung ist, wie sie aussieht. Und sie trägt keinen Ring am Finger, obwohl das nichts bedeuten muss.
Der Staff Sergeant kommt zu uns zurück, und Natasha ist wieder Constable Trottier. MacAvery steckt sein Handy weg.
„Ein Krankenwagen ist unterwegs. Die Kollegen aus Deer Lake schicken ein paar Leute, um ihn zu bergen.“ Sandy erklärt sich bereit, beim Parkplatz zu warten und das Rettungsteam herzuführen. Sie ist erleichtert, wieder frische Luft atmen zu können.
„Ich habe zusätzliches Personal angefordert, um das Gelände gründlich auf Spuren abzusuchen. Eine Mordwaffe, Kleidungsstücke, Fingerabdrücke und dergleichen. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass niemand auf eigene Faust herumschnüffeln und den Tatort verunreinigen darf.“ Ich habe das starke Gefühl, dass der Hinweis vor allem mir gilt. „Der Tatort muss fotografiert werden. Zu diesem Zweck habe ich vorsorglich die Kamera unseres Reviers mitgenommen. Constable Trottier wird das übernehmen.“ Er zieht eine kleine Kameratasche hervor und reicht sie ihr.
Ich schaue zu Natasha und sehe ihr an, dass sie das noch nie gemacht hat. Die Scheißjobs bekommen immer die Neuen im Team. MacAvery will bestimmt Nahaufnahmen. Mit allen grausigen Details.





























