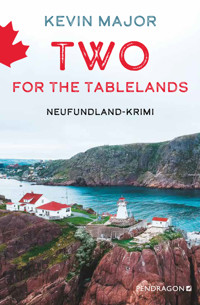Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Roman nach einem historischen Ereignis! Neufundland im Oktober 1942: Als die Caribou ihren Hafen verlässt, ahnen weder Passagiere noch Mannschaft, dass sie nur wenige Stunden später von einem deutschen U-Boot angegriffen werden. An Bord von U 69 hat der junge und ehrgeizige Offizier Ulrich Gräf das Kommando. Trotz aller Gefahren hofft er darauf, unbeschadet zu seiner großen Liebe Elise zurückkehren zu können. Währenddessen träumt auf der Caribou der draufgängerische Steward John Gilbert von einem abenteuerlichen Leben. Jäh aus ihren Hoffnungen gerissen, müssen die beiden Männer in der tosenden See ums Überleben kämpfen. Kevin Major zeichnet ein lebendiges Bild der menschlichen Tragödien während der Schlacht im Atlantik. Er verleiht den Menschen ein Gesicht und eine Geschichte, ohne in ein simples Täter-Opfer-Schema zu fallen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kevin Major • Caribou
Kevin Major
Caribou
Nach einem historischen Ereignis
Übersetzt von Bernd Gockel und mit
einem Nachwort von Christian Adam
PENDRAGON
Dieser unselige Moment, in dem die Zeit stehen zu bleiben scheint, dieses finale, unwiderrufliche Herumlegen des Hebels, diese geballte Wucht aus Stahl, die aus dem Torpedorohr schießt, dieses fatale Klicken des Magneten, das im nächsten Moment 200 Kilogramm Hexanit in einen glühenden Feuerball verwandelt.
Jede Faser des Körpers steht unter Strom. Es ist der Augenblick, auf den wir fixiert sind, auf den unsere ganze Ausbildung ausgerichtet war. In den Köpfen der U-Boot-Besatzung sind die Bewegungsabläufe so eingebrannt, dass der Prozess – einmal in Gang gebracht – nicht mehr aufzuhalten ist.
14.10.1942, Cabot-Straße,
0534, W 1-2, See 1, c 1, 1026 mb, sehr gute Sicht, schwaches Nordlicht.
Diese Aufzeichnungen wurden gemacht, als wir das Schiff vor Neufundland gesichtet hatten. 0534 Normalzeit Berlin. Noch sechs Stunden bis Sonnenaufgang. Dies sind meine handschriftlichen Notizen – das Kriegstagebuch von U 69.
1 Schatten in Sicht, dahinter ein zweiter Kleiner, Gegnerkurs 40°, Fahrt 10,5 sm. Stark qualmender Frachtpassagierdampfer von ca. 6500 BRT. Stb. achteraus sichert ein 2-Schornsteinzerstörer. Vorgesetzt.
Nachdem wir nach Lorient zurückgekehrt waren, wurde eine maschinelle Abschrift des KTB – von mir, Ulrich Gräf, allabendlich abgezeichnet – Admiral Dönitz im Pariser Hauptquartier der Kriegsmarine vorgelegt.
Am Ende des Kriegstagebuches, das unsere gesamte, 83-tägige Unternehmung dokumentiert, schrieb Dönitz einen kurzen Kommentar:
Der Kommandant hat sich aber immer wieder zähe und einsatzbereit bemüht, zum Erfolg zu kommen.
Natürlich hatte ich mir mehr versprochen. Sicher, der Kommentar sprach für sich selbst. Unterm Strich war ich durchaus zufrieden. Dönitz ist nun mal alles andere als ein überschwänglicher Mensch. Ich hatte jedenfalls bewiesen, dass ich zu Höherem berufen war.
Und nur darum, Admiral Dönitz, nur darum ging es mir.
1
Das Ritterkreuz war eigentlich immer das Ende der Fahnenstange. Darüber hinaus gab es absolut nichts, das unsere Fantasie hätte beflügeln können.
20 000 Bruttoregistertonnen. Sechs Schiffe versenkt. Nicht der Rede wert. Ich war nicht der Kriegsmarine beigetreten, um in die Geschichtsbücher einzugehen. Es war schon Ruhm genug, überhaupt zu den Auserwählten zu zählen.
Dessen waren wir uns bereits als Schuljungen bewusst, als wir erstmals unser Gymnasium betraten. Für jeden Jungen, der diese Schwelle überqueren durfte, gab es neun Kandidaten, die auf weniger renommierte Schulen abgeschoben wurden. Als wir endlich auf dem Dänholm unser Quartier bezogen, waren die Erwartungen entsprechend hoch.
Es gibt einen Schnappschuss unserer verschworenen Crew aus dem Jahre 1935: freie Oberkörper, völlig verschwitzt, Arm in Arm. Wir waren 19 Jahre alt – und obwohl uns Unteroffizier Jodeit den ganzen Tag mit seinem barbarischen Drill über den Platz gejagt hatte, konnte er uns das Lachen auf den Lippen nicht nehmen.
Es gibt keinen Offizier, der seinen Schleifer je vergisst – selbst wenn er dessen Dienstgrad längst hinter sich gelassen hat.
Ich hatte seinen Sarkasmus schon zur Genüge kennengelernt, als Jodeit – an unserem dritten Tag in der Kaserne – zufällig meinen Zeichenblock zu Gesicht bekam. Ich hätte mich ohrfeigen können, als er eine Ecke des Blocks unter meiner Decke entdeckte, ihn herauszog, sich auf die Bettkante setzte und ein Blatt nach dem anderen begutachtete.
„Ein Künstler, Matrose Gräf? Ein Meister der Bleistift-Skizze?
„Nicht mehr als ein Hobby, Herr Unteroffizier.“
Er fand offensichtlich Gefallen daran, mich vor versammelter Mannschaft vorzuführen. „Sie sind zu bescheiden, Matrose Gräf.“ Er riss eine Seite heraus. Die Zeichnung – eine Flussbiegung an der Elbe – war eine meiner besten, aber noch unvollendet. „Wird sich sehr gut in meinem Zimmer machen. Ich war schon immer ein Freund von allen nur erdenklichen Gewässern. Stilistisch ein wenig zu wild für meinen Geschmack, aber ich werde die Ungeduld in Ihrer Strichführung wohlwollend übersehen – zumal sie sich ja anscheinend in all Ihren Arbeiten niederschlägt.“
Ich ließ mich zu keiner Reaktion hinreißen, sondern lächelte nur. Er klappte das Skizzenbuch vorsichtig zu und schob es wieder unter die Decke.
„Ab sofort haben wir beide ein kleines Geheimnis, Matrose Gräf: Jedes Mal, wenn Sie einen Stift in die Hand nehmen, werden Sie an das Bild denken, das fortan über meinem Bett hängt. Es wird Ihnen helfen, ein besserer Künstler zu werden. Verstanden?“ Er grinste.
„Jawohl, Herr Unteroffizier.“
Bevor er unsere Baracke verließ – alle Mann mit versteinertem Gesicht strammgestanden, die rechte Hand zum Salut erhoben – wedelte er mit der Zeichnung über seinem Kopf. „Meine Herren, Sie haben einen Künstler in Ihren Reihen. Einen kleinen Caspar David Friedrich! Vielleicht wird er ja auch Porträts malen, meine Herren. Vielleicht fordert er Sie dazu auf, für sein Skizzenbuch nackt zu posieren. Passen Sie auf, meine Herren, dass er Ihnen nichts abguckt.“
Und damit drehte er sich um und verschwand. Ich blieb zurück mit meinen johlenden Kameraden, die gar nicht mehr aufhören wollten, mich nach Herzenslust aufzuziehen.
Irgendwann aber verstummte dann auch der letzte Lacher. Jeder von uns hatte seinen eigenen Grund, Jodeit ins Pfefferland zu wünschen – und viele von ihnen waren berechtigter als meiner. Ich selbst war mit einer stattlichen Größe gesegnet und obendrein in bester körperlicher Verfassung, doch für diejenigen, die von der Natur nicht so großzügig bedacht worden waren, hatte Herr Unteroffizier ein ganzes Arsenal wüster Beschimpfungen auf Lager.
Doch selbst wenn er einigen meiner Kameraden das Leben zur Hölle machte, schaffte er es nie, unser kollektives Rückgrat zu brechen. Gemeinsam entwickelten wir einen eisernen Willen – selbst wenn wir in den wenigen Minuten, die uns vor dem Schlafengehen blieben, nur noch unsere geschundenen Knochen spürten. Ein junger Kerl, der wegen seiner Skizzen durch den Kakao gezogen wird, kann sich nicht wirklich beim Schicksal beklagen.
Besagtes Skizzenbuch war allerdings auch mein Rettungsanker auf dem Dänholm – ungeachtet der Tatsache, dass ich nur selten zum Zeichnen kam. Doch es gab Momente, etwa, wenn wir durch Dünen robbten, das Maschinengewehr bleischwer in den Händen, in denen mir unweigerlich die Bilder von Otto Dix durch den Kopf gingen.
Sicher, die grotesken Kriegsbilder, die Dix malte, hatten andere, drastischere Sujets als einen Soldaten in der Grundausbildung. Und abgesehen davon war er zu diesem Zeitpunkt ohnehin aus der Öffentlichkeit verbannt worden: Das Reich hatte ihm das Etikett „Entartete Kunst“ verpasst und ihn so jeder Publizität beraubt. Dabei hatte ich zwei Jahre zuvor noch seine Bilder im Neuen Rathaus in Dresden bewundert – und die von Dutzenden vergleichbarer Maler auch. Einer von ihnen war übrigens Wilhelm Lachnit, bei dem ich selbst das Zeichnen gelernt hatte.
Der Oberbürgermeister, als überzeugtes Parteimitglied bereits an seiner Uniform erkennbar, war durchs Rathaus paradiert und hatte seine Meinung zu den ausgestellten Gemälden zum Besten gegeben. Dass sich staatliche Instanzen zum Schiedsrichter über künstlerische Verdienste aufzuschwingen versuchten, sollte leider Gottes schon bald auf der Tagesordnung stehen.
Noch tiefere Spuren als Dix hatte bei mir allerdings Franz Marc hinterlassen. Es gab Zeiten, in denen ich nach der unbändigen Wildheit seiner Tiere, nach der Brillanz seiner Farben geradezu verrückt war. „Blau ist das männliche Prinzip“, schrieb er einmal, „herb und geistig.“ Er musste das Blau des Meeres gemeint haben. Das redete ich mir jedenfalls immer ein.
Warum trieb ich mich eigentlich beim Militär herum, wenn mein Herz noch immer für die Kunstakademie schlug? Nun, es war eben nur ein Teil meines Herzens – und nicht mehr unbedingt der wichtigste. Andere Faktoren hatten seinen Platz eingenommen: die körperliche Fitness, die Rivalität unter den Kameraden – und nicht zuletzt eben auch der Glaube an den heldenhaften Kampf der Kriegsmarine.
Ein Mann ist erst ein Mann, wenn er die unterschiedlichsten Qualitäten in sich vereint.
Sie hatte auf viele Namen gehört, vorwiegend aber auf Bride. Sinnigerweise war sie nie verheiratet gewesen und wird es – mit inzwischen 61 – vermutlich auch nie mehr sein. Was sie aber keineswegs bedauert. Nach dem, was Bride in ihrem Leben über Männer gelernt hat, schätzt sie sich glücklich, dass es nie zu einer engeren Bindung gekommen war.
Da gab’s Gerald, mit dem sie’s eine Weile versucht hatte. Und sie hatten eine wirklich gute Zeit miteinander verbracht. Gerald hatte fraglos Qualitäten gehabt – und es gab Nächte, in denen sie sich noch immer nach der schieren Nacktheit seines Körpers und seinem ansteckenden Lachen am Frühstückstisch sehnte. Aber am Ende des Tages passte es einfach nicht zusammen, wie man so schön sagt.
Inzwischen hat sie das seltene Glück, dem Mann ihrer Träume zehn Mal täglich über den Weg zu laufen: Kanadier, Amerikaner, Briten, Neufundländer – schnittige Kerle allesamt, oft uniformiert und garantiert auch mit körperlichen Vorzügen ausgestattet, die sie sich im Detail lieber nicht vorstellen will. Einige sind so jung und stehen sexuell so unter Strom, dass sie den faktischen Altersunterschied als unüberbrückbares Hindernis empfindet. Aber, wie sie schon vor geraumer Zeit erkannte: besser das als gar nichts. Es hält ihren Kopf frisch. Und daran gibt es nicht den Hauch eines Zweifels.
Miss Fitzpatrick nennt er sie.
Keine Frage: Der junge Mann ist auf einer verzweifelten Suche, doch sie könnte das Ziel seiner Suche beim besten Willen nicht mit Worten benennen. Die Uniform, die er trägt, ist in diesem Fall die Kluft eines Schiffskellners – was seinen Chancen bei der Damenwelt natürlich nicht gerade zuträglich ist. Es gibt durchaus junge und hübsche Damen an Bord der Caribou, doch an einen Steward werden sie ihr Herz nicht verlieren wollen.
Sie ruft ihn Johnny, auch wenn er John bevorzugt hätte.
John hat seinen eigenen Kopf. Bride machte zum ersten Mal diese Erfahrung, als sie ihn vor Jahren kennenlernte. Er war ein grüner Junge aus Neufundland, hatte sich aber partout in den Kopf gesetzt, sein Glück in New York zu versuchen. Als sich die anderen Passagiere in ihre nächtlichen Quartiere verzogen hatten, knöpfte sie sich den Möchtegern-Weltenbummler vor und redete Tacheles mit ihm. Da sie zehn Jahre Manhattan auf dem Buckel hatte, fühlte sie sich dazu durchaus berufen.
Der Stiefvater des jungen Mannes hatte Neufundland verlassen, um die Stahlgerippe der New Yorker Wolkenkratzer zusammenzuschweißen. Auch am Empire State Building habe er angeblich mitgewirkt. Insofern war der junge Mann gar nicht so unvorbereitet, wie sie anfangs befürchtet hatte. Was aber nichts daran änderte, dass er noch grün hinter den Ohren war und dringend auf das Leben in New York vorbereitet werden musste.
Dann, acht Monate später, kreuzte John Gilbert erneut ihren Weg. Er hatte mit New York abgeschlossen und befand sich auf der Heimfahrt nach St. Anthony. Sie war auch nicht überrascht, als sie im nächsten Jahr einen Brief von ihm bekam: Ob sie ihm vielleicht dabei helfen könne, einen Job auf der Caribou zu bekommen. John hatte einfach Hummeln im Hintern. Und hat sie heute noch.
Doch er wartet geduldig, bis sie ihm ihre Aufmerksamkeit schenkt. „Die Stricklands wollen eine größere Kabine.“
„Es gibt aber keine freien Kabinen mehr.“
Bride schaut ihm nach, als er sich umdreht und den Treppenschacht hinuntergeht. Manchmal möchte sie nicht ausschließen, dass er es eines Tages zum Chefsteward schafft. Das Potenzial ist vorhanden, aber zunächst sollte er besser noch kleine Brötchen backen und sich die nötige Reife aneignen. Er tut sich immer noch schwer damit, Befehle von Frauen befolgen zu müssen. Was natürlich auf die Mehrzahl der männlichen Kameraden zutrifft – und Bride nicht im Geringsten aus dem Gleichgewicht bringt. So was braucht seine Zeit. Früher oder später müssen sie aber alle dadurch. Ohne Ausnahme.
Die gleiche Erfahrung hatte sie bereits in Manhattan gemacht. Die jungen Schlaumeier, die sich über sie lustig gemacht hatten, waren felsenfest davon überzeugt, die kompetentere Alternative zu sein. Sie sollten eines Besseren belehrt werden. Entweder sie lernten, was Sache war – oder aber sie durften wieder die Bürgersteige fegen. Sie hatte ihre Position im Waldorf Astoria schließlich nicht ohne Grund bekommen. Sie wusste, was getan werden musste, sorgte dafür, dass es getan wurde – und war erst zufrieden, wenn sich der Gast mit einem Lächeln bedankte.
Warum ließ sie all das nach zehn Jahren zurück? Wenn sie morgens zur Arbeit ging, kam sie am Empire State Building vorbei – und stellte jeden Tag aufs Neue fest, dass sie ein derartiges Weltwunder in Neufundland nicht so schnell sehen würde. Sie blickte andächtig hoch, fixierte die Nadel auf der Spitze – und schaute sich dann das Gewimmel der Passanten auf dem Bürgersteig an. Was ist es bloß, fragte sie sich, das eine Person an einen spezifischen Ort fesselt?
Familie? In ihrem Fall Fehlanzeige. Die Kicks einer Großstadt? Sicher, davon gab’s in New York jede Menge, aber nach einer gewissen Zeit wurde eigentlich jeder Reiz fad. Für sie, das wurde ihr im Laufe der Jahre immer klarer, war die Heimat der Magnet. Sie sehnte sich nach allem, das sie irgendwie mit der Heimat in Verbindung bringen konnte. Und aus genau diesem Grunde freute sie sich auf die Caribou und ihre Arbeit an Bord. Jedes Mal, wenn die Fähre in Nova Scotia ablegte, war sie auf dem Weg in die Heimat. Und gab es einen größeren Kick, als mit einem Haufen von Soldaten und Matrosen am Piano zu stehen, gemeinsam zu singen oder zu tanzen?
Ja, es gab einen: Piloten!
Auch ein Pfeife rauchender Kapitän sollte seinem Laster tunlichst auf offenem Deck nachgehen. Selbst im Winter. Obwohl, es ist noch nicht einmal richtig Winter. Es ist eine Oktobernacht, die Ben Taverner auf dem öden schwarzen Deck des Schiffs verbringt, dessen Geschicke ihm nun seit 14 Jahren anvertraut sind.
Der Mond taucht das Deck in fahles, seidig schimmerndes Licht. Taverner umfasst mit einer Hand die eiserne Reling und zieht mit der anderen an seiner betagten Rosenholz-Pfeife. Er tut das in zeitlichen Abständen, die er im Lauf der Jahre verinnerlicht hat: Einerseits sollten keine Funken die Pfeife verlassen, andererseits die Glut nicht verlöschen. Heute Nacht aber hat der Tabak den Dienst quittiert – und kein noch so hektisches Paffen bringt ihn wieder zum Glühen.
„Captain. Sir.“ Es ist eine jenseitige, geisterhafte Stimme, die seine Bemühungen unterbricht.
In den Worten schwingt eine Distanziertheit mit, die Taverner irritiert – auch wenn er dieses Gefühl nie mit dem dritten Offizier teilen würde, der zufällig auch sein leiblicher Sohn ist.
Taverner antwortet mit der schlichten Nennung seines Namens: „Harold.“
Schritt für Schritt löst sich Harold aus der alles verschlingenden Dunkelheit. Sein Gesicht, von einer Mütze halb verdeckt, schiebt sich zuletzt ins fahle Mondlicht. In seinem Blick ist eine demonstrative, seinem Vater nur allzu gut bekannte Verschlossenheit, die das Gefühl der Fremdheit nur noch verstärkt. Für einen Moment sieht er älter aus, als er ist – älter auch als sein Bruder Stanley, der ebenfalls zur Mannschaft zählt. Harold ist 24.
Taverner geht nicht davon aus, dass sein Sohn an seinen Gedankengängen interessiert ist, will sie aber trotzdem ausgesprochen wissen.
„Die Caribou hat sich schon viel zu lange auf die Gunst des Schicksals verlassen.“
„Die Deutschen haben auch die Waterton versenkt – und nicht eine Person kam ums Leben. Die Vision hat sie alle an Bord genommen.“
Harold hatte recht. Was aber vor allem der Tatsache geschuldet war, dass sich der Vorfall am Tage ereignete. In völliger Dunkelheit wäre es mit Sicherheit nicht so glimpflich verlaufen.
Der Kapitän zeigt selten Gefühle, selbst in dieser Situation nicht. Nur seine engsten Freunde haben eine emotionale Reaktion von ihm erlebt. Die meisten Mitglieder der Mannschaft sehen in ihm einen unbiegsamen, unerschütterlichen Mann, der in allen Situationen absolute Ruhe bewahrt.
Harold indes wurde bereits mehrfach Zeuge, wie die Fassade zu bröckeln begann. Er hat obendrein gelernt, den Zeitpunkt der Implosion vorauszusagen – und, bis zu einem gewissen Grad, sogar zu schätzen.
Seit einigen Monaten hat es Ben Taverner standhaft abgelehnt, sich die Perspektive seines Sohnes anzueignen. Harold ist felsenfest davon überzeugt, dass die Kanadier mit der Waterton nur auf dem falschen Fuß erwischt wurden – und nun alles nur Erdenkliche tun, um einen weiteren Zwischenfall zu vermeiden.
Doch auf den Mann, der die Gewässer der Cabotstraße besser kennt als jeder andere, wollen sie natürlich nicht hören. Sicher, die S.S. Caribou ist ein ziviles Passagierschiff, aber über die Hälfte der 191 Passagiere sind Soldaten, die nach dem Heimaturlaub zurück an ihre Stützpunkte in Neufundland fahren. Und Taverner hat nicht den leisesten Zweifel, dass der deutsche Geheimdienst bestens darüber informiert ist.
Harold hingegen ist überzeugt, dass sich die Pickelhauben für kleine Pötte wie die Caribou überhaupt nicht interessieren.
Taverner schaut seinen Sohn an und sieht eine Ignoranz am Werk, die umso verbissener wird, je weiter sie sich von der Realität entfernt. Ihn mit Argumenten erreichen zu wollen, ist völlig sinnlos geworden.
Für einige Monate hatte Harold auf einem Frachtschiff gearbeitet, das auf den Great Lakes verkehrte und einige Kanadier beschäftigte. Er könnte sich Besseres vorstellen, als an Bord der Caribou sein Leben zu fristen. Taverner versteht ihn nicht. Wenn einem auf dem Silbertablett die Chance präsentiert wird, sich zum Kapitän hochzuarbeiten, würde doch jeder normale Mensch sofort zuschlagen.
Wenn Taverner eines Tages in den Ruhestand geht, wird Stanley die Chance mit Kusshand ergreifen. Er rechnet vermutlich sogar fest damit. Und doch ist es Harold, der den Verstand und das natürliche Verständnis für die See hat – mehr als genug jedenfalls, um jedes Schiff sicher über die sieben Meere zu steuern. Taverner hat ihm das oft genug versichert.
Er wäre der nächste Käpt’n Taverner.
Warum sollte ein Sohn nicht stolz darauf sein?
Das Schiff tuckert im Dunkel der Nacht unbeirrt voran, eingehüllt in schwarzen Ruß und Rauch. Nur das Mondlicht hat für seine Diskretion kein Verständnis.
Jede Faser meines Körpers wartete ungeduldig auf den Tag, an dem wir die feldgrauen Uniformen gegen das Blau der Marine eintauschen konnten. Man gab uns sogar einen Tag frei, um unsere neue Montur in der Öffentlichkeit auszuführen. Die Mädels in Stralsund jedenfalls waren begeistert. Sie kamen uns auf den vereisten Einfahrten ihrer Häuser entgegengeschlittert und strahlten übers ganze Gesicht. Zum ersten Mal merkten wir, dass Kleider Leute machen – Uniformen aber noch mehr.
Im Anschluss ging’s hinaus auf die Ostsee, drei Monate lang auf der Gorch Fock – dem Segelschulschiff der Marine, das an guten Tagen auf eine Segelfläche von fast 2 000 Quadratmetern kam. Es ist ein absolut wundervolles Boot – auch wenn man sich natürlich keinen größeren Kontrast zu einem U-Boot vorstellen kann.
Aber … wir waren ja noch keine U-Boot-Fahrer, sondern erst Kadetten, die ihre nautischen Kenntnisse verzweifelt unter Beweis stellen wollten. Wir enterten die Rah und kletterten auf die Webleinen – lautstark angetrieben von Oberbootsmann Kühn. Wir waren Matrosen ganz unten auf der Karriereleiter – zu Tode getriezt von sadistischen Feldwebeln, die in uns nur den Schmutz unter ihren Stiefeln sahen. Wer für einen Tag abgestellt wurde, die Unteroffiziers-Quartiere zu säubern, hatte ebenso wenig zu lachen. „Sie sind sich wohl zu fein fürs Putzen, Gräf?“, wurde man gleich zu Anfang angeschnauzt. Ihre Räumlichkeiten stanken nach Schweiß, Bier und kaltem Zigarettenqualm. Jan Maat war wohl die Marke ihrer Wahl. Selbst meine Freunde und ich rauchten besseren Stoff.
Ein Unteroffizier, nur mit Unterhose bekleidet, fiel betrunken aus seiner Hängematte. Als er neben mir landete, ließ er seinen Gasen freien Lauf. „Und wir dachten immer, dass Kadetten den Duft von Scheiße besonders mögen“, pöbelte er unter lautstarkem Gelächter.
Ich sagte nichts und ließ sie lachen.
Wir waren uns sicher, dass wir sie überleben würden. In einigen Nächten trafen wir uns heimlich am Sicherheitsnetz unter dem Klüverbaum. Es war der Ort, an dem ich auch Teddy Suhren kennenlernte – den Tausendsassa und künftigen Liebling der Nation. Und nach dem, was ich damals sah, kann ich nur bestätigen, dass er nicht zufällig der strahlende Held wurde. Auch er zog über die Unteroffiziere mächtig her, doch das taten wir schließlich alle. Suhren aber war ein echter Teufelskerl, der vor nichts zurückschreckte. Die Partei kam jedenfalls zu dem folgerichtigen Schluss, dass man einen Teufelskerl, der obendrein clever war und vom Glück beschenkt, als Aushängeschild fürs Reich gut gebrauchen konnte.
Suhren hatte eine ganz eigene Vorstellung vom täglichen Überlebenskampf – und machte damit auf mich schweren Eindruck. Wenn der Bug des Schiffes durch den phosphoreszierenden Schaum der Wellen schnitt, saßen wir dort in der Dunkelheit und lauschten still den Urgewalten der Natur – so wie es Seeleute seit Jahrhunderten getan hatten. Doch irgendwann durchbrach Suhren die Stille und knarzte die Worte Gorch Focks heraus, des dichtenden Seemanns aus Hamburg, dessen Name unser Schiff zierte.
Dicke Berta heet ik,
Tweeunveertig meet ik!
Wat ik kann, dat week it!
Söben Milen scheet ik …
Der Rest unserer Truppe stimmte mit ein. Natürlich kannten wir alle die frechen Verse über die Dicke Berta, unsere gewaltige Haubitze. Unsere dröhnenden Stimmen klangen dabei wie ein basslastiger Unterwasserchor, doch unser Gelächter am Ende war glasklar und kam von ganzem Herzen.
Fock wusste natürlich nicht, dass dieser wundervolle Windjammer einmal nach ihm benannt werden sollte. Er kam 1916 bei der Skagerrakschlacht ums Leben. Wir ließen es uns nicht nehmen, auf unserer Reise sein Grab zu besuchen.
Wenn im Folgenden Zweifel an meiner Mission durchschimmern sollten, so möchte ich dieses Missverständnis gleich im Keim ersticken: In der Kriegsmarine gibt’s keinen Platz für Zweifler. Meine Untergebenen vertrauen mir ohne Wenn und Aber. Ihr Leben liegt in meiner Hand – oder genauer gesagt: in den Händen all jener Männer, die einen einmal erteilten Befehl auch adäquat umzusetzen versuchen. Es ist eine eiserne Kette von Händen, die ineinandergreifen – und dabei vollstes Vertrauen in die Entscheidungen jener haben, die am Anfang dieser Kette stehen.
Admiral Dönitz genießt das Vertrauen von ausnahmslos allen Kapitänen. Und da U-Boote in seiner besonderen Gunst stehen, wird er von ihren Besatzungen geradezu abgöttisch verehrt. „Der Löwe“ ließ es sich natürlich nicht nehmen, U 69 und seine bärtige, sonnengegerbte Truppe persönlich zu begrüßen, als wir am 25. Juni 1942 wieder in St. Nazaire einliefen. Der Trip in die Karibik war meine Jungfernfahrt als Kommandant gewesen. Wir hatten vier Schiffe mit insgesamt 12 000 BRT versenkt – kleine Fische, aber mit Sicherheit groß genug, um meine Qualifikation zu bestätigen. Für meine zweite Mission hatte der Admiral – genau wie ich auch – jedenfalls Größeres im Sinn.
Als er an Bord kam und meine Hand schüttelte, nahm er mir gleich jegliche Berührungsängste. Er war einfach dieser Typ von Mann. Es wurde kolportiert, dass er mehrfach mit seinem eigenen Geld einem Kommandanten unter die Arme gegriffen hätte. Wenn jemand knapp bei Kasse war oder sich vor seiner nächsten Fahrt noch etwas Spaß in Paris gönnen wollte, hatte er spontan sein Portemonnaie gezückt.
„Ein vielversprechender Start, Oberleutnant Gräf. Die Karibik scheint Ihnen zu liegen.“
„Jawohl, Admiral“, sagte ich, „auch wenn sie heiß wie die Hölle ist.“ Die Fahrten auf Deck waren überaus angenehm gewesen, doch die langen Tauchgänge waren Dampfbäder mit Diesel-Aufguss. Das kondensierte Wasser tropfte an allen Ecken und Kanten. Oft genug konnten die Leute kaum noch atmen.
Unsere fetteste Beute war die Lise gewesen – ein norwegischer Öltanker, der im Auftrag der Tommies unterwegs war. Wir nahmen sie in der Nähe von Curaçao unter Beschuss – zuerst mit einem Torpedo, dann mit vollen Rohren auf ihren Geschützturm. Als keine Gegenwehr mehr zu erwarten war, ordnete ich eine Feuerpause an. Ich wollte den Überlebenden Zeit geben, von Bord zu gehen, bevor wir das Schiff mit einem Gnadenschuss auf den Meeresboden beförderten.
Unser Feind ist das Schiff, nicht die Besatzung. Wir wollen Menschenleben retten, wo immer wir es können. Die Tommies hätten das Gleiche getan – selbst wenn uns Widderhörner aus der Stirn gewachsen wären. Auch das ist Teil des Krieges. In der Konfrontation zwischen erbitterten Feinden lösen sich selbst vermeintliche Fakten oft genug in Luft auf. Als die Mannschaft des Schoners James E. Newsom an dem Proviant knabberte, den wir in ihr Rettungsboot geworfen hatten, dürfte sie sich darüber kaum beschwert haben.
Damit wir uns nicht falsch verstehen: Die Sicherheit des U-Boots geht über alles. Es wäre Wahnsinn, das Leben der eigenen Besatzung zu riskieren, nur um Kriegsgegnern eine helfende Hand zu reichen. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, einen Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren, dann unternehmen wir alles, was in unserer Macht steht. Andere Kapitäne tun das Gleiche – oft sogar zur Überraschung der Überlebenden. Der Führer hätte natürlich vor Wut geschäumt. Doch tatenlos zuzusehen, wie Überlebende ertrinken, gehört weder zum Ehrenkodex noch zum Selbstverständnis der Marine.
Bride hält sich selbst für ein echtes Glückskind. Als sie wieder in Neufundland landet, befindet sich das von England kontrollierte Territorium gerade in einem erstaunlichen Aufschwung.
Zehn Jahre zuvor hatte sich Bride unter den umgekehrten Vorzeichen verabschiedet: Wer Arbeit suchte, musste wohl oder übel auswandern. Das Land war so klamm, dass man in England, beim einstigen Kolonialherren, um ein Darlehen nachfragen musste. Die Briten schrieben zwar ein paar Schecks, verabreichten den Kolonisten aber auch eine bittere Pille: Die politische Unabhängigkeit, auf die man so stolz war, wurde sang- und klanglos wieder rückgängig gemacht. Nicht nur Bride war empört. Hatte es je ein Land gegeben, das für seine Unabhängigkeit gekämpft hatte – um sie dann bei nächstbester Gelegenheit zu verscherbeln?
Neufundland wird nun also wieder von den Briten kontrolliert. Zugegeben: Die einzige Flagge, die hier je wehte, war der Union Jack. Eine Regierungskommission aus drei Briten und drei Einheimischen wurde gebildet, die das Land verwalten soll. Es gibt genug Zeitgenossen, die darin den Grund für den wirtschaftlichen Aufschwung sehen. Bride gehört nicht zu ihnen.
Aber zumindest, argumentieren die Anglophilen, gebe es jetzt nicht mehr die neureichen Unterhaus-Abgeordneten, die in St. John’s in Saus und Braus lebten, während die armen Schweine in den Außenhäfen sprichwörtlich am Verhungern gewesen seien. In diesem Punkt muss ihnen Bride rechtgeben. In ihrer Jugend wurde sie mit so viel Hunger konfrontiert, dass sie daran nicht mal mehr erinnert werden möchte.
Aber – und das weiß sie aus erster Hand – waren es nicht etwa die Briten, die das Schlimmste verhinderten, sondern Uncle Sam. Oder anders gesagt: der Krieg. Die USA hatten sich das Stückchen Nordamerika ausgeguckt, das auf halbem Weg zu den Kriegsschauplätzen in Europa lag. Und als die Briten Interesse signalisierten, schenkten sie ihnen 50 Zerstörer, durften im Gegenzug aber Militärbasen in Neufundland und Labrador eröffnen. Die Amis brachten das Geld und Tausende von GIs obendrein.
Wie etwa den Jungen, der just in dieser Minute vor Bride steht. Strahlend weiße Zähne, Kaugummi, Vitalis-Haarcreme. Er ist auf dem Weg zurück zu seiner Einheit, wie die meisten hier an Bord.
Ma’am nennt er sie – und kommt natürlich all the way from Texas. Er hört auf den Namen Hank.
„Aber auf dem Umweg über Pennsylvania, Ma’am.“
Und immer haben sie einen dicken Kumpel im Schlepptau. Entweder kannten sie ihn schon vor dem Ablegen – oder höchstens fünf Minuten später. Beide waren auf Heimaturlaub – und beide haben natürlich auch ihre Familien besucht.
„Und ein paar neue Melodien hab ich auch im Seesack“, berichtet Buzz mit sichtlichem Stolz.
Buzz kann stundenlang am Klavier sitzen und klimpern. „Er ist dann so glücklich wie ein vollgefressener Jagdhund am warmen Ofen“, wie es Hank augenzwinkernd ausdrückt. Bride schüttelt den Kopf und schmunzelt. Über die beiden könnte sie sich den ganzen Abend amüsieren.
Die beiden teilen sich auch eine Kabine – wobei sich Bride ziemlich sicher ist, dass Hank seinen Buddy hochkant rauswerfen würde, wenn ein amouröses Abenteuer des Weges käme.
Er bietet ihr einen Juicy Fruit-Streifen an und zeigt dabei seine blendend weißen Zähne. Bride schüttelt den Kopf und deutet mit einem leichten Kräuseln ihrer Lippen an, dass sie kein Fan von Kaugummi ist. Dessen ungeachtet schiebt sich Hank seinen Streifen unbekümmert in den Mund.
Setzt sich Buzz ans Klavier, glaubt man eine Hand zu sehen, die in einen maßgeschneiderten Handschuh gleitet. Er hält sich jedenfalls nicht lange mit Vorreden auf, sondern haut gleich in die Tasten.
Hank glaubt, die Melodie schon zu kennen und grinst übers ganze Gesicht. Wenn man ihm Glauben schenken darf, hat er diesen Song erst vor zwei Tagen selbst gesungen – als er auf dem Bahnsteig der Grand Central Station eine Angebetete umgarnen wollte.
Hank ist ein Ami, wie er im Buche steht. Er ist ein Charmebolzen sondergleichen und macht einem Mädel so lange Komplimente, bis es erschöpft die Waffen streckt. Er lebt sein Leben, als sei das Morgen eine Million Meilen entfernt. Was aber nichts daran ändert, dass der Krieg bereits lange Schatten wirft. Und nachdem die USA nun aktiv mitmischen, könnte ihm das Grinsen schnell vergehen. Schon morgen könnte er einen Freifahrtschein nach Europa gewinnen und umgehend an die Front verfrachtet werden.
Buzz gibt eine Version von „When the Lights Go On Again“ zum Besten, dem neuen US-Hit, der bereits das Ende des Krieges heraufbeschwört. Hank übernimmt die ersten Zeilen – und für einen Moment wirft Bride ihre professionelle Zurückhaltung über Bord. Schon bald versuchen sie sich an einem zweistimmigen Harmoniegesang und vermitteln den Eindruck, als existiere der Krieg nur in Form seiner Lieder. Bride lehnt sich auf das Klavier und kommt sich einen Moment wie eine stolze Mutter vor.
Doch sie beendet das vokale Intermezzo so abrupt, wie sie es begonnen hat. Ihre Aufgaben auf dem Schiff haben Vorrang. Und sie hat schon in einigen Nächten wirklich alle Hände voll zu tun.
William Lundrigan hat den Gesellschaftsraum betreten: olivgrüner Trenchcoat, darunter Anzug mit Krawatte. Er stellt einen ledernen Koffer ab, der seine besseren Tage schon hinter sich hat, aber noch immer die Vorzüge gediegener Handarbeit erahnen lässt. William Lundrigan ist Bauunternehmer und einer der führenden Geschäftsleute der Insel. Er scheint gute Geschäfte zu machen, seit das amerikanische Militär Neufundland entdeckt hat.
Bride war über seinen Namen schon auf der Passagierliste gestolpert. Diskret hatte sie sich bei ihm erkundigt, was es mit seinem Trip nach Montreal auf sich hatte. Ihr war aufgefallen, dass er eine Woche zuvor bereits zum Festland gefahren war – aus medizinischen Gründen, wie sie vermutete.
Er versichert ihr, dass alles im grünen Bereich sei – wobei er sich weitere Details allerdings für sich behält. Das Herz, nimmt sie mal an. Sie will aber nicht weiter in ihn dringen. Er sieht jedenfalls ziemlich mitgenommen aus. Da ihm die Reiserei offensichtlich zugesetzt habe, möchte er so schnell wie möglich in seine Kabine.
Sie schaut sich suchend nach einem Steward um, der ihm den Koffer heruntertragen soll. Er nickt und meint, dass das tatsächlich hilfreich sei. Er dürfe nicht schwer heben. Vielleicht doch eher Leistenbruch, denkt sie sich. Sie schaut auf den Flur hinaus und ruft nach John.
Doch bevor er auftaucht, hat eine Mrs. Shiers ihren Auftritt – das ist jedenfalls der Name, den Bride der Passagierliste entnimmt. Die Frau hat ein schreiendes Baby im Arm und möchte mit einem Entscheidungsberechtigten sprechen. Sie scheint nicht gerade glücklich, sich mit Bride begnügen zu müssen. Jedenfalls habe sie keine Kabine, keinen Ort, wo sie sich um ihr Baby kümmern könne – und nur mit einem Sitzplatz würden sie die Nacht beim besten Willen nicht überstehen.
Brides Sympathie hält sich in Grenzen. Natürlich hätte die Frau eine Kabine mieten können, wenn sie sich nur frühzeitig gemeldet hätte. Bride sagt ihr, dass sie diesbezüglich mit dem Zahlmeister sprechen müsse.
Habe sie ja alles gemacht, sagt die Frau. Doch das Militär erhalte den Vorzug bei allen Kabinen, die nicht langfristig vorgebucht seien. Und die Tatsache, dass ihr Mann bei der kanadischen Marine sei, habe an dieser Richtlinie nichts geändert. Leonard, ihr Baby, brauche einfach seinen Schlaf – und deshalb sei sie auch gewillt, eine Kabine mit einem Fremden zu teilen.
Bride schaut Hank an und überlegt, ob sich der GI vielleicht opfern würde. Sie ist fast dankbar, dass der Hoffnungsträger keine spontane Begeisterung signalisiert.
Lundrigan bringt sich ins Spiel und bietet der Frau seine Kabine an. Er hat selbst Kinder – nicht weniger als zwölf sogar. Und der Jüngste ist nicht viel älter als Mrs. Shiers Baby. Lundrigan bittet Bride, alles Weitere mit dem Zahlmeister zu regeln.
Was ihr aber gegen den Strich geht. Sie weist Mrs. Shiers unmissverständlich darauf hin, dass Lundrigan ein kranker Mann sei, der gerade eine Operation überstanden habe und dringend seine Nachtruhe brauche.
Blödsinn, sagt Lundrigan. Er holt seinen Schlüssel aus der Tasche und händigt ihn Mrs. Shiers aus.
Es liegt natürlich nicht in ihrem Aufgabenbereich, mit ihm darüber zu streiten – und doch ist es genau das, was sie am liebsten tun möchte.
Wo will er sich denn hinlegen? Nur das Sofa im Gesellschaftsraum komme dafür in Frage – aber das hätte man auch einem Penner angeboten, der ohne jeden Penny an Bord erschienen wäre. Bride fehlen einfach die Worte.
Es heißt, dass jeder Kapitän nur so gut ist, wie seine Mannschaft. Taverner würde entgegnen, dass er das Beste aus seiner Mannschaft herausholt, weil er das Beste von ihnen erwarte. Er dirigiere ein Schiff, auf das jeder stolz sein könne. Selbstvertrauen ist nicht gerade eine Qualität, an der es ihm mangelt.
Taverner spricht oft und gerne über die anderen Brüderpaare, die auf seinem Schiff arbeiten – abgesehen von seinen beiden eigenen Söhnen. Es ist ein Faktor, der ihm viel bedeutet. Da gibt’s die Hanns, Harry und Clarence, die Gales, George und Jerome, die Coffins, Elijah und Bert. Sechs Paare sind’s insgesamt – und ausnahmslos sind es geborene Seeleute, die sich durch Frauen oder Mütter nicht von ihrer Berufung abbringen lassen. Seine Männer kennen die Gefahren genauso gut wie er. Er rechnet es ihnen hoch an, dass sie alle Bedenken rigoros vom Tisch wischen.
Er wird aus seinen Gedankengängen gerissen. Ein Mann, Kragen hochgeschlagen und den Hut tief heruntergezogen, tritt aus der Dunkelheit.
Es ist Lundrigan. Taverner weiß zwar, dass er an Bord ist, hat aber eigentlich damit gerechnet, dass er sich längst in seine Kabine begeben hat. Er warnt ihn, sich bei dem kalten Wetter keine Erkältung einzufangen.
Lundrigan hat klein angefangen. In seinem ersten Job verdiente er 50 Cent – pro Tag. Mit 15 verließ er die Schule, um in der Familie auszuhelfen: Sein Vater war nach einem Bergbauunfall arbeitsunfähig geworden. Er selbst wurde Bergmann, reisender Vertreter, Besitzer eines kleinen Lebensmittelladens – und fasste dann im Holzhandel Fuß. Inzwischen hat er ein Dutzend Eisen im Feuer und arbeitet rund um die Uhr. Er ist ein Mann, der einfach nicht loslassen kann.
Die beiden Männer haben aus ihrem gegenseitigen Respekt nie ein Geheimnis gemacht. Der Kapitän streckt seine Hand aus. Lundrigan drückt sie, wenn auch nicht so kraftvoll wie bei seinem letzten Besuch an Bord.
„Ich brauch nur etwas frische Luft“, sagt er. Lundrigan kennt Stanley von seinen früheren Trips. Harold begegnet er gerade zum ersten Mal. Er schüttelt seine Hand. „Muss für einen Käpt’n ein gutes Gefühl sein, seine Söhne mit an Bord zu haben.“ Der Händedruck hat darüber hinaus Assoziationen ausgelöst, die er schon immer artikuliert haben wollte. „Die Liebe zum Meer – so was steckt im Blut, oder?“
„Ja, im Blut.“ Taverner hat in diesem Punkt nicht den Hauch eines Zweifels. Trinity, wo er groß wurde, hatte seit dem 16. Jahrhundert einen Hafen, in dem selbst internationale Fischkutter anlegten – Portugiesen, Engländer, Franzosen. Als er ein Kind war, hatte der Ort geradezu Hochkonjunktur. Doch kaum hatte er die Grundschule verlassen, nahm Taverner das erstbeste Boot und kehrte Neufundland den Rücken. Als er 20 war, hatte er bereits sein „British Foreign Going Masters“-Zertifikat in der Tasche. „Ich wusste, dass ich mein Leben auf See verbringen würde. Daran gab’s nie einen Zweifel.“
„Besessen“, schlägt Lundrigan vor. Nur ein besessener Mann wird im Leben etwas erreichen. Und ganz ohne Dickköpfigkeit geht’s eben auch nicht.
Taverner hätte in jedem Hafen des britischen Empires arbeiten können – wenn er’s denn gewollt hätte. Doch einen echten Neufundländer wird die Insel immer in ihren Bann ziehen – egal, wie lange es ihn in die Ferne verschlagen hat. In Taverners Fall ist es aber mehr als eine Frage der Gewohnheit. Neufundland – davon ist er fest überzeugt – braucht starke und visionäre Führer, die das Land wieder auf den rechten Pfad bringen können.
Deshalb zieht er auch vor Lundrigan den Hut: Der Mann gibt seinen Landsleuten wieder Arbeit und zahlt ihnen einen vernünftigen Lohn. Männern, die den menschlichen Aderlass in Neufundland stoppen, kann man gar nicht genug danken.
„Und wie macht sich Harold, wenn ich fragen darf?“
„Ich bin gerade von den Great Lakes zurück“, sagt Harold. „Wenn ich gewollt hätte, hätte ich dort auch bleiben können. Ich entschied mich aber, nach Hause zurückzukehren.“
Lundrigan schaut ihn forschend an. „Auch wenn’s momentan nicht gerade der sicherste Ort ist, den’s auf Erden gibt?“
Der Kapitän ist ob derartiger Zweifel etwas ungehalten. Er kann sich nicht vorstellen, dass ein Passagier die Sicherheit seines Schiffes infrage stellen könnte.
Lundrigan räumt sogar ein, mit dem Gedanken gespielt zu haben, einen TCA-Flug nach Gander zu nehmen.
Was er aber dann doch nicht tat.
Harold springt seinem Vater bei: „Dies ist die Cabotstraße, Sir, nicht die Straße von Gibraltar.“
Harold hat sich fest vorgenommen, die Waterton nicht zu erwähnen – genauso wenig wie sein Vater. Er erwähnt auch nicht den U-Boot-Angriff auf die Eisenerz-Frachter vor Bell Island, bei dem 29 Menschen ums Leben kamen. Es macht keinen Sinn, Lundrigan noch nervöser zu machen, als er’s eh schon ist.
Jeder Passagier weiß, wo sein Rettungsboot hängt. Und die kanadische Marine hat der Caribou obendrein ein Dutzend Carley-Schlauchboote zur Verfügung gestellt.
Lundrigan wollte sich auf seinem Deck-Spaziergang offensichtlich die Route zu dem für ihn vorgesehenen Rettungsboot einprägen. Taverner nickt. Es kann nie schaden, wenn man im Notfall weiß, wo’s langgeht.
„Dann ist für unsere Sicherheit wohl alles getan. Ich wünsche Ihnen beiden noch einen schönen Abend, meine Herren.“ Sie wünschen ihm das Gleiche und verfolgen, wie er in der Nacht verschwindet.
In U-Boot-Kreisen machte folgende Anekdote schnell die Runde: Nach seiner letzten Feindfahrt war Teddy Suhren 1942 in Brest eingelaufen – mit 32 000 weiteren BRT auf seinem Konto. Beim Andocken war ihm gleich sein Freund Hein Uphoff aufgefallen. Zusammen mit dem Flottillenadmiral und anderen Parteihonoratioren stand Uphoff bereits am Kai, als Suhren ihn erspähte. „Hein“, rief er, „sind die Nazis noch am Ruder?“ „Ja“, kam als Antwort und darauf Teddy Suhren: „Beide Maschinen zurück.“
Nur Suhren konnte eine derart kesse Lippe riskieren. Das Ritterkreuz mit Eichenlaub und Schwertern, das unter seinem Kinn baumelte, half natürlich dabei, kritische Stimmen zum Verstummen zu bringen. Der Flottillenkapitän wurde jedenfalls merklich blasser, verkniff sich aber jeden Kommentar.
Wobei niemand unsere Loyalität zum Reich infrage stellen sollte. Auf Dänholm waren wir 400 Kadetten, die stramm den rechten Arm erhoben und „Heil Hitler“ herausbellten – als ob uns der Führer direkt in die Augen blicken würde. „Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des Reiches und Volkes, Adolf Hitler, dem Obersten Befehlshaber der Wehrmacht, unbedingten Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen.“
Es waren Worte, die einem Mann nicht leichtfertig über die Lippen kommen.
Nachdem der Vertrag von Versailles unseren Stolz mit Füßen getreten hatte, gab uns der Führer unsere Würde zurück. Die Polen hatten nichts Besseres verdient. Sie hatten keinen Anspruch auf unsere Heimat. Ich kann mich noch gut an die Geschichten erinnern, die mein Vater erzählte – wie anmaßende Polen ihren Bauernhof beschlagnahmt und die Bewohner zum Teufel gejagt hätten. Auch die arroganten Franzosen waren für Vater ein rotes Tuch. Die ganze Schuld am Ersten Weltkrieg wollten sie den Deutschen aufhalsen – als wären wir mit den Millionen deutscher Gefallener nicht schon genug gestraft gewesen. Wenn es nach den Franzosen ginge, würden wir bis in alle Ewigkeit ihre Stiefel lecken.
Im November 1939 nahm ich an einem Lehrgang zum Torpedo-Offizier in Flensburg-Mürwik teil. Über die Kristallnacht oder gar ihre Hintergründe wusste ich damals nichts. Kurz darauf war ich auf Heimaturlaub in Dresden und ging zur Synagoge, die ein Opfer der Flammen und inzwischen dem Erdboden gleichgemacht worden war. Vater, der auf die Architektur seiner Heimatstadt überaus stolz war, rückte dann mit der Sprache heraus, dass wohl die SA dahinterstecken würde. Und nicht nur dahinter, empörte sich meine Mutter. Hunderten von Juden habe man ihren Arbeitsplatz genommen – mein Freund Josef sei einer der Ersten, die’s getroffen habe. Josefs Mutter berichtete, dass man mit allen nur erdenklichen Maßnahmen versuchte, die Juden zu schikanieren und zum Verlassen der Stadt zu zwingen.
„Josef habe ich seit Jahren schon nicht mehr gesehen“, stellte Vater fest. „Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als das Thema einfach abzuhaken. Wobei: Die Juden müssen sich auch selbst an die eigene Nase fassen. Sie haben das Unheil geradezu heraufbeschworen. Bei den Juden dreht sich doch alles nur ums Geld.“
„Schäm dich, Walter, schäm dich.“
Das Thema sollte die ansonsten harmonische Ehe meiner Eltern auf eine harte Probe stellen – und mich davon überzeugen, voreilig auf die Marineschule zurückzukehren. Politik stand nämlich dort nicht auf der Tagesordnung.
Niemand redete davon, dass sich Deutschland auf den Krieg vorbereitete. Sollte es aber zu einem Krieg kommen, müsse die Nation natürlich auf diese Aggression vorbereitet sein. Und was die Marine betraf, so hatte sie der Führer wahrlich in ihrem früheren Glanz wiederbelebt. Keine Frage: Das ganze Land hatte zu alter Stärke zurückgefunden. Wir hatten unseren Stolz wiederentdeckt – dieses überlebensnotwendige Gefühl, das man uns für alle Ewigkeit absprechen wollte. Wie konnte man nur auf den lächerlichen Gedanken kommen, dass ein Land ohne Stolz überhaupt existieren könnte? Wir waren schließlich nicht irgendein Blinddarmfortsatz von Afrika oder Asien.
Nachdem wir das Training aufder Gorch Fock abgeschlossen hatten, reisten wir neun Monate lang um die Welt. Erst im Wettstreit mit fremden Ideen und Perspektiven wurde uns klar, was es bedeutet, ein Deutscher zu sein. Und wir waren stolz auf diese deutsche Identität. Den unbedingten Drang, sich ständig verbessern zu wollen, fanden wir nirgendwo sonst auf dieser Welt. Denn was nützt uns schon das Streben nach Freiheit und neuen Horizonten, wenn es nicht von einem ebenso ausgeprägten Ehrgeiz angetrieben wird?
Die Hälfte unserer Crew landete auf dem Kreuzer Emden, während die andere – meine Wenigkeit eingeschlossen – in Kiel an Bord der Karlsruhe ging. Wir machten an exotischen Orten wie Batavia und Hongkong Station, wurden am Ende unserer Reise aber zu einem unplanmäßigen Aufenthalt in San Diego gezwungen.
Der Vertrag von Versailles hatte auch die Schiffsproduktion so dramatisch beschränkt, dass wir nicht mal mehr ein vernünftiges Schiff bauen konnten. Ein sechs Zentimeter breiter Riss quer durch den Rumpf! Es war schon mehr als peinlich, bei der American Naval Yard um Hilfe anklopfen zu müssen.
Es sollte sich nicht wiederholen. Der Führer hatte mit den Engländern eine Regelung ausgehandelt, die Versailles praktisch unterlief und die Begrenzung unserer Stückzahlen rückgängig machte. Was bedeutete: mehr Matrosen, mehr Schiffe, mehr U-Boote.
Und plötzlich waren es U-Boote, die meine Fantasie beflügelten. Innerhalb weniger Monate hatten wir eine ganze Flottille von U-Booten beisammen – zum ersten Mal seit dem letzten Krieg. Und Karl Dönitz zum Befehlshaber zu machen, war natürlich ein brillanter Schachzug.
Während ich auf der Marineschule Mürwik noch meine Ausbildung abschloss, waren all meine Gedanken auf den Tag fixiert, an dem ich erstmals ein U-Boot befehligen würde. Ob es nun Navigation, Waffenkunde oder Seerecht war, das man uns eintrichterte – oder selbst so weltmännische Betätigungen wie Fechten, Reiten und Tanzen: In meinen Gedanken sah ich mich immer hinter einem Periskop.
Es war die Karotte vor meinen Augen, der Köder, der mir das Durchhalten leichter machte. Doch für einen Oberfähnrich zur See gab es natürlich immer noch eine Menge zu lernen. Wie andere Aspiranten wurde ich auf diversen Schiffen eingesetzt, um mir praktisches Wissen in allen nur erdenklichen Disziplinen anzueignen. Auf dem Dampfschiff Hecht lernte ich navigatorische Feinheiten, während ich auf dem Kreuzer Nürnberg als Bordfunker eingesetzt wurde. Als unsere Soldaten in Polen einmarschierten, waren wir auf Patrouille in der Ostsee, während wir wenig später in der Nordsee unsere Zerstörer absicherten, die vor der englischen Küste Minen legten.
Wie tückisch ein U-Boot sein konnte, lernte ich dabei aus erster Hand – auch wenn in diesem Fall die Royal Navy der Absender war. Der Feind hatte einen Torpedo auf den Weg gebracht, der den Bug der Nürnberg