
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Über die Kraft der Natur und den Zauber der Berge Auf seiner ersten Zugreise mitten durchs Schneegestöber kann Vadim nur an eines denken: Atmen. Hoch oben in den Bergen, wo das Ende der Welt nicht mehr weit zu sein scheint, fließt die Luft klar und ungehindert in seine Lungen. Dort oben ist weit und breit kein Fliegeralarm zu hören, nur die alles umfassende Stille der Natur. Von nun an wird er als Vincent ein neues Leben führen, fern von seiner russisch-jüdischen Familie, abgeschieden von der Zivilisation. Und trotz der schneidenden Kälte findet er in dem kleinen Dorf am Hang ein Zuhause und Menschen, die ihm Wärme schenken. Doch über allen Bergen bleibt die Zeit nicht stehen, und schließlich wird die Realität 1943 auch über seinen Zufluchtsort hereinbrechen ... »Valentine Goby beschreibt uns die Metamorphose der Natur im Laufe der Jahreszeiten. Wie schön die Berge unter der Feder von Valentine Goby sind!« LIRE MAGAZINE LITTÉRAIRE
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über allen Bergen
VALENTINE GOBY, geboren 1974, hat zahlreiche Romane und Erzählungen veröffentlicht. 2014 erhielt sie für Kinderzimmer den renommierten Prix des Libraires. In ihren Romanen beschäftigt sie sich häufig mit historischen Themen und verwebt Geschichte und Gegenwart. Valentine Goby lebt in der Nähe von Paris.MARLENE FRUCHT übersetzt seit 2008 aus dem Französischen und Englischen. 2009 erhielt sie das Bode-Stipendium des Deutschen Übersetzerfonds. Zu ihren Autor:innen gehören u.a. Assia Djebar, Baptiste Beaulieu und Éric-Emmanuel Schmitt.
Vincent sieht zu, wie der Schnee den Berg bedeckt, ihn erneut mit Winter überzieht. Der verblüffenden Schönheit des Schnees gelingt es, ihn ins Hier und Jetzt zurückzuholen und die Nacht zu vertreiben. Noch ahnt er nicht, dass es bald Föhn geben wird und dass damit die Schmelze beginnt. Im Moment hat der Schnee noch die Oberhand, der Schnee von Vallorcine, der den Pass verriegelt und die Welt auf Distanz hält, ihr Echo verschluckt.
»Valentine Goby beschreibt uns die Metamorphose der Natur im Laufe der Jahreszeiten. Wie schön die Berge unter der Feder von Valentine Goby sind!« LIRE MAGAZINE LITTÉRAIRE
Valentine Goby
Über allen Bergen
Roman
Aus dem Französischen von Marlene Frucht
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel L'Île haute bei Actes Sud, Arles.
List ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH© der deutschsprachigen Ausgabe 2024by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin© Actes Sud, 2022
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka Umschlagmotiv: Charles Henri Contencin „Das Mont-Blanc-Massiv bei Megève“ © VG Bild-Kunst, Bonn 2024/ © Foto: John Mitchell Fine Paintings / Bridgeman Images; Sabine KwaukaAutorinnenfoto: © Renaud MonfournyE-Book-Konvertierung powered by pepyrusAlle Rechte vorbehaltenISBN978-3-8437-3281-9
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
1 weiß
2 grün
3 gelb
Danke
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
1 weiß
1 weiß
Sobald sie den Zug verlassen haben, bemächtigt sich die Kälte des Jungen. Sie stanzt seinen Körper aus der Umgebung heraus, die unter weiten Kleidern verborgene, magere Gestalt, den Nasenrücken, die Finger, deren Spitzen aus den Handschuhen herausschauen. Mit dem Koffer in der Hand bleibt er auf dem Bahnsteig stehen, in die Wolke des eigenen Atems gehüllt. Er spürt die Umrisse seines Körpers überdeutlich, die ganz feine Grenze, die ihn von der Außenwelt trennt, da, wo warme Haut und eiskalte Luft wie zwei fremde Elemente aufeinandertreffen. Er fühlt sich wie eine der Scherenschnitt-Figuren beim Schattentheater, so stark ist der Eindruck. Im nächsten Moment jedoch verschwindet die scharfe Trennung auch schon wieder, und seine Form beginnt sich aufzulösen.
Der Schnee reicht ihm schon bis zu den Knöcheln, bleibt in großen Flocken an seiner Mütze, der Hose und dem wollenen Mantel hängen, türmt sich auf seinem Koffer und den Schuhen und will ihn verschwinden lassen, so wie er auch alles andere zu verschlucken scheint. Der kleine Bahnhof, die Bäume und Bänke sind nur als glatte, runde Formen zu erahnen, neu geformt vom Schnee. Im Nebel verschmilzt die ganze Umgebung zu einer einzigen undurchdringlichen Substanz, die nur hier und da von einzelnen schwarzen Linien unterbrochen wird: Gleise, die schmale, windabgewandte Seite der Stämme, die Ränder der Dächer. Das Gerippe der Landschaft. Sogar die Ordensschwester neben ihm ist im Verschwinden begriffen, die Wangen, die Tracht und die helle Kopfbedeckung verblassen; einzig die Ränder der Brille und der Gehstock treten hervor, als schwebten sie einfach so in der Luft.
»Vincent?«
Ein Mann löst sich aus der kalten Umgebung heraus, Mütze, Hose und Umhang voll weißer Flocken, Eisstückchen im Bart. Also hat er von der Lawine und der verschütteten Strecke gehört und ist gekommen, um den Jungen abzuholen. Die Schwester seufzt erleichtert, dann kann sie sich ja gleich auf den Rückweg machen.
Seit ihrer Abfahrt aus Paris sind sie zweimal umgestiegen. Es war Vadims erste Fahrt mit dem Zug, der ihn fortbringt aus der Stadt. Doch er war zu aufgeregt, um sich zu freuen. Die ganze Reise über an der Seite der Nonne nur ein Gedanke: Atmen. Auf diese winzige Aufgabe hat er sich konzentriert: einatmen, ausatmen, Sekunde um Sekunde; sechshundert Kilometer Ungewissheit aufgeteilt in Tausende vertraute Einheiten. Für die von der Geschwindigkeit in Fetzen gerissene Landschaft hinter der beschlagenen Scheibe hatte er kaum einen Blick. Er hat ein wenig in seinem Heft herumgekritzelt. Hat versucht zu schlafen, während seine Schulterblätter sich an der hölzernen Sitzlehne rieben. In der Nähe von Lyon begann es zu regnen, später wurde daraus Schneeregen und noch später dichte Flocken, ein unwirkliches, allzu märchenhaftes Abbild der Kälte draußen. Jeder Umstieg schien sie dem Winter ein Stückchen näher zu bringen, als wäre der Winter das Ziel ihrer Reise.
Als der Nebel so dicht wurde, dass er auf beiden Seiten bis an die Gleisböschung heranreichte, verdüsterte sich das Gesicht der Nonne. Vadim war das Wetter egal, er wusste ja auch nicht, welche Gefahr davon ausging. Ihr war dagegen sehr wohl bewusst, was es bedeutet, am Fuß des Passes nicht weiterzukommen. Hinzu kam, dass sie alt und müde war und ihr das Risiko dieser Reise auch für sich genommen schon ausreichte. Vadim sah nicht die Ebene von Chedde, genauso wenig wie die Gipfel der Aravis-Kette. Er sah keine der Kuppeln, Kämme, Spitzen und Gipfel, die jenseits der Wolken verschwanden. Was er sah, waren dichte Passagen aus Fichten, die den hochfahrenden Zug umschlossen, und während er sich die Steigung hinaufkämpfte, fielen die unter dem Gewicht des Schnees gebeugten Zweige wie nasse Haarsträhnen über die Waggonfenster. Er sah einen Tunnel, einen gewundenen Graben, der sich dunkel von der Umgebung abhob. Das Viadukt, das sich über die grüne Arve wölbt, sah er nicht. Er konnte sich kein Bild von der Landschaft machen, weil er weder Kirchtürme noch überhängende Schneekappen, noch eingestürzte Gletscher erblickte.
Als er die Stirn an die Scheibe drückte, sah er neben den Gleisen struppige Zweige mit vereinzelten Blättern aus all dem Weiß am Boden ragen und stellte sich vor, es wären ausgemergelte Arme, die sich aus dem gefrorenen Boden streckten und um Hilfe baten. Von der Durchsage wegen der Lawine hat er nichts mitbekommen, weil er da gerade ein Schild auf dem Bahnsteig entzifferte und sich darüber freute, an diesem vollkommen fremden Ort unerwartet auf vertraute Klänge zu treffen: Chamonix. Das Wort kam ihm bekannt vor, Chamonix, und er sagte sich die Silben einzeln vor, wie wenn man die Absätze wieder und wieder in den Lehm rammt, um darin eingegrabene kleine Steine an die Oberfläche zu bringen, Cha-mo-nix-Cha-mo-nix, bis aus den Tiefen seiner Erinnerung das Bild jener kleinen, rundlichen, mit Orangencreme gefüllten Küchlein auftauchte, an deren dünnem Zuckerüberzug er vor langer Zeit einmal mit dem Fingernagel herumgekratzt hatte, früher, als man die kleinen Chamonix-Kuchen noch kaufen konnte: Er stellte sich die Küchlein auf dem verschneiten Bahnsteig vor, wie sie unter transparentem Papier in ihrer Verpackung lagen, ein Karton der Firma L’Alsacienne, und schon glaubte er zu fühlen, wie ihm das Gebäck auf der Zunge zerging und der imaginäre Zucker sein Zahnfleisch reizte. Die widersprüchlichen Ortsbezeichnungen »Chamonix« und »L’Alsacienne« ließen ihn endgültig die Orientierung verlieren: Das Elsass in Frankreichs Osten, wie er sich zu erinnern meinte, dann hier die weiter südlich gelegenen Alpen, wo sich dieses Chamonix-Schild befand, und die Marmelade aus Zitrusfrüchten, die ihn eher an eines jener sonnenverwöhnten Länder denken ließ, für das er keinen Namen hatte: Wo waren sie jetzt noch mal genau? Wo auf der Karte, die seine Mutter am Abend vor der Abreise in ihrem Zimmer ausgebreitet hatte, an welchem Punkt der grob nachgezeichneten Strecke? Er war verwirrt.
Offenbar hatte er etwas vor sich hin gemurmelt, denn die Schwester tätschelte seine Hand und flüsterte ihm leise ins Ohr: »Es heißt Chamoni! Nicht Chamo-nix, das X spricht man nicht …« Dann lächelte sie: »Mein Kloster ist hier.« Sie fuhr fort: »Hast du gehört? Der Zug endet zwei Stationen früher, wegen einer Lawine.« Blieb nur zu hoffen, dass die Nachricht den Mann ebenfalls erreichte. »Mach dir keine Sorgen, Vincent, wir sind bald da.« Aber zu spät, das Wort Lawine beschwor bereits die nächste Bedrohung herauf. Den Rest der Reise verschlief Vadim, er tauchte einfach hinab in den Schlaf und sah nichts mehr.
Jetzt ist er an der provisorischen Endstation angelangt, irgendwo mitten in dem ganzen Weiß, doch noch nicht am Ziel, und abgesehen von Schnee und Kälte vermag er nicht zu sagen, was ihn umgibt.
»Vincent?«, sagt der Mann noch einmal.
An den Vornamen muss er sich erst noch gewöhnen.
»Ja, wir sind es, also er ist Vincent …«, sagt die Schwester. »Sind Sie Albert?«
»Albert konnte nicht kommen, wegen seines Beins. Ich bin sein Bruder.«
Seltsam, der Mann spricht die Rs so ähnlich aus wie Vadims Vater, der immer versucht, sie nicht zu rollen, und den Laut stattdessen weit hinten im Hals bildet, weil er genauso klingen möchte wie die anderen Pariser. Aber der Akzent ist ein anderer, und wenn der Mann spricht, macht er dabei kaum den Mund auf. Er ist mit Sicherheit kein Russe.
»Sind Sie zu Fuß hergekommen?«
»Heute Morgen kam die Lawine runter. Also bin ich extra früher los.«
Die Schwester nickt bedächtig. Sie legt eine Hand auf Vadims Schulter und drückt sie.
»Passen Sie gut auf ihn auf … und grüßen Sie Abbé Payot von mir.«
Sie klopft den Schnee von ihrer Tracht, steigt wieder in den Waggon und nimmt am Fenster Platz. Sie sieht Vadim winken, sodass die Flocken um sein Gesicht wirbeln, und wie sein Mund stumme Worte der Verabschiedung formt. Schon verschwindet der Junge, der Schnee verschluckt seinen mageren Körper, daran kann auch die Brille nichts ändern, die sie gegen ihre Kurzsichtigkeit trägt. Sie denkt: Es ist das Beste, was ihm passieren kann.
»Es wird bald dunkel, Kleiner, also machen wir uns sofort auf den Weg. Zeig mal deine Schuhe her.«
Vadim folgt dem Mann ins Bahnhofsgebäude und stampft ein paarmal auf den Fliesenboden.
»Also gut …«
Der Mann setzt seine Kiepe ab, holt ein Paar Stiefel mit nagelbesetzter Sohle hervor und kniet sich vor Vadim hin. Man sieht sofort, dass sie ihm zu groß sind.
»Mir wurde gesagt, du seist zwölf …«
»Ich bin zwölf.«
»Deine Füße nicht.«
Der Mann knüllt etwas Zeitungspapier zusammen, stopft es vorne in die Stiefel hinein und zieht die Schnürsenkel fester.
»So, jetzt müsste es gehen.«
Er verstaut die unbrauchbaren Schuhe in seiner Kiepe und hält Vadim ein Stück Brot und eine Trinkflasche hin.
»Hier, zur Stärkung.«
Vadim beißt von dem Brot ab und trinkt.
»Gib mal deinen Koffer her, besser, du hast die Hände frei. Nie die Hände in die Taschen stecken, verstanden?«
Sie reihen sich hinter andere Gestalten, die aus demselben Zug gestiegen sind, und folgen der lose zusammenhängenden Menschenschlange bergauf. Es geht ein kleines Sträßchen hinauf, das sich wie ein schmales Band zwischen den Bäumen hindurchwindet, wo sie fortwährend ältere, schon fast wieder verschwundene Spuren durch neue ersetzen. Vadim zurrt seine Schuhe fest und versucht, in die Stapfen des Mannes vor ihm zu treten. Er muss die Knie ziemlich hochheben, um sich aus dem Schnee zu befreien, dann aber setzt er seine Füße mit Bestimmtheit auf, rammt die großen Clownslatschen in den Boden und streckt dabei die Arme aus, um das Gleichgewicht zu halten. Er hört das gedämpfte Knirschen unter ihren Sohlen. Er passt seine Schritte denen des Mannes an, seinen Atem dessen Atem, und sein Herz klopft wild wie der Schlägel einer Glocke. Im Gleichschritt geht es stetig bergauf, das Tempo ihrer Schritte hält die Menschen zusammen wie ein unsichtbares Seil, während der Schnee unaufhörlich auf sie herabfällt. Um sie herum vermutet Vadim Abgründe, Verwerfungen und Erhebungen. Er wähnt überall Verstecke, Schlupfwinkel, Fallen, dabei weiß er gar nicht, dass er auf alten Schmugglerrouten unterwegs ist; dennoch erscheint ihm die Landschaft, die sich seinem Blick fortwährend entzieht, voller Geheimnisse. Irgendwann zerreißt von ferne ein Pfiff die Stille: Das ist der Zug, der sich unten im Tal wieder in Bewegung setzt.
Bald fängt Vadim an, durch den geöffneten Mund einzuatmen, für ihn ein wohlvertrauter Überlebensreflex. Weil sich bei Anstrengung meistens sofort sein Brustkorb verengt, soll er sich immer schonen, ganz anders als sein älterer Bruder Jean, der ein ausgezeichneter Läufer ist. »Meine kleine Lokomotive«, sagt seine Mutter oft und streicht lächelnd über das blasse Gesicht ihres Sohnes, der schon so oft dem Tod von der Schippe gesprungen ist. Für ihn bewahrt sie echten Kaffee in einer eisernen Dose auf, ein wahrer Schatz, denn das Koffein weitet die Bronchien, und nachts, wenn er schläft, legt sie horchend ein Ohr auf seine Brust. Er hat Asthma seit seiner Geburt, und in den letzten Monaten wurde ihm Stück für Stück die Luft zum Atmen genommen. Erst hatte sein Vater die Schuhmacherwerkstatt in die Wohnung der Familie verlegen müssen – und sie konnten die Tür noch so gut abdichten und für Durchzug sorgen, der Geruch vom Klebstoff und den Lösungsmitteln breitete sich unaufhaltsam aus, griff seine Lungen an und trieb ihn in die Flucht, ins Treppenhaus, zu den Nachbarn. Doch sein Vater hatte keine Wahl, wollte er weiter arbeiten, so musste er es im Verborgenen tun. Kurz darauf zog sich der Raum um Vadim noch enger zusammen, als sein Vater floh und seine Mutter entschied, vorsichtshalber mit ihm die Wohnung zu verlassen. Sie zogen zu den Dorselles, den Arbeitgebern seiner Mutter, wo sie in zwei Einzelbetten schliefen, die nur durch einen mit hauchdünnem Stoff bezogenen Raumteiler voneinander getrennt waren, ihre gefalteten Kleider auf dem einzigen Regalbrett ablegten und Tag und Nacht den Sauerstoff miteinander teilten. Schon als kleines Kind hatte Vadim angefangen, winzig kleine Welten zu zeichnen, Blattadern, Kerben im Holz, Lichtreflexe in einer Pfütze, Haut, Fell, Rinde, einen Schmetterlingsflügel, alles nahm er ganz genau in Augenschein, Unebenheiten im Glas, Risse im Leder, und bannte sie in Abstufungen von Grau auf die Seiten seines Notizbuchs, eine Ansammlung ultrapräziser Fresken. Je kleiner und feiner, umso besser, mikroskopisch kleine Landschaften. Im letzten Herbst hatte er dann in dem kleinen Zimmer begonnen, zylindrische Formen zu zeichnen, das Papier mit ineinander verschlungenen Schläuchen zu füllen, mit schlaffen Umrissen und unzähligen Hohlräumen, die wie platt gedrückte Trauben aussahen. Man konnte reine Formen darin sehen, pure Abstraktion, eine visuelle Spielerei. Doch brachte er darin das Chaos in seinem Körper zum Ausdruck, das für ihn immer schwerer zu ertragen war. Die Angst vor der äußeren Welt presste seine Bronchien zusammen. An dem Tag, als er die Adrenalinspritze bekam, lag er wie ein sterbendes Kind auf dem Bett und starrte an die Decke, blasses Gesicht, auf dem sich das Netz der Adern abzeichnete, lila verfärbte Lider und Lippen, aber sein Herz galoppierte wie wild, und im Weiß der Augen pulsierte das Blut. Da hatte seine Mutter »Stopp« gesagt. Madame Dorselles hatte recht, Vadim musste fort. Ihr Ehemann kannte einen Unternehmer, dessen Familie in Ivry, einem Vorort von Paris, mit Kautschuk ein Vermögen gemacht hatte. Die Dorselles hatten der schwangeren Nichte jenes Mannes vor einiger Zeit einen Gefallen getan und sie so lange als Hausangestellte bei sich arbeiten lassen, bis sie sich des Kindes entledigt hatte – in ebender Wohnung, in der jetzt Vadims Mutter lebte. Der Geschäftsmann stammte aus einem winzigen Tal, das zu schmal war, um im Atlas auffindbar zu sein, einem kleinen Flecken ganz hoch oben, der wie eine natürliche Wiege ins Gebirge gegraben war, von ihm »Tal der Bären« genannt. Dort würde sich jemand des Jungen annehmen. Sophie würde dafür einen Teil ihres Lohns abgeben, und die Dorselles übernahmen den Rest.
Vadim war nicht klar gewesen, dass es so steil hinaufgehen würde, dass so viel Schnee an seinen Waden haften und der Nebel so dicht sein würde. Seiner Mutter und dem Ehepaar Dorselles offenbar auch nicht, denn sonst hätten sie wohl größere Bedenken gehabt. Er achtet auf seine Atmung, lauscht auf das kleinste Rasseln, das erste Anzeichen einer Verengung. Er darf sich nicht überanstrengen und überlegt, dass er ja die riesigen Schuhe als Ausrede anführen kann, falls er allzu sehr trödelt. Aber das Einzige, was sich einstellt, ist wachsende Erleichterung, und den Mann scheint es im Übrigen gar nicht zu kümmern, wie langsam er vorankommt. Vielleicht weiß er auch Bescheid und hat deshalb Geduld mit ihm. Unter den Rippen des Jungen füllen sich viele kleine Ballons mit Helium und heben ihn empor, bis er das Gefühl hat zu schweben. Die Kälte schiebt sich wie kleine Bürstchen aus Eis in seine Bronchien und kleidet sie schützend aus, sodass die kühle Luft pfeilschnell hineinzischen kann. Die Grenze zwischen seiner Haut und der Außenluft existiert nicht mehr, aber es ist nicht einmal unangenehm; die Finger sind klamm, die Zehen vor Kälte gefühllos, so wird er mit der Kälte eins. Die Flocken bleiben an seinen Wimpern hängen, kleben an seinen Wangen wie seltsame Federn. Der Rotz unter seiner Nase gefriert, er spürt sein Gesicht nicht mehr, nicht mehr die kratzige Wolle und nicht die brennenden Wangen. Sein Schal wird zu einem festen Kinnriemen, die Mütze wird zum Helm, sein Mantel zu einer merkwürdigen Rüstung. Es fühlt sich gut an, auch wenn der Gedanke an die Mutter, die nun ganz allein ist, und an den Vater, wer weiß wo, ihn davon abhält, sich ganz und gar verzaubern zu lassen. Sie fahren ihm zärtlich wuschelnd durch die Locken und sagen immer wieder: »Geh, Vadim, geh«, bis er sich schließlich fügt. Wenn auch widerwillig, denn egal, was passiert, er ist und bleibt doch Sophies und Josephs Sohn, Jeans Bruder, der Enkel von Pierre und Myriam, Rachel und Jacob.
»Geht’s?«
Vadim hebt den Kopf. Die Umrisse vor ihnen sind fort, vielleicht gibt es Dörfer irgendwo in der Nähe, zu denen sie abgebogen sind.
»Ja.«
Der Mann stellt den Koffer ab, massiert seine Schulter, deutet zum Himmel. Er sagt, da oben ist der Pass. Der Pass ist sechs bis sieben Monate im Jahr unpassierbar, die Straße ebenso, denn dann liegt da oben etwa zwölf Meter hoch Schnee, manchmal sogar vierzehn, zwanzig Meter. Der einzige Weg, das Tal zu erreichen, ist durch den Tunnel von Montroc. Wenn der Zug durchfahren kann, nimmt man den Zug, wenn eine Lawine den Weg versperrt, muss man zu Fuß durch den Tunnel gehen.
»Und das ist es, was wir tun werden.«
Vadim blickt zu dem unsichtbaren Pass empor, ein Pass, der kein Passieren ermöglicht und das Tal stattdessen einschließt oder beschützt, je nachdem. Unwichtig, solange das Tal eine Zuflucht ist. Zwischen einzelnen, verstreuten Häusern, aus denen weder Laut noch Lichtschein dringt, biegen sie ab und gelangen zu den Eisenbahnschienen, die sie in der Mitte von dem, was von der Fahrspur übrig ist, nur erahnen können und die sie zum Eingang des Tunnels führen.
»Pass auf die Zapfen auf«, sagt der Mann und richtet den Strahl seiner Lampe auf eine Reihe von herabhängenden Eiszapfen. Vadim betrachtet die winzigen, nun golden schimmernden Dolche an der Decke, die wie Zähne in einem märchenhaften Mund anmuten. Der Mann bricht zwei Äste von einem Strauch ab, schüttelt den Schnee herunter und entfernt die kleineren Zweige.
»Die Lampe sparen wir uns für nach dem Tunnel auf«, erklärt er, »im Dunkeln wissen wir sonst nicht, wo es langgeht. Hier können wir uns an der Wand orientieren. Du kratzt einfach mit dem Ast an der Mauer entlang, so, bis zum Ende.«
Der Mann schaltet seine Lampe aus, Vadim betritt nach ihm den Tunnel, und beide werden von der Dunkelheit verschluckt. Vadim macht es wie der Mann, hält seinen Ast in der rechten Hand und lässt ihn an der Wand entlangratschen. Es ist nicht mehr dieselbe Stille wie draußen, die eben noch gedämpften Geräusche werden nun deutlicher, weil das Gestein sie in hellen Tönen zurückwirft, von Mal zu Mal ein bisschen abgeschwächter. Vadim hört sich selbst schniefen und seufzen. Das pausenlose Kratzen der Stöcke, das Aufsetzen der Sohlen auf der Erde, das Brechen vom Eis gefrorener Pfützen, das Tröpfeln und die saugenden Geräusche des Schlamms verschmelzen zu einem bizarren Magma, einer Höhlensymphonie, die einen glauben lässt, zehn, zwanzig Leute würden da unten mit ihnen entlanggehen. Er merkt, dass er seine Atmung nicht länger überwachen muss, die Luft fließt klar und ungehindert hinein und wieder heraus. Also konzentriert er sich aufs Licht, die Suche nach Helligkeit. Doch egal, wie weit er die Augen aufreißt, keine Aufhellung in Sicht. Nicht einmal als flüchtige Spiegelung auf den Eiszapfen, die auf der ganzen Länge des Gewölbes wie Orgelpfeifen von der Decke hängen müssen. Wenn er zurückschaut, ebenfalls nichts als Dunkelheit. Da vernimmt er ein metallisches Reiben, und ein Strauß Funken leuchtet kurz auf. Gleich darauf hört man einen Stein über den Boden rollen.
»Jetzt bist du dran!«, hört er die Stimme des Mannes. »Bück dich einfach, heb einen Stein auf und streich damit die Wand entlang.«
Vadim schnappt sich einen Stein und schlägt ihn gegen die Wand.
»Fester!«
Er versucht es noch einmal, aber die Hände sind steif vor Kälte, sodass er nur drei mickrige Fünkchen zustande bringt und sich dabei die Finger zerkratzt. Da lacht der Mann, der Tunnel vervielfältigt sein Lachen, und Vadim lässt den Stein fallen. Als Nächstes ist wieder das Reiben des Astes zu hören. Vadim fängt auch wieder damit an, obwohl ihm davon schon der Arm wehtut. Da taucht plötzlich in der Dunkelheit ein heller Punkt auf. Der Mann wirft den Ast fort, Vadim tut es ihm nach. Der Punkt wird größer, und schon können sie wieder etwas sehen. Der Ausgang des Tunnels ist ein Loch, das in die Lawine gegraben wurde, eine weiße Öffnung, über deren Rand sie nun hinwegsteigen müssen.
»Nichts Zerbrechliches dabei?«, fragt der Mann und hebt den Koffer hoch.
Vadim schüttelt den Kopf. Da schleudert der Mann den Koffer über die Schneemauer und streckt dem Jungen anschließend die Hand entgegen, um ihn zu stützen. »Komm schnell, wir dürfen hier nicht stehen bleiben, das ist alles nicht stabil.«
Der Tunnel liegt jetzt hinter ihnen. Es hat aufgehört zu schneien. Keine einzige Flocke fällt mehr. Kein Windhauch. Die Landschaft liegt im Nebel wie in einer weißen Dämmerung. Eine erstarrte Welt, wie jene in Bromsilbergelatine auf Glasplatten festgehaltenen Szenen, die Vadim bei seinem Nachbarn in Paris, fest an das Okular eines entsprechenden Bildbetrachters gepresst, hat sehen können.
Nur ein vage angedeuteter Weg führt hier durch den Schnee, aber immerhin scheint vor ihnen schon jemand hier gewesen zu sein, ein Mensch oder vielleicht auch nur ein Tier. Vadim fragt sich, woher der Mann weiß, wohin er seine Schritte setzen muss, um nicht auszurutschen, sich den Knöchel zu verdrehen oder mit dem Fuß in ein Loch zu geraten. Hin und wieder wirft er einen Blick über die Schulter nach hinten und vergewissert sich, dass der Tunnel in ihrem Rücken immer kleiner wird. Dahinter liegt Vadims langer, langer Tag – Chamoni oder Chamo-nix, die Abdrücke seiner Stirn und Fingerspitzen auf beschlagenen Fensterscheiben, der tiefe Schlaf, Tausende von kontrollierten Atemzügen, um durchzuhalten, all die Bahnhöfe, Bahnsteige und Zwischenhalte, die ganze seit Paris zurückgelegte Strecke, die kleine Kammer bei den Dorselles, die verlassene Wohnung seiner Familie. Er ist todmüde. Dies ist das Tal der Bären, wo er von nun an nur noch Vincent heißt.
Sie gehen an den Gleisen entlang, die erst abwärtsführen und dann eine Biegung machen. Man hört das leise Rauschen eines Wasserfalls und den Ruf eines Vogels, der an diesem so still und reglos daliegenden Ort ganz unwirklich klingt. Sie wenden sich nach links, steigen eine Böschung hinauf, stecken bis zu den Hüften im Schnee und setzen ihren Weg dann in einem Gang mit geraden, glatten Wänden fort, die wirken wie mit einer Schaufel gegraben und den Jungen um mehr als das Doppelte überragen. Da schießt ihm plötzlich etwas durch den Kopf – eigentlich kennt er sich mit den heiligen Texten nicht gut aus, aber dieser eine muss ihn wohl beeindruckt haben, oder vielleicht hat er davon auch ein Gemälde gesehen, ein Bild, auf dem das Rote Meer sich vor Moses auftut wie riesige Wände. Schlafwandlerisch geht er weiter, mit eisigen Oberschenkeln, eisigen Knien, eisigen Waden und eisigen Füßen, und stellt sich vor, wie die Wände aus Schnee sich hinter ihnen wieder schließen. Er kämpft gegen die Hand aus Eis, die seine Lider zudrücken will, und blickt zu den grauen Gebilden empor, die dicht unter dem Himmel hängen, es mögen entfernte Felsen oder auch Wälder sein oder Erscheinungen in einem Traum. Er starrt auf den hellen Lichtkreis, den die Lampe auf den Schnee wirft. Jenseits der Mauern erblickt er, stets erst in dem Augenblick, in dem er daran vorübergeht, vom Schnee niedergedrückte Häuser, Lichtstreifen hinter verrammelten Fenstern. Danach gibt es nur noch den Gang und den Schein der Lampe. Er strauchelt. Der Mann dreht sich zu ihm um.
»Zwei Kilometer noch. Hier, iss das. Und schwing deine Arme vor und zurück, so, das regt den Kreislauf an.«
Der Junge beißt in das dunkle Brot und lässt es einfach auf der Zunge liegen, bis es weich wird, kauen wäre zu anstrengend. Sie stapfen die steil aufsteigende Route des Confins hinauf, also sozusagen die Straße am Ende – er weiß nicht, dass die Straße so heißt, aber wenn, dann käme es ihm sicherlich passend vor: Das Ende der Welt kann hier nicht weit sein. Ein Haus, eine Kurve. Und immer wieder der Schein der Lampe. Sie verlassen den Gang und gehen jetzt schräg zur Straße bergauf, folgen einem Pfad im Schnee, der schon wieder halb zugeschneit ist, und wieder sinken ihre Füße ein. Oben dann ein kleiner Weiler, dicht aneinandergedrängte Häuser, deren Umrisse noch dunkler sind als die Nacht. Der Mann bleibt stehen und macht die Lampe aus. Dann schüttelt er seinen Umhang aus, schlägt die Schuhe gegen eine Treppenstufe und stößt eine Tür auf.
Auf einmal steht der Junge im Licht, der Geruch von Feuer, Suppe und Tier dringt in seine Nase. Die Hand, die ihn zurückhält, gehört einer Frau. Alles, was dann passiert, ist verschwommen wie im Traum.
Die Frau sagt: »Klopf zuerst deine Schuhe ab.« Das macht er. Dann: »Na komm, bist ja ganz durchgefroren.«
Er tritt ein, in Mantel und Schuhen, lässt sich durch den Raum schieben und neben einen Ofen setzen. Sie stellt ihm keine Fragen, niemand fragt ihn etwas, nicht der Mann, auch nicht ein weiterer Mann, der dem ersten zum Verwechseln ähnlich sieht, außer dass er humpelt, und ein älterer Mann, der Pfeife raucht, auch nicht. Sie beobachten ihn nur, »Ihm ist kalt«, sagen sie, »das sieht man, und er ist erschöpft, kein Wunder. Morgen wird‘s ihm schon besser gehen, gib ihm was zu trinken und zu essen«, und die Frau rubbelt seine Haare energisch mit einem Tuch trocken, während er sich in der Maserung des Holzbodens verliert. Aus den Schuhen des Jungen tropft Wasser auf die Dielen, unter seinem Mantel bilden sich kleine Pfützen, seine Schnürsenkel tauen auf. Die Hitze brennt an seinen Händen und Füßen und im Gesicht, bohrt sich in seine Schläfen. Die Frau knöpft seinen Mantel auf und zieht ihn aus. Kniet sich hin, öffnet die Schnürsenkel, zieht ihm vorsichtig die Schuhe und die tropfnassen Socken aus und reibt seine Füße zwischen ihren Händen.
»Hast du Hunger?«
»Nein danke.«
»Hier, nimm das trotzdem.«
Sie hält ihm einen Löffel mit einer goldgelben Masse hin, er schiebt ihn sich in den Mund. Der Honig explodiert unter seinen Geschmacksknospen, viel zu intensiv, er verzieht das Gesicht. Sie kocht Tee, fordert ihn zum Trinken auf. Er trinkt, es schmeckt nach Kräutern und Medizin. Er kann nicht mehr. Er beeilt sich, will nur noch schlafen. Taumelnd folgt er der Frau die Treppe hinauf, stolpert in ein kleines Zimmer hinein, in dem eine Glühbirne unter einem spitzenbesetzten Schirm von der Decke baumelt. Die Frau reicht ihm ein sauberes Hemd.
»Ich warte hinter der Tür, und du gibst mir deine Kleider, damit ich sie zum Trocknen aufhängen kann.«
Mit fahrigen Bewegungen zieht er sich aus, muss sich zusammenreißen, um vor Müdigkeit nicht einfach umzufallen. Er schaudert, als der raue Stoff des Hemdes seine Haut berührt. Dann rauft er seine Kleider zusammen und reicht sie durch den Spalt der halb geschlossenen Tür hindurch.
»Pass auf den Backstein auf, ja?«
Keine Ahnung, was sie meint, er will einfach nur schlafen.
»Ja.«
»Gute Nacht, Vincent!«
»Gute Nacht, Madame!«
»Ich heiße Blanche.«
»Blanche«, wiederholt er stumpf.
Dann krabbelt er unter die Decke, stößt sich die Zehen an einem warmen, festen Gegenstand, hebt das Laken an: der Backstein.
Er schiebt ihn ganz ans Bettende, schleudert das Daunenkissen von sich – keine Federbetten für Asthmatiker – und schließt endlich die Augen. Da tauchen vor ihm die Gesichter seiner Mutter auf, von Jean, von seinem Vater, genau so, wie sie unten im Koffer in dem Medaillon aus Leder eingeschlossen sind. Auf dem Koffer steht der Name Vincent Dorselles. Von nun an ist er Vincent.
Dann legt sich Schnee über die Gesichter.
Er wacht auf, als es hell wird. Vielleicht hat ihn auch sein steifer Nacken geweckt, weil er die ganze Nacht in ein und derselben Position verbracht hat, er muss geschlafen haben wie ein Stein. Oder aber die Kälte an seinem Bein, weil er in der Nacht die Decke von sich getreten hat. Vielleicht sind es auch die regelmäßigen Schläge draußen, irgendwer hämmert dort. Oder es sind die Glockenklänge, die durch den Fußboden dringen – nicht das dunkle Dröhnen von Kirchenglocken oder das helle Klingen der Dienstglocke, die seine Mutter bei den Dorselles benutzt, sondern liebliche, unregelmäßige Glockenklänge, die keinerlei Aufforderung beinhalten, so wie der Wind in den Zweigen oder das Rauschen einer Quelle, ein fröhliches Geklimper nur, um das Ohr zu erfreuen. Vielleicht ist es auch der Geruch von Suppe. Oder seine volle Blase. Auf dem Rücken liegend, fühlt er den Druck. Er dreht sich auf der dünnen Matte um. Da spürt er den kalten Backstein an den Füßen. Er streckt sich aus, streicht mit den Fingerspitzen an der eiskalten Wand entlang und erinnert sich. Vallorcine, das Tal der Bären. Sein Blick fällt auf den Kopf einer Katze. Rechts von ihm ist eine warme Stelle, daneben ein runder Sabberfleck. Hat die Katze etwa dort geschlafen, direkt in seiner Atemluft, ohne dass er daran erstickt ist? Er streckt die Finger nach dem Tier aus, normalerweise darf er keine Katzen um sich haben, wegen der Haare. Die Katze weicht zurück und miaut. Vincent steht auf, seine Muskeln schmerzen, und er tritt bibbernd, mit vogelkrallenartig gekrümmten Zehen ans Fenster, sogar seine Fußsohlen schmerzen. Er schiebt den Vorhang ein Stückchen zur Seite. Kratzt an der Eisschicht am Fenster, haucht ein rundes Loch hinein und wischt mit dem Ärmel darüber. Doppelte Fenster, man sieht nichts, nur milchiges Licht.
Er traut sich nicht nach unten, weil er nichts anzuziehen hat. Aber er hat Bauchweh. Als er die Tür einen Spalt öffnet, huscht die Katze hindurch. Auf dem Holzfußboden hinter der Tür liegen seine Kleider, trocken und säuberlich gefaltet. Rasch zieht er sich an. Er hält sich den Bauch und steigt die Treppe Stufe um Stufe hinab, er will nicht, dass sie knarrt, will jetzt nicht auf sich aufmerksam machen mit seiner vollen Blase, kann sich nicht mal mehr an die Gesichter vom Vorabend erinnern. Am Fuß der Treppe sieht er eine Küche, einen Herd, auf dem ein großer, dampfender Topf steht, und ein kleines Fenster, dessen Scheibe komplett eingeschneit ist. Er wirft einen Blick in die Richtung, aus der das Glockengeläut kommt. Da sieht er zwei Kuhhintern mit weiß-rötlichem Fell, echte Kühe im Haus, die sich bewegen und seltsame Kaugeräusche von sich geben. Für einen Moment vergisst er seine Blase, starrt auf die Kruppen und die hin- und herschwingenden Schwänze.
»Du kannst da hinter den Kühen gehen«, sagt der alte Mann, der neben dem Ofen sitzt. Hinter den Kühen? Vincent blickt zu den beiden Tieren, nicht sicher, ob er richtig verstanden hat. »Oder halt draußen«, sagt der Alte und klopft auf seine Pfeife, »aber dann musst du dir erst Schuhe anziehen«.
Mit den Augen sucht Vincent nach seinen Schuhen vom Vortag. Sie stehen vor dem Ofen zum Trocknen. Er findet seinen Mantel an einem Haken hängend, legt seinen Schal um und läuft nach draußen. Das Haus ist komplett von einer Hülle aus Schnee umgeben, nur die Fassade ist frei.
»Da drüben«, vernimmt er eine andere Stimme und erkennt den Mann von gestern wieder, der mit seiner Schaufel auf eine kleine Holzhütte deutet, die der Junge jetzt aufsucht, und die harte, noch unberührte Schneeschicht verrät ihm, dass die anderen offenbar den Stall bevorzugen. Als er mit klappernden Zähnen wieder herauskommt, steht auf einmal vor ihm der Berg.
Es ist das erste Mal, dass er einen Berg sieht. Er ist einfach so vor ihm aufgetaucht, ohne Vorwarnung, in der kurzen Zeit, als er pinkeln war. Von einem Augenblick auf den anderen ist er nur noch das: ein Junge, der einen Berg anschaut. Er sieht eine schwarz-weiße, annähernd dreieckige, asymmetrische Form, die aus einer tiefen Mulde in der Landschaft aufragt und sich vor dem fahlen Himmel abzeichnet, mit einem auf einer Seite abgeschrägten Gipfel, als würde der ganze Fels jeden Moment zur Seite kippen, gezogen von einem unsichtbaren Gewicht. Die Sonne zeigt sich noch nicht, aber man ahnt, dass sie ganz in der Nähe, hinter dem Massiv gerade aufgeht, weil der Berg von einem goldenen Schein überzogen ist. In seinen Schulbüchern hat Vincent wohl mal Radierungen von Bergen gesehen, vielleicht auch ein paar zweifarbige Fotos von Wasserfällen oder Gletschern, aber diese papiernen Landschaften haben keine Spuren in seinem Gedächtnis hinterlassen. Welch ein Glück: So ist der Berg für ihn eine vollkommene Überraschung. Und selbst wenn Vincent sich doch noch vage an irgendein Bild oder eine Zeichnung erinnern könnte, so hätte ihn das mit Sicherheit nicht auf den Anblick dieser riesigen, plumpen, unförmigen Masse vorbereiten können, die kaum etwas mit den schematischen Unterrichtsinhalten gemein hat.
Die Ortsbezeichnungen aus dem Erdkunde-Unterricht haben ihm nichts beigebracht, »Walliser Alpen«, »Grajische Alpen«, »Cottische Alpen« und viele weitere Begriffe sind für ihn bloß bedeutungslose Klangfolgen. Da hat er anhand von Karten voller kalter Darstellungen und Legenden mit Streifen, Schraffierungen und Grau in allen Abstufungen ein ganzes Wörterbuch zur Beschreibung der Erdoberfläche auswendig gelernt, huronische, kaledonische, herzynische Gebirgsfaltungen, und trotzdem kommt ihm jetzt, wo er echte Hänge, echte Schluchten, echte Bergspitzen, echten Schiefer, Granit und Kalkstein vor sich hat, nichts davon bekannt vor. Weil er die Stadt noch nie in seinem Leben verlassen hat, trägt er noch kein Bild eines Berges in sich, hat keinen Roman gelesen, keine Filme gesehen, keine Geschichten gehört, kein Berg hat bisher sein reales Leben oder seine Träume ausgefüllt, sodass sein Hirn noch keine Hypothese aufgestellt hat, und so kommt es, dass die Wirklichkeit, die er nun vor sich hat, mit keiner wie auch immer gearteten, bereits vorhandenen Vorstellung konkurrieren muss. Wenn er die Hände ausstreckt, kann Vincent die ganze Landschaft damit verdecken. Er hat keine Ahnung, wie weit weg und wie hoch das alles ist, was er da vor sich hat. In Paris kennt er einen Berg, den Berg Saint-Geneviève, der ganze 61 Meter über dem Meeresspiegel misst; zwar kennt er diese Zahl nicht, aber er hat Augen, um zu sehen, und während er da wie angewurzelt vor dem Klohäuschen steht, dessen Tür hinter ihm leise ins Schloss fällt, wird ihm klar, dass Worte nichts Feststehendes sind, sondern nur Anhaltspunkte: Der Berg Sainte-Geneviève und das hier, das sind zwei Welten. Eine vollkommen andere Dimension.
Da fällt ihm ein weiterer Berg ein. Ein gemalter Berg in einem Buch, das sein alter Nachbar eines Tages aus dem Regal zog, als der Klebstoffgeruch Vadim mal wieder aus der Wohnung getrieben hatte. Als der Nachbar am Ende ihrer Vorlesestunde sah, wie der Junge eine seiner Bleistiftzeichnungen als Lesezeichen zwischen die Seiten des Romans legte, hatte er gefragt, ob er sie sich ansehen dürfe. Er blickte auf die unzähligen eiförmigen Gebilde auf dem Papier: »Was ist das?« Vielleicht irgendeine Substanz in einer Pfütze, Schimmel an einer Mauer oder ein Rest Suppe im Teller seines Vaters, Vadim wusste es nicht mehr, aber der Nachbar war bereits aufgestanden, hatte ein dickes Buch aus einem Regal gezogen, das er nun aufgeschlagen vor ihn hinlegte. Auf dem Papier waberten verschwommene Umrisse umher. Unvollendete Kreise und Farben auf schwarzem Grund, etwas, das aussah wie Insekten mit Wimpern und Pfoten auf cremefarbener Leinwand, tierische Miniaturgeschöpfe in einem Bad aus Blau, Sphären und schlangenförmige Gebilde, angeordnet in Galaxien, die große Ähnlichkeit mit seinen eigenen Zeichnungen hatten. »Kurios, nicht wahr?«, lachte der Nachbar. Vadim hatte umgeblättert und war auf ein Gemälde gestoßen, das Moskau hieß. Bis dahin war die Stadt seines Vaters für ihn nur ein Name gewesen, jetzt blickte er auf die teils schiefen, teils rundlichen Häuser, die sich scheinbar mitten im Himmel auf einem wundersamen Planeten zu unübersichtlichen Landschaften zusammenfügten, ein laut schepperndes Durcheinander, in vielen bunten Farben angestrahlt. Dann schlug er eine andere Seite auf und sah einen Berg, zumindest behauptete das der Titel des Gemäldes, ein dunkelblauer Hügel, eingerahmt von einem roten und einem gelben Baum, davor Pferde. Man musste allerdings zugeben, dass dies ein recht mickriger Berg war, ein beinahe gleichschenkliges Dreieck, das kleiner war als die Bäume. Er hatte weder Moskau noch je in seinem Leben einen Berg gesehen, steckte die flache Hand zwischen die Buchseiten und klappte das Buch kurz zu, um den Namen zu lesen, der in Großbuchstaben auf dem Buchdeckel stand: KANDINSKY. Am nächsten Morgen hatte der alte Mann Vadim eine Schachtel mit Stiften der Marke Caran d’Ache geschenkt – »in Farbe malt es sich viel besser, Kleiner« – und einen Stapel festes Papier mit feiner Körnung, das sich weich anfühlte, und beides hat Vadim heil mit hierhergebracht. Aber Kandinskys Berg und die Radierungen aus den Schulbüchern zerbersten angesichts des Anblicks, der sich Vincent nun bietet.
Nicht weit von ihm entfernt steht der Mann von gestern, stützt sich auf den Stiel seiner Schaufel und betrachtet den Jungen, der den Berg betrachtet. Als hätte er eine Fee gesehen. Er dagegen hat nie etwas anderes gesehen. Er ist mit jeder einzelnen Form vertraut, aus denen der Berg zusammengesetzt ist, die Gegenwart des Berges gehört für ihn von Kindesbeinen an ebenso dazu wie die seines Bruders oder des Vaters, ebenso selbstverständlich wie das Fließen des Wassers im Becken vor dem Haus oder der Wald oberhalb von La Villaz. Nur wegen des Jungen hat er jetzt sein Schaufeln unterbrochen und blickt auf den Berg. Seit zweiunddreißig Jahren, seit seinem allerersten Ausflug in der Kiepe seiner Mutter haben tausend Versionen ein und desselben Motivs einander überlagert und sich miteinander vermischt, sodass der allererste Anblick längst von all den darauf folgenden erdrückt worden ist. Selbst wenn er mal ein paar Tage fort war, in Chamonix, Sallanches oder Martigny, hat seine Abwesenheit nie lange genug gedauert, um darüber das Bild des Berges verblassen oder vergessen zu lassen, sodass es ihn bei seiner Rückkehr erneut hätte überraschen können. Ob der Eiffelturm auf ihn die gleiche Wirkung hätte wie der Berg auf diesen Jungen? Ihm fällt kein erstes Mal ein, an das er sich erinnern könnte. Nicht sein erstes Melken. Nicht sein erstes Bad im Fluss. Und auch nicht seine erste Schaufel Schnee, nichts davon hat eine wieder auffindbare Spur in ihm hinterlassen. Er sucht weiter: gut, vielleicht das erste Mal Holz schlagen, der erste Rausch. Doch er ahnt, dass nichts davon dieselbe Tragweite hat wie das, was der Junge empfindet, und vielleicht beneidet er das Kind sogar ein wenig darum. Der Junge kann sich zwar genauso wenig wie er an seinen ersten Schritt, seine erste Silbe, seinen ersten Keks erinnern, aber dafür wird er seinen ersten, mit zwölf Jahren erblickten Berg niemals wieder vergessen. Als er ihn da so stehen sieht, mit schlaff herunterhängenden Armen, geöffnetem Mund und aufgerissenen Augen, weiß er, dass die Ängstlichkeit vom Vortag einer Art Verzauberung gewichen ist.
»Pass mal auf, dass du da nicht festfrierst!«
Der Junge schreckt zusammen.
»Das sind die Aiguilles Rouges«, sagt der Mann.
Die Roten Spitzen? Vincent sieht weder rot noch Spitzen. Doch er nimmt den seltsamen, unpassenden Namen einfach hin, so wie er auch das Hereinbrechen des Berges in seine Existenz hinnimmt. Für ihn wird sowieso alles hier neu und unvorhergesehen sein.
»Schau mal, von da hinten sind wir gestern gekommen«, sagt der Mann und deutet mit dem Stiel der Schaufel in die Richtung. »Der Pass Col des Montets liegt da in der Senke, in einem alten Gletscherriegel. Auf der rechten Seite, vom Wald verdeckt, liegt der Col de Bérard, da, wo die Sonne untergeht«, erklärt er weiter. »Und da links, wo du die kleine weiße Kerbe siehst, da ist der Mont Blanc.« Vincent ist stumm vor Staunen, diesen ganzen Weg soll er zurückgelegt haben, ohne irgendwas zu sehen? Nicht einmal den Mont Blanc, den höchsten Berg Europas – das immerhin hat er aus dem Unterricht behalten. »Und auf der anderen Seite«, sagt der Mann, also hinter Vincents Rücken, »da liegt die Schweiz.« Vincent dreht sich um und sieht einen weißen Streifen oberhalb einer kleinen Baumgruppe. Der Mann sagt: »Von unten kannst du es besser sehen, die Dents de Morcles kann man nicht verfehlen. In die Schweiz hinüber führt allerdings kein Pass, da sind nur tiefe Schluchten und natürlich Stacheldraht.«
Vincent wiederholt für sich im Stillen; auf der einen Seite also der Pass, auf dem zwölf Meter Schnee liegen, und der von der Lawine verschüttete Tunnel, auf der anderen eine geschlossene Grenze. Vincent sieht nichts als schneebedeckte Hänge, Bäume und ein paar zartlila schimmernde Wolkenlinien vor dem strahlend blauen Himmel; kein Hinweis in der Landschaft lässt ihn erkennen, welcher Fels nun schweizerisch und welcher französisch ist. Er hatte irgendwie angenommen, dass man die Grenze würde sehen können, und denkt an die dicken roten Linien auf der Karte, die seine Mutter ausbreitete, mit kleinen Kreuzen darunter wie Spanische Reiter. Sie war mit ihrem Finger über jene dicke Narbe gefahren und hatte mit einem geheimnisvollen Lächeln gesagt: »Das ist die Schweiz.«
»In der Schweiz«, sagt der Mann jetzt leise, »da gibt’s Tabak.«
Vincent dreht sich wieder zu den Aiguilles Rouges um. Der Berg erinnert ihn mit seinen gewölbten Hängen an einen Kraken. Vincent hat noch nie von ihm gehört, weil der Berg trotz der Nähe nicht zum Mont-Blanc-Massiv gehört und keine erhabenen Gletscher besitzt, die Victor Hugo als »silberfarbene Mauern« hätte bezeichnen können, keine scharfen Kontraste, sichtbaren Spitzen oder spektakulären Ansichten, die zu literarischen Meisterwerken oder Gemälden anregen – aber von deren Existenz weiß Vincent sowieso nichts. Alles, was er sieht, ist ein Stück Bergmassiv aus kristallinem Schiefer, das älter und runder geformt ist und aus dem das besteht, was die Geografen als »externe Alpen« bezeichnen. Mit anderen Worten, eine Landschaft, die etwas bescheidener daherkommt, zugänglicher. Sicherlich werden eines Tages andere Berge dieses Urerlebnis verändern, Berge von dramatischerem Aussehen, das näher an die Berichte der großen Alpinisten heranreicht; aber keiner von ihnen wird das allererste, klar umrissene Bild dieses Januarmorgens je verdrängen können, das einen so starken Eindruck hinterlässt, dass es einer Initiation gleichkommt. Dieser Anblick der Aiguilles Rouges ist soeben dabei, sich ihm für immer einzuprägen, und jeder weitere Blick auf diesen Berg wird ihn nur noch tiefer in seine Netzhaut drücken. Er wird für Vincent von nun an der Berg sein, und alles, was danach kommt, ist nur eine Variation davon.
»Hast du gut geschlafen, Vincent?«
Das war Blanches Stimme, sie ist aus dem Haus getreten und schirmt die Augen mit der Hand ab. »Komm, ich hab dir Kaffee gemacht.« Er folgt der Frau, und hinter ihm geht das rhythmische Schneeschaufeln wieder los. Als Erstes fällt sein Blick auf den Klumpen Butter auf dem Tisch. Ein runder, leuchtend gelber Block, in dessen Mitte ein Messer steckt. Ein riesiger Brocken. Die Frau nimmt ihm gegenüber Platz, reicht ihm eine dampfende Schale und Süßstoff, es riecht nach gerösteter Gerste. Vincent ist von all diesen Gerüchen überwältigt. Der Geruch des Schnees, der mit ihnen ins Haus gelangt ist, eine Mischung aus Flusswasser und Pflanzensäften. Das Holz im Kamin, die Pfeife des alten Mannes, die Kühe, die Suppe, die leicht ranzige Butter, die er auf seinem Brot verstreicht.
»Nimm dir ruhig mehr davon«, sagt die Frau.
Er traut sich aber nicht.
Da nimmt sie das Brot und macht es selbst. »Los, nimm dir ordentlich davon, du musst unbedingt zu Kräften kommen.«
Er beißt kleine Bissen ab und kaut und wagt es nicht, die Frau anzusehen. Hin und wieder schaut er zum Fenster, wo der allgegenwärtige Schnee den Blick auf ein kleines Stück des Berges zulässt.
»Ich weiß noch genau, wie ich die Aiguilles Rouges zum ersten Mal gesehen habe«, sagt die Frau.
Während die Männer hier alle ein bisschen nuscheln, verschluckt Blanche keine einzige Silbe oder Endung, ihre Aussprache ist klar und melodiös.
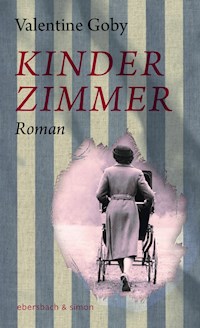












![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















