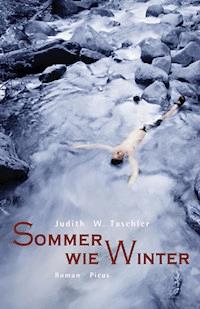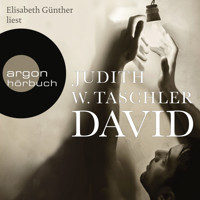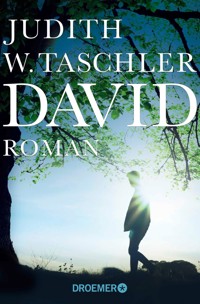Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Judith W. Taschler versteht es, den Leser zu fesseln.“ (Sebastian Fasthuber, Falter) – Nach „Die Deutschlehrerin“ ihr neuer großer Familienroman über drei Generationen Fast hat man sich in der Hofmühle damit abgefunden, dass Carl im Krieg gefallen ist, als er im Winter 1918 plötzlich vor der Tür steht. Selbst sein Zwillingsbruder Eugen hätte ihn fast nicht erkannt. Eugen ist nur zu Besuch, er hat in Amerika sein Glück gesucht und vielleicht sogar gefunden. Wird er es mit Carl teilen? Lässt sich Glück überhaupt teilen? Judith W. Taschler hat einen großen Familienroman geschrieben. Über drei Generationen verfolgen wir gebannt das Schicksal der Familie Brugger, deren Leben in der Mühle vor allem die Frauen prägen. Das einfühlsame Porträt eines Dorfes, ein Buch über Abschiede und die Liebe unter schwierigen Vorzeichen, über den Krieg und die unstillbare Sehnsucht nach vergangenem Glück.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 644
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
»Judith W. Taschler versteht es, den Leser zu fesseln.« (Sebastian Fasthuber, Falter) — Nach »Die Deutschlehrerin« ihr neuer großer Familienroman über drei GenerationenFast hat man sich in der Hofmühle damit abgefunden, dass Carl im Krieg gefallen ist, als er im Winter 1918 plötzlich vor der Tür steht. Selbst sein Zwillingsbruder Eugen hätte ihn fast nicht erkannt. Eugen ist nur zu Besuch, er hat in Amerika sein Glück gesucht und vielleicht sogar gefunden. Wird er es mit Carl teilen? Lässt sich Glück überhaupt teilen? Judith W. Taschler hat einen großen Familienroman geschrieben. Über drei Generationen verfolgen wir gebannt das Schicksal der Familie Brugger, deren Leben in der Mühle vor allem die Frauen prägen. Das einfühlsame Porträt eines Dorfes, ein Buch über Abschiede und die Liebe unter schwierigen Vorzeichen, über den Krieg und die unstillbare Sehnsucht nach vergangenem Glück.
Judith W. Taschler
Über Carl reden wir morgen
Roman
Paul Zsolnay Verlag
FÜR PAPA
Anton und Rosa
1
Im Haus seines Nachbarn schlüpfte für Albert Theodor Brugger zum ersten Mal ein Mädchen aus den Kleidern. Sie knöpfte die Bluse auf, zog sie über die Schultern zurück und hängte sie achtlos über die Stuhllehne, sie öffnete den Knopf des Bundes und stieg aus dem schweren Rock. Als sie so im Unterhemd vor ihm stand, schien sie über sich selbst zu erschrecken und kroch schnell unter die Bettdecke. Hastig zog er Schuhe und Hose aus — er hatte Angst, sie würde ihre Entschlossenheit bereuen und einen Rückzieher machen — und folgte ihr. Ihr Name war Magdalene, Albert sagte Lene zu ihr, sie war die Schwägerin des Nachbarn, dessen Schlafzimmer sich genau gegenüber befand.
Einige Wochen zuvor hatte dieser, ein ernster Mann Anfang dreißig, seine Hochzeit gefeiert. Da er von einem kleinen Bauernhof und seiner Arbeit als Tagelöhner leben musste, war es ein bescheidenes Fest mit wenigen Gästen gewesen, aber nichtsdestotrotz ein ausgelassenes. Die Braut hatte den Ruf, sich nicht zu schade für die Arbeit zu sein, brachte sogar eine kleine Aussteuer in die Ehe mit und war obendrein nicht unansehnlich. Vor allem aber war ersichtlich, dass die Heirat kein pragmatischer Bund zweier Übriggebliebener war, sondern aus Liebe geschah. Die Leute freuten sich für ihn, sie gönnten ihm sein Glück — in dem kleinen Ort durchaus keine Selbstverständlichkeit. Der Mann hatte einiges durchgemacht, nicht nur dass sein Vater ein Tunichtgut gewesen war und den Hof völlig heruntergewirtschaftet hatte, er hatte seine Familie regelmäßig verprügelt. Da er nicht mehr lebte, übernahm Alberts Vater Anton die Rolle des Bräutigamvaters.
Für den sechzehnjährigen Albert war es sogar ein rauschendes Fest, der Grund dafür war Magdalene, die jüngste Schwester der Braut, ein Jahr älter als er. Er hatte sie in den Monaten vor der Hochzeit vier-, fünfmal in der Kirche gesehen — jedes Mal hatte sie ihm einen neugierigen, beinahe frechen Blick zugeworfen —, wenn sie mit ihrer Schwester zu Besuch im Ort gewesen war, damit die beiden Verlobten Zeit miteinander verbringen konnten, denn die junge Braut stammte aus einem entfernten Nachbardorf. Lene hatte krauses dunkelblondes Haar, Sommersprossen, eine kleine Nase, große blaue Augen, volle Lippen.
Auf dem Weg von der Kirche zum Gasthof Zur Linde ging sie plötzlich neben ihm, sie lächelte ihn an und begann mit ihm zu plaudern, ihre Wangen waren von der Kälte mit einer leichten Röte überzogen, der frischgefallene Schnee knirschte unter ihren energischen Schritten. Als die Hochzeitsgesellschaft schweinsbratenverzehrend im kleinen Saal saß, warfen Lene und Albert einander immer wieder Blicke zu, was von seinen Schwestern natürlich nicht unbemerkt blieb, sie hänselten ihn. Albert fühlte sich übermütig, trank zu viel Bier. Sein Vater schüttelte missbilligend den Kopf, er — der Sparsame — dachte weniger an den Alkohol, der seinem Sohn vielleicht abträglich sein konnte, sondern an die hohe Rechnung, die der Bräutigam bezahlen musste. Der Musiker packte sein Akkordeon aus, Albert tanzte mit seiner Tante — er wirbelte sie so schwungvoll herum, dass sie von einigen sogar Applaus bekamen — und fand endlich den Mut, zuerst die Braut und dann Lene aufzufordern.
»Ich freue mich, einen netten Buben wie dich in der Nachbarschaft zu haben«, sagte die Braut, »deine Tante Rosa erzählt nur Gutes von dir.« Es kränkte ihn, dass sie ihn als Buben bezeichnete.
»Du bist mit drei älteren Schwestern aufgewachsen, das bedeutet, du weißt alles über Frauen«, sagte Lene und lachte ihn herausfordernd an.
Später am Abend, er war auf dem Weg zurück in den Saal — das Klosett befand sich hinter dem Gasthof in einem Holzhäuschen —, trat sie ihm am Ende des Ganges entgegen und zog ihn hinter eine Tür. Während sie versteckt im Dunkeln auf der Treppe standen, die hinunter in den Keller führte, im Hintergrund die Tanzmusik hörten, das laute Lachen und Rufen, das aus dem Saal zu ihnen drang, erlebte Albert das Aufregendste und Glückseligste, das er bisher in seinem jungen Leben erfahren hatte: Er hielt eine junge Frau in den Armen, spürte ihre Rundungen und küsste sie.
Lene blieb bei dem frisch verheirateten Ehepaar und somit in Alberts Nähe. Sie ging ihrer Schwester auf dem Hof zur Hand und verdingte sich tageweise als Aushilfe in den Häusern auf dem Marktplatz, auf Bauernhöfen wollte sie nicht arbeiten. Albert besuchte sie heimlich in den Nächten. Wenn sie ihre Lampe ins Fenster stellte, wusste er, die Luft war rein, das junge Ehepaar hatte sich in seine Kammer zurückgezogen. Er schlich aus seinem Elternhaus, der Hofmühle, eilte den Bach entlang und den Hang hinauf. Wenn es warm war, stand das Fenster bei den Eheleuten offen, und er hörte, wie sie sich liebten oder zärtlich miteinander sprachen. Lene erwartete ihn vor der Stalltür, durch den kleinen Stall betraten sie das Haus. In ihrer Kammer lagen sie — zunächst bekleidet, später halb entkleidet, schließlich völlig nackt — auf dem schmalen Bett und erkundeten gegenseitig ihre Körper.
Abrupt endete der paradiesische Frühling für beide Paare. Im Mai führte der Ehemann mit anderen Männern für einen Großbauern Waldarbeiten durch und verletzte sich dabei schwer. Als einer der Männer einen Baum fällte, stürzte der Stamm auf einen anderen Baum, der dadurch entwurzelt wurde und den Mann unter sich begrub, wenige Tage darauf starb er. Die junge Witwe war außer sich vor Trauer, im Dorf stand man der Tragödie fassungslos gegenüber.
Umgehend unterbreitete ihr Johann Eder — der Großbauer, in dessen Wald das Unglück geschehen war — ein Kaufangebot für den kleinen Hof und die zwei dazugehörigen Felder. Die meisten Dorfleute bezweifelten, dass es aus Mitleid oder aus Verantwortungsgefühl geschah, Eder war seit Jahren unermüdlich dabei, seinen Besitz zu vergrößern. Alberts Vater Anton und seine Tante Rosa schluckten, als die junge Frau sie davon in Kenntnis setzte. Sie wollten den Großbauern, der — wie schon sein Vater vor ihm — als Grobian bekannt war, als ein Leuteschinder, nicht als unmittelbaren Nachbarn haben, selbst wenn dieser den Hof an jemanden verpachtet hätte. Der Ertrag des Hofes war derart gering, dass er eine Pachtzahlung kaum zuließ, es hätte das Elend des Pächters bedeutet und in der Folge ständig wechselnde Pächter.
Die Eltern der Witwe drängten diese, den Besitz zu verkaufen und nach Hause zurückzukehren. Anton und Rosa redeten ihr zu, den Hof zu behalten, ihn zu bewirtschaften, sie boten ihre Unterstützung an, aber die Frau fühlte noch keine Verbundenheit für das Fleckchen Erde. In ihrer Trauer sehnte sie sich nach Heimat, nach vertrauten Gesichtern und wollte alles, was sie an ihr kurzes Glück erinnerte, so schnell wie möglich hinter sich lassen. Anton sah keinen anderen Ausweg als ebenfalls ein Angebot zu machen, obwohl er beim besten Willen nicht wusste, wie er den Kaufpreis bezahlen sollte, daraufhin erhöhte Johann Eder die gebotene Summe. Es entstand ein erbittertes Ringen zwischen ihm und Anton, schlussendlich verkaufte die Witwe an Anton Brugger, da sie sich ihm gegenüber mehr verpflichtet fühlte, und gewährte ihm Ratenzahlungen. Der Familie brachte es einen vergrößerten Grundbesitz ein, der sie in alle Himmelsrichtungen nachbarlos machte — und obendrein die Feindschaft mit dem größten Bauern im Ort.
So kam es, dass nicht einmal fünf Monate nach der Hochzeit die beiden jungen Frauen auf dem Fuhrwerk ihres Vaters — hinter ihnen aufgetürmt ihr Hausrat — bei der Hofmühle vorbeikamen, um sich zu verabschieden. Bedrückt saßen alle in der Stube beieinander. Albert betrachtete das verweinte Gesicht der Ehefrau, das um Jahre gealtert schien, dachte an das unbeschwerte Hochzeitsfest zurück und stellte sich die Frage, warum das Glück derart zerbrechlich und vor allem ungerecht war. Und als er in das traurige Gesicht seiner Geliebten schaute, fragte er sich verzweifelt, wie sein Körper ohne den ihren die nächsten Wochen überstehen sollte.
2
Die Sache mit dem Glück beschäftigte Albert bereits als Kind, besonders was das weibliche Geschlecht betraf, zerbrach er sich den Kopf darüber. Im Alter von sieben Jahren erlebte er mit, wie ein Kind zur Welt kam, und die Angelegenheit erschreckte ihn zutiefst. Wochenlang fragte er sich, warum die Frauen beim Gebären derart leiden mussten, und kam zu keinem richtigen Schluss. Er wusste nur eines: Großes Glück hatte ein Mann allein schon deshalb, weil er als Mann geboren worden war, zusätzlich konnte er dann noch sein Glück machen, indem er tüchtig war und es zu etwas brachte. Wohingegen eine Frau nur von Glück reden konnte, wenn sie bei einer Geburt nicht elendig starb. Er war froh, als Bub zur Welt gekommen zu sein.
Sein Vater Anton war derjenige, der die Hebamme holte, da ihn der werdende Vater darum bat. Dieser war Knecht beim Schmied und wohnte mit seiner Frau bei seiner Mutter auf einem kleinen Hof mit nur einem Feld und zwei Kühen, nicht weit entfernt von der Hofmühle. Er stand um die Mittagszeit in der Tür und knetete seinen Hut in den Händen, während er mit hochrotem Kopf seine Bitte vortrug. Er selbst besaß nicht einmal ein langsames Ochsenfuhrwerk und wusste von der Stute, die der Hofmüller vor einem Jahr gekauft hatte. Die Hebamme hatte er in ihrem Haus nicht angetroffen, von ihrem Gatten wusste er, dass sie sich bei einer Wöchnerin im Nachbarort aufhielt. Dorthin würde er zu Fuß länger als eine Stunde brauchen.
»Meine Frau liegt schon seit gestern Abend in den Wehen, und mir scheint, es stimmt was nicht«, sagte der Mann verlegen. »Ich würd dich sonst nicht fragen, Hofmüller.«
Während ihm Anton noch ungläubig ins Gesicht schaute — er wunderte sich, warum der Mann nicht schon früher die Hebamme holen gegangen war und auch warum er mit seiner Bitte nicht zu seinem Arbeitgeber ging —, scheuchte Rosa bereits Albert in den Stall.
»Leg der Mari das Geschirr und das Zaumzeug an«, sagte sie zu ihm, während sie in den Mantel schlüpfte. Zu ihrem Bruder gewandt sagte sie: »Ich hab seiner Frau Hilfe angeboten.«
Anton seufzte und schüttelte den Kopf. Seitdem seine Schwester aus Wien zurückgekommen war, konnte sie es nicht lassen, sich bei den Armen im Dorf als große Retterin in der Not aufzuspielen, obwohl er sie immer wieder gebeten hatte, in der Hinsicht etwas zurückhaltender zu sein. Güte wurde ausgenutzt, war seine Meinung, oder anders ausgedrückt: Gibt man dem Teufel den kleinen Finger, so greift er nach der ganzen Hand.
Albert begleitete seinen Vater, durfte ab und zu die Zügel halten. Auf dem Rückweg saß die Hebamme vorne am Bock, sie trieb Anton zur Eile an, er redete kein Wort mit ihr. Albert spürte, dass seinem Vater die Situation nicht behagte: Er musste die teuer erstandene Stute, die er wie seinen Augapfel hütete, für etwas schinden, das ihm keinerlei Nutzen brachte. Er tat einem Mann, den er nicht ausstehen konnte, einen Gefallen, indem er eine Frau im Nachbarort abholte, die er ebenfalls nicht sonderlich leiden konnte. Schließlich jagte er das Pferd im Galopp bis zum Hof des Mannes, er wollte keine schlechte Nachrede im Ort haben. Die Frau bedankte sich, kletterte vom Wagen und verschwand im Haus, der Vater stieg ebenfalls ab und tätschelte sorgenvoll Maris schweißnassen Hals und Bauch.
»Ich muss sie trockenreiben, sonst wird sie krank. Das hätte mir noch gefehlt«, sagte er. »Steig ab. Du fragst deine Tante, ob sie etwas braucht, und kommst dann nach Hause.«
Mit flauem Magen und zittrigen Knien — er war bei der rasanten Fahrt ziemlich durchgerüttelt worden — stand Albert im Hausflur. Aus der Kammer hinter der Küche drangen furchtbare Geräusche, er konnte sich nicht erklären, wie ein Mensch in der Lage sein konnte, solche Laute von sich zu geben, ihm wurde übel. Die Tür öffnete sich, und er hörte die Hebamme mit dem Mann schimpfen: »Warum hast mich nicht früher holen lassen? Hast geglaubt, ihr kommt ohne mich aus und du kannst dir meinen Lohn sparen, du Geizkragen?«
Der Mann, er war grau im Gesicht, trat heraus. Für einen kurzen Augenblick konnte Albert in den Raum hineinspähen, er sah das vor Schmerz verzerrte Gesicht der Frau, ihre weißen, gespreizten Beine und eine dunkle, blutige, haarige Öffnung, in der die Hand der Hebamme steckte. Der Mann schlurfte an ihm vorbei in die Küche, und Albert hockte sich auf den Boden, um nicht umzufallen. Es erschien ihm wie eine Ewigkeit, bis seine Tante aus der Kammer kam, beinahe wäre sie über ihn gestolpert.
»Was tust du hier?«, fuhr sie ihn an.
»Ich soll dich fragen, ob du etwas brauchst«, stammelte er. »Hat der Vater gesagt.«
»Herrgott nochmal«, sagte sie. »Was soll ich schon brauchen?« Sie zog ihn hoch. »Ein Wunder wär nicht schlecht. Geh nach Haus, Bub, das ist nichts für dich.«
»Wird alles gutgehen?«, fragte er ängstlich.
Sie hob nur hilflos die Hände. Albert wankte ins Freie, es dämmerte bereits. So schnell er konnte lief er in die Talsenke hinunter, Licht drang aus dem kleinen Stallfenster, der Vater war also noch mit Mari oder den Schweinen beschäftigt. Albert lehnte sich an die Stallmauer und erbrach sich. In der Nacht kam seine Tante nach Hause, er stand auf und schlich in ihre Kammer.
»Ist es ein Bub oder ein Mädchen?«, fragte er sie.
»Ein Mädchen.«
»Wie geht es der Mutter?«
Seine Tante zögerte. »Es war eine schwere Geburt. Das Kind ist mit den Beinen zuerst gekommen. Wir hoffen, dass beide die Nacht überleben.«
»Kommt denn ein Kind normalerweise nicht zuerst mit den Beinen?«
Er hatte sich immer vorgestellt, dass zuerst seine Füße geboren worden waren, dass er regelrecht auf die Welt gesprungen war.
»Nein«, sagte Tante Rosa, »ein Kind kommt mit dem Kopf zuerst zur Welt.«
Am liebsten hätte er sich neben seine Tante ins Bett gelegt, um mit ihr noch ein bisschen zu reden, doch mit seinen sieben Jahren war er zu alt dafür, sein Vater hatte es ihm schon vor längerem verboten, er kroch zurück in sein Bett. Bestimmt hatte sich der Mann einen Sohn gewünscht und war enttäuscht, dachte er. Mit einem Sohn ging alles weiter, für die Tochter musste man einen guten Mann finden und ihr obendrein eine Aussteuer mitgeben, das bedeutete Sorgen und Mühsal. Albert wusste das, es war allgemein bekannt, ohne dass ständig darüber gesprochen worden wäre. Sein Vater hatte ihm erzählt, wie glücklich er über seine, Alberts, Geburt gewesen war. Seine arme Mutter war wenige Tage darauf an hohem Fieber gestorben, und manchmal hätte Albert gerne seinen Vater gefragt, ob er lieber eine vierte Tochter gehabt hätte, wenn die Mutter dafür am Leben geblieben wäre, traute sich jedoch nicht. Vor welcher Antwort er sich mehr fürchtete, hätte er nicht sagen können.
Albert wälzte sich im Bett herum, er bekam das Bild der gebärenden Frau nicht aus seinem Kopf. Er hatte schon vorher gewusst, dass die Geburt eines Kindes für die Mutter schmerzhaft war, doch was er gesehen hatte, überstieg seine Vorstellungskraft bei weitem.
»Gottes Schöpfung ist unendlich, und jede noch so winzige Kleinigkeit hat darin ihren Sinn«, hatte der Pfarrer einmal im Religionsunterricht gesagt. Wenn dem so war, hatte das Leiden der Frauen also einen Grund.
In der Schule nahm Albert seinen ganzen Mut zusammen und fragte den Pfarrer danach. Er wurde puterrot dabei, auch den meisten der Mädchen stieg vor Scham das Blut in den Kopf. Der Pfarrer war entsetzt darüber, dass Albert die Geschichte von Adam und Eva noch nicht kannte.
»Ich werde mit deiner Tante ein Wörtchen reden müssen«, sagte er, und es klang beinahe drohend.
Er erzählte ausschmückend und ereifernd vom ersten Menschen Adam, den Gott als Krone der Schöpfung aus Lehm geformt und ihm mit seinem Atem Leben eingehaucht hatte. Adam, der im Paradies lebte, fühlte sich einsam, und Gott erkannte, dass es gut wäre, wenn er eine Gefährtin hätte. Aus einer Rippe Adams wurde Eva geschaffen, die beiden waren glücklich im Paradies, bis sie eines Tages eine Frucht von einem Baum aßen, von dem zu essen ihnen Gott verboten hatte. Eine Schlange verführte Eva, und sie wiederum überredete Adam, ebenso von dem Baum zu essen. Daraufhin war Gott erzürnt und verjagte die zwei aus dem Paradies, sie sollten fortan hart arbeiten müssen, um ihr Leben fristen zu können. Der Frau kündigte Gott an, dass sie ihre Kinder unter Schmerzen gebären werde.
Die Mädchen saßen mit gesenkten Köpfen da, als der Pfarrer mit den Worten schloss: »Die Frau hat sich durch ihren Ungehorsam als schlechtes, verderbtes Wesen herausgestellt, und Gott bestraft sie mit den Qualen, die sie bei der Geburt ihrer Kinder erleiden muss.«
Ganz zufriedenstellend fand Albert die Erklärung des Pfarrers nicht. Seiner Meinung nach war die Strafe Gottes eindeutig zu hoch bemessen, auch er stahl immer wieder Äpfel, Birnen und Zwetschken und verleitete seine Freunde, es ihm nachzumachen. Immerhin hatte Eva den Baum, den Gott offensichtlich sehr liebte, ja nicht umgehackt, sondern lediglich einen einzigen Apfel davon genommen. Noch etwas, was der Pfarrer gesagt hatte, wollte ihm nicht aus dem Kopf. Die Frau war verderbt und schlecht? Wenn er im Geiste die Frauen in seiner Umgebung durchging, kam er zu dem Schluss, dass sie freundlicher und fürsorglicher als die Männer waren. Allein wenn er seinen Vater und seine Tante betrachtete: Der Vater war wortkarg und mitunter auch grantig, seine Tante, die zwar resolut sein konnte, war eine liebevolle Person. Er hatte von Männern gehört — und auch mit eigenen Augen gesehen —, die Kinder, Dienstboten, Vieh, Ehefrauen sehr grob behandelten, auch verprügelten, umgekehrt hatte er das nie miterlebt.
Bei der Weihnachtsbeichte platzte es im Beichtstuhl aus ihm heraus: »Ich empfinde seit Wochen Freude darüber, ein Mann zu sein! Ist das Hochmut?« Albert hörte ein leises Glucksen. Lachte der Pfarrer über ihn?
»Bist du denn schon einer?«, ertönte die Stimme hinter dem Gitter.
»Ich meine«, stotterte er, »ich bin froh, dass ich nicht als Mädchen geboren worden bin und später keine Frau, sondern ein Mann bin.«
»Gott verzeiht dir«, sagte der Pfarrer. »Die Frau ist dem Mann unterlegen, er muss sie lenken. Deshalb ist es gut, dass du mit Stolz ein Mann bist.«
Als er beim Mittagessen seinen Vater und seine Tante vor sich sah, dachte er, dass der Pfarrer Unrecht gehabt hatte: Sie lenkt ihn, und er ist ihr unterlegen, und zwar in allem. Nur was die Körperkraft betraf, war es umgekehrt, der Vater konnte einen Vierzigkilosack Mehl schleppen, die Tante nur einen Zwanzigkilosack, da sie aber mit dem leichteren Sack ein bisschen schneller war, lief es am Ende auf fast dasselbe hinaus.
Und noch etwas dachte er: Welch ein Glück haben meine Schwestern und ich gehabt, dass Tante Rosa keine Kinder bekommen hat und deshalb bei uns leben kann.
3
Anton und Rosa Brugger waren die einzigen überlebenden Kinder ihrer Eltern. Alle anderen — die genaue Anzahl ihrer Geschwister kannten beide nicht — hatten entweder die Geburt oder die ersten Lebensjahre nicht überlebt. Eine ältere Schwester war zwölf Jahre alt geworden, bevor sie in einem harten Winter eine Lungenentzündung dahinraffte, Anton hatte nur vage Erinnerungen an sie, die um drei Jahre jüngere Rosa gar keine.
Nach dem sechsjährigen Schulbesuch erlernte Anton den Beruf des Müllers bei seinem Vater, Rosa half der Mutter im Haus und bei der kleinen Landwirtschaft, die aus zwei Kühen und der Schweinezucht bestand. Rosa war für den Kuhstall zuständig, während die Mutter sich vorwiegend um die Schweine kümmerte, sie wollte nicht, dass die Tochter nach Schweinestall stank.
Die meisten Bauern, die ihr Mehl in der Hofmühle mahlen ließen, konnten nicht bezahlen, sondern entrichteten die sogenannte Maut: Der Müller durfte — je nach Verhandlung — zehn bis fünfzehn Prozent des Getreides für sich behalten, damit wurden die Schweine gefüttert, deren Verkauf an den Metzger oder direkt an einen Gastwirt bares Geld einbrachte.
Manchmal half Rosa im Gasthof Zur Linde aus, die Wirtin war eine entfernte Verwandte ihres Vaters, sie schenkte den Gästen ein und trug das Essen auf. Die Arbeit im Gasthof machte sie gerne, vor allem dann, wenn die Gäste keine Einheimischen waren, sondern Durchreisende. Sie liebte es, diese zu beobachten, zu belauschen, alles an ihnen studierte sie, Kleider, Hüte, Schuhe und ihre Sprache. Durch sie erhielt Rosa einen Einblick in eine fremde aufregende Welt, ihre eigene erschien ihr langweilig und trostlos.
Der Lebenslauf der beiden Geschwister war vorgezeichnet. Anton war der zukünftige Pächter der Hofmühle und würde sie, so Gott wollte, vergrößern und später seinem Sohn übergeben. Rosas Zukunft lag — wie die jeder Frau — in der Ehe, wenn möglich mit einem Bauern oder einem gut gestellten Müller, der den Ruf genoss, nicht grob zu sein, darauf würden die Eltern bei der Wahl achten. Die Familie war zuversichtlich, das Mädchen hatte gute Aussichten, sie war fleißig und galt als Schönheit, bei jedem Gottesdienst schauten ihr die Männer nach. Schon mit siebzehn bekam sie den ersten Heiratsantrag, den die Eltern ablehnten. Auf dem Land hielten sich noch manche an das ungeschriebene Gesetz, eine Tochter nicht gar zu jung zu verheiraten, an die fünfzehn Schwangerschaften und Geburten innerhalb eines Ehelebens waren mehr als ausreichend. Insgeheim hegte Anton die Hoffnung, dass Rosa nie heiraten und zeitlebens bei ihm bleiben würde. Die meisten unverheirateten Frauen blieben in ihrem Elternhaus und dienten der Familie des Bruders, welcher den Besitz geerbt hatte und weiterführte. Genau das wünschte sich Anton, er konnte sich nicht vorstellen, auf seine Schwester zu verzichten.
Er war ihr sehr zugetan, sah in ihr etwas Besonderes. Ihre gerade Haltung und ihr unbekümmertes, jedoch anmutiges Benehmen erschienen ihm beinahe aristokratisch, er wusste, dass manche Frauen im Dorf sie als hochmütig bezeichneten. Ihn faszinierte ihre frische Art, das Unerwartete zu sagen oder zu tun, er liebte ihre Lebhaftigkeit, ihre leuchtenden Augen, wenn sie sich für etwas begeisterte. Neben ihr kam er sich gewöhnlich vor, derb, und vor allem hässlich, er war zwar groß und stattlich gebaut, hatte aber eine pockennarbige Haut und schlechte Zähne, eine Glatze zeichnete sich bereits ab.
Wenn sie alleine waren, las Rosa ihrem Bruder etwas aus den Büchern vor, die ihr der Schulmeister heimlich lieh. Dem Vater gefiel es nicht, seine Tochter so oft über ein Buch gebeugt zu sehen, seiner Meinung nach war zu viel Lektüre gefährlich für den einfachen, arbeitenden Menschen, weil es ihm Flausen in den Kopf setzte und ihn unzufrieden machte. Anton hörte gern von Abenteuern und fremden Ländern, er konnte ihr stundenlang zuhören, musste aber insgeheim seinem Vater Recht geben. Rosa vertraute ihm eines Tages ihre Träume an, die ihm vermessen erschienen: Sie wollte keinen Bauern heiraten, sie wollte in der Stadt leben. Ihn lockte das Stadtleben nicht, im Gegenteil, wenn er sich die vielen Leute vorstellte, bekam er Bauchschmerzen.
So ungern der Vater seine Tochter über ein Buch gebeugt sah, noch weniger passte es ihm, dass der Sohn so viel Zeit mit seiner Schwester verbrachte. Es kam sogar vor, dass Anton auf das sonntägliche Kartenspielen im Gasthaus verzichtete, um mit Rosa nach Hause zu spazieren oder, wenn das Wetter schön war, noch einen längeren Spaziergang zu machen.
»In deinem Alter solltest du anderen Mädchen nachstellen und nicht deiner Schwester«, sagte der Vater manchmal. Rosa lachte darüber, Anton war angewidert von der Andeutung.
Er erinnerte sich nicht daran, seine Eltern jemals fröhlich gesehen zu haben, ihr Wesen war erfüllt von Strenge und Gottesfurcht. Er brachte ihnen wenig Achtung entgegen und empfand auch keine Liebe für sie, nichtsdestotrotz konnte er sich aufgrund seiner Erziehung kein anderes als ein auf absoluter Unterordnung und höchstem Respekt beruhendes Verhältnis vorstellen. Er ging ihnen aus dem Weg. Ganz anders empfand er für seine Schwester, er suchte ihre Nähe, sie hatte eine Wirkung auf ihn, die er sich nicht erklären konnte, wenn sie bei ihm war, erschien ihm die Welt freundlicher. Die Beziehung seiner Schwester zu den Eltern war eine andere als seine; die Liebe, die sie der Mutter entgegenbrachte, gepaart mit Mitgefühl, war spürbar zwischen den beiden, dem Vater bot sie unverblümt die Stirn, wenn er missmutig oder grob mit ihr umsprang, Anton hätte nie den Mut dazu aufgebracht. Er liebte es, wenn sie nur mit dem Unterkleid neben ihm auf der Wiese stand, um das Heu zu wenden, und er ihre nackten, schweißnass glänzenden Schultern und Arme sehen konnte, ihre bloßen schlanken Füße.
4
Im Frühling 1828 begann Rosa — nicht einmal achtzehnjährig — als Dienstmädchen in einem großen Wiener Haushalt zu arbeiten.
Sie hatte die Chance genutzt, als sie eines Samstagabends in der Gaststube der Linde von einer älteren Frau angesprochen wurde, die sie geradeheraus nach ihrem Namen fragte und ihr im selben Atemzug ein Kompliment machte: »Wie ist dein Name, schönes Mädchen?«
Wie die meisten Anwesenden in der Gaststube schaute Rosa die ganze Zeit verstohlen zu ihr hinüber und spürte, dass sie ebenso beobachtet wurde. Die Frau war offensichtlich eine feine Dame aus der Stadt, sie trug ein in der Taille eng geschnürtes, dunkelgrünes Kleid aus Satin mit Puffärmeln und Rüschen am Rock. Begleitet wurde sie von drei einfach gekleideten Mädchen. Der Unterschied zwischen der Aufmachung der älteren Frau und der Mädchen war derart groß, dass die Gruppe beinahe grotesk wirkte. Die Tatsache, dass die Frau kerzengerade saß, mit Messer und Gabel und zierlichen Bewegungen nur wenige Bissen zu sich nahm, während die Mädchen gierig zulangten, verstärkte den Eindruck.
»Setz dich doch einen Augenblick zu uns«, sagte sie zu Rosa, als sie die Teller abräumte. Sobald Rosa Platz genommen hatte, erklärte die Frau, dass sie auf der Suche nach Arbeitskräften für reiche Wiener Familien war. Junge Frauen konnten ihr Glück als Dienstmädchen versuchen und, falls sie sich geschickt anstellten, zur Köchin, zum Kindermädchen oder gar zur Hauswirtschafterin ausgebildet werden, die doppelt so viel verdiente; junge Männer waren als Gärtner, Hausmeister, Portier, Stallknecht gefragt.
»Wärst du an einer solchen Stelle interessiert, mein Kind?«, fragte die Frau lauernd. »Du würdest viel Geld verdienen und Wien kennenlernen.«
Ein Bauer, der am Nebentisch saß und ihren Worten gelauscht hatte, spuckte verächtlich auf den Boden und sagte: »Sollen wir dem ausbeuterischen Gesindel auch noch unsere Kinder und Kindeskinder als halbe Sklaven überlassen? Schlimmer als jede Kupplerin bist du! Verschwind von hier!«
In einem der Gastzimmer, welches die Frau, sie hieß Martha Böhm, gemietet hatte, wurde Rosa von allen Seiten begutachtet. Sie musste ihre Lippen kräftig in die Höhe ziehen, damit ihre Zähne betrachtet werden konnten, dabei blies ihr die Frau ihren schlechten Atem ins Gesicht. Sie musste den Rock heben, um ihre Beine zu zeigen, die nicht krumm sein sollten, ihre Haare öffnen, die nach Läusen durchsucht wurden. Rosa wurde über ihre Familie ausgefragt, welchen Beruf ihr Vater ausübte, welche Krankheiten sie bisher gehabt hatte, über bestimmte Fertigkeiten und Fähigkeiten im Haushalt. Sogar die Frage, ob sie bereits bei einem Mann gelegen war, musste sie über sich ergehen lassen.
»Nein!«, rief Rosa entrüstet aus, unwillkürlich trat sie einen Schritt zurück und errötete. Eine Unverschämtheit, mich Derartiges zu fragen, was fällt der Frau ein?, dachte sie zornig.
Zum Schluss ließ man sie ein paar Zeilen aus einem Buch vorlesen und die erste Strophe eines Kinderliedes vorsingen, mit allem war die Böhm höchst zufrieden. Und sie dankte Gott für den glücklichen Zufall, dass sie ausgerechnet vor diesem Gasthof Halt gemacht hatte, um die Nacht zu verbringen. Welch eine liebreizende Schönheit und obendrein noch klug, dachte sie. Das Mädchen entsprach genau dem Typ, den sie für eine bestimmte Herrschaft suchte. Großgewachsen sollte sie sein, nicht dürr, mit geradem Rücken, symmetrisch gefälligen Gesichtszügen, nicht zu hellem Teint, dichtem dunklen Haar, wachen Augen, mit einer angenehmen Stimme, des Lesens mächtig, vom Wesen klug, temperamentvoll, fröhlich, jedoch nicht zu rebellisch, war im Brief gestanden, welcher ihr vom Kutscher überreicht worden war. Martha Böhm hatte nicht schlecht gestaunt, als sie gesehen hatte, dass er von der Freifrau von Reischach persönlich verfasst worden war, üblicherweise war das Anstellen von Dienstpersonal Angelegenheit der Hauswirtschafterin. Sie nahm an, dass die neue Unschuld vom Lande neben ihrer Arbeit vor allem die Bedürfnisse des Sohnes der Herrschaften befriedigen sollte. So etwas war nicht selten in den höchsten Kreisen Wiens, Affären mit Dienstmädchen stellten, was Krankheiten betraf oder gar Erpressungen, keine Gefahr dar. Nicht nur in adeligen, auch in großbürgerlichen Haushalten unterhielten junge Herren Liebesbeziehungen zu Dienstmädchen, das Ganze wurde oftmals regelrecht arrangiert von den Eltern, Martha Böhm hatte bereits viele solcher Mädchen vermittelt. Seit mehr als zehn Jahren war sie im Geschäft und bekannt dafür, dass sie diskret war und ein gutes Händchen hatte, wenn es darum ging, zaghafte Schönheiten in den hintersten Dörfern aufzuspüren, um genau zu sein, war sie auf dem Gebiet die Beste. Mit der Köchin des Hauses Reischach war sie befreundet, weshalb sie einiges über den einzigen Sohn wusste. Er litt an einer seltenen unheilbaren Krankheit, doch niemand vom Personal wusste Genaueres darüber. Die Familie war bemüht, die Krankheit vor der Öffentlichkeit zu verbergen, weshalb man mit allen Mitteln versuchte, den jungen Mann viel im Haus zu halten.
Beim Abschied drückte die Böhm verbindlich Rosas Hand und sagte eindringlich, wobei sie ihre Worte sorgfältig wählte, um das Mädchen für sich zu gewinnen: »Ich habe einen hervorragenden Posten als Stubenmädchen für dich und würde dich gerne auf der Stelle nach Wien mitnehmen. Was möchtest du werden? Köchin? Hauswirtschafterin? Kindermädchen und später Gouvernante? Du kannst dich hocharbeiten. Die Herrschaft, die mich beauftragt hat, wird auf deine Wünsche eingehen. Sie sucht genau jemanden wie dich. Sie ist sehr reich und behandelt ihre Angestellten gut, besser als viele andere Familien, vor allem bezahlen sie besser. Du bekommst ein sauberes, warmes Zimmer und reichlich zu essen, vermutlich bekommst du dort mehr zu essen als in deinem Elternhaus. In zwei Tagen komme ich aus Haslach zurück, ich habe in der Weberei zu tun. Wenn du bereit bist, kannst du mitkommen. Selbstverständlich komme ich für alle Auslagen auf, die du während der Fahrt hast.«
Sie winkte dem Mädchen freundlich nach und dachte: Für die schöne Müllerstochter kann ich eine Gebühr verlangen, die sich gewaschen hat.
Schon bei der ersten Andeutung, die Rosa im Kreis ihrer Familie machte, wusste sie, sie würde von ihrem Vater nie die Erlaubnis bekommen. Dieser wurde äußerst zornig, er verpasste ihr eine Ohrfeige und untersagte ihr, je wieder davon zu reden.
Sie machte sich in der Nacht auf den Weg. Bevor sie aufbrach, schrieb sie ihrer Familie einen Abschiedsbrief, in dem sie erklärte, sie wolle nicht im Dorf bleiben, um ein derart armseliges Leben zu führen, wie es alle Frauen taten, die sie kannte. Ich werde fleißig arbeiten, so viel Geld wie möglich sparen und später in Wien einen gutherzigen Mann heiraten, am liebsten wäre mir ein Lehrer. Sie überlegte, Anton in ihre Pläne einzuweihen und sich von ihm zu verabschieden, doch sie traute ihm nicht, er würde vermutlich den Vater warnen, der sie daraufhin eingesperrt hätte.
Heimlich lief sie zu der vereinbarten Stelle, welche ihr die Böhm genannt hatte. Mittlerweile wurde diese von vier Mädchen begleitet, allesamt Töchter von kleinen Bauern, wie Rosa erfuhr. Sie hatte noch nie eine Kutsche von innen gesehen, in Linz bestieg sie zum ersten Mal ein Schiff. Die ganze Zeit über wurden die Mädchen belehrt, wie sie sich gegenüber ihren Arbeitgebern zu benehmen hatten. Sie studierten ein, wann sie das Wort an die Herrschaften richten durften, wie sie ihre Dienstgeber anzusprechen hatten, wohin sie dabei ihre Blicke wendeten, wie sie ein Zimmer betraten und es wieder verließen, wie der vollendete Knicks aussah.
Die Mädchen waren ausgelassen und benahmen sich wie kleine Kinder, so glücklich fühlten sie sich, der Enge ihres Weilers, ihres Dorfes entkommen zu sein, sie waren deshalb nicht besonders aufmerksam. Die Böhm hörte schließlich auf zu dozieren, und weil sie von einem plötzlich aufkeimenden Mitleid heimgesucht wurde — neuerdings erst hatte sie festgestellt, dass sie dagegen nicht gefeit war —, öffnete sie seufzend ihre große Tasche. Sie holte die Linzer Torte heraus, die sie einem Konditor an seinem Stand abgekauft hatte, bevor sie das Schiff betreten hatten, und gab jedem Mädchen ein großes Stück. Sie schaute ihnen dabei zu, wie sie kauten und schmatzten und lachten. Die fünf waren dabei, ihr bedauernswertes Schicksal gegen ein anderes bedauernswertes einzutauschen, denn so oder so war es ein jämmerliches Leben. Doch was konnte sie schon dagegen ausrichten, und schließlich musste sie irgendwie ihren Lebensunterhalt verdienen.
Rosas Vater raste vor Wut. Weit weg sollte die einzige Tochter die Nachtschüssel irgendwelcher feiner Pinkel leeren und waschen und das vielleicht sogar ihr ganzes Leben lang. Der Gedanke daran war für ihn unerträglich, schlimmer noch als die Vorstellung, Rosa wäre in seinem Haus eine alte Jungfer geworden. Er stürmte in die Linde und stellte seine Kusine lautstark zur Rede, die nicht wusste, wie ihr geschah.
»Gib es zu, du hast das Treffen zwischen Rosa und diesem — diesem Wiener Weibsbild arrangiert!«, schrie er wie von Sinnen.
Hinter dem Tresen begann er alle Gläser auf den Boden zu fegen. Die Gastwirtin musste ihren Mann zu Hilfe holen, der den Müller aus der Gaststube warf und ihm drohte: Nie wieder möge er sich blicken lassen.
Anton war tief gekränkt, seine Schwester hatte sich nicht einmal von ihm verabschiedet. Wenn sie es getan hätte, er hätte mit Sicherheit den Vater geweckt. Sie wäre wütend auf ihn gewesen, doch hätte sie sich wieder beruhigt und eingesehen, dass es letztendlich das Beste für sie war, in der Heimat zu bleiben, in der Nähe der Familie. An dem Morgen, an dem ihr Verschwinden bemerkt wurde, packte ihn ein Entsetzen, das ihn lähmte, er war also allein mit den wortkargen, abgestumpften Eltern. Wochenlang war er reizbar und kaum ansprechbar, später begann er sie unsäglich zu vermissen, den Eltern gegenüber gab er es nicht zu.
Die Mutter war die Einzige, die weder wütend noch gekränkt war, sie freute sich für ihre Tochter, dass sie dem harten Leben auf dem Land entkommen war, doch nie hätte sie gewagt, dies laut auszusprechen. Fast ein bisschen Schadenfreude empfand sie ihrem Mann gegenüber und auch all den Männern gegenüber, die ihrer schönen Tochter mit lüsternen Blicken nachgeschaut hatten. Meine kluge Rosa hat euch ein Schnippchen geschlagen, keiner von euch wird sie bekommen, um sie schuften zu lassen und ihr wieder und wieder einen dicken Bauch zu machen, dachte sie hämisch. Sie wünschte ihrer Tochter, dass ihr Traum wahr wurde, dass die Arbeit nicht zu hart war und sie nach einigen Jahren Dienst einen lieben Mann fand. Aber um Himmels willen keinen Lehrer, Lehrer sind im Kopf zwar vollgestopft mit Wissen, verstehen aber die einfachsten Dinge im Leben nicht, dachte sie, sie sind zu weich und zu nachgiebig, um sich durchzusetzen, gegenüber allem und jedem. Außerdem nagen sie am Hungertuch, am besten ist, Rosa heiratet einen Handwerker, einen Tapezierer oder Schneider, am besten einen Bäcker, ein Bäcker hat weiche Hände, vielleicht sogar einen, der sein eigenes Geschäft besitzt, das den kaiserlichen Hof beliefert. Immer rosiger malte sich die Mutter die Zukunft der Tochter aus. Und ein ganz klein wenig schwang auch Neid mit: Liebend gern wäre sie einmal in ihrem Leben schön gekleidet in einem Kaffeehaus gesessen, um dort Kaffee mit Milchschaum zu trinken und eine duftende Nussschnecke zu verzehren.
5
Mit seiner Mutter, seiner Frau und seinen drei Kindern bewohnte Rosas Dienstgeber Karl Freiherr von Reischach ein Palais in der Leopoldstadt in Wien, welches von der Familie selbst als klein bezeichnet wurde. In den ersten Tagen fühlte sich Rosa von der Üppigkeit und Opulenz, die sie umgab, beinahe wie betäubt. Sie verlief sich mehrmals in den unzähligen Fluren, Salons, Zimmern und Kammern, die sich über den Keller, drei Stockwerke und das Dachgeschoss verteilten. Gemeinsam mit einer jungen Böhmin bewohnte sie eine kleine fensterlose Kammer unter dem Dach, die Arbeit erschien ihr in den ersten Tagen nicht hart — sie war härtere gewohnt —, doch das änderte sich schnell. Sie musste sich daran gewöhnen, dass sie permanent unter Beobachtung stand, sich keine Minute auf einen Stuhl setzen durfte — es sei denn, sie nahm die Mahlzeiten ein — und dass der Arbeitstag um vieles länger war, als er es in ihrem Elternhaus gewesen war, um halb sieben Uhr morgens trat sie ihren Dienst an, der bis zehn Uhr abends dauerte. Selbst wenn man ihr nichts auftrug, hatte sie bereitzustehen und durfte sich nicht zurückziehen. Die ganze Woche lang freute sie sich auf die sonntäglichen freien Stunden, in denen sie durch die Innenstadt bummeln durfte, viel zu schnell waren sie jedes Mal um. Am ersten Sonntag verlief sich Rosa und kehrte zu spät in das Palais zurück, die Hauswirtschafterin erfuhr davon, schimpfte sie heftig, sie setzte bereits zu einer Ohrfeige an, als der junge Freiherr auf der Treppe stand und ihr überraschend zu Hilfe kam: »Seien Sie nicht so streng mit dem Mädchen.«
Einschließlich der Gärtner, Kutscher und Rossknechte, die in einem eigenen Personalhaus hinter dem Stall wohnten, kam auf die sechsköpfige Familie eine Dienerschaft von insgesamt sechsunddreißig Personen. Es herrschte eine strenge Hierarchie, die von niemandem missachtet wurde, auch nicht von den Dienstgebern. Wenn ein Auftrag erteilt wurde, war er an eine bestimmte Person gerichtet, und diese musste ihn wiederum an eine bestimmte Person weiterleiten, welche den Auftrag dann entweder ausführte oder noch einmal weiterleitete. Jeder hatte seinen Aufgabenbereich, den er ohne ausdrückliche Erlaubnis und genaue Instruktion nicht überschreiten durfte. Als sich Rosa einmal darüber lustig machte — sie bot sich für eine Arbeit an, für die sie nicht vorgesehen war —, wurde sie mehrfach gerügt. Wie man richtig polierte, war das Erste, das man ihr beibrachte, sie polierte Böden, Tische, Lederfauteuils, Fenster, Schuhe. Für alles gab es die richtige Politur, fein säuberlich beschriftet standen die Flaschen und Dosen in den Regalen der Kammer hinter der Waschküche, in der es auch Besen, Bürsten, Putzlappen und Staubwedel jeder Art gab, und es galt als ein großes Vergehen, die Dinge an den falschen Platz zurückzustellen.
Rosa und ihre Zimmerkollegin Agnezka waren für die Sauberkeit im ersten Stockwerk zuständig. Im östlichen Teil befanden sich die Schlaf-, Ankleide- und Badezimmer der beiden Töchter, im westlichen Teil die Räume des Sohnes, die eine in sich abgeschlossene Wohnung darstellten. Für das Wohlbefinden der Töchter war ein anderes Dienstmädchen zuständig, sie stand im Rang höher als Rosa und ihre Kollegin, diente bereits mehrere Jahre der Familie und kannte jede Kleinigkeit, die es zu beachten gab, in- und auswendig. Die heiße Schokolade, welche die Jüngere ans Bett serviert haben wollte, bevor sie sich schlafen legte, musste in einer bestimmten Tasse gebracht werden und durfte nicht zu heiß und nicht zu kalt sein. Das warme Fußbad und die anschließende Fußmassage, welche die Ältere vor dem Schlafengehen benötigte, da sie ansonsten wegen zu kalter Füße nicht einschlafen konnte, stellte eine noch heiklere Sache dar. Die Jüngere liebte frische Blumen in ihrem Schlafzimmer, die Ältere konnte bei intensivem Blumenduft nicht schlafen. Am Anfang kam Rosa aus dem Staunen nicht heraus, wenn sie von all den Details hörte, die es von früh bis spät zu wissen und zu beherzigen galt. Nur die erfahrene Dienstbotin war in der Lage, die Bedürfnisse der Herrschaft im Vorhinein zu erkennen und mit Umsicht zu erfüllen, sie hatte also einen langen Weg vor sich.
Theodor Johann Freiherr von Reischach war einundzwanzig und hatte eine eigene Wohnung im Palais der Eltern, zu der nur sein Diener Zutritt hatte, weshalb ihn das übrige Personal wenig zu Gesicht bekam. Am Familienleben nahm er kaum teil, wenn er nicht — in den warmen Monaten — auf seinen Wanderungen in der Natur unterwegs war, verkroch er sich hauptsächlich in seinen Räumen. Auf Wunsch seiner Eltern arbeitete er im Familienunternehmen mit, allerdings nicht mit derselben Disziplin wie sein Vater, der täglich um neun Uhr morgens in das Werk fuhr und meist erst spät am Abend zurückkehrte. Rosa spürte, dass es da etwas gab, das die Familie belastete, und dass dies mit dem jungen Freiherrn zu tun haben musste. Keiner der Dienstboten schien gern über ihn zu reden, wohingegen über seine beiden Schwestern viel getratscht wurde, über Launen, Kleidergeschmack, Theaterbesuche, Verehrer. Wenn sie selbst die Rede auf den jungen Mann brachte, zuckten sie mit den Achseln und wechselten das Thema.
Zu seinem Vater schien Theodor Johann ein angespanntes Verhältnis zu haben. Karl von Reischach hatte eine Manufaktur aufgebaut, der sein ganzer Ehrgeiz galt, die Verwaltung seiner Ländereien und Wälder überließ er anderen. Noch verschlangen sie mehr Geld, als sie einbrachten, doch der Freiherr war unermüdlich. Sein Steckenpferd war die Medizin, mit Akribie verfolgte er die Neuerungen, die sich auf diesem Gebiet taten, zu diesem Zweck hatte er verschiedene Fachzeitschriften abonniert. In der Manufaktur wurden höhenverstellbare Operationstische, Krankenbetten, gynäkologische Stühle, Medikamentenschränke für Arztpraxen, Kranken- und Kurhäuser hergestellt, spezialisiert hatte er sich dabei auf gutsituierte Patienten. Die Luxusvarianten seiner Betten und Liegen hatten einen ausgezeichneten Ruf, sie waren bereits bis nach England und in das russische Zarenreich exportiert worden. Das Neuartige, das Reischachs Unternehmen auszeichnete, waren die Kataloge, die er hatte anfertigen lassen, die Produkte waren darin nicht nur ausführlich beschrieben, sondern mit einer präzisen Illustration dargestellt. Er war ein pedantischer Mann, der zu cholerischen Ausbrüchen neigte, wenn etwas nicht lief, wie er sich das vorgestellt hatte, und ein strenger, jedoch gerechter Arbeitgeber. Für seine Angestellten, die ihrer Arbeit in der Manufaktur nicht nachkommen konnten, da sie krank, verletzt oder zu alt waren, sorgte er. In seiner Freizeit ging er — wenn er nicht gerade seine Fachzeitschriften las oder Krankenhäuser besuchte, um den Ärzten bei der Arbeit zuzuschauen — seiner Leidenschaft, der Jagd, nach.
Dem jungen Theodor Johann fehlte das Interesse für all das, was sein Vater liebte, weder mochte er die Jagd, noch interessierten ihn die Medizin oder die Belange der Manufaktur — für ihn war es eine simple Tischlerei, die Betten und Schränke herstellte —, und am meisten verabscheute er die grauenhaften Operationen, bei denen sein Vater so gerne zusah.
Seiner Mutter Wilhelmina, warmherzig und gebildet, stand er näher, wie sie las er gerne. Auf seinen Wanderungen versuchte er sein Glück mit dem Kohlestift, doch hatte er kein Talent, sein Vater schüttelte den Kopf, wenn er eine Zeichnung zu Gesicht bekam, seine Schwestern lachten ihn manchmal aus: »Du Möchtegernkünstler!«
Nur in einem waren sich der alte und der junge Freiherr einig, beide konnten sie die zahlreichen Abendgesellschaften, welche die Freifrau veranstaltete, um der Langeweile zu entfliehen, nicht leiden. Seitdem Sohn und Töchter dem Kindesalter entwachsen waren, besuchte sie einmal wöchentlich die Arbeitersiedlung, in welcher die Arbeiter der Manufaktur mit ihren Familien wohnten, um nach dem Rechten zu sehen. Ansonsten verlor sie sich in komplizierten Stickereien, französischen Romanen, Migräneanfällen, Kartenspielen und hielt Ausschau nach geeigneten Ehepartnern für ihre Kinder.
Nach einer Weile im Hause der Reischachs stellte Rosa fest — sie besaß eine hervorragende Beobachtungsgabe —, dass es zweierlei Dienstboten gab. In einem ihrer ersten Briefe an Anton bezeichnete sie sie als die Toten und die Lebenden. Diejenigen, die wie Schatten im Palais herumhuschten, der Herrschaft mit völliger Hingabe dienten, nie ein schlechtes Wort über sie verloren, diejenigen, deren Wunsch es war, ihr ganzes Leben lang derselben Herrschaft zu dienen, und die nicht einmal im Entferntesten an eine eigene Familie dachten, das waren die Toten. Ich vermute, selbst wenn sie auf die Straße gejagt werden und im Armenhaus enden, quält sie noch der Gedanke, ob das Frühstücksei in dem Zustand serviert wird, in dem die Herrschaft es liebt.
Sie selbst zählte sich zu den Lebenden. Diese stellten einige Jahre ihres Lebens in den Dienst der Herrschaft, um Geld zu sparen für eine Zukunft, konnten über bestimmte Allüren der Herrschaft lachen oder sich auch ärgern. Rosa erkannte außerdem, dass die Herrschaft ein Gespür dafür haben musste, welcher Art der Dienstbote war, und dies beim Aufsteigen in der Hierarchie berücksichtigte. Es ging dabei weniger um Klugheit oder Beflissenheit, sondern um absolute Loyalität.
Von den Annäherungsversuchen des jungen Freiherrn, die mit jedem Tag dreister wurden, schrieb Rosa ihrem Bruder nicht, sie wusste, Anton hätte sie auf keinen Fall gutgeheißen. Bereits in den ersten Tagen war ihr aufgefallen, dass Theodor Johann es jedes Mal, wenn er seine Wohnung verließ, so einrichtete, dass er auf sie traf. Er begann ihr Komplimente zu machen, fragte sie über ihre Herkunft aus und lieh ihr ein Buch, nachdem sie errötend gestanden hatte, dass sie gerne las. Rosa war verwirrt und wusste nicht, was sie von seinem Interesse halten sollte, wenn sie mit anderen Frauen im Personal darüber reden wollte, hüllten sich alle in Schweigen, selbst Agnezka, die in ihrem breiten böhmischen Dialekt zu allem bereitwillig Auskunft gab. Sie ertappte sich dabei, dass sie oft an den jungen Mann dachte, und merkte, dass ihr Herz wie wild klopfte, wenn er sich ihr näherte.
Als Rosa auf Knien das Parkett in seiner Wohnung polierte — sie war seit drei Wochen bei den Reischachs —, bemerkte sie erst nach geraumer Weile, dass Theodor Johann in einer dunklen Ecke saß und sie beobachtete. Erschrocken fuhr sie in die Höhe, woraufhin er aufstand und zu ihr kam, er bückte sich und streichelte ihr Gesicht.
6
Am 14. Mai 1830, gegen zwei Uhr früh, brachte Rosa auf einem kleinen Bauernhof am Stadtrand von Wien einen Buben zur Welt.
Am Abend zuvor hatten die Wehen eingesetzt, gleichzeitig mit einem heftigen Gewitter, dennoch tauchte kurze Zeit darauf eine Hebamme in ihrer Kammer auf, in der sie angstvoll auf dem Bett lag, zitternd vor dem, was sie erwartete. Bei ihrem Eintreten wunderte sich Rosa darüber, warum sie nicht nässer geworden war.
Die Hebamme war eine stämmige Frau um die sechzig, sie roch nach Schweiß, strahlte jedoch Ruhe und Zuversicht aus, die ganze Zeit über redete sie der Wöchnerin gut zu, manchmal nahm sie sogar ihre Hand und streichelte sie. Rosa durfte sie mit ihrem Vornamen anreden: Frau Therese. Heilfroh war sie über ihre Anwesenheit, sie hatte befürchtet, die Niederkunft allein in der kleinen Kammer durchstehen zu müssen, in welchem Ausmaß ihre Gastgeberin, die Bäuerin, zu helfen gedachte, wusste sie nicht, denn diese war seit ihrer Ankunft zehn Tage zuvor unnahbar und unfreundlich gewesen. Sie war eine hagere Person, mit gekrümmter Haltung und langen hängenden Armen, die Stirn faltendurchzogen, obwohl sie keine vierzig war.
»Geh in deiner Kammer auf und ab«, hatte sie nach dem Einsetzen der Wehen zu Rosa gesagt, »das beschleunigt die Sache. Und wenn du nicht mehr kannst, leg dich ins Bett.«
Seit dem frühen Tod ihres Mannes nahm die Bäuerin, um sich und ihre drei Kinder über Wasser zu halten, hochschwangere Dienstbotinnen auf und erhielt dafür Geld von deren Herrschaften. Die Frauen konnten in ihrem Haus entbinden — mit oder ohne Hebamme, je nachdem, ob die Herrschaft zusätzlich dafür bezahlen wollte — und gingen am Tag darauf zurück an ihre Arbeit. Das Kind blieb in der Obhut der Witwe, die eine Amme und später einen geeigneten Platz suchte. Von der Höhe der Summe, die der leibliche Vater für das Großziehen seines Sprösslings gewillt war zu zahlen, hing es ab, wo das Kind letztendlich landete: in einer gutsituierten, liebevollen Familie oder in einer ärmlichen, die auf das Geld angewiesen war, in der es jedoch rau und grob zuging — dazwischen gab es unzählige Abstufungen —, in einem nonnengeführten Waisenheim oder gar im Findelhaus.
Rosa lag halb aufgerichtet im schmalen Bett in der engen Kammer und presste aus Leibeskräften, wenn Frau Therese es ihr befahl, dabei versuchte sie so leise wie möglich zu sein, sie wollte die Nachtruhe der anderen Hofbewohner nicht stören. Die Person, die ihr am meisten in den Sinn kam in diesen Stunden, war nicht der Vater des Kindes, sondern ihr eigener, sie stellte sich vor, wie er seine Haare raufte, fluchte und schimpfte. Alles verlief ohne Schwierigkeiten, zum Schluss sagte die Hebamme: »Ich würd mir wünschen, dass es bei allen Frauen so leicht geht wie bei dir.«
Dabei hielt sie das nackte krähende Kind in die Höhe, und Rosa spürte große Erleichterung. Sie richtete ein kurzes Dankesgebet himmelwärts, ein Sohn stellte doch einen größeren Trumpf als eine Tochter dar, sie war überzeugt, ihre Position war durch ihn gestärkter. Einen Tag darauf tauchte ein Geistlicher in ihrer Kammer auf und sagte ohne Umschweife: »Ich bin hier, um deinen Sohn zu taufen.«
Der Kleine erhielt den Namen Theodor, offenbar hatte der Mann diesbezüglich Anweisungen erhalten, Rosa wurde nicht lange gefragt, ob sie etwas dagegen hätte. Die Taufe fand in der Küche statt, als Pate stellte sich aus freien Stücken der jüngste der zwei Stallknechte zur Verfügung. In der ersten Zeit kam die Hebamme jeden zweiten Tag vorbei, um nachzusehen, ob Rosas Brustwarzen gesund waren und sich nicht entzündeten, ob das Kind genügend trank. Als der Bub sechs Wochen alt war, besuchte sein Vater sie, er stand neben dem Bett — Rosa war dabei, dem Kleinen die Brust zu geben — und schaute wortlos auf Mutter und Kind hinab. Sie griff nach seiner Hand, er entzog sie ihr und verließ die Kammer, ein zweites Mal kam er nicht.
Ihr war im Vorhinein zugesichert worden, ein halbes Jahr lang bei ihrem Kind bleiben zu dürfen. In diesem Punkt hatte sich der junge Reischach seinen Eltern gegenüber durchgesetzt, was beinahe an ein Wunder grenzte, denn er war zumeist Wachs in ihren Händen, besonders in denen der Freifrau. Diese wusste, wie sie ihn zu nehmen hatte, sie hörte nicht auf, begütigend und verständnisvoll auf ihn einzureden, bis er wie ein Lamm zu allem nickte, wohingegen er auf die missbilligenden Blicke und Wutausbrüche seines Vaters oftmals trotzig reagierte, indem er aufstand und den Raum verließ. Sie wusste, dass der alte Reischach seinen Sohn angebrüllt hatte: »Es tut einer jungen Mutter nicht gut, wenn sie eine zu starke Bindung zu ihrem Kind aufbaut, das sie ohnehin auf dem Hof zurücklassen muss. Verschwendest du überhaupt einen Gedanken an das arme Ding?«
Dasselbe sprach die Bäuerin aus, nachdem sie die Nachricht der Freifrau gelesen hatte, entsetzt schüttelte sie den Kopf.
»Sowas hab ich noch nie erlebt«, murmelte sie und sagte zu ihr: »Wenn du sofort nach der Geburt gehst, wird es leichter für dich sein. Am besten ist, du schaust das Kind gar nicht an.«
Im Laufe des Sommers taute die Frau auf, sie wurde freundlicher und zugänglicher, an den Abenden suchte sie das Gespräch mit Rosa, sie erzählte von ihrem Mann, den sie sehr geschätzt hatte, ihren Sorgen, den vielen Frauen, die bereits in ihrem Haus entbunden hatten. Mehrmals schloss sie seufzend mit den Worten: »Weißt du überhaupt, wie großzügig deine Herrschaft ist?«
Rosa wusste es, sie hatte genug gehört, kannte haarsträubende Geschichten von Dienstbotinnen aus anderen Häusern, die man auf die Straße gejagt hatte, weil sie in anderen Umständen waren, die im Armenhaus gebären mussten, von Säuglingen und kleinen Kindern, die im Findelhaus starben.
Es war ein heißer Sommer, Rosa saß gern im Freien, las — Theodor Johann hatte ihr einige Bücher mitgegeben — oder schaute gedankenverloren in die Weite. Weil sie sich dort unbeobachtet fühlte und es schattig war, saß sie am liebsten auf der Bank an der hinteren Stallmauer, manchmal setzte sich der junge Stallknecht zu ihr. Von ihm erfuhr sie, dass er es gewesen war, der im strömenden Regen die Hebamme abgeholt hatte. Er erzählte ihr von seinen Plänen, er wollte nach Amerika auswandern, seine eigene Farm bewirtschaften, eisern sparte er für die Schiffspassage.
Sechs Monate nach der Niederkunft kehrte Rosa in das Palais der Reischachs zurück, die schriftliche Aufforderung dazu hatte ihr der Kutscher eine Woche zuvor mit spitzen Fingern und ohne ein Wort überreicht. Von ihrer Gastgeberin erfuhr sie, dass die Freifrau angefragt habe, ob das Kind vorläufig bei ihr bleiben könne, und sie zugesagt habe, Rosas Hand tätschelnd sagte sie: »Ich passe gut auf ihn auf.«
Da sie sich verlief, brauchte sie drei anstatt zwei Stunden, erst gegen Mittag kam sie völlig durchfroren an, das Personal verhielt sich ihr gegenüber abweisend, lediglich Agnezka stellte ihr eine warme Suppe hin und reichte ihr ein Taschentuch, als sie zu weinen begann.
Rosa nahm ihre Arbeit wieder auf, schrubbte und putzte wie vor ihrer Niederkunft, nur dass sie für den zweiten Stock zuständig war und nicht für den ersten, in dem Theodor Johanns Wohnung lag — dieser ging ihr den ganzen Winter lang aus dem Weg —, und dass sie sich in den Nächten in den Schlaf weinte. Ihren Sohn besuchte sie an den Sonntagen, sie hatte ganztags frei und nicht wie die anderen Angestellten nur wenige Stunden am Nachmittag, das hatte der junge Freiherr gegenüber seiner Mutter durchsetzen können. Die Dienstboten waren neidisch und mieden Rosa.
Am ersten Geburtstag saß Rosa mit ihrem Sohn in der Wiese hinter dem Hof auf einer Decke, der Kleine spielte mit Holzklötzen, als überraschend der junge Reischach um die Hausecke gebogen kam, sich auf die Bank an der Mauer setzte und die beiden zu zeichnen begann. Sie konnte keinen klaren Gedanken fassen, fühlte sich wie in den Wochen nach der ersten Berührung, der junge schüchterne Mann war ihr permanent nachgestiegen, um ihr Komplimente zu machen, bis er sich eines Tages — sie war beim Schrubben des Fußbodens — zu ihr beugte, sie küsste und damit in höchsten innerlichen Aufruhr versetzte. Daraufhin nahm er sie beinahe täglich an der Hand, ganz gleich welche Tätigkeit sie ausführte, um sie in seine Wohnung zu ziehen, wo er sie zuerst langsam auszog, um sie andächtig zu betrachten, bevor er sie aufforderte, sich aufs Bett zu legen.
Auf der Heimfahrt saß sie ihm in der Kutsche gegenüber, sie wusste nicht, wie sie sich verhalten sollte, und schaute an ihm vorbei aus dem Fenster, während ihr Herz bis in den Hals klopfte. Er entschuldigte sich für sein abweisendes Verhalten in den letzten Monaten, er habe ihr Unverzeihliches angetan, sagte er. In ihrer Brust bahnte sich ein Schluchzen seinen Weg nach oben, sie konnte es nicht unterdrücken, sosehr sie auch dagegen ankämpfte, bis es aus ihr herausbrach, mächtig und gewaltig, und er sie in seine Arme nahm.
Wieder begann sie sich Hoffnungen zu machen. Sie war nicht naiv, sie wusste, dass Theodor Johann sie nie ehelichen würde, nur im ersten Jahr war sie so vermessen gewesen, in ihrer immensen Verliebtheit davon zu träumen. Aber sie hatte von Liebschaften gehört, die von Bestand waren, oft ein Leben lang hielten, die Geliebte bekam eine angemessene Wohnung finanziert und erhielt obendrein eine monatliche Apanage, die höher war als das jährliche Gehalt eines Dienstmädchens. Theodor Johann machte diesbezüglich immer wieder Andeutungen, er hätte gerne eine zweite Wohnung außerhalb des Palais seiner Eltern gehabt, bewohnt von ihr, dem geliebten Menschen, bei dem er jederzeit Zuflucht finden konnte, selbst wenn er später gezwungen sein sollte, doch zu heiraten. Ihr ganzes Denken und Sehnen war auf diese Wohnung gerichtet — sie stellte sich die einzelnen Räume bereits im Geiste vor —, in der sie ihren Sohn selbst erziehen konnte, in der sie frei und unabhängig sein würde, niemandem Rechenschaft schuldig und obendrein eine wichtige Rolle im Leben des Mannes spielend, ohne den sie nicht sein wollte. Sie war überzeugt, der junge Freiherr würde letztendlich den Mut dafür aufbringen, wenn sie ihm nur unermüdlich ihre Liebe bewies und all das tat, was er von ihr verlangte.
Theodor Johann war krank, er litt an der sogenannten Fallsucht, starke Krampfanfälle suchten ihn in unregelmäßigen Abständen heim, nach einem Anfall, äußerst erschöpft, machte er Versprechungen, später wurde sie vertröstet. Sie nahm an, dass er Angst hatte vor der finanziellen Unsicherheit, denn sein Vater ließ dem kranken Sohn nur eine kleine monatliche Apanage zukommen, welche für sie ein Vermögen darstellte, für ihn jedoch beschämend war. Über diese Mutmaßung schüttelte Agnezka den Kopf.
»Am Geld liegt es nicht«, sagte sie. »Du bist schon drei Jahre in Wien, aber viel hast du noch nicht verstanden. Ein Freiherr muss einem Dienstmädchen keine Wohnung zahlen, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, einer Bürgerlichen ja, aber nicht unsereins. Es ist besser, du verabschiedest dich von deinen Träumen, bevor du ganz vor die Hunde gehst. Du bist noch jung, such dir einen Ehemann und kündig die Stelle.«
Allmählich kühlte die Beziehung des jungen Freiherrn zu ihr ab, und sie litt darunter. Je älter er wurde, umso fordernder und forscher wurde sein Verhalten, der schüchterne stille Mann wurde zunehmend launisch, unberechenbar, mitunter auch aggressiv. Er begann einem anderen — neuen — Dienstmädchen nachzustellen, später einer stummen Küchenhilfe, nicht einmal sechzehnjährig, was er außerhalb des Palais trieb, wusste Rosa nicht. Aber da immer wieder sie es war, die Theodor Johann — nach Unterbrechungen — an der Hand packte und mit sich zog, gab sie die Hoffnung auf ein besseres Leben in einer eigenen Wohnung nicht auf. Und weil die Reischachs Theos Unterhalt bezahlten, hätte sie nicht gewagt zu kündigen, so oder so war sie durch ihren Sohn an die Familie gebunden.
Als ihr Sohn acht war, heiratete Theodor Johann eine Gräfin, die seine Mutter für ihn ausgesucht hatte, lange hatte er sich dagegen gewehrt. Man erwartete vom einzigen Sohn, der aufgrund seiner schweren Erkrankung eine Enttäuschung für die Familie darstellte, zumindest eheliche — männliche — Nachkommen, damit die Linie nicht ausstarb. Mit dem Dienstmädchen Rosa hatte der junge Freiherr bewiesen, dass er in der Lage war, gesunde Kinder zu zeugen.
Sie erfuhr, dass sie einzig und allein zu diesem Zweck eingestellt worden war, Theodor Johann selbst war es, der nach ein paar Gläsern Wein launig alles ausplauderte, wenige Tage vor seiner Trauung: Rosa sollte dem jungen Mann den Gang in die Bordelle ersparen — die Gefahr, sich eine Geschlechtskrankheit zu holen oder auch erpresst zu werden, war sehr groß — und ein Kind von ihm bekommen. Rosa war von einer Stellenvermittlerin gezielt für ihn ausgesucht worden, man hatte ihr im Vorhinein Anweisungen gegeben, wie das Mädchen auszusehen hatte. Weil man nicht unmenschlich sein wollte und weil der junge Mann darauf bestand — er war tatsächlich eine Zeitlang sehr in sie vernarrt gewesen —, jagte man sie nach der Geburt ihres Kindes nicht auf die Straße.
»Und jetzt liegt es an meinem Vater, warum du immer noch hier bist«, warf er ihr an den Kopf, »ich bin deiner mehr als überdrüssig. Und meiner Mutter hast du es zu verdanken, dass es deinem Kind gut geht. Sie bezahlt dafür dieser grantigen Bohnenstange von Bäuerin ein fürstliches Gehalt.«
Rosa lernte einen Lehrer kennen, er unterrichtete Musik in einem Gymnasium, hatte eine gute Singstimme und interessierte sich in seiner Freizeit für Weinanbau. Monatelang traf sie ihn heimlich, schlich nach Dienstschluss aus dem Haus, um ihn für eine Stunde zu sehen, eilte an den Sonntagabenden — nachdem sie Theo verlassen hatte — zum vereinbarten Treffpunkt. Schließlich erzählte sie ihm von ihrem Sohn, er wollte sie nicht mehr sehen und löste die Verlobung. Rosa, die den Mann sehr gern hatte, sich sehnlichst weitere Kinder, ein eigenes Heim wünschte, brach zusammen und brauchte lange, um sich zu erholen.
Der zwölfjährige Theo übersiedelte in ein Knabeninternat, aufgrund der guten Noten hatten seine Großeltern entschieden, ihn ein Gymnasium besuchen zu lassen. Rosa war glücklich darüber, sie wünschte sich nichts mehr, als dass ihren Sohn eine bessere Zukunft erwartete, sie träumte davon, dass Theo ein Medizinstudium absolvierte. Eines Tages würde er seine eigene Ordination haben, angesehen sein, und sie, seine alte Mutter, würde in seinem Haus leben und mithelfen, die Enkelkinder großzuziehen. Er war ein aufgeweckter Junge, der ihr manchmal die Besuchsstunden schwer machte mit seinen bohrenden neugierigen Fragen, vorlaut und doch charmant, groß für sein Alter, ihr sehr ähnlich.
Auch sie wurde von der Herrschaft gut behandelt, sie stieg zur rechten Hand der Hauswirtschafterin auf, und als diese zu alt war, um ihren Posten verantwortungsvoll auszuüben, bekleidete sie das Amt selbst, das gesamte weibliche Dienstpersonal unterstand ihr. Mittlerweile hatte sie die Mitte dreißig überschritten, sie gab es auf, sich ein eigenes Leben aufbauen zu wollen, resignierte und widmete ihr ganzes Denken, Fühlen und Sein dem Wohlbefinden der Herrschaft. Sie arbeitete nicht nur für die Familie, es war