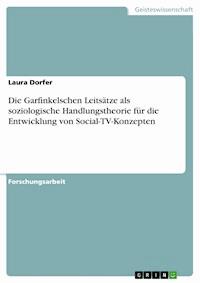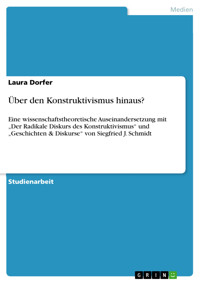
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Theorien, Modelle, Begriffe, Note: 1,3, Universität Siegen, Veranstaltung: Kulturwissenschaftliche Wissenschaftstheorie, Sprache: Deutsch, Abstract: Die hiesige Arbeit verfolgt das Ziel, die grundlegenden wissenschaftstheoretischen Voraussetzungen, soll heißen die Charakteristika der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung, der 2003 erschienen Schrift Geschichten & Diskurse von Siegfried J. Schmidt vor dem Hintergrund des Aufsatzes „Der Radikale Konstruktivismus: Ein neues Paradigma im interdisziplinären Diskurs“4 von 1987 aufzuzeigen und auf ihre logische Konsistenz und Viabilität5 zu prüfen. Als Maßstab der Evaluation fungiert hierbei die Zielsetzung, die Missstände des Konstruktivismus entlang der zentralen Problematiken der Wirklichkeitskonstruktion, des Dualismus sowie der Selbstaufhebung zu beseitigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Page 1
Universität Siegen
Hauptseminar:: Kulturwissenschaftliche Wissenschaftstheorie Modul: IB 1 Seminar Wissenschaftstheorie Wintersemester 2008/2009
Über den Konstruktivismus hinaus?
Eine wissenschaftstheoretische Auseinandersetzung mit „Der Radikale Diskurs des
Konstruktivismus“ und „Geschichten & Diskurs“ von Siegfried J. Schmidt
Siegen, 10. November 2009
Page 1
1. Einführung
Ein neuer 'radikaler' Konstruktivismus macht von sich reden. Einige aufregende Formulierungen kommen druckfrisch aus der Presse - und schon gilt die Sache als etabliert. So schnell muß es heute gehen. Man erfährt etwas über das Eingeschlossensein des Gehirns und über die Autopoiesis des Lebens. Man wird darüber belehrt, daß man nichts sehen kann, was man nicht sehen kann. Man wird über Sachverhalte unterrichtet, die man immer schon gewußt hat - aber in einer Weise, die das Gewußte in ein neues Licht versetzt und neue Anschlußüberlegungen ermöglicht, die viel radikalere Konsequenzen haben, als bisher für möglich gehalten wurde.1
Dieses Postulat Niklas Luhmanns stammt aus einer Zeit, in welcher dem Konstruktivismus die revolutionäre Kraft beigemessen wurde, eine grundlegende Umorientierung in der Deutung des Erkenntnisgeschehens zu vollziehen. Nahezu zwanzig Jahre später sind trotz der breiten Akzeptanz und Popularität des Konstruktivismus in wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Kreisen Zweifel an dem Innovationspotential entstanden. Schwerwiegende Mängel und Paradoxien sind sichtbar geworden, die unbehebbar erscheinen und in einer Selbstdelegitimation münden. So stellt sich die Frage in der Scientific Community: Was kommt nach dem Konstruktivismus?2Mit der PublikationGeschichten & Diskurse. Abschied vom Konstruktivismus3ist es just Siegfried J. Schmidt, einer der populärsten Vertreter des Konstruktivismus, der eine Antwort auf diese Frage zu geben versucht. Dabei ist diese Theorie, so sei vorweggenommen, nicht etwa die Abkehr vom Konstruktivismus, sondern eine Neukonzeption dieser Epistemologie, in welcher der Abschied von den Missständen der traditionellen Konstruktivismuskonzepte vollzogen wird.
Die hiesige Arbeit verfolgt das Ziel, die grundlegenden wissenschaftstheoretischen Voraussetzungen, soll heißen die Charakteristika der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung, der 2003 erschienen SchriftGeschichten & Diskursevon Siegfried J. Schmidt vor dem Hintergrund des Aufsatzes „Der Radikale Konstruktivismus: Ein neues Paradigma im interdisziplinären Diskurs“4von 1987 aufzuzeigen und auf ihre logische Konsistenz und Viabilität5zu prüfen. Als Maßstab der Evaluation fungiert hierbei die Zielsetzung, die Missstände des Konstruktivismus entlang der zentralen Problematiken der Wirklichkeitskonstruktion, des Dualismus sowie der Selbstaufhebung zu beseitigen.
1Luhmann 2005 , S.31
2Vgl.Jahrestagung der GWTF„Was kommt nach dem Konstruktivismus in der Wissenschafts- und Technikforschung?“Berlin, 26.-27. 11. 2004
3Vgl. Schmidt 2003a / im Folgenden abgekürzt mitGeschichten & Diskurse
4Vgl Ebd. 1987 / im Folgenden abgekürzt „Der Radikale Konstruktivismus“
5Viabilität wird im Sinne Ernst von Glasersfeld verwendet: „Handlungen, Begriffe und begriffliche Operationen sind dann viabel, wenn sie zu den Zwecken oder Beschreibungen passen, für die wir sie benutzen. Nach konstruktivistischer Denkweise ersetzt der Begriff der Viabilität im Bereich der Erfahrung den traditionellen philosophischen Wahrheitsbegriff, der eine ‚korrekte’ Abbildung der Realität bestimmt.“ (Glasersfeld 1997 S.43)