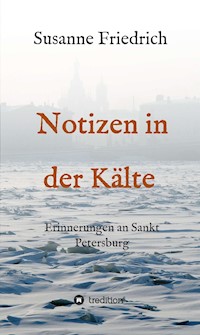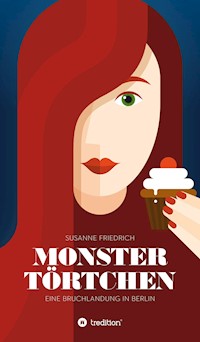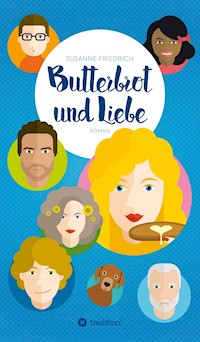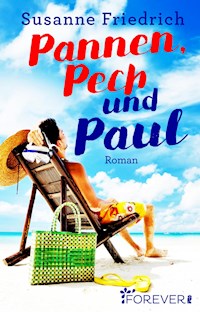Über die Symbolik der räumlichen Isolation des Menschen in der modernen Literatur E-Book
Susanne Friedrich
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 2,0, Friedrich-Schiller-Universität Jena (Institut für Germanistische Literaturwissenschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Das Problem der Vereinzelung und Isolation ist ein Thema, dass scheinbar besonders in der heutigen Gesellschaft zunehmend an Bedeutung gewinnt. Es kann alle Gruppen der Gesellschaft betreffen – chronisch kranke Menschen, psychiatrische Patienten, Strafgefangene, ebenso wie alte Menschen, Alleinerziehende oder Arbeitslose. Immer mehr Bevölkerungsanteile werden mit Isolation konfrontiert; in einem viel größeren Ausmaß als in vormodernen Zeiten. Die „räumliche“ Isolation ist dabei eine mögliche Ausprägungsform unter vielen. Einsamkeits- und Isolationserfahrungen lassen sich in der Literatur weit zurückverfolgen, bereits in der Bibel durchlebt Jona alle Ängste der Verlassenheit. Dennoch scheinen die Isolationserlebnisse und –ängste ab dem frühen zwanzigsten Jahrhundert zuzunehmen. Schon die Wahl des Schauplatzes verdeutlicht dabei einen Zusammenhang zwischen dem inneren Erleben des Protagonisten und der Außenwelt. Jeder Raum vergegenwärtigt die darin lebende Person und offenbart nicht selten die Beziehung des Bewohners zur Welt. Insofern wird der Raum zum „Symbol“ und dient (in dem hier betrachteten Zusammenhang) als bildhaftes Zeichen der Veranschaulichung eines Lebensstils, der von Unsicherheit und Ungeborgensein geprägt ist. Der Raum bleibt dabei nicht nur Lebensraum, sondern nimmt weitere Bedeutungsebenen und Konnotationen an, wie beispielsweise „Zufluchtort“, „Gefängnis“, „Schneckenhaus“ oder „Kontemplationsort“. In Bezug auf die drei, beispielhaft gewählten Prosastücke von Autoren des 20. Jahrhundert (Kafka, Bernhard, Süskind) drängen sich dabei folgende Behauptungen auf: These 1: Die räumliche Isolation ist eine mögliche Reaktion des Individuums auf die gesellschaftlichen Gegebenheiten. These 2: Die gesellschaftlichen Isolationen der Menschen liegen häufig in existenziellen Ängsten begründet. These 3: Die existenzielle Angst des Protagonisten aus “Die Verwandlung”, Gregor Samsa, ist die Angst vor der Ich-Aufgabe. These 4: Die existenzielle Angst des Protagonisten aus “Der Kulterer”, Franz Kulterer, ist die Angst vor der Ich-Werdung. These 5: Die existenzielle Angst des Protagonisten aus “Die Taube”, Jonathan Noel, ist die Angst vor der Veränderung. Diese fünf Thesen sollen nachfolgend untersucht werden. Aufgrund der vielschichtigen Kausalitäten wird zusätzlich Literatur zum Thema Verhaltenspsychologie und Soziologie herangezogen, um anhand dieser Parallelen und Zuordnungen festzuhalten, welche auf eine Be- oder Widerlegung der Thesen deuten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Page 1
Page 3
1. Einleitung
Das Problem der Vereinzelung und Isolation ist ein Thema, dass scheinbar besonders in der heutigen Gesellschaft zunehmend an Bedeutung gewinnt. Es kann alle Gruppen der Gesellschaft betreffen - chronisch kranke Menschen, psychiatrische Patienten, Strafgefangene, ebenso wie alte Menschen, Alleinerziehende oder Arbeitslose. Immer mehr Bevölkerungsanteile werden mit Isolation konfrontiert; in einem viel größeren Ausmaß als in vormodernen Zeiten. Die „räumliche“ Isolation ist dabei eine mögliche Ausprägungsform unter vielen. Einsamkeits- und Isolationserfahrungen lassen sich in der Literatur weit zurückverfolgen, bereits in der Bibel durchlebt Jona alle Ängste der Verlassenheit. Dennoch scheinen die Isolationserlebnisse undängste ab dem frühen zwanzigsten Jahrhundert zuzunehmen. Wie auch Bernhard Blume feststellt, vollzieht sich in der Literatur der letzten Jahrhunderte in steigendem Maße ein „Weg von ‚romantischer’ Einfühlung in die Natur, von Naturgenuss und Naturgemeinschaft zu einem Pathos der äußersten Naturferne und der absoluten Vereinzelung.“1Viele Werke der Moderne stammen tatsächlich von Vereinzelten, die diesen Zustand quälend empfanden, weshalb dieses Thema in ihren Werken mit besonderer Intensität bearbeitet wurde. Schon die Wahl des Schauplatzes verdeutlicht dabei einen Zusammenhang zwischen dem inneren Erleben des Protagonisten und der Außenwelt. Jeder Raum vergegenwärtigt die darin lebende Person2und offenbart nicht selten die Beziehung des Bewohners zur Welt. Insofern wird der Raum zum „Symbol“ und dient (in dem hier betrachteten Zusammenhang) als bildhaftes Zeichen der Veranschaulichung eines Lebensstils, der von Unsicherheit und Ungeborgensein geprägt ist. Der Raum bleibt dabei nicht nur Lebensraum, sondern nimmt weitere Bedeutungsebenen und Konnotationen an, wie beispielsweise „Zufluchtort“, „Gefängnis“, „Schneckenhaus“ oder „Kontemplationsort“. Weil mehrere Ebenen integriert werden und das Ganze mehr ist als die Summe ihrer Teile, wird tatsächlich mehr gesagt, als bewusst ausgedrückt wird. Wenn man sich mit verschiedenen Einzelfällen von Isolierten (ob in der Literatur oder der Realität) beschäftigt, dann entsteht schnell der Eindruck, dass ein Rückzug von der Welt häufig mit Ängsten verbunden ist: Angst vorm Versagen, Angst vor der Zukunft, Angst vorm Verlassenwerden, um nur einige zu nennen. In dieser Arbeit sollen Kafkas „Die Verwandlung“, Bernhards „Der Kulterer“ und Süskinds „Die Taube“ näher betrachtet werden. „Die Verwandlung“ handelt von dem sozial und später auch räumlich isolierten Gregor Samsa, der sich selbst mit der Verantwortung gegenüber seiner Familie überfordert und sich durch die äußerliche Verwandlung in ein Ungeziefer von den Ansprüchen seiner Familie befreit. In „Der Kulterer“ geht es um einen Gefängnishäftling, der seine Haftzeit durch die völlige Aufgabe eigener Ansprüche und das Schreiben von Geschichten erträglich macht und dadurch meint, geistige Freiheit zu erlangen. „Die Taube“ schließlich thematisiert die innere Zerrissenheit des Wachmanns Jonathan Noel, der glaubt, sich vor der Unzuverlässigkeit der Menschen und der Welt zu schützen, indem er jeglichen Bezug zu ihnen abbricht. In Bezug auf diese drei, beispielhaft gewählten Prosastücke von Autoren des 20. Jahrhundert drängen sich dabei folgende Behauptungen auf:
1Blume, Bernhard: Lyrismus der Zelle. In: Almanach. Das neunundsiebzigste Jahr. Hrsg. von J. Hellmut Freund und Gerda Niedieck. Frkf. a. M.: Fischer 1965. S. 92.
2Söder, Thomas: Patrick Süskind "Die Taube". Versuch einer Deutung. Freiburg: HochschulVerlag 1992. S. 19.
Page 4
These 1: Die räumliche Isolation ist eine mögliche Reaktion des Individuums auf die gesellschaftlichen Gegebenheiten.
These 2: Die gesellschaftlichen Isolationen der Menschen liegen häufig in existenziellen Ängsten begründet.
These 3: Die existenzielle Angst des Protagonisten aus “Die Verwandlung”, Gregor Samsa, ist die Angst vor der Ich-Aufgabe.3
These 4: Die existenzielle Angst des Protagonisten aus “Der Kulterer”, Franz Kulterer, ist die Angst vor der Ich-Werdung.
These 5: Die existenzielle Angst des Protagonisten aus “Die Taube”, Jonathan Noel, ist die Angst vor der Veränderung.
Diese fünf Thesen sollen anhand der folgenden Ausführungen untersucht werden. Aufgrund der vielschichtigen Kausalitäten wird zusätzlich Literatur zum Thema Verhaltenspsychologie und Soziologie herangezogen, um anhand dieser Parallelen und Zuordnungen festzuhalten, welche auf eine Be- oder Widerlegung der Thesen deuten.
Im Mittelpunkt der Betrachtung sollen räumliche Isolationserfahrungen stehen, die auf Einsamkeitsgefühle zurückzuführen sind. Nicht gemeint ist jedoch die Einsamkeit im Sinne von Alleinsein. Nicht „einsam“ wie beispielsweise Thoreau, der freiwillig ins „Exil“ ging.4Nicht „einsam“ wie der Almhirte oder Waldarbeiter, der dem Gesetz seiner Arbeit folgt. Nicht „einsam“, wie die Protagonisten von Schauerliteratur, die sich in beängstigenden Szenen wie Schlössern oder Spukhäusern wieder finden. Für diese Untersuchung soll der Rückzug in die räumliche Isolation aufgrund von jedweder Orientierungslosigkeit vor der Unverständlichkeit der Welt im Vordergrund stehen. Eine Orientierungslosigkeit, die offenbar stets an Ängste und seelische Überforderungen gekoppelt ist. Natürlich kann diese Thematik auch vor dem Hintergrund der oben genannten Szenerien auftreten; ausgeschlossen werden jedoch alle Bücher, die sich nicht mit der oben beschriebenen Art von Angst beschäftigen.
Da das Gefühl der Orientierungslosigkeit und Unfasslichkeit des Lebens eine übergeordnete Rolle spielen wird, sei an dieser Stelle auf den relativen Charakter dieser Arbeit hingewiesen. Da sie auf der Annahme fußt, dass die Welt stets unerklärbar und absurd bleibt, ergibt sich die Schlussfolgerung, dass jede wirkliche Erkenntnis unmöglich ist. Die folgende Arbeit liefert keine fertigen Antworten, sie vermag lediglich Erschei-nungsformen aufzudecken und einen gegenwärtigen Lebensstil spürbar zu machen.
In der Auseinandersetzung mit der Thematik der vorliegenden Arbeit, eröffneten sich immer wieder zusätzliche Sichtweisen und Beispiele in Literatur und Gesellschaft, dennoch konnten nicht alle diese Teilaspekte aufgrund ihres Umfangs in dieser Arbeit dargestellt werden.
3Die Angst vor der Ich-Aufgabe, Ich-Werdung und die Angst vor Veränderung beziehen sich auf Formulierungen Riemanns in: Riemann, Fritz: Grundformen der Angst. Eine tiefenpsychologische Studie. 36. Aufl. München: Reinhardt 2003. S. 20 ff. S. 59 ff. S. 105 ff.
4Henry David Thorau (1817 - 1862) lebte einige Jahre in einer selbstgebauten Hütte allein am Walden-See, Massachusetts. In seinem Werk „Walden“ beschreibt er unter anderem sein einfaches Leben in der Natur.
Page 5
2. Über die Symbolik der räumlichen Isolation des Menschen in der modernen Literatur
Untersucht anhand: F. Kafkas „Die Verwandlung“, Th. Bernhards „Der Kulterer“,
P. Süskinds „Die Taube“
2.1 Die Soziologie von Alleinsein, Einsamkeit und Isolation
Jeder Mensch ist im Laufe seines Lebens immer mal wieder allein, ja philosophisch betrachtet ist man sogar immer und überall allein. - Jeder kann die Welt nur für sich allein (subjektiv) erfahren. Das Alleinsein ist demzufolge eine Grundtatsache unserer Existenz. Aber auch in einem umgangssprachlicheren Sinne betrachtet, erfahren wir diesen Zustand fortwährend: Man ist nicht immer von anderen Menschen umgeben, was wiederum auch wichtig ist, denn das Alleinsein ermöglicht dem Menschen auch zur Ruhe zu kommen, abzuschalten vom Alltagsleben, von der Arbeit und wird „oft als befriedigend, entspannend und als Bedingung für die eigene Selbstreflexion und Selbstfindung empfunden.“5Alleinsein muss also nichts Negatives sein. Doch Alleinsein ist nicht das Gleiche wie Einsamkeit oder Isolation: Einsam fühlt sich der Mensch erst, wenn wichtige soziale Kontakte nicht oder nicht in ausreichendem Maße existieren, wenn man sich der fehlenden sozialen Kontakte bewusst ist und sie vermisst. Einsamkeit ist auch ein Phänomen, „dessen Grenzen zur Traurigkeit [und] zur Melancholie fließend sind“6und mit dem nicht erfüllten Wunsch nach Geborgenheit beginnt. Sie entsteht, wenn man aus einer kollektiven Gemeinschaft ausgeschlossen ist, oder wenn man sich selbst aus der Gemeinschaft ausschließt. Im Gegensatz dazu bedeutet Isolation, wie Lauster ausführt, dass man zwar die Möglichkeit hat, Kontakt aufzunehmen, man sich aber nicht verstanden fühlt. Trotz möglicher Kommunikation ist man sich seines Andersseins bewusst und betrachtet sich demzufolge als isoliert.7Einsamkeit und Isolation entstehen jedoch immer erst „durch die individuelle Wahrnehmung.“8Lauth und Viebahn weisen darauf hin, dass „erst die fehlende Freiheit zwischen Integration und sozialem Rückzug wählen zu können, [...] die soziale Isolierung zu einem negativen Phänomen [macht].“9
Auch innerhalb einer Gemeinschaft kann man sich also einsam und isoliert fühlen. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Man kann andere Ansichten haben als der soziale Kreis, in welchem man sich befindet oder das eigene Verhalten, der eigene soziale Hintergrund, der bisherige Lebensweg, persönliche Probleme oder das Aussehen entspricht nicht den Vorstellungen der Gemeinschaft. Doch wer für seine Wahrnehmung der Welt, oder für die Art und Weise, wie er sich selbst sieht, häufig von für ihn wichtigen Menschen getadelt wird, neigt leicht dazu, schließlich seinen Sinnen zu misstrauen. Auf diesen Umstand verweist Watzlawick und führt weiter aus:
5Lauth, Gerhard W. / Viebahn, Peter: Soziale Isolierung. Ursachen und Interventionsmöglichkeiten. München / Weinheim: Psychologie-Verl.-Union 1987. S. 4.
6Freudenthal, David: Zeichen der Einsamkeit. Sinnstiftung und Sinnverweigerung im Erzählen von Patrick Süskind. Hamburg: Dr. Kovac 2005. (= Poetica. Schriften zur Literaturwissenschaft Bd. 80). S. 72.
7Lauster, Peter: Stärkung des Ich. Die zweite Geburt der Selbstwerdung. Düsseldorf: Econ 1993. S. 146.8Lauth, Gerhard W. / Viebahn, Peter: Soziale Isolierung. S. 3.9Ebd. S. 4.
Page 6
Da ihm auf diese Weise immer wieder nahe gelegt wird, er habe unrecht, wird es ihm noch schwerer fallen, sich in der Welt und besonders in zwischenmenschlichen Situationen zurechtzufinden [...]. Wer von anderen, die für ihn lebenswichtig sind, dafür verantwortlich gemacht wird, anders zu fühlen, als er fühlen sollte, wird sich schließlich dafür schuldig fühlen, nicht die ‚richtigen’ Gefühle in sich erwecken zu können.10Solche Erlebnisse oder Wahrnehmungen können dem Menschen die Kontaktaufnahme zu anderen erschweren oder gar unmöglich machen. Dann kann es leicht dazu kommen, dass sich entweder die anderen abwenden oder man selbst sich ausschließt.
Phasen solchen inneren und äußeren Rückzugs haben durchaus ihre Berechtigung. So können sie dazu dienen, Kräfte zu sammeln oder das Leben neu zu organisieren. Auf Dauer angelegt besteht jedoch die Gefahr, dass sich Ängste und Unsicherheiten sowie fehlende oder unzureichende soziale Fertigkeiten verstärken. Die Unsicherheit im Umgang mit Menschen wird mit der Zeit immer schwieriger werden, da keine Übungsmöglichkeiten vorhanden sind und man auf eigene Vermutungen zurückgreifen muss, was in dieser oder jener Situation angemessen erscheint. Dies wiederum kann zu Handlungsweisen führen, die von der Gemeinschaft als ungeschickt und linkisch angesehen werden und so die selbst herbeigeführte Isolation nun auch von der Gemeinschaft her bestärkt. Die Isolierten werden dann häufig von der Außenwelt als Sonderlinge oder Außenseiter angesehen.11Toleranz und Anpassung sind hier wichtige Voraussetzungen dafür, dass soziale Kontakte gelingen.