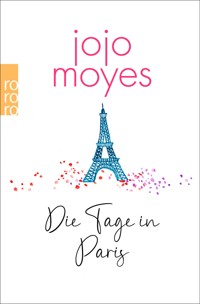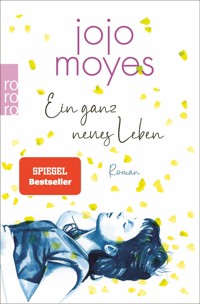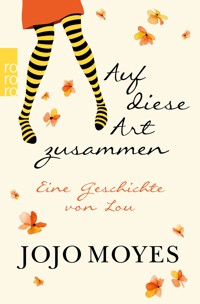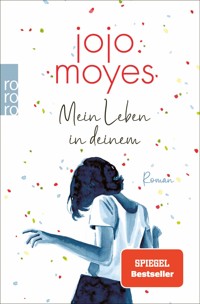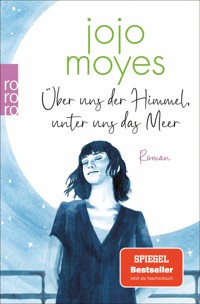
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein berührender Roman über Hoffnung, Schicksal und Liebe – inspiriert von Jojo Moyes' eigener Familiengeschichte. Australien 1946. Sechshundert Frauen machen sich auf eine Reise ins Ungewisse. Ein Flugzeugträger soll sie nach England bringen, dort erwartet die Frauen ihre Zukunft: ihre Verlobten, ihre Ehemänner – englische Soldaten, mit denen sie oft nur wenige Tage verbracht hatten, bevor der Krieg sie wieder trennte. Unter den Frauen ist auch die Krankenschwester Frances. Während die anderen zu Schicksalsgenossinnen werden, ihre Hoffnungen und Ängste miteinander teilen, bleibt sie verschlossen. Nur in Marinesoldat Henry Nicol, der jede Nacht vor ihrer Kabine Wache steht und wie sie Schreckliches erlebt hat im Krieg, findet sie einen Vertrauten. Eines Tages jedoch holt Frances ausgerechnet der Teil ihrer Vergangenheit ein, vor dem sie ans andere Ende der Welt fliehen wollte … Jeder von Jojo Moyes' Romanen eroberte die Spitze der Bestsellerliste. Ihre besondere Mischung aus Leichtigkeit und Tiefe, aus Humor und Dramatik begeistert weltweit Millionen Leser:innen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 657
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Jojo Moyes
Über uns der Himmel, unter uns das Meer
Roman
Über dieses Buch
Über das Meer zu dir
Australien 1946. Sechshundert Frauen machen sich auf eine Reise ins Ungewisse. Ein Flugzeugträger soll sie nach England bringen, dort erwartet die Frauen ihre Zukunft: ihre Verlobten, ihre Ehemänner – englische Soldaten, mit denen sie oft nur wenige Tage verbracht hatten, bevor der Krieg sie wieder trennte. Unter den Frauen ist auch die Krankenschwester Frances. Während die anderen zu Schicksalsgenossinnen werden, ihre Hoffnungen und Ängste miteinander teilen, bleibt sie verschlossen. Nur in Marinesoldat Henry Nicol, der jede Nacht vor ihrer Kabine Wache steht und wie sie Schreckliches erlebt hat im Krieg, findet sie einen Vertrauten. Eines Tages jedoch holt Frances ausgerechnet der Teil ihrer Vergangenheit ein, vor dem sie ans andere Ende der Welt fliehen wollte …
Ein berührender Roman über Hoffnung, Schicksal und Liebe – inspiriert von Jojo Moyes’ eigener Familiengeschichte.
Vita
Jojo Moyes, geboren 1969, hat Journalistik studiert und für die «Sunday Morning Post» in Hongkong und den «Independent» in London gearbeitet. Der Roman «Ein ganzes halbes Jahr» machte sie international zur Bestsellerautorin. Weitere Nr.-1-Romane folgten, zuletzt «Ein ganz neues Leben». Jojo Moyes hat drei erwachsene Kinder und lebt in London.
In «Über uns der Himmel, unter uns das Meer» erzählt Jojo Moyes auch ein Stück eigene Familiengeschichte. Ihre australische Großmutter war eine der Frauen, die diese außergewöhnliche Reise erlebten; sie gehörte zu den Glücklichen, wie Jojo Moyes in ihrem Vorwort schreibt, deren Vertrauen in eine ungewisse Zukunft am anderen Ende der Welt belohnt wurde: In England traf sie ihren schottischen Ehemann wieder – Jojo Moyes’ Großvater.
Katharina Naumann ist Autorin, freie Lektorin und Übersetzerin und lebt in Hamburg. Sie hat unter anderem Werke von Jojo Moyes, Anna McPartlin und Jeanine Cummins übersetzt.
Impressum
Die englische Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel «The Ship of Brides» bei Hodder & Stoughton/An Hachette Livre UK Company, London.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2016
Copyright © 2016 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«The Ship of Brides» Copyright © 2005 by Jojo Moyes
Redaktion Johanna Schwering
Covergestaltung SO YEAH DESIGN, Gabi Braun
Coverabbildung Silke Schmidt
ISBN 978-3-644-49801-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Betty McKee und Jo Staunton-Lambert, für ihren Mut auf sehr unterschiedlichen Reisen
Vorbemerkung der Autorin
1946 startete die Royal Navy die letzte Phase des Transports von Kriegsbräuten, jenen Frauen und Mädchen, die britische Soldaten geheiratet hatten, die in Übersee dienten. Die meisten wurden auf Truppentransportern oder auf speziell dafür bestimmten Linienschiffen nach England gebracht. Aber am 2. Juli 1946 brachen rund 655 australische Kriegsbräute zu einer einzigartigen Reise auf: Sie fuhren über das Meer, um ihre britischen Ehemänner zu treffen – auf der HMSVictorious, einem Flugzeugträger.
Mehr als 1100 Männer – und neunzehn Flugzeuge – begleiteten sie auf der Reise, die fast sechs Wochen dauerte. Mindestens eine wurde zur Witwe, bevor sie ihr Ziel erreichte. Meine Großmutter, Betty McKee, war eine der Glücklichen, deren Vertrauen in die Zukunft belohnt wurde.
Dieser fiktionale Bericht beruht auf dieser Reise, und ich widme ihn ihr und all jenen Bräuten, die mutig genug waren, um an eine ungewisse Zukunft auf der anderen Seite der Welt zu glauben.
Alle den Kapiteln vorangestellten Zitate und Auszüge sind nichtfiktional und gehen zurück auf die Erlebnisse von Kriegsbräuten oder jenen, die auf der Victorious dienten.
Jojo Moyes
Prolog
Indien, 2002
Sie war aufgewacht, weil jemand zeterte. Es klang wie das aufgeregte Gekläff eines kleinen Hündchens, das noch nicht genau weiß, aus welcher Richtung die Gefahr droht. Die alte Frau hob den Kopf vom Fenster, rieb sich den Nacken, wo die Kälte der Klimaanlage tief in ihre Knochen gedrungen war, und versuchte, sich aufzurichten. In den ersten verschwommenen Sekunden des Wachseins wusste sie nicht genau, wo oder wer sie war. Sie nahm Stimmen wahr, dann konnte sie Wörter unterscheiden, die sie aus ihrem traumlosen Schlaf in die Wirklichkeit zerrten.
«Ich sage ja gar nicht, dass ich die Paläste nicht mag. Oder die Tempel. Ich sage nur, dass ich schon zwei Wochen hier bin und nicht das Gefühl habe, das wahre Indien auch nur annähernd kennengelernt zu haben.»
«Was glaubst du denn, was ich bin?» Das kam vom Vordersitz, die Stimme klang leicht spöttisch.
«Du weißt schon, was ich meine.»
«Ich bin Inder. Ram hier ist Inder. Nur weil ich mein halbes Leben in England verbracht habe, bin ich nicht weniger ein Inder als die Inder hier.»
«Ach hör doch auf, Jay, du bist doch nun wirklich nicht typisch.»
«Typisch für was?»
«Ich weiß nicht. Für die Menschen, die hier leben.»
Der junge Mann schüttelte verständnislos den Kopf. «Du willst Elendstourismus betreiben. Du willst nach Hause fahren und deinen Freunden von all den schrecklichen Dingen erzählen können, die du gesehen hast. Ihnen sagen, dass sie keine Ahnung von all dem Leid haben. Und alles, was wir dir geboten haben, ist Coca-Cola und eine Klimaanlage.»
Gelächter. Die alte Frau blinzelte und warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. Es war beinahe halb zwölf: Sie hatte fast eine Stunde geschlafen.
Ihre Enkelin neben ihr beugte sich nach vorn und streckte den Kopf zwischen den Vordersitzen hindurch. «Schau mal, ich will doch nur etwas sehen, das mir zeigt, wie die Menschen hier wirklich leben. Ich meine, die Fremdenführer wollen uns immer nur die Prinzenresidenzen oder die Einkaufszentren zeigen.»
«Also willst du in die Elendsviertel.»
Vom Fahrersitz kam die Stimme von Mister Vaghela: «Ich kann Sie leider nicht mit zu mir nach Hause nehmen, Miss Jennifer. Das wäre nämlich tatsächlich eine Elendsbehausung.»
Als die beiden jungen Leute nicht auf seine Bemerkung eingingen, hob er die Stimme: «Sehen Sie sich Mister Ram B. Vaghela hier genau an, dann finden Sie alles zusammen: die Armen, die Geknechteten und die Vertriebenen.» Er zuckte die Achseln. «Wissen Sie, es ist mir selbst unbegreiflich, wie ich so lange überleben konnte.»
«Wir wundern uns auch fast täglich darüber», warf Sanjay ein.
Die alte Frau setzte sich auf und überprüfte im Rückspiegel ihr Aussehen. Ihre Haare waren auf einer Seite ganz plattgedrückt, und der Kragen hatte eine tiefe rote Delle in ihrer blassen Haut hinterlassen.
Jennifer schaute sich um. «Geht’s dir gut, Großmama?» Das ärmellose Top war verrutscht und entblößte ein kleines Tattoo auf ihrer Hüfte.
«Alles gut, meine Liebe.» Hatte Jennifer ihr eigentlich von diesem Tattoo erzählt? «Es tut mir leid. Ich muss eingenickt sein.»
«Dafür müssen Sie sich nicht entschuldigen», sagte Mister Vaghela. «Wir reiferen Mitbürger sollten uns jederzeit ausruhen dürfen, wenn wir das Bedürfnis danach verspüren.»
«Willst du damit sagen, dass ich fahren soll, Ram?», fragte Sanjay.
«Nein, nein, Mister Sanjay, Sir. Ich würde Ihren brillanten Diskurs nur äußerst ungern unterbrechen.»
Der Blick des alten Mannes fing ihren im Rückspiegel auf. Immer noch benebelt und dünnhäutig vom Schlaf, zwang sie sich zu einem Lächeln. Sie nahm an, dass er ihr zugezwinkert hatte.
Sie mussten schon seit drei Stunden unterwegs sein. Jennifer und sie hatten sich kurzfristig entschlossen, dem dichtgedrängten Reiseplan zu entfliehen. Ihre Fahrt nach Gujarat hatte als Abenteuer begonnen («Die Eltern meines alten Freundes aus dem College, er heißt Sanjay, haben uns für ein paar Nächte eingeladen, Großmama! Sie haben ein wundervolles Haus, fast einen Palast. Und es ist nur ein paar Stunden entfernt!») und fast in einer Katastrophe geendet, weil ihr Flug gestrichen worden war und ihnen jetzt nur noch ein Tag blieb, um ihren Anschlussflug in Bombay zu erreichen.
Die Reise hatte sie ohnehin sehr erschöpft, aber diese Verzögerung hatte sie fast verzweifeln lassen. Indien war eine echte Prüfung für ihre Sinne, und die Vorstellung, in Gujarat gestrandet zu sein, wenn auch innerhalb der palastartigen Räume der Singhs, erfüllte sie mit namenlosem Schrecken. Aber dann hatte Mrs. Singh ihren Wagen und ihren Fahrer zur Verfügung gestellt, um sicherzustellen, dass «die Ladies» es rechtzeitig nach Bombay schafften. Obwohl der Flughafen vierhundert Meilen entfernt lag. «Sie wollen sich wohl eher nicht auf Bahnhöfen aufhalten», hatte sie gesagt und auf Jennifers strahlend blondes Haar gedeutet. «Jedenfalls nicht ohne Begleitung.»
«Ich kann sie fahren», hatte Sanjay angeboten. Aber seine Mutter hatte irgendetwas von Versicherung und Fahrverbot gemurmelt, und ihr Sohn hatte schließlich eingewilligt, Mr. Vaghela zu begleiten, damit sichergestellt war, dass sie nicht belästigt würden, wenn sie irgendwo anhielten. Früher hätte sie sich darüber geärgert, dass man alleinreisenden Frauen nicht zutraute, auf sich selbst aufzupassen, aber jetzt war sie dankbar für diese altmodische Auffassung von Höflichkeit. Sie fühlte sich der Aufgabe, sich durch diese fremden Landschaften zu kämpfen, einfach nicht gewachsen, und sie machte sich ständig um ihre risikofreudige Enkelin Sorgen, die vor nichts Angst zu haben schien. Sie hatte sie mehrfach warnen wollen, sich dann aber zurückgehalten. Die Jungen hatten das Recht, furchtlos zu sein, hatte sie sich ermahnt. Erinnere dich an dich selbst, als du in ihrem Alter warst.
«Alles in Ordnung mit Ihnen, Madam?»
«Mir geht es gut, danke, Sanjay.»
«Wir haben noch eine ordentliche Strecke vor uns, fürchte ich. Es ist keine leichte Fahrt.»
«Es muss ziemlich anstrengend sein, wenn man nur sitzt», murmelte Mr. Vaghela.
«Es ist sehr freundlich von Ihnen, uns zu fahren.»
«Jay! Sieh dir das an!»
Sie hatten die Schnellstraße verlassen und fuhren durch ein Elendsviertel. Überall standen Lagerhallen voller Stahlträger und Holz. Die Straße säumte eine Wand, die aus Metallstücken notdürftig zusammengeschweißt worden war, und die Fahrbahn wurde immer löchriger und zerfurchter. Der schwarze Lexus kroch buchstäblich vorwärts, und sein Motor gab ein leises, ungeduldiges Grollen von sich. Immer wieder musste der Wagen Schlaglöchern oder sogar Kühen ausweichen.
Der Anlass für Jennifers Ausruf war jedoch keine Kuh gewesen (sie hatten bereits viele von ihnen gesehen), sondern ein Berg von weißen Keramikwaschbecken, aus dem die Abflussrohre wie durchschnittene Nabelschnüre hervorragten. Ein paar Meter davon entfernt lag ein Haufen Matratzen und daneben etwas, das wie ein Berg von Operationstischen aussah.
«Können wir mal anhalten?», fragte Jennifer. «Wo sind wir eigentlich?»
Der Fahrer legte seinen knotigen Finger auf einen Punkt der Karte, die neben ihm lag. «Alang.»
Sanjay runzelte die Stirn. «Ich glaube nicht, dass es gut wäre, hier anzuhalten.»
«Lass mich mal die Karte sehen.» Jennifer drängte sich zwischen die beiden Männer nach vorn. «Vielleicht liegt hier irgendetwas abseits der ausgetretenen Pfade. Irgendetwas … Interessantes.»
«Nein …» Sanjay schaute sich um. «Ich glaube, das ist wirklich nicht der richtige Ort …»
Die alte Frau rutschte auf ihrem Sitz herum. Sie sehnte sich nach etwas zu trinken und danach, ihre Beine auszustrecken. Außerdem hätte sie sich über den Besuch einer Toilette gefreut, aber in der kurzen Zeit, die sie in Indien verbracht hatte, hatte sie bereits gelernt, dass das außerhalb der größeren Hotels eher eine Tortur als eine Erleichterung bedeutete.
«Ich sage Ihnen was», sagte Sanjay. «Wir kaufen uns irgendwo ein paar Flaschen Cola und halten außerhalb der Stadt an, wo wir uns die Beine vertreten können.»
«Ist das hier irgendwie eine Art Schrottplatz-Stadt?» Jennifer blinzelte in Richtung eines Haufens von Kühlschränken.
Sanjay gab dem Fahrer ein Zeichen. «Halte hier an, Ram, direkt vor dem Laden. Da, neben dem Tempel. Ich hole ein paar kühle Getränke.»
«Wir holen ein paar kühle Getränke», verbesserte Jennifer. Der Wagen fuhr vor den Laden. «Ist es in Ordnung, wenn du im Wagen wartest, Großmama?» Doch sie wartete die Antwort nicht ab. Die beiden sprangen heraus und gingen lachend auf den Laden zu, der in der brütenden Hitze lag.
Ein paar Meter weiter hockte ein Grüppchen Männer am Straßenrand. Neugierig musterten sie den Wagen. Die alte Frau lauschte dem Brummen des Motors im Leerlauf und hatte plötzlich das Gefühl, sehr auffällig zu sein. Mr. Vaghela wandte sich zu ihr um. «Madam, darf ich Sie fragen – was zahlen Sie Ihrem Fahrer?» Es war die dritte Frage dieser Art, die er ihr stellte, wann immer Sanjay nicht im Wagen war.
«Ich habe keinen.»
«Was? Keine Hilfe?»
«Na ja, ich habe ein Mädchen, das mir hilft», gab sie schließlich zu. «Annette.»
«Hat sie ihre eigene Wohnung?»
Sie dachte an Annettes hübsches Eisenbahner-Häuschen und an die Geranien auf dem Fensterbrett. «Wenn man so will, ja.»
«Bezahlten Urlaub?»
«Ich fürchte, das weiß ich nicht genau.» Sie war drauf und dran, ihm die Arbeitsbeziehung zwischen ihr und Annette zu erklären, aber Mr. Vaghela unterbrach sie.
«Vierzig Jahre arbeite ich nun schon für diese Familie, aber ich habe nur eine Woche bezahlten Urlaub im Jahr. Ich denke darüber nach, eine Gewerkschaft zu gründen, Mammaji. Mein Cousin hat zu Hause Internet. Wir haben uns angeschaut, wie das funktioniert. Dänemark. Das ist ein gutes Land für die Rechte von Arbeitern.» Er wandte sich wieder nach vorn und nickte. «Altersversorgung, Krankenhäuser … Bildung … Wir sollten alle in Dänemark arbeiten.»
Sie schwieg eine Weile. «Ich war noch nie dort», sagte sie schließlich.
Sie beobachtete die beiden jungen Leute, den blonden und den schwarzen Schopf, wie sie sich im Laden bewegten. Jennifer hatte zwar behauptet, dass sie nur Freunde seien, aber vor zwei Nächten hatte sie gehört, wie ihre Enkelin über den gefliesten Flur in die Richtung geschlichen war, in der sie Sanjays Zimmer vermutete. Am nächsten Tag waren sie so verspielt miteinander umgegangen wie Kinder. «Verliebt in ihn?» – Jennifer hatte vollkommen entsetzt auf ihre vorsichtige Frage reagiert. «Gott, nein, Großmama. Jay und ich … oh nein … ich will keine Beziehung, und er weiß das.»
Wieder musste sie daran denken, wie sie selbst in ihrem Alter gewesen war, wie viel Angst sie davor gehabt hatte, mit einem Mann allein zu sein, an ihre Entschlossenheit, niemals zu heiraten, aus unterschiedlichen Gründen.
«Haben Sie schon mal von diesem Ort gehört?» Mr. Vaghela steckte sich ein weiteres Stück Betelnuss in den Mund. Seine Zähne waren schon ganz rot gefärbt.
Sie schüttelte den Kopf. Die Klimaanlage war ausgestellt; sie spürte schon, wie die Temperatur stieg. Ihr Mund war ganz trocken, und sie schluckte mühsam. Sie hatte Jennifer schon oft gesagt, dass sie Cola nicht mochte.
«Alang. Größter Schiffsverschrottungshafen der Welt.»
«Oh.» Sie versuchte, interessiert auszusehen, fühlte sich jedoch immer matter. Sie wollte unbedingt weiter. Das Bombay Hotel, das in unbekannter Entfernung vor ihnen lag, erschien ihr wie eine Oase. Sie schaute auf ihre Armbanduhr: Wie schaffte man es nur, zwanzig Minuten für den Kauf von zwei Flaschen Cola zu brauchen?
«Vierhundert Werften gibt es hier. Und Männer, die einen Tanker in ein paar Monaten in seine Einzelteile zerlegen können.»
«Oh.»
«Hier haben die Arbeiter keine Rechte, wissen Sie. Ein Pfund pro Tag bezahlt man ihnen dafür, dass sie Leib und Leben aufs Spiel setzen.»
«Wirklich?»
«Einige der größten Schiffe der Welt sind hier verschrottet worden. Sie würden nicht glauben, was die Eigentümer alles auf ihren Kreuzern liegen lassen – Tafelservices, irisches Leinen, Musikinstrumente, die ein ganzes Orchester bilden könnten. Alles, was nicht niet- und nagelfest ist, wird verkauft.» Er seufzte. «Manchmal macht einen das ziemlich traurig, Mammaji. So schöne Schiffe, von denen nur noch ein Haufen Metall übrig bleibt.»
«Mr. Vaghela.»
«Ja, Madam?»
«Ist das ein Teehaus?»
Mr. Vaghela folgte mit dem Blick ihrem Finger, der auf ein Lokal zeigte, vor dem einige Stühle und Tische verstreut am staubigen Straßenrand standen. «Ja, das ist es.»
«Wären Sie dann bitte so freundlich, mich dorthin zu begleiten und mir eine Tasse Tee zu bestellen? Ich glaube wirklich nicht, dass ich noch länger auf meine Enkelin warten kann.»
«Es wäre mir ein Vergnügen, Madam.» Er stieg aus dem Wagen und hielt ihr die Tür auf. «Diese jungen Leute, Mammaji, einfach keinen Respekt.» Er bot ihr seinen Arm. Sie stützte sich beim Aussteigen darauf und blinzelte in die Mittagssonne. «Ich habe gehört, in Dänemark ist das ganz anders.»
Die jungen Leute traten aus dem Laden, als der Tee bereits serviert war. Die Tasse war so zerkratzt, als sei sie schon seit Jahren in Gebrauch, aber sie sah sauber aus, und der Mann, der sie bedient hatte, hatte den Tee mit erstaunlichem Brimborium serviert. Sie hatte mit Mr. Vaghelas Übersetzung die unausweichlichen Fragen über ihre Reise beantwortet, bedauert, dass sie nicht mit dem Cousin des Besitzers in Milton Keynes bekannt war, und hatte dann für Mr. Vaghelas Glas Chai (und eine klebrige Pistazienkrokantstange, um bei Kräften zu bleiben, Sie verstehen) bezahlt. Jetzt saß sie unter der Markise und schaute von ihrem leicht erhöhten Plätzchen auf das, was hinter der Stahlwand lag: den endlosen, blau schimmernden Ozean.
In einiger Entfernung stand ein kleiner Hindutempel im Schatten eines Neembaumes. Daneben hatte man ein paar Hütten errichtet, offenbar für die Bedürfnisse der Arbeiter: eine Friseurbude, ein Zigarettenverkäufer, ein Mann, der mit Obst und Eiern handelte, und ein anderer, der Fahrradteile anbot. Es dauerte ein paar Minuten, bis ihr klarwurde, dass sie und ihre Enkelin die einzigen Frauen weit und breit waren.
«Wir haben uns schon gefragt, wo ihr hin seid», riss Jennifer sie aus ihren Gedanken.
«Wohl nicht sehr lange, nehme ich an. Mr. Vaghela und ich haben uns ja nur ein paar Meter vom Wagen entfernt.» Ihr Ton klang schärfer als beabsichtigt.
«Ich habe doch gesagt, dass wir hier lieber nicht anhalten sollten», bemerkte Sanjay und warf erst einen kaum verhohlen misstrauischen Blick auf die Gruppe Männer, die in der Nähe saß, und dann auf das Auto.
«Ich musste mal aussteigen», sagte sie mit fester Stimme. «Mr. Vaghela war so freundlich, mich zu begleiten.» Sie nahm einen Schluck von ihrem Tee, der erstaunlich gut war. «Ich brauchte eine Pause.»
«Natürlich. Ich meinte nur – ich hätte lieber einen malerischeren Ort für Sie gefunden, zumal es der letzte Tag Ihres Urlaubs ist.»
«Hier gefällt es mir recht gut.» Sie fühlte sich schon ein bisschen besser: Eine kaum spürbare Brise, die vom Meer kam, machte die Hitze ein wenig erträglicher. Der Anblick des azurblauen Wassers tat wohl nach den endlosen Meilen auf der Schnellstraße. Aus der Ferne hörte sie das gedämpfte Geräusch von Metall, das auf Metall schlug, und das Kreischen einer Säge.
«Wow! Sieh mal all diese Schiffe!» Jennifer zeigte auf das Ufer, wo ihre Großmutter gerade eben die Rümpfe riesiger Schiffe erkennen konnte, die wie gestrandete Wale auf dem Sand lagen.
Sie kniff die Augen zusammen und ärgerte sich, dass sie ihre Brille im Wagen hatte liegen lassen. «Ist das der Schiffsverschrottungshafen, den Sie erwähnt haben?», fragte sie Mr. Vaghela.
«Vierhundert Schiffe, Madam. Auf zehn Kilometern Strand.»
«Sieht fast aus wie ein Elefantenfriedhof», bemerkte Jennifer und fügte dann bedeutungsschwer hinzu: «Wohin die Schiffe zum Sterben kommen. Soll ich dir deine Brille holen, Großmama?» Sie war hilfsbereit und versöhnlich, als wolle sie ihren langen Aufenthalt in dem Laden wiedergutmachen.
«Das wäre sehr nett.»
Unter anderen Umständen, dachte sie später, hätte der endlose Sandstrand womöglich eine Reisebroschüre geziert. Der blaue Himmel traf am Horizont in einem silbrigen Bogen auf den Ozean, dahinter ragten in der Ferne blaue Berge auf. Aber dank ihrer Brille erkannte sie, dass der Sand grau von Rost und Öl war und dass alle Viertelmeile ein gewaltiges Schiff auf der riesigen Strandfläche lag. Dazwischen häuften sich große undefinierbare Metallstücke, die ausgebauten Innereien defekter Wasserfahrzeuge.
«Nicht gerade die übliche Touristenattraktion», sagte Sanjay.
Jennifer beschattete mit einer Hand ihre Augen und blickte gespannt auf das Geschehen. Ihre Großmutter betrachtete ihre nackten Schultern und fragte sich, ob sie ihr raten sollte, sie zu bedecken.
«Das ist genau das, wovon ich gesprochen habe. Komm, Jay, wir gehen hin und schauen uns das an.»
«Nein, nein, Miss. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist», sagte Mr. Vaghela. «Eine Schiffswerft ist ganz sicher kein Ort für eine Lady.»
«Ich will doch nur schauen, Ram. Ich werde schon nicht das Schweißgerät schwingen.»
«Ich finde, du solltest auf Mr. Vaghela hören, meine Liebe.» Sie stellte ihr Glas im vollen Bewusstsein ab, dass schon ihre Anwesenheit im Teehaus Aufmerksamkeit erregte.
«Mein Gott! Komm, Jay. Es wird ja wohl niemanden stören, wenn wir uns das mal für fünf Minuten anschauen.»
«Da steht ein Wächter am Eingang», gab Sanjay zu bedenken.
«Fünf Minuten.» Jennifer sprang auf, sie hüpfte fast vor Ungeduld. Schon war sie halb über die Straße gegangen.
«Dann gehe ich wohl besser mit», seufzte Sanjay resigniert. «Wir sind gleich wieder da.»
«Junge Leute», sagte Mr. Vaghela erneut und kaute versonnen auf seiner Krokantstange.
Ein riesiger Lastwagen rollte vorbei. Auf seiner Ladefläche lagen verbogene Metallstücke, an denen sich sechs oder sieben Männer festhielten. Es sah gefährlich aus.
Als er vorbei war, sah sie ihre Enkelin mit dem Mann am Tor sprechen. Das Mädchen lächelte und fuhr sich mit der Hand durch ihr blondes Haar. Dann langte sie in ihre Tasche und gab ihm eine Flasche Cola. Als Sanjay sie erreichte, öffnete sich das Tor. Und dann waren sie verschwunden und erschienen ein paar Sekunden darauf als winzige Gestalten am Strand.
Zwanzig Minuten später, als die beiden jungen Leute noch nicht mal mehr in Sicht waren, versuchte sie, ihren Ärger darüber zu unterdrücken, dass ihre Enkelin sich schon wieder so selbstsüchtig und rücksichtslos verhielt. Gleichzeitig fürchtete sie, ihr könnte etwas passieren.
«Ich glaube, wir sollten ihnen hinterhergehen und sie zurückholen», sagte Mr. Vaghela, als könne er ihre Gedanken lesen. «Sie haben eindeutig die Zeit vergessen.»
Sie nahm dankbar seinen Arm. Sein Hemd fühlte sich weich und papieren an, Leinen, das man viele, viele Male gewaschen hatte. Er zog den schwarzen Schirm hervor, den er schon einige Male benutzt hatte, öffnete ihn und hielt ihn so, dass sie in seinem Schatten gehen konnte.
Sie blieben am Tor stehen, Mr. Vaghela sagte etwas zu dem Wächter und zeigte zum Werftgelände. Es klang aggressiv, kampflustig, so als ob der Mann ein Verbrechen begangen hätte, indem er die beiden jungen Leute durchgelassen hatte.
Der Wächter sagte etwas, das offenbar eine Beschwichtigung war, und führte sie hinein.
Die Schiffe waren allesamt alt, vorzeitliche, rostige Kolosse. Winzige Männchen krabbelten wie Ameisen auf ihnen herum, ganz offensichtlich unempfindlich gegen das schrille Geräusch von reißendem Metall und das hochtonige Kreischen der Stahlsägen. Sie waren mit Schweißgeräten, Vorschlaghämmern und Schraubenschlüsseln bewaffnet, und das rhythmische Hämmern ihrer Zerstörungsarbeit hallte trostlos auf dem Platz wider.
An den Rümpfen, die noch in tieferem Wasser lagen, hatte man Seile befestigt, von denen unglaublich zerbrechliche Plattformen herabhingen, auf denen man das Metall zum Ufer beförderte. Am Wasser hob sie unwillkürlich die Hand zum Gesicht, weil es so durchdringend nach ungeklärtem Abwasser und nach etwas Chemischem stank, das sie nicht benennen konnte. Ein paar Meter weiter stiegen aus Feuern dicke Wolken giftigen Rauches in die klare Luft.
«Passen Sie bitte auf, wo Sie hintreten», warnte sie Mr. Vaghela und deutete auf den verfärbten Sand. Um sie herum lagen wüste Haufen rostiger Metallträger und etwas, das aussah wie übergroße Turbinen und zerknautschte Stahlplatten. Riesige, mit Seepocken bedeckte Ketten schlängelten sich darum herum oder lagen in mit Algen bedeckten Rollen wie schlafende Schlangen da. Sie ließen die Arbeiter im Vergleich geradezu zwergenhaft aussehen.
Aber keine Spur von Jennifer.
Sie griff nach Mr. Vaghelas Arm und hielt einen Moment inne, um sich an die Hitze zu gewöhnen. Dann gingen sie langsam hinunter ans Wasser, wo Männer in staubigen Gewändern mit Walkie-Talkies hin- und herliefen und aufgeregt miteinander sprachen.
«Da kommt noch ein Schiff», erklärte Mr. Vaghela und zeigte zum Horizont.
Sie beobachteten etwas, das vermutlich einmal ein alter Tanker gewesen war. Von mehreren Schleppern gezogen, bewegte er sich langsam auf das Ufer zu. Ein japanischer Geländewagen dröhnte vorbei und blieb ein paar hundert Meter weiter mit quietschenden Reifen stehen. In diesem Moment hörten sie die wütenden Stimmen. Als sie um einen riesigen Haufen Gaszylinder bogen, sahen sie eine kleine Gruppe Menschen, die im Schatten eines gewaltigen Metallrumpfes stand. In ihrer Mitte schien es einen Tumult zu geben.
«Madam, wir sollten uns wohl in diese Richtung begeben», schlug Mr. Vaghela vor.
Sie nickte. Plötzlich hatte sie Angst.
Der Mann, dessen ausladender Bierbauch ihn auch ohne sein schickes Auto aus der Menge hätte herausstechen lassen, machte wilde Handbewegungen in Richtung des Schiffes. Er redete so aufgebracht, dass sein Speichel nur so spritzte. Sanjay stand direkt vor ihm. Er hielt die Hände in einer versöhnlichen Geste mit den Handflächen nach unten und versuchte, ihn zu unterbrechen. Jennifer, auf die sich der Zorn des Mannes richtete, stand in der Haltung da, an die sich ihre Großmutter noch aus der Pubertät ihrer Enkelin erinnerte: die Hüften leicht nach vorn gekippt, die Arme schützend vor der Brust verschränkt, den Kopf frech zur Seite geneigt.
«Du kannst ihm sagen», rief sie, «dass ich gar nichts auf seinem verdammten Schiff wollte. Und dass es kein Gesetz gibt, das das Anschauen verbietet.»
Sanjay wandte sich zu ihr um. «Genau das ist das Problem, Jen. Es gibt ein Gesetz, das das Anschauen verbietet. Wenn man nämlich den Grundbesitz eines anderen widerrechtlich betritt.»
«Das hier ist ein Strand», schrie Jennifer den Mann an. «Er ist zehn Kilometer lang. Tausende von Leuten hängen hier herum. Welchen verdammten Unterschied macht es, wenn ich mir hier ein paar verrostete Schiffe anschaue?»
«Jen, bitte …»
Die Männer standen um Sanjay herum und starrten mit unverhohlenem Interesse auf Jennifers Jeans und ihr Tanktop, dabei stießen sie sich gegenseitig in die Rippen. Als sich die alte Frau näherte, wichen einige von ihnen zurück, und sie roch alten Schweiß, Räucherstäbchen und etwas Schwefliges. Sie musste sich zusammenreißen, um nicht die Hand vor den Mund zu legen.
«Er glaubt, dass Jennifer eine Umweltaktivistin ist und hier nach Beweisen gegen ihn sucht», erklärte Sanjay.
«Ich habe doch noch nicht einmal eine Kamera dabei», sagte Jennifer betont deutlich zu dem Mann, der sie finster anschaute.
«Das ist jetzt wirklich keine Hilfe», beschwerte sich Sanjay.
Die alte Frau versuchte einzuschätzen, welche Bedrohung von dem Mann ausging. Seine Handbewegungen waren immer aufgeregter geworden, sein Gesicht hatte sich vor Zorn gerötet. Sie schaute hilfesuchend zu Mr. Vaghela, als ob er der einzige andere Erwachsene in dieser Runde wäre.
Er schien das zu spüren, löste sich von ihr und bahnte sich, plötzlich sehr aufrecht, seinen Weg durch die Menge. Er trat vor den Schiffsverschrotter und hielt ihm seine Hand so hin, dass der gezwungen war, sie zu ergreifen.
«Sir. Ich bin Mr. Ram B. Vaghela», verkündete er.
Die beiden Männer begannen, sich schnell auf Urdu zu unterhalten. Mr. Vaghelas Stimme klang erst bittend und beruhigend, dann entschlossen und bestimmt.
Das Gespräch schien seine Zeit zu brauchen. Ohne Mr. Vaghelas Arm als Stütze fühlte sich die alte Frau etwas wackelig. Sie schaute sich um, suchte nach einer Sitzgelegenheit und zog sich dann ein paar Schritte aus der Menge zurück, wobei sie versuchte, unter den unverfroren neugierigen Blicken der Männer nicht allzu unsicher oder ängstlich zu wirken. Sie entdeckte eine Stahltrommel und ging langsam in die Richtung.
Sie setzte sich darauf und sah zu, wie Mr. Vaghela und Sanjay versuchten, den Schiffseigentümer zu beruhigen, ihn von der Naivität und Unschuld der Besucher zu überzeugen. Hin und wieder winkten sie ihr zu. Sie fächelte sich unter ihrem Schirm mit der Hand Luft zu, wohl wissend, dass die Anwesenheit einer offensichtlich gebrechlichen alten Dame sicher nicht schadete. Nach außen wirkte sie harmlos, aber innerlich kochte sie vor Wut. Jennifer hatte sich bewusst über die Wünsche aller anderen hinweggesetzt und die Reise jetzt um mindestens eine Stunde verzögert. Schiffswerften waren gefährliche Orte, hatte Mr. Vaghela gemurmelt, als sie über den Strand gegangen waren, nicht nur für die Arbeiter, sondern auch für diejenigen, die die Arbeit «störten». Er habe von Fällen gehört, in denen man das Eigentum der Eindringlinge konfisziert hatte. Dabei hatte er sich nervös zum Wagen umgeschaut.
Jetzt dachte sie über die Tatsache nach, dass sie die ganze Strecke über den heißen Sand würde zurückgehen müssen und dass es vollkommen im Bereich des Möglichen lag, dass sie diesen Leuten auch noch Geld geben mussten, damit sie überhaupt gehen konnten. Das würde ihr ohnehin schon so gut wie erschöpftes Budget noch weiter strapazieren.
«Dummes, rücksichtsloses Mädchen», murmelte sie.
Sie stand auf und versuchte, dabei gelassen zu wirken. Sie ging zum Bug des Schiffes, um einen möglichst großen Abstand zwischen sich und ihre verantwortungslose Enkelin und die Männer mit den leeren Blicken zu legen.
Sie hielt sich den Schirm dicht über den Kopf. Auf der Suche nach ein wenig Schatten ging sie weiter, mit jedem ihrer Schritte wirbelte sie eine Staubwolke auf. Das Schiff war bereits halb zerlegt, und der Rumpf endete so jäh, als hätte ihn die Hand eines Riesen in zwei Teile gehackt und den hinteren Teil weggenommen. Sie hob den Schirm, um besser sehen zu können. Von hier unten war wenig zu erkennen, aber sie machte ein paar Geschütztürme aus, die man noch nicht abgebaut hatte. Sie betrachtete sie und runzelte die Stirn. Die Oberflächen waren in dem zarten Blassgrau britischer Kriegsschiffe gestrichen. Nach einer Weile senkte sie den Schirm, trat zurück und starrte hinauf zu dem zerbrochenen Rumpf, der über ihr emporragte. Dabei vergaß sie sogar ihren steifen Nacken.
Sie hob die Hand, um die Augen vor der erbarmungslosen Sonne zu schützen, bis sie erkennen konnte, was von dem Namen am Schiffsrumpf übrig geblieben war.
Dann, als sie den letzten Buchstaben entziffert hatte, verstummten die streitenden Stimmen, und trotz der drückenden Hitze des indischen Nachmittags fühlte die alte Frau unter dem Schiff plötzlich, wie eine Eiseskälte von ihr Besitz ergriff.
Der Schiffsverschrotter, Mr. Bhattacharya, schien noch längst nicht überzeugt zu sein, aber obwohl er immer feindseliger wirkte, die Menge immer unruhiger wurde und sie inzwischen schon mehr als eine Stunde verloren hatten, zankten die beiden jungen Leute immer noch.
Mr. Vaghela wischte sich die Stirn mit einem Taschentuch. Miss Jennifer trat wütend und beleidigt mit dem Fuß in den Sand, schien sich aber fügen zu wollen. Mr. Sanjays Gesicht war gerötet, er sah aus wie jemand, der die unangenehme Aufgabe hatte, jemanden zu verteidigen, der eindeutig im Unrecht war.
Schließlich trat Mr. Sanjay zu dem Mädchen. «Jen. Geh zurück zum Wagen und nimm deine Großmutter mit. Wir regeln das hier schon.»
«Sag mir nicht, was ich zu tun habe, Jay. Ich brauche wirklich keinen …» Miss Jennifer hielt jäh inne.
Plötzlich herrschte Stille, und Mr. Vaghela folgte dem Blick der Menge, der auf eine schattige Stelle unter dem Rumpf des benachbarten Schiffes gerichtet war.
«Was ist mit der alten Frau los?», fragte Mr. Bhattacharya.
Sie saß vornübergebeugt da, den Kopf auf die Hände gestützt. Ihr graues Haar wirkte in der Sonne silbrig weiß.
«Großmama?» Das Mädchen rannte zu ihr hinüber.
Die alte Frau hob den Kopf, und Mr. Vaghela atmete erleichtert aus. Er musste zugeben, dass ihre Haltung ihm Angst eingejagt hatte.
«Geht es dir gut?»
«Ja. Ja, meine Liebe.» Es klang mechanisch, fand Mr. Vaghela. Mr. Sanjay und er ließen Mr. Bhattacharya stehen, gingen zu ihr und hockten sich vor sie hin.
«Sie sehen recht blass aus, Mammaji, wenn ich das so sagen darf.» Sie hatte eine Hand auf das Schiff gelegt. Dafür musste sie sich merkwürdig zur Seite beugen.
Der Schiffsverschrotter stand jetzt neben ihnen und säuberte seine teuren Krokodillederschuhe an seinen Hosenbeinen. Er flüsterte Mr. Vaghela etwas zu. «Er fragt, ob Sie etwas zu trinken möchten», übersetzte er. «Er hat Eiswasser in seinem Büro.»
«Ich will nicht, dass sie hier auf meiner Werft einen Herzanfall bekommt», sagte Mr. Bhattacharya. «Gebt ihr Wasser und bringt sie dann fort von hier.»
«Möchten Sie etwas Eiswasser?»
Es sah so aus, als wollte sie sich aufrichten, aber stattdessen hob sie nur kraftlos die Hand. «Das ist sehr freundlich, aber ich möchte hier nur ein bisschen sitzen bleiben.»
«Großmama? Was ist los?» Jennifer hatte sich neben sie gehockt und ihr die Hände auf die Knie gelegt. Ihre Augen waren vor Sorge geweitet. Die zur Schau gestellte Arroganz hatte sich verflüchtigt. Hinter ihnen murmelten die jungen Männer und rempelten sich gegenseitig an, um das Schauspiel zu sehen.
«Bitte sag ihnen, dass sie gehen sollen, Jen», flüsterte die alte Frau. «Wirklich. Es ist alles in Ordnung, wenn man mich nur in Ruhe lässt.»
«Ist es meine Schuld? Es tut mir so leid, Großmama. Ich weiß, dass ich furchtbar nervig sein kann. Mir hat nur die Art nicht gefallen, wie er mit mir gesprochen hat. Nur weil ich eine Frau bin, weißt du? Das regt mich so auf.»
«Es ist nicht deine Schuld …»
«Es tut mir leid. Ich hätte rücksichtsvoller sein sollen. Komm, wir bringen dich zurück ins Auto.»
Mr. Vaghela freute sich, ihre Entschuldigung zu hören. Es war gut zu wissen, dass die jungen Leute ihr verantwortungsloses Betragen noch zugeben konnten. Sie hätte niemals zulassen dürfen, dass die alte Frau einen so langen Weg in der Hitze gehen musste, noch dazu an einem Ort wie diesem. Das war einfach respektlos.
«Es ist nicht deine Schuld, Jennifer.» Die Stimme der alten Frau klang gepresst. «Es ist das Schiff», flüsterte sie.
Verständnislos folgten sie ihrem Blick zu der riesigen Fläche blassgrauen Metalls, den enormen rostigen Nieten, die sich über die gesamte Seite nach oben reihten.
«Das ist doch nur ein Schiff, Großmama», sagte Jennifer.
«Nein», widersprach sie, und Mr. Vaghela bemerkte, dass ihr Gesicht so bleich war wie das Metall, vor dem sie kauerte. «Da liegst du vollkommen falsch.»
Teil eins
Investieren Sie in Kaninchen! Kürzlich brachte der Verkauf der besten ausgewachsenen Rammler 19 Schilling, 11 Pence das Pfund, den höchsten Preis, von dem ich in Australien je gehört habe.Landwirtschaftskolumne «The Man on the Land», The Bulletin, Sydney, 10. Juli 1946
Kapitel 1
Australien, 1946
Vier Wochen vor Abfahrt
Letty McHugh stoppte den Pick-up, blickte in den Rückspiegel und sah, dass ein Lippenstift in der Farbe Kirschblüte bei einer Frau mit «markanten Gesichtszügen», wie die Verkäuferin sie taktvoll genannt hatte, auch nicht viel ausrichten konnte. Sie wischte sich die Lippen ab und ärgerte sich, dass sie den teuren Lippenstift überhaupt gekauft hatte. Kaum eine Minute später griff sie in ihre Tasche, trug ihn erneut auf und schnitt Grimassen vor dem Spiegel.
Sie strich sich die Bluse glatt, nahm den Stapel Briefe, den sie bei ihrem wöchentlichen Besuch von der Post abgeholt hatte, und spähte durch die Windschutzscheibe hinaus. Es würde sicher nicht aufhören zu regnen, egal wie lange sie wartete. Sie atmete einmal tief durch, sprang aus dem Wagen und rannte zum Haus.
«Margaret? Maggie?»
Letty trat die Füße ab und ging in die Küche.
«Maggie? Bist du da?»
Wie fast immer, seit Noreen nicht mehr da war, war die Küche leer. Letty legte ihre Handtasche und die Briefe auf den geschrubbten Holztisch und trat zum Herd, auf dem ein Eintopf köchelte. Sie hob den Deckel und schnupperte. Dann griff sie mit schlechtem Gewissen in die Schublade und gab eine Prise Salz hinzu, etwas Kreuzkümmel und Maismehl, rührte um und legte den Deckel wieder auf den Topf.
Sie ging zu dem kleinen angelaufenen Spiegel neben dem Medizinschränkchen und versuchte, ihre Haare zu glätten, die sich in der feuchten Luft zu kräuseln begonnen hatten. Sie konnte nur Teile ihres Gesichts erkennen; Eitelkeit konnte man der Familie Donleavy sicher nicht vorwerfen.
Mit einem Taschentuch wischte sie sich erneut über die Lippen, dann ging sie zurück in die Küche. Sie musterte das Linoleum, das an einigen Stellen gebrochen war. Der Schmutz von den Äckern war so tief darin eingedrungen, dass man ihn nicht mehr entfernen konnte, egal wie oft man den Boden wischte und fegte. Ihre Schwester hatte neues Linoleum verlegen wollen, sie hatte Letty sogar ein Muster gezeigt, das ihr gefiel, in einem Buch, das extra aus Perth geschickt worden war.
Sie betrachtete die verblichene Farbe an der Wand, die Hundekörbe mit den alten schmuddeligen Decken darin, die neben der Tür aufgereiht standen, und das Paket Wäschestärke für die Männerhemden, aus dem Körner auf die gebleichte Arbeitsplatte gerieselt waren.
Der einzige Hinweis auf die Anwesenheit einer Frau in diesem Haushalt war ein Exemplar der Zeitschrift Glamour, auf dessen Titelseite ein Artikel mit der Überschrift «Würden Sie einen Ausländer heiraten?» angekündigt wurde. Die Seiten waren offenbar häufig durchgeblättert worden.
«Margaret?»
Ein Blick auf die Uhr zeigte ihr, dass die Männer gleich zum Mittagessen kommen würden. Sie ging zur Garderobe an der Hintertür und nahm eine alte Farmarbeiterjacke vom Haken. Sie schauderte, als ihr der Geruch von Teer und nassem Hund in die Nase stieg.
Der Regen fiel jetzt so heftig, dass sich an einigen Stellen des Hofes wahre Bäche gebildet hatten. Die Gullys gurgelten protestierend, und die Hühner hockten zerzaust in Grüppchen unter den Büschen. Letty ärgerte sich, dass sie ihre Gummistiefel zu Hause gelassen hatte, und rannte von der Hintertür über den Hof und um die Scheune herum. Auf der Weide machte sie einen braunen Klumpen in Ölkleidung auf einem Pferd aus. Das Gesicht unter dem breitkrempigen Hut, der bis auf den Kragen reichte, war nicht zu erkennen. Die Gestalt glänzte tropfnass.
«Margaret!» Letty stand unter dem Dachvorsprung der Scheune und musste schreien, um das Rauschen des Regens zu übertönen. Das Pferd hatte eindeutig genug: Sein Schwanz klebte an den nassen Hinterläufen, es setzte vorsichtig einen Huf vor den anderen und bewegte sich seitwärts um das Gatter herum, hin und wieder blieb es stehen und scharrte frustriert mit den Hufen, aber seine Reiterin befahl ihm jedes Mal wieder, zu wenden und das Manöver von neuem zu beginnen.
«Maggie!»
Plötzlich scheute das Pferd. Lettys Herz setzte einen Schlag aus, und sie schlug die Hand vor den Mund. Aber die Reiterin saß noch immer fest im Sattel und schien nicht im Geringsten beeindruckt. Sie stieß dem Tier die Stiefel in die Flanken und murmelte etwas, das ein Tadel sein mochte – oder auch nicht.
«Um Gottes willen, Maggie, jetzt komm endlich hier herüber!»
Die Hutkrempe hob sich, und eine Hand winkte grüßend. Das Pferd wurde gewendet und trabte mit gesenktem Kopf zum Tor. «Stehst du schon lange da, Letty?», rief Margaret.
«Bist du verrückt geworden, Mädchen? Was um Himmels willen tust du da eigentlich?» Sie sah, dass ihre Nichte unter der Hutkrempe breit grinste.
«Ich reite sie zu. Dad ist zu groß, um sie zu reiten, und die Jungs machen nur Unsinn mit ihr, also muss ich es tun. Eine launische junge Dame, nicht wahr?»
Letty schüttelte den Kopf und bedeutete Maggie abzusitzen.
«Ist es schon Mittagszeit? Ich habe einen Eintopf aufgesetzt, aber ich weiß nicht, wann die Männer reinkommen. Sie treiben die Kälber zum Yarrawa-Bach, und es kann sein, dass sie den ganzen Tag dort bleiben.»
«Bei dem Wetter bestimmt nicht», entgegnete Letty, während sich Margaret unelegant vom Pferd gleiten ließ und schwer auf den Füßen landete. «Es sei denn, sie sind genauso verrückt wie du. Du bist ja vollkommen durchnässt. Sieh dich doch mal an! Grundgütiger, Maggie, ich weiß wirklich nicht, was du dir dabei gedacht hast … Bei diesem Wetter! Gott allein weiß, was deine liebe Mutter dazu gesagt hätte.»
Margaret krauste die Nase und machte sich daran, das Pferd abzusatteln.
Letty fragte sich, ob sie zu viel gesagt hatte. «Ich wollte nicht …»
«Schon gut. Du hast ja recht, Letty», sagte das Mädchen und klemmte sich den Sattel unter den Arm. «Sie hätte die Stute nicht im Kreis herumgeritten, um sie auszubalancieren. Sie hätte ihr Schlaufzügel angelegt, und das wär’s dann gewesen.»
Die Männer kamen kurz vor ein Uhr zurück, ein lärmender Haufen aus nassen Überschuhen und tropfenden Hüten. Sie ließen ihre Mäntel an der Tür zurück. Margaret hatte den Tisch gedeckt und stellte dampfende Schüsseln mit Rindfleischeintopf auf den Tisch.
«Colm, du hast immer noch Dreck hinten an deinen Stiefeln», bemerkte Letty, und der junge Mann zog die Stiefel auf der Matte aus, statt Zeit mit ihrer Reinigung zu verschwenden.
«Gibt es auch Brot dazu?»
«Nun wartet doch mal ab, Jungs. Ich mach schon so schnell ich kann.»
«Maggie, deine Hündin schläft in Dads altem Hut», sagte Daniel und grinste. «Dad sagt, wenn er Flöhe von ihr bekommt, erschießt er sie.»
«Das hab ich nie gesagt, du Spaßvogel. Wie geht es dir, Letty? Bist du gestern in der Stadt gewesen?» Murray Donleavy, ein riesiger, kantiger Kerl, dessen Sommersprossen und blasse Augen seine irische Abstammung erahnen ließen, setzte sich an den Kopf der Tafel und fing an, sich genüsslich die dicke Scheibe Brot einzuverleiben, die ihm seine Schwägerin abgeschnitten hatte.
«Bin ich, Murray.»
«Hast du Post für uns mitgebracht?»
«Ja, ich gebe sie euch nach dem Essen.» So, wie diese Männer sich bei Tisch benahmen, würden die Briefe sonst mit Suppe bekleckert und mit fettigen Fingern betatscht werden. Noreen schien das egal gewesen zu sein.
Sie seufzte und versuchte, jetzt nicht an ihre Schwester zu denken, wie sie es jeden Tag unzählige Male tat. Dann sagte sie in heiterem Ton: «Alf Pettits Frau hat einen von diesen neuen Defender-Kühlschränken gekauft. Er hat vier Fächer und einen Eiswürfelbereiter, und er ist vollkommen geräuschlos.»
«Im Gegensatz zu Alf Pettits Frau», bemerkte Murray. Er hatte die neueste Ausgabe des Bulletin zu sich herangezogen und sich in die Landwirtschaftskolumne vertieft. «Hm. Hier schreiben sie, dass die Milchhöfe schmutziger werden, weil die Frauen alle kündigen.»
«Dann haben sie noch nie einen Blick in Maggies Zimmer geworfen.»
«Hast du das gekocht?» Murray schaute von seiner Zeitung auf und wies mit dem Daumen auf die Schüssel, die fast leer war.
«Nein, das hat Maggie gemacht», antwortete Letty.
«Lecker. Besser als der letzte.»
«Versteh ich nicht», sagte Margaret. «Ich habe nichts anders gemacht als sonst.»
«Da läuft ein neuer Film im Odeon an», sagte Letty, um das Thema zu wechseln. Jetzt hatte sie ihre Aufmerksamkeit. Sie wusste, dass die Männer so taten, als hätten sie kein Interesse am Klatsch, den sie ihnen zweimal die Woche erzählte, weil sie das für Weiberkram hielten, aber von Zeit zu Zeit ließen sie die zur Schau getragene Maske der Gleichgültigkeit fallen. Sie lehnte sich gegen das Waschbecken und verschränkte die Arme vor der Brust.
«Und?»
«Es ist ein Kriegsfilm. Greer Garson und Tyrone Power. Ich hab den Titel vergessen. Irgendwas mit Für immer darin.»
«Hoffentlich mit ganz vielen Kampfflugzeugen. Amerikanischen.» Daniel schaute Zustimmung heischend zu seinen Brüdern, aber die hielten die Köpfe gesenkt und schaufelten den Eintopf in sich hinein.
«Wie willst du denn nach Woodside kommen, du Zwerg? Dein Fahrrad ist kaputt, wenn du dich erinnerst.» Liam knuffte ihn.
«Er fährt sowieso nicht allein den ganzen Weg dorthin», sagte Murray.
«Einer von euch kann mich doch im Truck mitnehmen. Ach kommt schon. Ich geb euch auch ein Eis aus.»
«Wie viele Kaninchen hast du diese Woche verkauft?»
Daniel verdiente sich etwas dazu, indem er Kaninchen häutete und die Felle verkaufte. Der Preis war unerklärlicherweise von einem Penny pro Stück auf mehrere Shilling gestiegen. Seine Brüder waren deshalb ein wenig neidisch auf seinen plötzlichen Reichtum.
«Nur vier.»
«Na, dann ist das der Preis dafür.»
«Oh, Murray, Betty hat mir gesagt, dass ihre gute Stute endlich trächtig ist, falls du noch Interesse hast.»
«Die, die sie zu dem Zauberer gebracht haben?»
«Ich glaube schon.»
Murray wechselte einen Blick mit seinem ältesten Sohn. «Vielleicht gehe ich dort im Laufe der Woche mal vorbei, Colm. Wäre gut, hier ein anständiges Pferd zu haben.»
«Dabei fällt mir ein.» Letty atmete tief durch. «Ich habe gesehen, dass Margaret auf deiner störrischen Jungstute geritten ist. Ich finde nicht, dass sie reiten sollte. Es … ist nicht sicher.»
Murray ließ sich nicht von seinem Eintopf ablenken. «Sie ist erwachsen, Letty. Bald haben wir ihr sowieso nichts mehr zu sagen.»
«Letty, jetzt hab dich nicht so. Ich weiß schon, was ich tue», mischte sich Margaret ein.
Letty machte sich an den Abwasch. «Ich sag ja nur, dass Noreen das sicher nicht gut gefunden hätte. In deinem Zustand!»
Eine kurze, bedrückte Pause entstand, als sie den Namen ihrer Schwester erwähnte.
Murray schob seine leere Schüssel in die Mitte des Tisches. «Es ist schön, dass du dich um uns sorgst, Letty. Denk nicht, dass wir nicht dankbar wären.»
Wenn die Kinder den Blick bemerkten, den die beiden «Alten», wie sie sie nannten, miteinander wechselten, oder wenn sie die sanfte Röte sahen, die Lettys Wangen überzog, so sagten sie nichts. Ebenso wenig, wie sie etwas gesagt hatten, als sie vor ein paar Monaten begonnen hatte, ihren guten Rock für die Besuche bei ihnen zu tragen. Oder dass sie sich neuerdings, obwohl schon Mitte vierzig, die Haare legen ließ.
Margaret war inzwischen aufgestanden und blätterte durch die Briefe, die auf der Kommode neben Lettys Handtasche lagen. «Verdammte Scheiße!», rief sie.
«Margaret!»
«Tut mir leid, Letty. Schau mal! Dad, schau mal, das ist für mich! Von der Marine.»
Ihr Vater gab ihr ein Zeichen, damit sie ihm den Brief zeigte. Er wendete den Umschlag in seinen breiten Händen, betrachtete den offiziellen Stempel und den Absender. «Soll ich ihn öffnen?»
«Er ist doch nicht tot, oder?», rief Daniel und fing sich von Colm einen harten Schlag auf den Hinterkopf ein.
«Was?» Margaret suchte Halt, um nicht zu schwanken, und die sonst so rosige Farbe wich aus ihrem Gesicht.
«Natürlich ist er nicht tot», sagte ihr Vater. «Dann hätten sie dir ein Telegramm geschickt.»
«Vielleicht wollten sie das Geld sparen …» Daniel wich zurück, um einem heftigen Tritt von seinem älteren Bruder auszuweichen.
«Ich wollte damit warten, bis ihr alle aufgegessen habt», bemerkte Letty, aber niemand hörte auf sie.
«Na los, Maggie. Worauf wartest du?», fragte Colm.
«Ich weiß nicht», sagte das Mädchen und blickte unsicher von einem zum anderen.
«Nun mach schon, wir sind doch alle da.» Ihr Vater legte ihr tröstend die Hand auf den Rücken.
Sie warf ihm einen Blick zu und schaute dann auf den Brief herunter, den sie jetzt in der Hand hielt. Ihre Brüder waren aufgestanden und hatten einen engen Kreis um sie gebildet. Letty, die vom Waschbecken aus zusah, fühlte sich so überflüssig, als wäre sie eine Fremde. Um ihr Unbehagen zu überspielen, nahm sie eine Pfanne und schrubbte sie heftig. Ihre Finger röteten sich im heißen Wasser.
Margaret riss den Brief auf und begann zu lesen, dabei murmelte sie vor sich hin, wie sie es schon als Kind getan hatte. Dann stöhnte sie leise, und Letty wirbelte herum. Margaret hatte sich schwer auf einen Stuhl fallen lassen, den einer ihrer Brüder ihr hingestellt hatte. Sie sah ihren Vater voller Trauer an.
«Geht’s dir gut, Mädchen?» Sein Gesicht war voller Angst.
«Ich gehe, Dad», krächzte sie. «Sie haben einen Platz für mich auf einem Schiff. Oh mein Gott, Dad.»
«Margaret!», mahnte Letty, aber niemand hörte sie.
«Maggie geht nach England!» Niall hatte sich den Brief geschnappt. «‹Aufgrund der Änderung der Umstände einer anderen Kriegsbraut können wir Ihnen eine Überfahrt auf der …› Wie spricht man das aus? … ‹wird von Sydney aus in See stechen›, bla, bla, bla.»
«Änderung der Umstände? Was ist wohl mit der armen Seele passiert?», spottete Colm.
«Es kann sein, dass der Ehemann bereits verheiratet war. Das kommt manchmal vor, wisst ihr.»
«Letty!», protestierte Murray.
«Ist doch so, Murray. Da ist schon alles Mögliche passiert. Du musst nur mal in die Zeitung schauen. Ich habe von Mädchen gehört, die den ganzen Weg nach Amerika auf sich genommen haben, nur um zu hören, dass man sie dort gar nicht will. Einige waren sogar schon …» Sie beendete den Satz nicht.
«Joe ist nicht so», sagte Murray. «Wir wissen alle, dass er nicht so ist.»
«Außerdem», sagte Colm fröhlich, «habe ich ihm auf der Hochzeit gesagt, dass ich ihn kriege und umbringe, wenn er Maggie jemals hängenlassen sollte.»
«Ach, du auch?», fragte Niall überrascht.
«Mein Gott», sagte Margaret und bekreuzigte sich in stummer Abbitte. «Wenn ihr so auf mich aufpasst, ist es ein Wunder, dass er es überhaupt mit mir ausgehalten hat.»
Langsam drang die Bedeutung des Briefes in das Bewusstsein der Anwesenden. Alle schwiegen. Margaret nahm die Hand ihres Vaters und drückte sie. Die anderen taten so, als sähen sie es nicht.
«Möchte noch jemand Tee?», fragte Letty. Sie hatte einen Kloß im Hals bei der Vorstellung, dass Margaret bald nicht mehr mit ihnen in dieser Küche sitzen würde. Zustimmendes Murmeln erklang.
«Es ist noch gar nicht raus, ob du eine Kabine bekommst, denk dran», sagte Niall.
«Sie könnten sie im Gepäckraum unterbringen», wandte Liam ein. «Sie ist zäh wie Leder.»
«War’s das dann?», fragte Daniel, der, wie Letty bemerkte, zutiefst erschüttert war. «Ich meine, du gehst einfach so nach England, und das war’s dann?»
«Das war’s dann», erwiderte Margaret leise.
«Aber was ist mit uns?», setzte Daniel mit brüchiger Stimme nach, als hätte er die Hochzeit seiner Schwester und ihre möglichen Folgen noch immer nicht begriffen. «Wir können doch nicht Mum und Maggie verlieren. Ich meine, was soll dann aus uns werden?»
Letty wollte etwas sagen, aber sie fand keine Worte.
Murray hatte schweigend am Küchentisch gesessen und die Hand seiner Tochter gehalten. Jetzt sagte er: «Wir, mein Sohn, sollten uns für sie freuen.»
«Was?»
Murray schenkte seiner Tochter ein Lächeln, das wohl beruhigend wirken sollte. «Wir werden uns für sie freuen, weil Margaret mit einem guten Mann zusammen sein wird. Mit einem Mann, der für sein Land und für uns gekämpft hat. Einem Mann, der es verdient, mit unserer Margaret zusammen zu sein, ebenso wie sie ihn verdient.»
«Oh, Dad.» Margaret tupfte sich die Tränen ab.
«Und was noch wichtiger ist», er hob die Stimme, als ob er jeden Einwand im Keim ersticken wollte, «wir sollten ganz besonders froh sein, weil Joes Großvater Ire war. Und das bedeutet …» – er legte zärtlich seine schwielige Hand auf den geschwollenen Leib seiner Tochter – «… dieser kleine Kerl hier wird mit Gottes Hilfe seinen Fuß auf Gottes eigenes Land setzen.»
«Oh, Murray», flüsterte Letty ergriffen.
«Nehmt euch in Acht, Jungs», wisperte Colm seinen Brüdern zu, «jetzt singt er wieder den ganzen Abend lang irische Volkslieder.»
Sie hatten keinen Platz mehr für all die nasse Wäsche. Der Trockenraum war schon so vollgehängt, dass die schwere Wäsche die Decke herunterzureißen drohte; feuchtes Leinen hing an allen erreichbaren Haken, an jedem Kabel und über den halboffenen Türen. Margaret zerrte ein weiteres nasses Unterhemd aus dem Eimer und gab es ihrer Tante, die es durch die Mangel drehte.
«Gestern ist einfach gar nichts trocken geworden», sagte Margaret. «Ich habe das Zeug nicht rechtzeitig von der Leine nehmen können, deshalb ist es noch einmal nass geworden, dabei war ich noch gar nicht mit allem fertig.»
«Setz dich doch mal kurz hin, Maggie», bot Letty mit einem Blick auf Margarets Beine an. «Leg ein paar Minuten die Füße hoch.»
Margaret ließ sich dankbar auf den Stuhl in der Waschküche sinken und streichelte ihren Terrier, der neben ihr saß. «Ich könnte noch was im Badezimmer aufhängen, aber Dad kann das nicht leiden.»
«Jetzt ruh dich erst einmal aus. Die meisten Frauen arbeiten in deinem Zustand nicht mehr so hart.»
Margaret winkte ab. «Ach, das ist doch noch ewig hin.»
«Kaum zwölf Wochen, nach meiner Rechnung.»
«Die Frauen in Afrika werfen ihre Kinder einfach hinter einem Busch und arbeiten dann weiter.»
«Du bist aber keine Afrikanerin. Und ich bezweifle, dass irgendeine Frau ihr Kind ‹wirft›, ich muss doch …» Letty rief sich in Erinnerung, dass sie vom Kinderkriegen nun wirklich keine Ahnung hatte. Also sagte sie nichts mehr, sondern wrang schweigend weiter Wäsche aus. Der Regen trommelte geräuschvoll auf das Blechdach des kleinen Waschküchenhäuschens, und der süße Geruch frischer feuchter Erde drang durch die offenen Fenster hinein.
«Daniel hat es schlechter aufgenommen, als ich dachte», bemerkte Margaret schließlich.
Letty kurbelte weiter. Sie ächzte, als sie die Kurbel zu sich heranzog. «Er ist noch jung. Er musste mit vielem fertig werden in den letzten Jahren.»
«Aber er ist richtig wütend. Ich hätte nicht gedacht, dass es ihn so wütend machen würde.»
Letty dachte nach. «Er fühlt sich im Stich gelassen, nehme ich an. Erst seine Mum und dann du …»
«Es ist ja nicht so, dass ich das mit Absicht täte.» Margaret erinnerte sich an den Ausbruch ihres Bruders, an die Worte «selbstsüchtig» und «gemein», die er ihr zornig an den Kopf geworfen hatte, bis die Handfläche ihres Vaters die Tirade abrupt beendete.
«Ich weiß», erwiderte Letty, die innehielt und sich aufrichtete. «Und deine Brüder wissen es auch. Sogar Daniel.»
«Als Joe und ich heirateten, habe ich gar nicht darüber nachgedacht, was es bedeutet, Dad und die Jungs zu verlassen. Ich dachte, es macht ihnen nichts aus.»
«Natürlich macht es ihnen etwas aus. Sie lieben dich.»
«Als Niall fortging, war es ihnen auch egal.»
«Das war der Krieg. Ihr wusstet, dass er gehen musste.»
«Aber wer kümmert sich jetzt um sie alle? Dad kriegt es gerade mal hin, den Abwasch zu machen, wenn er muss, aber keiner von ihnen kann kochen. Und sie werden so lange in derselben Bettwäsche schlafen, bis sie von selbst zum Wäschekorb läuft.»
Margaret begann beinahe selbst daran zu glauben, dass der Haushalt ohne sie vollkommen zusammenbrechen würde. Zwei Jahre lang hatte sie ihn führen müssen, und sie hatte es mit stillem Groll getan. Sie hatte sich früher nicht vorstellen können, jemals für jemanden kochen und putzen zu müssen. Sogar Joe hatte es verstanden, als sie ihm gestand, dass sie in diesen Dingen ein hoffnungsloser Fall war und, noch wichtiger, auch nichts daran ändern wollte. Jetzt, da sie gezwungen war, sich jeden Tag um ihre Brüder zu kümmern, die sie vorher immer als gleichberechtigt empfunden hatte, kämpften Kummer, Schuldgefühle und stummer Zorn in ihr. «Es macht mir große Sorge, Letty. Ich glaube wirklich nicht, dass sie ohne … na ja, ohne eine Frau im Haus zurechtkommen.»
Sie schwiegen beide. Der Hund jaulte im Schlaf und bewegte die Beine, als träumte er von der Kaninchenjagd.
«Vielleicht könnten sie jemanden einstellen, eine Haushälterin zum Beispiel», schlug Letty schließlich mit aufgesetzter Heiterkeit vor.
«Dad will sicher kein Geld dafür ausgeben. Du weißt doch, wie sparsam er ist. Und außerdem glaube ich nicht, dass sie eine Fremde in ihrer Küche ertragen würden.» Sie warf einen heimlichen Blick auf ihre Tante. «Du weißt doch, wie Niall auf fremde Menschen reagiert, seit er aus den Lagern zurückgekehrt ist. Oh, ich weiß nicht …»
Draußen ließ der Regen langsam nach. Das Trommeln auf dem Blechdach war leiser geworden, und man sah kleine blaue Flecken zwischen den grauen Wolken im Osten. Die beiden Frauen schwiegen eine Weile, jede scheinbar in die Aussicht vor dem Fenster versunken.
Als Letty nichts entgegnete, fuhr Margaret fort: «Tatsächlich frage ich mich, ob ich überhaupt fortgehen kann. Ich meine, es ergibt doch keinen Sinn, wenn ich fortgehe, nur um mir die ganze Zeit Sorgen um meine Familie zu machen, nicht wahr? Weil ich …»
«Ich glaube», unterbrach Letty sie, «dass ich aushelfen könnte.»
«Was?»
«Man sagt nicht ‹was›, meine Liebe. Es heißt ‹wie bitte›. Wenn du dir solche Sorgen machst», fügte sie gemessen hinzu, «könnte ich vielleicht öfter vorbeikommen. Um ihnen ein bisschen zu helfen.»
«Oh, Letty, würdest du das tun?» Margaret achtete darauf, dass ihre Stimme genau die richtige Mischung aus Überraschung und Dankbarkeit zeigte.
«Ich möchte aber auf keinen Fall irgendjemandem zu nahe treten.»
«Nein, nein … natürlich nicht.»
«Ich möchte nicht, dass du oder die Jungen denken … dass ich womöglich versuche, den Platz eurer Mutter einzunehmen.»
«Oh, ich glaube nicht, dass das irgendjemand denkt.»
«Es kann sein, dass einige Leute … die Dinge in den falschen Hals bekommen. Die Leute in der Stadt zum Beispiel.» Letty strich sich unwillkürlich die Haare glatt.
«Ja, das kann sein», erwiderte Margaret mit ernstem Gesicht.
«Aber andererseits ist es ja nicht so, dass ich Arbeit hätte, jetzt, da sie die Munitionsfabrik geschlossen haben. Und die Familie sollte immer an erster Stelle stehen.»
«Auf jeden Fall.»
«Ich meine, diese Jungen brauchen den Einfluss einer Frau. Besonders Daniel. Er ist in einem schwierigen Alter … Und es ist ja nicht so, dass ich irgendetwas Falsches täte. Irgendetwas … du weißt schon …»
Wenn Margaret die leichte freudige Röte im Gesicht ihrer Tante bemerkte, dann sagte sie nichts. Wenn sie etwas im Gesicht ihrer Tante sah, vielleicht die Spuren des neuen Lippenstifts, und deshalb ein unbehagliches Gefühl hinsichtlich ihrer Vereinbarung hatte, dann schob sie es von sich. Wenn es der Preis für ihre eigene Freiheit und ein reines Gewissen war, dass sie den Platz ihrer Mutter jemand anderem überließ, dann würde sie sich nur auf die Vorteile konzentrieren.
Ein Lächeln erhellte Lettys kantiges Gesicht. «In diesem Fall, meine Liebe, und wenn es dir hilft, werde ich mich gut um sie alle kümmern», sagte sie. «Du musst dir keine Sorgen machen.»
Voll plötzlichem Tatendrang wrang Letty das letzte Hemd mit der Hand aus und warf es in den Wäschekorb, damit es aufgehängt werden konnte.
Sie wischte sich die großen, knochigen Hände an der Schürze ab. «Also gut. Soll ich uns eine Tasse Tee machen? Du schreibst deinen Brief an die Marine und sagst ihnen, dass du die Einladung annimmst, und dann wissen wir, dass alles seinen Gang geht. Du willst doch nicht, dass sie deinen Platz an jemand anderen vergeben, oder?»
Margaret lächelte bereitwilliger, als sie sich fühlte. In dem Artikel in der Glamour hatte gestanden, dass man seine Familie vielleicht niemals wiedersehen würde. Man musste dazu bereit sein.
«Ich sag dir was, Maggie. Ich schau mal in deine Kommode oben, ob ich darin etwas zum Flicken finde. Ich weiß, dass du mit der Nadel nicht die Geschickteste bist, und wir wollen doch, dass du aussiehst wie aus dem Ei gepellt, wenn du deinen Joe wiedersiehst.»
Man durfte es ihm nicht verübeln, hatte es in der Zeitschrift geheißen. Man durfte auf keinen Fall dem Mann die Schuld daran geben, dass man von seiner Familie getrennt war. Ihre Tante schleppte jetzt den Korb mit derselben Selbstverständlichkeit durch die Waschküche, wie es ihre Mutter einst getan hatte.
Margaret schloss die Augen und atmete tief durch. Lettys Stimme hallte in der Waschküche wider: «Ich könnte gleich auch noch ein paar Hemden deines Vaters flicken, wenn ich schon dabei bin. Ich habe leider bemerkt, meine Liebe, dass sie ein wenig abgewetzt aussehen, und ich würde nicht wollen, dass irgendjemand sagt, dass ich nicht …» Sie warf aus den Augenwinkeln einen Blick auf Margaret.
«Glaubst du … glaubst du, deinem Vater macht es etwas aus? Ich meine, wenn ich da bin?» Letty sah plötzlich ganz ängstlich aus, ihre fünfundvierzigjährigen Züge so weich und offen wie die einer jungen Braut.
«Ich glaube, er wird begeistert sein», sagte Margaret und beugte sich vor, um ihren kleinen Hund zu streicheln. «Er mag dich sehr, Letty, genau wie die Jungen.» Sie hustete und sah hinunter auf ihre Hände. Später, in den vielen Nächten, in denen sie an diesen Augenblick zurückdachte, fragte sich Margaret, warum sie es nicht dabei belassen hatte. Sie war eigentlich keine boshafte Person. Sie wollte doch nur, dass weder Letty noch ihr Vater einsam waren. «Er hat oft gesagt, dass er dich wie eine Art … Schwester sieht. Wie jemanden, mit dem er über Mum reden kann, der sich daran erinnert, wie sie war … Und wenn du ihnen die Hemden wäschst, hast du sowieso ihre ewige Dankbarkeit.» Aus irgendeinem Grund war es ihr unmöglich aufzuschauen, aber sie bemerkte natürlich, dass Lettys Röcke nicht mehr raschelten, dass sich ihre dünnen, starken Beine nicht mehr rührten. Ihre Hände, sonst immer in Bewegung, lagen regungslos auf ihrer Schürze.
«Ja», sagte Letty schließlich. «Natürlich.» Es klang ein wenig krächzend. «Gut. Wie ich schon sagte. Ich … ich gehe jetzt und mache uns Tee.»
Die beiden Känguru-Männchen, die erst vor zwölf Monaten aus dem Beutel gekrochen sind und demnächst nach London fliegen, bekommen auf ihrer Reise 12 Pfund Heu zu fressen. Qantas Empire Airways meldete gestern, dass die Kängurus nur 63 Stunden in der Luft verbringen müssen.Sydney Morning Herald, 4. Juli 1946
Kapitel 2
Drei Wochen vor Abfahrt
Ian, mein Schatz,
ich bin drin! Du wirst es nicht glauben, ich selbst schaffe es kaum, aber es ist wahr. Daddy hat mit einem seiner Freunde beim Roten Kreuz gesprochen, der wiederum Freunde ganz oben bei der Königlichen Marine hat, und schon bekam ich eine Benachrichtigung, in der stand, dass ich einen Platz auf dem nächsten Schiff bekomme, obwohl ich eigentlich, wenn man es genau nimmt, keinen Vorrang habe.
Ich musste den anderen Bräuten zu Hause erzählen, dass ich nach Perth zu meiner Großmutter fahre, damit sie keinen Krawall machen, aber jetzt bin ich hier im Wentworth Hotel in Sydney und warte darauf, dass ich noch vor ihnen aufs Schiff flitzen kann.