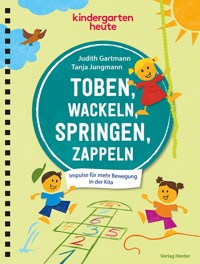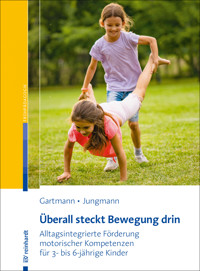
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Um motorische Fähigkeiten altersgerecht entwickeln zu können, brauchen Kinder Bewegungsgelegenheiten, räumliche Gegebenheiten, um sich sicher auszuprobieren und Anregungen durch pädagogische Fachkräfte. Stattdessen werden sie im Rahmen der Schulvorbereitung oft selbstverständlich an die Verrichtung sitzender Tätigkeiten gewöhnt. Das beeinflusst den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder mit negativen Konsequenzen für deren Gesundheit und die Entwicklung motorischer Fähigkeiten. Dieses Praxishandbuch der "Überall"-Reihe vermittelt die theoretischen Grundlagen der alltagsintegrierten Bewegungsförderung praxisnah und illustriert die konkrete Umsetzung anhand von zahlreichen Spielen und Ideen zur bewegungsförderlichen Gestaltung von Alltagssituationen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Judith Gartmann, Physiotherapeutin, ist als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) tätig.
Prof. Dr. Tanja Jungmann, Diplom-Psychologin, ist an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg als Professorin für Sprache und Kommunikation und ihre sonderpädagogische Förderung beschäftigt.
Im Ernst Reinhardt Verlag ebenfalls erschienen:
Koch, K., Schulz, A., Jungmann, T.: Überall steckt Mathe drin
(2. Aufl. 2020; ISBN 978-3-497-02951-8)
Jungmann, T., Koch, K., Schulz, A.: Überall stecken Gefühle drin
(2. Aufl. 2019; ISBN 978-3-497-02833-7)
Jungmann, T., Morawiak, U., Meindl, M.: Überall steckt Sprache drin
(2. Aufl. 2018; ISBN 978-3-497-02756-9)
Hinweis: Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnungen nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-497-03020-0 (Print)
ISBN 978-3-497-61472-1 (PDF-E-Book)
ISBN 978-3-497-61473-8 (EPUB)
© 2021 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in EU
Cover unter Verwendung eines Fotos von iStock.com/StockPlanets (Agenturfoto. Mit Models gestellt)
Abb. 1, Abb. 2 und Online-Zusatzmaterial unter Verwendung von Fotos und Abbildungen von Judith Gartmann
Satz: Katharina Ehle
Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München
Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]
Inhalt
Vorwort
1 Motorische Kompetenzen
1.1 Meilensteine der Bewegungsentwicklung und das motorische Lernen
1.2 Auffälligkeiten in der Bewegungsentwicklung
1.3 Motorische Kompetenzen und Bewegung beobachten und dokumentieren
1.4 Beziehung zu anderen Entwicklungsbereichen
2 Alltagsintegrierte Förderung motorischer Kompetenzen
2.1 Was ist alltagsintegrierte Bewegungsförderung?
2.2 Gemeinsam in Bewegung – Die Rolle der pädagogischen Fachkraft
2.3 Räume für Bewegung schaffen – Förderliche Raumgestaltung
3 Ein Tag in der Kita
3.1 Übergreifende Förderaspekte
3.2 Spezifische Alltagssituationen
Bewegte Begrüßung
Morgenkreis
Das Freispiel – Raufen, Toben, Erkunden
Gemeinsame Mahlzeiten – Ernährung und Mundmotorik im Fokus
Bewegte Bilderbucherfahrungen
Malen, Basteln und andere kreative Aktivitäten
In der Turnhalle – Wir machen Sport
Gemeinsames Tanzen und Musizieren
4 Spielesammlung zur Motorikförderung
4.1 Grob- und Körpermotorik – Endlich toben
Spiel 1: Mein rechter Platz ist frei
Spiel 2: Reise nach Jerusalem
Spiel 3: Obstsalat
Spiel 4: Tierischer Bewegungsspaß
Spiel 5: Fang-Frage
Spiel 6: Der Plumpsack geht um
Spiel 7: Hase und Igel
Spiel 8: Sandsäckchen-Boccia
Spiel 9: Verrücktes Wetter
Spiel 10: Zauberkleber
Spiel 11: Schneeballschlacht
Spiel 12: Farbenjagd
Spiel 13: Hip & Hep
Spiel 14: Kettenfangen
Spiel 15: Hindernisrennen
Spiel 16: Es war einmal …
Spiel 17: Eiszeit
Spiel 18: Ball-Tandem
Spiel 19: Ballkette
Spiel 20: Robotertanz
Spiel 21: Apfelkuchen
Spiel 22: Klammernjagd
Spiel 23: Bewegungsparcours
Spiel 24: Gemüsejagd
Spiel 25: Piraten auf großer Fahrt
4.2 Feinmotorik – Wir sind kreativ
Spiel 26: Bilderbuchpantomime
Spiel 27: Mal-Reime
Spiel 28: Luftballon „waschen“
Spiel 29: Murmelschnipsen
Spiel 30: Wäscheklammern-Angeln
Spiel 31: Zaubertrank
Spiel 32: Marmeladenlippenstift
Spiel 33: Blubberblasen
Spiel 34: Korkenkirmes
Spiel 35: Die Füße aufwecken
Spiel 36: Schwungübungen
Spiel 37: Tuchwanderung
Spiel 38: Punktieren
Spiel 39: Fußabdrücke
Spiel 40: Deckelkastagnetten
Spiel 41: Deckeltambourin
Spiel 42: Gläserxylophon
Spiel 43: Mosaik
Spiel 44: Kneten
Spiel 45: Baumeister
Spiel 46: Gemüsetiere und Obstgesichter
Spiel 47: Figuren angeln
4.3 Koordination – Geschickt eingefädelt
Spiel 48: Schleife binden
Spiel 49: Klatsch-Treffen
Spiel 50: Rollen
Spiel 51: Eierlauf
Spiel 52: Klatschspiele
Spiel 53: Samba-Band
Spiel 54: Balanceakt
Spiel 55: Wäschekorb-Ninja
Spiel 56: Wellen im Sturm
4.4 Wahrnehmen und Spüren – Den Körper erleben
Spiel 57: Karottenziehen
Spiel 58: Geräuschmemory
Spiel 59: Fußmassage
Spiel 60: Verstecken
Spiel 61: Picasso
Spiel 62: Pizzabäcker
Spiel 63: Geschmacksafari
Spiel 64: Körper spüren
Spiel 65: Atmen mit dem Luftballon
Literatur
Register
Vorwort
Durch Bewegung erkunden und begreifen Kinder ihre Umwelt, beeinflussen diese aber auch aktiv. Eine der wichtigsten Entwicklungsaufgaben der frühen Kindheit besteht darin, motorische Kompetenzen zu erwerben. Dabei bieten Kindertageseinrichtungen Kindern zahlreiche Lernanlässe und Möglichkeiten, um ihre motorischen Fähigkeiten auszudifferenzieren und zu vervollkommnen. Die Bildungspläne aller Bundesländer geben ebenso wie der Bildungsrahmen für elementare Bildungseinrichtungen in Österreich und der Kindergartenlehrplan in der Schweiz Orientierungshilfen zur Umsetzung des Bildungsbereiches Bewegung. Dabei wird übereinstimmend festgestellt, dass das tägliche Miteinander in Kindertageseinrichtungen durch eine Vielzahl an Situationen geprägt ist, die zahlreiche Anlässe bieten, Bewegung als Lerngegenstand und als Medium des Lernens zu nutzen. Darüber hinaus kommt auch der gezielten Bewegungsförderung und der Prävention von motorischen Auffälligkeiten und Gesundheitsproblemen ein besonderer Stellenwert zu.
Das vorliegende Buch widmet sich der konkreten Ausgestaltung alltagsintegrierter Förderung motorischer Fähigkeiten. Die folgenden Fragen, die uns im Rahmen der Inhouse-Schulungen und der kollegialen Intervisionen im Rahmen des Professionalisierungsangebots für pädagogische Fachkräfte, GIF-Plus+ sehr häufig begegnet sind, sollen beantwortet werden:
•Steckt tatsächlich in allen Alltagssituationen in den Kindertageseinrichtungen Bewegung als Lerngegenstand bzw. als Medium des Lernens?
•Wie kann dieses Potenzial zur Förderung am besten erkannt und genutzt werden?
•Wie viel Anleitung und Unterstützung brauchen Kinder für die optimale Bewegungsentwicklung von ihren pädagogischen Fachkräften?
Bei GIF-Plus+ handelt es sich um ein Projekt zur Professionalisierung von pädagogischen Fachkräften in Kindertageseinrichtungen, das in Kooperation der Universitätsmedizin Greifswald, der Universität Rostock und der Medizinischen Hochschule Hannover durchgeführt und wissenschaftlich begleitet und vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern gefördert wurde.
Neben der Beantwortung dieser Fragen sollen aber vor allem Möglichkeiten aufgezeigt werden, auf spielerische Art und Weise motorische Kompetenzen zu fördern bzw. Auffälligkeiten in der Bewegungsentwicklung präventiv entgegenzuwirken. Die Spiele werden differenziert nach den jeweiligen Kompetenzen dargestellt, für die sie förderlich sind, und ausführlich erläutert. Sie sind außerdem nach den Entwicklungsstufen geordnet, auf denen sich die Kinder gerade befinden.
Um die Anregungen und Spiele, die Sie in diesem Buch finden, umzusetzen, benötigen Sie weder teure Zusatzmaterialien, noch müssen Sie besondere Situationen schaffen, denn: Überall steckt Bewegung drin! Wir wünschen Ihnen und den Kindern viel Spaß und Freude bei der Umsetzung und freuen uns über Ihr Feedback.
Abschließend möchten wir all jenen danken, die uns tatkräftig unterstützt haben: Allen voran sind das die pädagogischen Fachkräfte, Kinder und Eltern, die am Projekt GIF-Plus+ mitgewirkt haben. Angestoßen durch deren zahlreiche Fragen und Anregungen aus der Praxis konnte dieses Buch erst entstehen.
Franziska Heinschke, Fenja Lampe, Thomas Pöche, Manuela Schumann und Tabea Testa danken wir für die kritische Durchsicht des Materials und zahlreiche wertvolle Anregungen.
Weiterhin möchten wir Eva Maria Reiling und Sarah Schröppel vom Ernst Reinhardt Verlag für ihre stets kompetente Betreuung des Buchprojektes sowie Corina Retzlaff für das Lektorat dieses Buches danken.
Hannover und Oldenburg, den 26.11.2020
Judith Gartmann Tanja Jungmann
1 Motorische Kompetenzen
In diesem Kapitel werden zunächst die Meilensteine der Bewegungsentwicklung im grob- und feinmotorischen Bereich skizziert. Im Anschluss daran wird auf Möglichkeiten der Bewegungsförderung für alle Kinder sowie für Kinder mit motorischen oder körperlichen Beeinträchtigungen eingegangen. Es wird thematisiert, welche Rolle der pädagogischen Fachkraft bei der Diagnose und in der alltagsintegrierten Förderung der Bewegungsentwicklung zukommt. Alltagstaugliche Möglichkeiten zur Beobachtung und Dokumentation der Bewegungsentwicklung und der motorischen Kompetenzen, die die Grundlage jeglicher Förderung bilden, werden beschrieben. Das Kapitel schließt mit einer kurzen Darstellung der Bedeutung der Motorik für die Entwicklungsbereiche Sprache und Kommunikation, sozial-emotionale Entwicklung sowie für schulische Fähigkeiten und die Gesundheit.
Die Entwicklung motorischer Fähigkeiten ist für alle Kinder genetisch weitgehend vorgegeben. Dennoch sollten sie in ihrer Bewegungsentwicklung gezielt unterstützt werden. Durch die Bildung und Förderung von Bewegung wird die Koordination der Bewegungsabläufe verbessert, die Kinder fühlen sich sicherer, werden motorisch bewusster und können Gefahren und überfordernde Situationen besser einschätzen. Zudem sind motorische Übungen und Erfahrungen u. a. wichtige Faktoren für das soziale Lernen, die emotionale Regulation, die Unterstützung geistiger Funktionen oder des körperlichen Wachstums. Darüber hinaus dienen sie der Prävention von Unfällen, Krankheiten und Übergewicht (Rosenkötter 2020, Schwarz 2020). Wichtige personelle Voraussetzungen seitens der pädagogischen Fachkräfte für die gezielte Förderung motorischer Kompetenzen sind das aktive Mitmachen, aber auch die aufmerksame und geduldige Begleitung der Kinder. Diese ist dadurch geprägt, dass sie Freiheiten zum körperlichen Ausagieren und Ausprobieren lässt, aber auch Grenzen setzt, um vor Gefahren zu schützen (Kap. 2.1). Kinder brauchen für ihre gesunde Bewegungsentwicklung auch andere Kinder. Mit ihnen können sie gemeinsam Ideen zu Bewegungsspielen entwickeln und diese miteinander teilen. So werden motorische und soziale Fähigkeiten gleichzeitig gefördert (Pauen 2011, Wolf 2010) Kap. 2.2,). In der Kindertageseinrichtung sollten zudem geeignete Innen- und Außenräume (z. B. Garten, Park oder Wiese) und verschiedene Materialien (z. B. Klettergerüste, Tunnel, Tücher, Laufstrecken, Matten und Kästen) für die Bewegungsförderung vorhanden sein. Gelingende Bewegungsbildung durch systematische Erziehung ist auf der individuellen Ebene (Verhältnisprävention) u. a. konkret daran zu erkennen, dass eine möglichst frühzeitige Unterstützung der motorischen Entwicklung stattfindet – unabhängig davon, ob ein Grenzstein Gefahr läuft, nicht aufzutauchen (Schwarz 2020).
1.1 Meilensteine der Bewegungsentwicklung und das motorische Lernen
Mit dem Begriff Motorik werden allgemein die verschiedenen körperlichen Funktionen von Haltung und Bewegung bezeichnet.
Bewegungskompetenzen
Jede Bewegung des menschlichen Körpers setzt sich aus den Teilbereichen Grobmotorik, Feinmotorik, Willkürmotorik, Sensomotorik und Koordination zusammen. Abhängig von der Bewegung sind diese Anteile unterschiedlich stark vertreten.
Grob- oder Körpermotorik
Als Grob- oder Körpermotorik werden die Bewegung und Koordination von Rumpf und Extremitäten, also die Körperhaltung im Allgemeinen und die Fortbewegung bezeichnet. Beispiele für grobmotorische Bewegungen sind das Gehen, Laufen und Springen.
Fein- bzw. Handmotorik
Die Feinmotorik umfasst sehr selektive, genau abgestimmte Bewegungsabläufe der Hände, der Füße sowie der mimischen Muskulatur im Gesicht. Unter Handmotorik werden zudem die Haltung und Bewegung der Hände (ein- und beidhändig), insbesondere auch die Beweglichkeit der Handgelenke und Finger gefasst. Dies wird auch als Handgeschicklichkeit bezeichnet. Zusammen mit der Auge-Hand-Koordination ist sie eine wesentliche Voraussetzung der grafomotorischen Kompetenzen beim Malen und für die Koordination der Schreibbewegungen im Schulalter (Rosenkötter 2020).
Willkürmotorik vs. Reflexe
Bewegungen, die bewusst vom Nervensystem gesteuert werden, bezeichnet man als Willkürmotorik. Im Gegensatz dazu stehen die unbewusst durchgeführten, unwillkürlichen Bewegungen des Körpers und die Reflexe. Zu den unbewusst gesteuerten Bewegungen gehören die Mitbewegungen der Arme beim Gehen oder z. B. Mitbewegungen der Zunge beim konzentrierten Malen oder Schreiben. Andere zumeist unbewusste Komponenten der Motorik sind Druck, Kraft und Ausdauer.
Der Begriff Sensomotorik bezeichnet die Steuerung von Haltung und Bewegung durch das Fühlen und Spüren z. B. von unterschiedlichen Untergründen oder wechselnder Raumlage des Körpers beim Schaukeln sowie die Verarbeitung dieser Signale durch das System der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung.
Sensomotorik
Die Koordination kann als die Basis aller Bewegungsfertigkeiten gesehen werden.
Koordination
Die Qualität der koordinativen Fähigkeiten wird im Kindesalter angelegt (Zägelein 2013).
Sie besteht aus den folgenden Fähigkeiten (Thiel et al 2017):
•Kopplungsfähigkeit: Zusammenarbeiten verschiedener Körperabschnitte (z. B. der Arme und Beine beim Gehen),
•Differenzierungsfähigkeit: Feinabstimmung verschiedener Körperabschnitte (z. B. beim Ausschneiden von Figuren mit einer Schere),
•Reaktionsfähigkeit: Bewegungsantworten, die unmittelbar mit einer hohen Geschwindigkeit durchgeführt werden; diese sind von einfachen Reflexantworten abzugrenzen,
•Gleichgewichtsfähigkeit: Fähigkeit, den Körper in Balance halten zu können, ohne zu stürzen (z. B. beim Balancieren auf einem Baumstamm),
•Orientierungsfähigkeit: Wissen um die eigene Raumlage (z. B. beim Schaukeln, Tanzen oder am Ende eines Purzelbaumes),
•Umstellungsfähigkeit: Anpassung oder Adaption derselben Bewegung an wechselnde äußere Gegebenheiten (z. B. benötigt das Gehen im Sand eine andere muskuläre Aktivität als das Gehen auf einem ebenen Rasen),
•Antizipationsfähigkeit: Anpassung von Bewegung an wechselnde Gegebenheiten basierend auf Erfahrungswissen (z. B. müssen eigene motorische Erfahrungen mit Tiefe oder Glätte gemacht werden, um das zukünftige motorische Handeln daran anzupassen).
•Rhythmisierungsfähigkeit: ermöglicht ein perfektes Zusammenspiel von Nervensystem und Muskulatur, das für alle Bewegungen im Alltag sehr hilfreich ist (z. B. dem Gehen und Laufen), aber auch auf der Schaukel oder Wippe; beinhaltet die Wahrnehmung eines vorgegebenen Bewegungsrhythmus, sein Erkennen und die Anpassung der eigenen Bewegungen an diesen Rhythmus; auch für viele Sportarten (z. B. für das Tanzen), aber auch für Ballsportarten spielt die Rhythmisierungsfähigkeit eine besondere Rolle.
Abb. 1: Überblick über die koordinativen Fähigkeiten nach Thiel et. al. 2017
Meilensteine der Entwicklung
Mit Meilensteinen sind genetisch relativ vorbestimmte Bewegungsmuster oder -formen gemeint, die insbesondere in den ersten drei Lebensjahren mit vergleichsweise verlässlicher Regelhaftigkeit innerhalb bestimmter Zeitfenster auftauchen (Schwarz 2020).
„Als Meilenstein wird ein Entwicklungsabschnitt bezeichnet, in dem wichtige Funktionen, wie z. B. das freie Laufen oder der Pinzettengriff, möglichst erworben sein sollten. Die Zeitangaben beziehen sich dabei jeweils auf die durchschnittliche Entwicklung. Sie bezeichnen den Zeitpunkt, zu dem 50 Prozent aller Kinder eine definierte Fähigkeit erworben haben“ (Rosenkötter 2020, 129). Durch die Orientierung an Meilensteinen kann die Variabilität der Entwicklung angemessen berücksichtigt werden.
Tabelle 1 gibt eine Übersicht der Meilensteine der grob- und feinmotorischen Entwicklung ab dem Krippenalter.
Tab. 1: Meilensteine der motorischen Entwicklung (Largo 2010, Scheid 2009, Wolf 2010, Zimmer 2014)
Einflussfaktoren
Ausgehend von angeborenen, im Zentralnervensystem verankerten motorischen Programmen mit ihren vielen Nervenverbindungen hat die Veränderung des Körperschwerpunktes durch das Wachstum Einfluss auf die Bewegungsentwicklung. Mit zunehmendem Körperwachstum richtet sich das Kind zunehmend gegen die Schwerkraft auf (Ayres 2013, Haber 2018).
Vom Unterarm- und Handwurzelstütz in Bauchlage im Alter von drei bis vier Monaten erlangt das Kind im Alter von sechs Monaten zunehmend Kopfkontrolle im gehaltenen Sitzen und es gelingt ihm, sich im Alter von sieben bis acht Monaten von der Bauch- in die Rückenlage zu drehen und zu robben.
Dies erfordert hohe Anpassungen des neuromuskulären Systems und die Entwicklung der Haltungskontrolle, d. h., es entsteht ein Gleichgewicht aus Stabilität und Mobilität, das in jeder Position und Bewegung vom Zentralnervensystem neu angepasst werden muss. Deshalb verwundert es auch nicht, dass z. B. die Entwicklung der Koordination im Vorschulalter große Sprünge macht, welche parallel zur Reifung des Zentralnervensystems verläuft (Roth 2009).
Durch die Bewegungserfahrungen des Kindes wird ein Lernprozess in Gang gesetzt, da es aus den vielen möglichen Bewegungsantworten auf eine erste Bewegung innerhalb der ersten Lebensjahre die geeigneten Bewegungsantworten abspeichern kann. Der Körper verhindert sozusagen mit der Zeit unnötige Bewegungen und den damit einhergehenden unnötigen Energieverlust. Die Zielbewegung wird präziser (Haber 2018, Horst 2005).
Dies lässt sich besonders gut im Säuglingsalter beobachten, wenn das Baby mit dem Greifen beginnt. Mit jedem Versuch wird das Zielobjekt besser gegriffen.
physiologische Grundlagen
Mehrere Regionen unseres Gehirns arbeiten mit dem Nervensystem und dem Muskel-Skelett-System zusammen, um Bewegung möglich zu machen. Dabei hat jeder Teil des Gehirns seine spezifische Aufgabe, z. B. leistet der Hirnstamm als ältester Teil unseres Gehirnes einen wesentlichen Beitrag bei stützmotorischen Aktivitäten wie dem Gehen und Stehen. Nicht zu vergessen ist das Kleinhirn, das in engem Kontakt mit den Sinnesorganen bei Bewegungen wie dem Aufrichten gegen die Schwerkraft und dem Anpassen von Bewegungen an verschiedene äußere Bedingungen unterstützt.
So sind das Gleichgewichtsorgan, die Augen, der Tastsinn und die tiefe Körperwahrnehmung nicht aus der Bewegung wegzudenken.
Je mehr sich ein Kind bewegt, desto stabiler werden die Nervenverbindungen zwischen den genannten Körperarealen und desto einfacher kann das Kind diese Bewegung durchführen sowie in späteren Lebensjahren noch abrufen.
Paul fährt mit großer Begeisterung täglich Fahrrad. Mehrmals in der Woche kommt er sogar mit dem Rad in Begleitung seines Vaters zum Kindergarten und radelt nachmittags wieder nach Hause. Sechs Wochen lang konnte er wegen seines gebrochenen Armes kein Fahrrad fahren. Doch nun geht es wieder los und er hat es nicht verlernt.
motorisches Lernen
Motivation und Freude sind die Voraussetzungen jeglichen motorischen Lernens im Spiel oder bei sportlicher Betätigung. Im Kindergartenalter sollte es nicht um sportartspezifisches Bewegungslernen, sondern um das spielerische Erlernen allgemeiner Bewegungskompetenzen für den alltäglichen Gebrauch sowie das gesunde Aufwachsen gehen.
Motorisches Lernen sollte im Kindesalter immer spielerisch erfolgen.
Dies ist an die Plastizität des Gehirns gekoppelt. Werden Bewegungen häufig und auch in Variationen durchgeführt, können diese im Gehirn langfristig abgespeichert und in ihrer Ausführung automatisiert werden. Auch die Wege zum Gehirn über die peripheren Nervenbahnen werden stabiler. Die Durchblutung des entsprechenden Hirnareals wird gesteigert (Conzelmann 2009, Horst 2005).
Das Kindergartenalter ist eine sensible Phase für Bewegungserfahrungen und deren Abspeicherung im Gehirn. Was jetzt nicht erlebt wird, kann in späteren Lebensphasen nur mit viel Anstrengung nachgeholt werden.
Bedeutung des Spiels
Das Spiel ist die Hauptaktivität eines Kindes zum Lernen für das Leben. Erste spielähnliche Bewegungen können bereits im Mutterleib nachgewiesen werden und ziehen sich durch die Entwicklung auch außerhalb des Mutterleibes. Das (früh-)kindliche Spiel ist immer lustbetont und hat nie ein bestimmtes Ziel im Sinne eines „Endproduktes“. Beim kindlichen Spiel geht es einzig um die Handlung an sich. Aus diesem Grund ist das Spielverhalten immer an den Entwicklungsstand eines Kindes angepasst. Ein gezieltes Einüben von bestimmten Bewegungen mit Hilfe der Bezugspersonen kann gegebenenfalls nicht dem selbstbestimmten Spiel entsprechen und negativ belegt werden. Das Training gezielter Bewegungen findet erst im späterem Alter im Rahmen des sportartspezifischen Trainings statt. Dennoch sollten Kinder zu verschiedensten Bewegungen animiert werden, z. B. ahmen Kinder Tätigkeiten Erwachsener nach oder spielen bei anderen Kindern Gesehenes nach (Largo 2010, Wolf 2010).
Abb. 2 Motorisches Lernen in Anlehnung an Zimmermann (1996)
Erziehung und spezielle Lerntechniken stellen im Normfall keine notwendigen Voraussetzungen für das Erreichen der Meilensteine dar. Vielmehr sind diese genetisch festgelegt. Durch Zusatzmaßnahmen kann das Erreichen aber beschleunigt, verbessert bzw. im Optimierungssinne unterstützt werden.
1.2 Auffälligkeiten in der Bewegungsentwicklung
Die interindividuelle Variabilität erschwert die sichere Unterscheidung zwischen einer normalen Bewegungsentwicklung und einer nicht mehr tolerablen Abweichung. Dennoch ist es wichtig, Zeitpunkte zu definieren, an denen Kinder eine bestimmte Fähigkeit erworben haben sollten. Als hilfreich haben sich in diesem Zusammenhang die Grenzsteine der Entwicklung erwiesen (u. a. Nennstiel-Ratzel et al. 2013).
Grenzsteine der Entwicklung
„Ein Grenzstein ist das Lebensalter, in dem eine bestimmte Funktion von 90 bis 95 Prozent aller Kinder sicher beherrscht wird. Ist dies der Fall, ist noch nicht mit Sicherheit eine Entwicklungsverzögerung oder -störung anzunehmen“ (Rosenkötter 2020, 128).