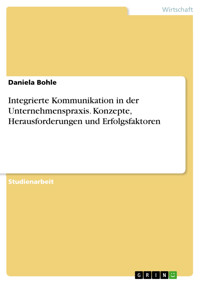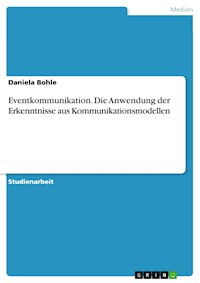Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Satyr Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vor Ellen tut sich eine große Leere auf: Die Kinder sind ausgezogen, ihr Mann und sie haben sich nicht mehr viel zu sagen und ihre Arbeit im Jobcenter ist nur noch eins: sicher. Als sie sich für einen Survivalkurs anmeldet, ist zumindest für ihre Freundinnen klar: Ellen steckt tief in der Midlife-Crisis. Dann erhält sie die Chance, für drei Monate ans andere Ende der Stadt zu ziehen. Doch damit kehrt erst recht Chaos in ihrem Leben ein: Ein verunglückter Kollege benötigt Hilfe, ihr Vater campiert vor einem Modegeschäft für Übergrößen und was hat die Ehekrise ihrer Eltern mit diesem Schuhkarton zu tun, den ihre Mutter seit Ellens Kindertagen im Schrank versteckt hält? Mit Verve und leisem, unaufdringlichem Humor erzählt Daniela Böhle vom Leben nach dem Auszug der eigenen Kinder und über vergessene und wiedergefundene Träume.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DANIELA BÖHLE
ÜBERLEBENSTRAINING
ROMAN
DANIELA BÖHLE
(Jahrgang 1970) stammt aus Köln und lebt seit 1999 mit zwei Kindern in Berlin. Nach einem Kunstgeschichtsstudium und einem medizinischen Staatsexamen arbeitet sie heute beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Sie schreibt Romane, Kurzgeschichten und Hörspiele; ihre erste Geschichtensammlung »Amokanrufbeantworter« sowie ihr Jugendbuch »Mein bisher bestes Jahr – Wer vorher nachdenkt, verpasst ’ne Menge« erschienen bei Satyr, ihr Roman »Schmetterlinge aus Marzipan« folgte 2019 bei dtv.
E-Book-Ausgabe September 2022
© Satyr Verlag Volker Surmann, Berlin 2022
www.satyr-verlag.de
Cover-Illustration: Richard Laschon/Adobe Stock
Korrektorat: Matthias Höhne
Die Marke »Satyr Verlag« ist eingetragen auf den Verlagsgründer Peter Maassen.
E-Book-ISBN: 978-3-947106-88-2
Für meine Eltern,
die nichts mit denen von Ellen gemeinsam haben
Inhalt
DANIELA BÖHLE
Überlebenstraining
Danke
Im Schrank meiner Mutter hatte es diesen Schuhkarton gegeben. Vor einem durchschnittlich neugierigen Menschen war er vermutlich gut versteckt, denn er lag unter einem ganzen Stapel aus Schuhkartons. Teenager sind meist überdurchschnittlich neugierig, daher öffnete ich den zweiten Schuhkarton, obwohl im obersten nur zwei Paar ziemlich hässliche alte Hausschuhe steckten. Und ich öffnete auch noch den dritten, obwohl sich im zweiten ein Paar Gummischlappen befand, diese dunkelblauen mit weißen Streifen, die über Jahrzehnte einfach nur praktisch und hässlich, aber immerhin über eine kurze Phase unerklärlich angesagt gewesen waren. Im dritten Karton hatten schließlich die Briefe gelegen.
///
Ich saß auf der Wiese und band meine Turnschuhe auf. Es war ein gutes Gefühl, erschöpft auf der Wiese zu sitzen. Ich kann das noch, dachte ich zufrieden. Ich kann noch exakt so lange laufen, wie ich will. Ich muss keine Kompromisse mit meinem Körper schließen, keine.
Ich streifte mir Schuhe und Strümpfe von den Füßen, streckte die zerdrückten Füße aus und wackelte mit den Zehen. Dann stützte ich mich nach hinten ab und beobachtete die anderen, die durch den Schöneberger Stadtpark liefen wie auf Schienen gesetzte Modelleisenbahnen, die nach vorgegebener Zeit wieder auftauchten und wieder verschwanden, wieder auftauchten und wieder verschwanden. Ich dachte an diese winzigen Bäume mit den streichholzdünnen Stämmen, die auf der Modelleisenbahnplatte verleimt waren, und stellte mir vor, wie ich selbst eine dieser starren Plastikfiguren war. Im Modelleisenbahnladen hieße ich »Liegende Frau«, weil es keinen Ausdruck gibt für diesen Zustand zwischen Sitzen und Liegen. Ich lag in der Wiese und die Modelleisenbahnmenschen auf Schienen tauchten auf und verschwanden, tauchten auf und verschwanden, während die Streichholzstammbäume friedlich herumstanden. Wiese und Wege waren mit Wandfarbe aufgemalt worden. Die Gäste schnalzten anerkennend mit der Zunge, weil die Wege überall dieselbe Breite hatten und das Gras so lebensecht aussah. In diesem Gras klebte die liegende Frau und war für eine Weile sehr zufrieden mit sich und der Modelleisenbahnwelt. Der nächste Schienenmensch tauchte auf und verschwand wieder, dann noch einer. Um diese Zeit waren es immer viele Modelleisenbahnen, noch dazu jetzt im Frühjahr. Da krochen sie alle wieder aus ihren Winterschlafhöhlen. Ich auch, dachte ich und wackelte mit den Zehen. Und wie die anderen war ich verdammt schnell wieder fit geworden.
Die Lauferei war im letzten Sommer Teil meines neuen Lebens geworden. Seit auch unser zweites Kind ausgezogen war. Diese Tatsache versetzte mir immer noch einen Stich. Immer noch und immer wieder. Warum hatten es meine Kinder gar nicht erwarten können auszuziehen? Ich dachte an Hilke, deren Sohn sich prima in seinem Kinderzimmer eingerichtet hatte und von dort auch eines Tages in Rente gehen würde, wenn Hilke und Rolf nichts unternahmen. Mein Verstand wusste, dass es irre war, auf die beiden und ihren unfassbar trägen Sohn neidisch zu sein, aber mein Herz wusste das nicht. Ich dachte an Judiths Tochter, die inzwischen gemeinsam mit Freund und Kind wieder eingezogen war, nachdem Judiths Mann zu seiner Geliebten verschwunden war. Ich dachte an unsere Nachbarn eine Etage über uns, deren Kinder ständig zu Besuch kamen und dann nicht selten über Nacht blieben. Was haben wir falsch gemacht?
Ich ließ mich nach hinten in die Wiese fallen. »Liegende Frau voller Trübsal«. Hier würde ich nun so lange herumliegen, bis die Sonne untergegangen sein würde. Hier würde ich warten und mir leidtun, denn außer mir bemitleidete mich niemand und irgendjemand musste das tun, das spürte ich deutlich. Ich seufzte. Es tat gut, dass ich mir leidtat. Ich fragte mich, ob ich damit langsam mal wieder aufhören sollte, bewegte den Gedanken kurz im Kopf und verwarf ihn dann. So weit war ich noch nicht. Der Himmel war wolkenlos und von einem herrlichen Hellblau. Ich seufzte noch einmal, aber es gelang mir nicht mehr so gut wie beim ersten Mal.
»Du hast angefangen zu laufen«, hatte meine Freundin Carola letzte Woche gesagt. Carola war auch eine von denen, denen ich einfach nicht leidtat. »Dann lauf doch mal richtig, Ellen«, war ihr esoterisch angestrichener Rat gewesen. »Nicht immer nur im Kreis durch den Stadtpark.« Ich hatte die Augen gerollt, aber jetzt, den Blick auf den strahlenden Sommerhimmel gerichtet, fragte ich mich heimlich, ob Carola recht haben konnte. Vielleicht war es wirklich Zeit, loszulaufen, beinahe egal wohin.
///
Es war ein Samstag, als ich zum Survivalkurs nördlich der Stadt antrat. In diesem Jahr war der Sommer kühl und wechselhaft, daher hatten wir auch für Regen vorsorgen sollen. Noch sah es allerdings nicht danach aus, die Sonne schien wie verrückt. Sie ließ das Grün so leuchten, dass wir Sonnenbrillen gebraucht hätten, wäre unser Ziel nicht der schattige Wald gewesen. Auf der kleinen Wiese neben dem Parkplatz glitzerte noch der Tau. Was auf den ersten Blick wie hohes Gras ausgesehen hatte, entpuppte sich bei näherem Hinsehen als eine wilde Mischung: Das meiste waren Pflanzen, die ich bis auf Löwenzahn nicht kannte. Jede von ihnen schien eine eigene Blattform, eine eigene Breite und Höhe und Grüntönung zu besitzen. Ich wäre gern in die Hocke gegangen, um alles genauer in Augenschein zu nehmen, wollte aber nicht sonderbar wirken. Sicherlich würde der Zeitpunkt für die fremden Pflanzen noch kommen. Der Wald grenzte direkt an die Wiese, ich nannte ihn bereits »unseren Wald« und hatte trotzdem Herzklopfen. Zwischen den Stämmen konnte ich nicht weit blicken und was dort lebte, ahnte ich nicht einmal. Gab es in einem deutschen Wald irgendwelche gefährlichen Tiere, vielleicht Giftschlangen oder Krankheiten übertragende Insekten? Wie konnte ich so alt geworden sein, ohne so grundlegende Dinge über meine nächste Umgebung zu wissen?
Der Wald war nicht meine nächste Umgebung, rechtfertigte ich mich innerlich. Einem Teil von mir war bang, ein anderer wollte mit diesem fremden Wald Freundschaft schließen.
Ich wandte mich ab und musterte verstohlen die anderen Gruppenmitglieder. Obwohl wir früh aufgestanden waren, um den Treffpunkt um acht Uhr zu erreichen, wirkten alle überraschend ausgeschlafen. Wir waren zwei Handvoll, allerdings schienen nur zwei von uns gut vorbereitet zu sein. Vorgestellt hatte ich mir eine regelrechte Horde, die zu diesem Überlebenskurs kommen würde. Ich trug meine Wanderschuhe, die ich zuletzt irgendwann während Linus’ Grundschulzeit getragen hatte, und meine dunkelblaue Wind-und-Wetter-Jacke, mit der ich Ausflüge ins Umland unternahm. Was ich so gut wie nie tat. Meine Kurzhaarfrisur sah trotz des vielen Geldes, das ich immer dafür ausgab, vermutlich in dieser Umgebung vor allem funktional aus. Ich fühlte mich unsicher und fehl am Platz.
Jennifer, die sich sofort bei allen vorgestellt hatte, war mindestens zehn Jahre jünger als ich und trug ihr langes Haar lässig hochgesteckt. Sie war der Typ Frau, der sich nie schminkt, das aber irgendwie auch nicht nötig hat, weil sie so ein ausdrucksvolles, waches Gesicht hat, dass man gar nicht wegschauen kann. Ihr Kinn war ein wenig zu lang und sie hatte jede Menge Sommersprossen. Sie gefiel mir sofort. Bei den anderen konnte ich das nicht so schnell sagen. Es war eine Familie dabei mit einem etwa fünfjährigen Mädchen und einem doppelt so alten Jungen, ein schwammiger Brillenträger, der sich als Dirk vorgestellt hatte und vermutlich ebenso wie ich in den Vierzigern war, und zwei Frauen, die nicht zusammengehörten, sich aber gleich zu einer Art Team zusammengeschlossen hatten.
Ralf leitete unseren gemischten Haufen. Er sah aus wie aus einem Werbekatalog für Männer aus der Wildnis: Bei seinem Gesicht fiel mir sofort »wettergegerbt« ein, es war von tiefen Falten durchzogen, obwohl er vermutlich kaum älter war als ich. Es waren keine Schlechte-Laune-Falten, sondern Falten von, tja, wovon? Von einem entbehrungsreichen Leben im Freien? Von Wind und Wetter, Schnee, Eis und Sonnenbrand? Er hatte einen ausgeprägten Hinterkopf, seine Augen waren ähnlich wach wie die von Jennifer und er hatte Hände, denen ich sofort mein Leben anvertraut hätte: groß und sehnig und so geschickt, dass ich kaum wegschauen konnte, sobald er etwas tat.
»Hallo zusammen«, rief er gut gelaunt, als wir alle in unserer mehr oder weniger praktischen Kleidung vor ihm auf dem Wiesenstück standen. Wir benahmen uns wie Grundschüler vor dem Lehrer, wie Kinder in einem Alter, in dem die Wissbegier noch stärker ist als das Bedürfnis, sich dadurch vor den Gleichaltrigen nicht zum Trottel zu machen.
Der Parkplatz nebenan war mit Schlaglöchern übersät. Ralf hatte in seinem schwarzen Kleinwagen sowohl Jennifer als auch Dirk mitgebracht. Anreise mit dem eigenen Auto, Mitnahme möglich, hatte auf der Website gestanden. Ich beäugte wieder den Wald. Unser Leiter trug Wanderschuhe, die bereits abgenutzt waren, Funktionskleidung in Blautönen und eine beige Schirmmütze, die ebenfalls schon einiges mitgemacht hatte. Wo hatte er das Ding her, dass es auf seinen außergewöhnlich großen Kopf passte? Mindestens Kopfgröße 62, schätzte ich, aber amerikanische Modelle gab es ohne Probleme bis 64. Meine Hände kribbelten, als würden auch sie gerade eine Zeitreise in meine Vergangenheit machen, in der Kopfgrößen so eine große Rolle gespielt hatten.
Ich konzentrierte mich mit aller Macht auf den Wald und schob meine Erinnerung weit fort. Dirks Kleidung war das glatte Gegenteil von Ralfs: Ich bezweifelte, dass seine Wanderschuhe schon einmal getragen worden waren. Die Jeans und das ausgewaschene Shirt mit langen Armen trug er vermutlich sonst nur noch, wenn ihn niemand sah, außerdem hatte er sich eine Jacke umgebunden, die wie eine Windjacke zum Fahrradfahren aussah. Die Mail, die uns Ralf zur Vorbereitung geschickt hatte, hatte gelautet, dass wir für den möglicherweise kalten Abend eine warme Jacke brauchen würden. Ich hoffte für Dirk, dass sich noch ein weiteres Kleidungsstück in seinem Rucksack befand.
///
Ich würde gern den Augenblick benennen, in dem die Waage auf die andere Seite gekippt ist. Der Moment, als es mehr Gründe gab, mein Leben zu ändern, als im gewohnten Trott zu bleiben. Aber das wäre ja Unsinn. Die Waage würde sich schließlich nicht neigen, wenn sich ihre Schale nicht die ganze Zeit über schon gefüllt und immer weiter gefüllt hätte. Es ist völlig egal, welches davon das letzte kleine Gewicht war, das aufgelegt wurde – ohne all die anderen zuvor wäre es ja ein Klacks. Der Moment auf der Wiese, als ich gedanklich in Angelas Hutwerkstatt zurückgestolpert war, war keines dieser Gewichte gewesen. Da hatte sich nur die kippende Waage bemerkbar gemacht.
Das vorletzte Gewicht war dieser gemeinsame Morgen am Küchentisch gewesen. Ich war spät aus dem Stadtpark zurückgekommen. Eben noch war ich ganz angefüllt mit Park und blauem Himmel gewesen. Eben noch hatte ich mich lebendig und unbesiegbar gefühlt. Jens hatte schon den Tisch gedeckt und las Zeitung. Sein dichtes Haar durfte am Wochenende widerspenstig in alle Richtungen stehen. Gewöhnlich mochte ich das, aber an diesem Tag verstimmte es mich ohne nennenswerten Grund. Er sah nicht auf, als ich hereinkam, murmelte aber: »Guten Morgen, schon zurück?« Und ich erzählte ihm nicht, was mir durch den Kopf ging. Ich erzählte ihm nicht, wie ich mich fühlte, aber ich wünschte ihm auch einen guten Morgen.
»Sonntags muss ich eine echte Zeitung in den Händen halten«, sagte er immer. Ich fragte mich, ob er wenigstens zu anderen Menschen manchmal Sätze sagte, die ich noch nicht kannte.
»Was gibt’s Neues in der Welt?« Unwillkürlich fragte ich mich, ob es Jens auch schien, dass er jeden Satz von mir schon einmal gehört hatte.
Ich setzte mich und nahm mir ein Brötchen. Seit einundzwanzig Jahren frühstückten Jens und ich zusammen. Gab es Menschen, die sich über Routine freuten? Ich konnte es mir nicht vorstellen. Aber bestimmt beruhigte sie viele. Wenn man einundzwanzig Jahre vorweisen konnte, war die Wahrscheinlichkeit groß, dass es noch weitere Jahre so weitergehen würde: ein vertrauter Mensch morgens am Frühstückstisch, der genau die richtigen Brötchen besorgte. Plötzlich konnte ich auch unter größter Anstrengung nicht mehr verstehen, was daran beruhigend sein sollte. Ich versuchte mir vorzustellen, wie es war, allein zu sein, und wartete auf ein Gefühl von Einsamkeit und Verlorenheit, aber ich spürte nur eine Aufbruchsstimmung. War das der Moment, in dem ich eine abschüssige Straße betreten hatte, von der es kein Zurück mehr gab? Das war das vorletzte Gewicht auf der Waagschale.
Dann hob Jens den Kopf und lächelte mich an. »Wie war’s im Stadtpark?«, fragte er. »Dass du dich so aufraffen kannst!« Der Augenblick war vorüber, spürte ich und lächelte zurück. Ein eigensinniger Teil von mir wollte den Gedanken an die abschüssige Straße festhalten, aber ich drängte ihn in einen dunklen Winkel meines Kopfes und vertraute auf die deutlichen Farben der Realität, die meine diffuse Unruhe überdecken würden. Später, als ich Abstand zu Jens genommen hatte, erinnerte ich mich seltsamerweise an diesen Morgen, obwohl er im Grunde gewesen war wie jeder andere Sonntagmorgen. Ich erinnerte mich an seine Frage und daran, dass wir uns angesehen hatten, aber geantwortet hatte ich nichts. Und offenbar hatte er gar keine Antwort erwartet.
Auch der Auszug unserer Kinder lag in der Waagschale. Zuerst war Marie ausgezogen und kurz darauf Linus. Damit war, ehrlich gesagt, die Waagschale schon ganz schön voll gewesen. Meine Freundin Carola war auch keine Hilfe gewesen. Sie erzählte bereits seit Jahren davon, dass in Berlin ein großer Frauenüberschuss herrsche und wir froh sein könnten, nicht mehr auf der Suche zu sein. Das klingt jetzt vielleicht naiv, aber ich war darüber nicht froh, ich wurde davon über die Jahre immer unglücklicher und unglücklicher. Ich wollte nicht mit Jens zusammenbleiben, weil ich sonst keinen mehr abbekommen würde. Ich fühlte mich zunehmend wie die mit dem Trostpreis, die unglücklicher war als die ganz ohne Preis, weil sie sich nicht einmal beklagen durfte. »Du bist unzufrieden mit deinem Mann? Sei froh, dass du überhaupt einen hast! Ein Trostpreis ist doch besser als nichts!« Aus eigener Erfahrung konnte ich sagen: Das war eine Fehleinschätzung.
Am nächsten Tag hatte ich im Biomarkt den Flyer von Ralf gefunden: Werbung für Überlebenswochenenden im Berliner Umland. Noch am selben Abend hatte ich mich online zu einem »Sommerkurs Survival for Beginners« angemeldet. Ich würde lernen, wie man Feuer macht, wie man einen einfachen Unterstand baut und welche Pflanzen man im Sommer finden und essen kann. Die Ankündigung für Herbst beinhaltete die entsprechenden Pflanzen und die Herstellung von Fischernetzen aus Pflanzenfasern und Klebstoff aus Naturstoffen.
Ich war mit Feuer und Unterstand mehr als zufrieden. Wenn mir das gefiel, konnte ich mich danach immer noch zum Herbstkurs anmelden.
///
Und hier war ich nun.
»Schön, dass ihr alle hergefunden habt«, sagte Ralf. Er duzte uns, ohne es zum Thema gemacht zu haben. Ich duzte eigentlich nur meine Freunde und vermied bei der Arbeit, wenn möglich, die persönliche Anrede, um niemanden auf die Idee zu bringen, mir das Du anzubieten. In der Nähe des Parkplatzes befand sich eine kleine Wiese, auf der wir uns für die Vorbesprechung im Kreis niederließen. Es war trotz der frühen Stunde schon angenehm warm. »Ich hoffe, ihr habt alles dabei, was auf der Liste stand«, begann Ralf. Außer einem Schlafsack und einer Trinkflasche waren das ein Taschenmesser, eine Trillerpfeife und eine Taschenlampe gewesen. Mir gegenüber saß der Junge, der jetzt halblaut mit seiner Mutter über die Sache mit dem Taschenmesser zu argumentieren begann. »Ich stelle mich mal vor. Ich bin Ralf, aber das wisst ihr sicher schon. Bitte nennt euren Namen und erzählt uns, warum ihr euch bei diesem Survivalkurs angemeldet habt.«
Jennifer machte den Anfang. Sie liebe es, in der Natur zu sein, und lerne bei jedem Aufenthalt etwas über die Natur und über sich dazu. Dirk sagte: »Man muss sich für den Ernstfall vorbereiten«, und auf Ralfs freundliche Nachfrage präzisierte er, dass er einen Atomkrieg erwarte. Danach schwieg er weiter. Nun folgte die Familie: Die Eltern hießen Andreas und Julia, ihre Kinder Gustav und Greta. Der blonde Gustav war kompakt und groß für sein Alter, sein mürrischer Gesichtsausdruck passte zu seinem schmalen Mund. Die jüngere Greta war zart, dazu hatte sie dunkles, ungewöhnlich dichtes Haar. Ein schwerer Pony drückte ihr rundes Gesicht in die Breite und ihre wachen Augen huschten unentwegt von einem zum anderen. Beide trugen helle Bauchtaschen, die ganz offensichtlich noch nie benutzt worden waren. Mir schwante nichts Gutes, als wir eine halbe Ewigkeit darauf warten mussten, bis die Kinder selbst ihre Namen gesagt hatten. Die Eltern wollten das offenbar nicht für sie tun und die Kinder wollten ihre Namen eigentlich auch nicht nennen. So mussten wir warten, bis die Eltern mit hellen Kinderstimmen lange genug auf sie eingeredet hatten, dass die beiden – das Mädchen scheu, der Junge mürrisch – ihre Namen für uns hervorgewürgt hatten, zweimal, weil der erste Anlauf beide Male zu leise gewesen war. »Danke, dass ihr uns eure Namen gesagt habt«, sagte Andreas und ich musste grinsen. Kurz fing ich Jennifers Blick auf und sie zwinkerte mir zu. »Wir wollen ein echtes Erlebnis mit unseren Kindern haben«, sagte Andreas und blickte bedeutungsvoll von einem zum anderen. Julia nickte dazu.
Ich spürte, wie mir das Blut in den Kopf stieg, als nun ich an der Reihe war. »Das mit dem Überleben hat mich direkt angesprochen, im Speziellen natürlich auch das Feuermachen«, sagte ich unangenehm gestelzt, »das sollte eigentlich jeder können: überleben.« Ich merkte selbst, wie lahm das klang. »Ich wollte das jedenfalls unbedingt lernen«, fügte ich hinzu und fragte mich, warum ich mich nicht wie Jennifer kurz halten konnte. Ich warf Ralf einen Blick zu wie ein Kind, das sich vergewissert, ob die Eltern einverstanden sind. Ralf nickte mir freundlich zu und ich spürte, wie mein Gesicht langsam weniger brannte.
Die Frau neben mir hieß Rita und suchte neue Wege der Erleuchtung, wie sie sagte. Heute wollte sie eine intensivere Beziehung zum Wald aufbauen. Die Letzte in der Runde war eine Frau, deren Namen mit C ich sofort wieder vergaß. Auch sie wollte sich darauf vorbereiten, dass etwas Schlimmes passieren konnte. »Nicht unbedingt ein Atomkrieg«, fügte sie hinzu, ging aber nicht weiter ins Detail.
Ralf ergriff wieder das Wort. »Eine Nacht im Wald ist eine echte Herausforderung«, sagte er. »Ich möchte, dass ihr jetzt in euch hineinspürt, ob es etwas gibt, wovor ihr Angst habt, wenn ihr an die nächsten vierundzwanzig Stunden denkt, die nun vor uns liegen.«
Wir schwiegen eine Weile und ich stellte überrascht fest, dass tatsächlich Angst in mir aufstieg. »Es wird ganz schön dunkel sein im Wald«, platzte ich heraus.
Ralf nickte mir wieder freundlich zu. Er ließ uns die Funktion unserer Taschenlampen überprüfen und wies uns darauf hin, dass wir uns vor dem Einschlafen vergewissern sollten, ob wir die Taschenlampe griffbereit hatten. »Ihr solltet sie sofort einschalten können, wenn ihr wach werdet und euch unwohl fühlt.«
Langsam nahmen die nächsten Stunden in meinem Kopf konkretere Formen an. Das fühlte sich zugleich gut und beunruhigend an – so genau hatte ich es mir bisher nicht ausgemalt und plötzlich erschien es mir fast unmöglich, mich auf eine stockfinstere Nacht mit einer Gruppe Fremder einzustellen. Das ist eine Herausforderung, redete ich mir ein und versuchte, zuversichtlich zu sein. Eine Nacht, sagte ich mir. Was ist schon eine Nacht? Rita hatte Angst, sich zu verletzen, und Ralf präsentierte uns seine Notfalltasche, in der er Pflaster, Desinfektionsspray und Verbandszeug aufbewahrte. Und die Zeckenzange gegen die Zecken, vor denen Julia und Andreas Angst hatten. Ich war froh, dass Rita außerdem noch Schlangen und andere größere Tiere erwähnte, denn ich hätte ungern noch etwas angesprochen, vor dem ich Angst hatte. Es war seltsam, plötzlich vor so vielem Angst zu haben. Es war nur ein harmloser Wald, redete ich mir ein, aber Ralfs Erklärungen trugen deutlich mehr dazu dabei, mich zu beruhigen, als meine innere Stimme. »Ringelnattern haben keinen Giftzahn«, sagte er zum Beispiel, »und selbst diese harmlosen Schlangen werdet ihr vermutlich nicht zu Gesicht bekommen.« Schließlich klatschte Ralf in die Hände. »Dann wollen wir mal aufbrechen«, sagte er und stand mühelos auf. Wir anderen quälten uns in den Stand und ich beschloss insgeheim, außer Laufen auch noch Gymnastikübungen in mein Sportprogramm aufzunehmen. Während er unsere Handys einsammelte (das hatte ebenfalls in der Mail gestanden, aber ich spürte trotzdem, wie schwer es mir fiel), sprach Ralf weiter: »Ich hoffe, ihr habt eure Wasserflasche dabei, denn wir werden eine Weile unterwegs sein, bis wir an einen Bach kommen, dessen Wasser wir trinken können.«
Ich machte mir ein wenig Sorgen wegen der beiden Kinder, aber Ralf würde vermutlich wissen, was er tat. Noch auf der Wiese erzählte uns Ralf zahllose Dinge. Er begann damit, wie ein Wald entstand. Er wies uns auf ein paar Birken hin und darauf, wie klein deren Blätter waren. »Birken gehören zu den ersten Bäumen, die sich ansiedeln«, sagte er. »Sie sind anspruchslos, sie wachsen schnell und ihre kleinen, leichten Blätter wandeln sich im Herbst rasch in gute Erde um. Ihnen folgen die langsamer wachsenden Bäume, die höher wachsen und mehr Schatten spenden und auf diese Weise die Birken verdrängen. Achtet ruhig einmal darauf, ob ihr tiefer im Wald noch Birken findet.« Er erzählte von Mythen, in denen Birken eine wichtige Rolle spielten, und ließ uns dann vorsichtig trockene Rinde von zwei Birken abschälen, die ein Sturm mitsamt den Wurzeln gefällt hatte. »Die brauchen wir später zum Feuermachen«, erklärte Ralf. »Denkt ruhig, wenn ihr Birken seht, immer daran, trockene Rinde mitzunehmen. Man weiß nie, wann man sie brauchen kann.«
Als er unsere Messer erwähnte, kam es zu einer Diskussion zwischen Gustav und seiner Mutter. Zuletzt bekam er seins und hackte so heftig auf einen Baum ein, dass ich befürchtete, für die Familie würde das Wochenende bereits wenig später beendet sein. Ralf ließ uns Zweierteams bilden und glücklicherweise war Jennifer in meinem. Ich musterte sie von der Seite und freute mich über ihre vielen Sommersprossen. Die Eltern taten sich jeweils mit einem der Kinder zusammen. Ralf überreichte nun jedem Zweierteam einen Kompass. »Haltet euch immer in Richtung Norden«, sagte er. Mithilfe sparsamer zusätzlicher Anweisungen verteilte er uns so im Gelände, dass wir die anderen Teams nur noch vereinzelt im Blick hatten. Falls wir die anderen vollständig aus den Augen verlieren oder wegen des Weges unsicher sein sollten, wäre der Moment gekommen, die Trillerpfeife zu benutzen. »Aber ich habe Vertrauen in euch. Das solltet ihr auch tun. Manchmal werdet ihr denken, dass ihr in die falsche Richtung gegangen seid. Aber wenn ihr euch immer an den Kompass haltet, kommt ihr zuletzt am Bach an, wo wir uns wiedertreffen.«
Mir war ein bisschen mulmig zumute, aber ich freute mich auch. Noch nie hatte ich einen Kompass benutzt. Mit dem kleinen fremden Gegenstand in der Hand konnte ich eine Weile nicht mehr aufhören zu strahlen, so aufgeregt war ich.
Jennifer hatte das schon einmal gemacht, daher ließ sie mich die Richtung bestimmen und folgte mir. Zuerst hatte es noch einen klar erkennbaren Weg gegeben, doch schon bald schlängelten wir uns mehr durch den Wald, als dass wir gingen. Wir mussten im Zickzack laufen, um dichtem Unterholz auszuweichen, und ich war jedes Mal erleichtert, wenn es bemooste Pfade gab, die mehr als schulterbreit waren. Ich hielt den Kompass so fest umklammert, als hinge mein Leben davon ab, und musste mich regelmäßig dazu zwingen, meine Hand ein wenig zu entspannen. Ralf hatte uns aufgefordert, bewusst durch den Wald zu wandern. Wir sollten auf alles achten, was uns begegnete, auf die Geräusche und Gerüche und auf unsere Gefühle. Ich staunte darüber, wie unterschiedlich alles war, Geräusche und Gerüche, und ich staunte darüber, wie sehr mich das alles verunsicherte. Ich hörte Vögel, die ich nicht zu Gesicht bekam, und zwischendurch knackte es in der Nähe so laut, als würden wir von einem großen Tier begleitet, das sich nicht zeigte. Ich blickte zu Jennifer, wenn ich das große Tier hörte, und es beruhigte mich, wie entspannt sie war. Ob Jens das alles gefallen würde? Würde er sich wie einer der Männer dieser Gruppe hier anstellen, so praktisch wie Ralf oder so unpraktisch wie Dirk? Er war ein guter Vater gewesen, erinnerte ich mich, nicht wie Andreas, der von seinen Kindern so seltsam getrennt zu sein schien – trotz oder vielleicht auch wegen seiner übertriebenen Sorge. Als unsere Kinder klein gewesen waren, hatte ich Jens oft wild geliebt, wenn ich ihn mit Marie oder Linus gesehen hatte. Er hatte sie sich mit einem Schwung auf die Schultern gesetzt und an jeder niedrigen Tür und an jedem Baum so instinktiv die Hand über die Köpfe unserer Kinder gehalten, als wären die Winzlinge auf seinen Schultern Teil seines eigenen Körpers. Er hatte ihnen im Kinderzoo gezeigt, wie man die kleinen Zicklein fütterte, und mit der anderen Hand sämtliche große Tiere in Schach gehalten. Jens hatte die schlafenden Kinder noch nach Hause getragen, als sie schon so groß waren wie Gustav, und war jedem Wutanfall mit entwaffnender Gelassenheit begegnet. Wann habe ich aufgehört, diese wilde Liebe für ihn zu empfinden? Als die Kinder in die Pubertät kamen? Früher? Später? Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass etwas vorgefallen war, etwas, auf das ich den Finger hätte legen können.
Andreas und Greta tauchten rechts von uns auf. Greta redete ohne Pause auf ihren Vater ein, dem das Haar mittlerweile kreuz und quer vom Kopf abstand. Außerdem war er mit seiner Funktionshose irgendwo hängen geblieben, durch den großen Triangelriss sah man ein erstaunlich behaartes Bein. Sie verschwanden wieder. Jens hatte zwar jede Menge Haare auf dem Kopf, war am Körper aber kaum behaart. Ich versuchte, weniger an Jens und mehr an das zu denken, was vor mir lag. Ich registrierte Bäume mit bemoosten Seiten und überlegte, welche Himmelsrichtung das Moos anzeigte. Norden? Ich prüfte den Kompass in meiner Hand. Es war die Westseite. Im Osten geht die Sonne auf, rekapitulierte ich. Dort lag das Morgenland. Ich sollte bestürzt darüber sein, wie wenig ich über die grundlegenden Dinge weiß, dachte ich. Ich kann kein Feuer machen, ich kann keine Vogelstimmen erkennen, ich kann Himmelsrichtungen nicht am Moos erkennen.
Kann ich doch, schob ich dann in Gedanken hinterher. Das habe ich gerade gelernt und ich werde es nicht mehr vergessen. Das fühlte sich besser an als jede Fortbildungsveranstaltung des Jobcenters in den letzten zehn Jahren. Ich merkte aber auch, dass das ein verrückter Gedanke war. Der Wald war längst nicht mehr ein Wald, wie ich ihn am Wochenende manchmal durchstreifte, der Grunewald oder der Tegeler Forst. So stellte ich mir einen europäischen Urwald vor, ehe es Menschen gegeben hatte, einen unberührten, Menschen gegenüber feindseligen Wald. Je mehr gigantische Wurzeln und moosüberwucherte Stellen mit dichtem Unterholz ich sah, desto kleiner und unbedeutender kam ich mir vor. Es war zugleich ein gutes und ein unbehagliches Gefühl: Ich konnte mich in den Schutz von etwas Größerem stellen, verlor aber auch so an Bedeutung, dass es fast war, als würde ich körperlich schrumpfen. Es roch gut. Mit jedem Zug atmete ich Stadtluft aus und Wald ein, bis jede Zelle meines Körpers mit diesem leisen Geruch nach Erde und lebendiger Rinde gefüllt war. Meine Schuhe waren zu warm und ich machte mir ein bisschen Sorgen, dass meine Socken feucht werden und Blasen verursachen könnten. Einige Momente fühlte ich nur in meine Schuhe hinein. Meine Füße hatten kaum Spielraum und auch wenn ich auf aus dem Boden ragende Wurzeln oder Steine trat, war es, als steckten meine Füße in sicheren Schienen. Keine Blasengefahr, hoffte ich.
///
Ich erinnerte mich an den Freitag nach meiner Anmeldung. Wir saßen im Leuchtturm, unserer Lieblingskneipe in Schöneberg: Carola, Hilke und ich. Das taten wir beinahe jeden Freitagabend, seit unsere Kinder in den gleichen Kindergarten gegangen waren. Es gefiel mir, dass wir uns für unsere Treffen immer so sorgfältig aufbrezelten, als hätten wir Dates. Wenn Carola direkt aus dem Büro kam, schminkte sie sich zu ihrem Businesskostüm nur aufwendig die Augen, aber wenn sie vorher zu Hause vorbeigefahren war, trug sie am liebsten teuer aussehende Designerpullover, die lang genug waren, um ihre Oberschenkel zu kaschieren. Die waren ihr zu breit, das hatte sie einmal zugegeben, als sie sehr betrunken war. Seitdem hatte sie nie wieder eine Schwäche eingestanden. Hilke war die Größte von uns und sie bastelte sich zu unseren Treffen vor allem aufwendige Frisuren. Selbst zu Schulzeiten, als ich meine Haare noch länger getragen hatte, hatte ich keinerlei Talent für so etwas gehabt, für mich waren kurze Haare perfekt. Nebeneinander sahen Carola, Hilke und ich aus wie eine ehemalige gecastete Mädchenband: eine groß und schlank, eine mittelgroß und üppig, eine klein und ohne nennenswerte Kurven – so unterschiedlich, dass für jeden Geschmack etwas dabei war.
»Mit kleineren Händen und Füßen würdest du in allen Männern den Beschützerinstinkt wecken«, hatte Carola heillos betrunken zu mir gesagt, als sie auch über ihre Oberschenkel gesprochen hatte. Mich hatte diese Feststellung richtiggehend schockiert. Den Grund dafür konnte ich gar nicht richtig erklären – vielleicht, weil es eine Beleidigung war, verpackt in einem Kompliment. Oder ein Kompliment, verpackt in einer Beleidigung. Vielleicht aber auch, weil ich an meine Eltern gedacht hatte und daran, wie sehr ich äußerlich meiner Mutter ähnelte. Daran, was für eine gefräßige Form es haben konnte, von einem Mann beschützt zu werden.
Vorher hätte ich gesagt, ich hatte keine Erwartungen an meine beiden Freundinnen, wenn ich ihnen von dem Survivalwochenende erzählte. Aber dann sagte Carola: »Überlebenstraining, ernsthaft?«, Hilke verzog das Gesicht und Carola fügte hinzu: »Erst laufen lernen, dann überleben lernen, darunter machst du’s wohl nicht, was?« Und als Hilke dann Carola anstupste und ihr »Lass sie mal machen« zuraunte, als würde ich nicht direkt danebensitzen, da wusste ich, dass ich doch Erwartungen gehabt hatte: Ich hatte erwartet, dass sie meine Freundinnen sein würden. Dass sie auf meiner Seite sein und sich nicht über mich lustig machen würden.
»Findet ihr das blöd?« Ich war nicht verärgert, stattdessen fühlte ich mich in die Ecke gedrängt. »Das sind doch interessante Dinge, die man da lernen kann! Und was mache ich sonst mit meinen Wochenenden?« Nichts als Rechtfertigungen.
Hilke hatte etwas gespürt und mir über die Hand gestrichen: »Alles in Ordnung, Ellen, lern du mal überleben, es klingt halt irgendwie, na ja …«
»Was meinst du?«, hatte ich fast fassungslos gefragt. »Wonach klingt es?«
»Nach Midlife-Crisis?«, fragte Hilke tastend. Carola lachte auf und ihre schmalen Augen blitzten. »Das ist echt ein bisschen klischeehaft, findest du nicht?«
Nein, fand ich nicht. Ich kannte niemanden, der einen Überlebenskurs machen wollte. Aber vielleicht verstand ich einfach nicht, was sie meinten.
»Kann sein«, ich versuchte, leichthin zu klingen, und wollte nur noch das Thema beenden. »Was habt ihr denn kommendes Wochenende vor?«
Hilke ging samstags immer mit ihrem Mann und gemeinsamen Freunden Squash spielen. »Sonntag fahren wir an die Ostsee, ein Kurztrip«, erzählte sie. Hilkes Mann hatte immer Hummeln im Hintern und war dann am liebsten mit vielen Menschen unterwegs, immer mit Hilke und einer Gruppe.
Carola hingegen hatte sich vor einigen Jahren von dem Vater ihrer Kinder getrennt und dann einige Jahre in Clubs herumgetrieben. Ich war damals total fasziniert gewesen, weil sie sich ausgerechnet auf diese Weise wieder ins Getümmel gestürzt hatte. In unserem Alter, hatte ich gedacht, mit fast vierzig. Ich hätte gar nicht gewusst, wo man in unserem Alter noch Gleichaltrige zum Tanzen treffen konnte. Carola wusste es. Nach zwei Jahren lernte sie auf diese Weise Alexander kennen. Er war zehn Jahre älter als sie, bereits grauhaarig und dass sie ihn beim Tanzen getroffen hatte, war reinstes Glück gewesen, so etwas hatte er nie zuvor und nie danach gemacht. Er war sehr ernst und mir fiel es schwer, mit ihm ins Gespräch zu kommen. »Wir sind bei Alexanders Schwestern«, erzählte Carola. »Wir wollen gemeinsam kochen.« Damit hatte ich beide von meinem Überlebenswochenende abgelenkt. Ich kam nicht mehr darauf zurück, auch zu keinem späteren Zeitpunkt.
///
Jens erzählte ich schließlich gar nicht erst von meinem Plan. Als ich außerdem noch log und ihm erzählte, dass ich mit Carola und Hilke an die Ostsee fuhr, spürte ich mehr als den Anflug eines schlechten Gewissens. Ich bin nicht abergläubisch, aber ich wäre gern sicher gewesen, dass mich Jens schon einmal angelogen hatte, damit wir nun quitt waren. Stattdessen hatte ich das mulmige Gefühl, dass Jens nun eine Lüge frei hatte. Trotzdem konnte ich ihm einfach nicht die Wahrheit sagen. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass er mich mit diesem leeren Blick ansehen würde, mit dem er inzwischen die meisten meiner Ideen und Probleme quittierte. »Du willst laufen gehen, gut«, hatte er gesagt und ich hatte ihm nicht erzählen können, warum das plötzlich so eine Bedeutung für mich hatte. »Die Kinder sind ausgezogen, wurde doch auch Zeit«, hatte er gesagt und ich hatte mir die Tränen verkniffen. Ich konnte ihm den Überlebenskurs nicht zum Fraß vorwerfen.
///
Ich schüttelte die Erinnerungen ab und gab mein Bewusstsein wieder für Vogelstimmen frei. Die Zeit, bis Jennifer und ich den Bach erreichten, verging rätselhafterweise sehr schnell und gleichzeitig sehr langsam. Plötzlich waren wir da, als hätten wir nur einen Wimpernschlag gebraucht, doch ich war so prall gefüllt mit Eindrücken, als hätte ich sie nicht eine Stunde, sondern eine ganze Woche lang aufgesaugt. Der Bach machte kleine Geräusche, als wäre er lebendig, und mir war, als hätte ich so etwas Schönes noch nie in meinem Leben gesehen. Durch das klare Wasser erkannte ich im Bachbett rund geschliffene Steine in allen Farben und unfassbar saftiges Gras säumte das Ufer. Ich kniete mich ans Wasser und hielt eine Hand hinein und auch das schien ein so schönes Gefühl zu sein, dass ich mich an nichts Vergleichbares erinnern konnte. Es war kühl und erfrischend und so rein, als könnte es mir durch die Haut alles aus dem Körper waschen, was sich dort ungefragt angesammelt hatte. Es plätscherte leise gegen meine Hand und staunend beobachtete ich die winzigen Strudel, die zwischen meinen Fingern entstanden und verschwanden, je nachdem wie ich die Hand hielt. Die Schatten tanzten am Rand des Wassers und ich verschmolz mit dem Wasser, dem Licht und den Geräuschen, die mich einhüllten wie ein Schutzmantel.
Nach und nach kamen auch die restlichen Gruppenmitglieder an und wir setzten uns in einen Kreis auf einer Lichtung nah des Baches und teilten unsere Erlebnisse. »Ich bin richtig stolz auf uns«, sagte ich. Es erleichterte mich, dass Ironie in dieser Gruppe völlig überflüssig war. Hier erlebte man alles ganz unmittelbar: Der Boden war hart, das Bachwasser war kalt, die Vogelstimmen waren wunderschön. In diesem Moment war es so ungefiltert hell, wie es nachher vollständig dunkel sein würde. Mir fiel auf, wie selten ich normalerweise über meine Gefühle sprach, ohne jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Mir fiel auf, wie wenig ich überhaupt über meine Gefühle sprach. War das immer schon so gewesen? Es war schön, diesen Fremden gegenüber alles aussprechen zu können. Alle taten das, sie sprachen von ihren Befürchtungen, von ihren Glücksgefühlen und ihren Ängsten.
»Überleben kommt mir viel schwieriger vor als erwartet«, sagte ich und die Frau mit C nickte.
»Die Germanen wussten, dass die Bäume und andere Pflanzen des Waldes untereinander Kontakt halten«, erzählte uns Ralf anschließend. »Dieses Wissen hatten die Menschen über viele Jahrhunderte verloren. Erst in den letzten Jahren erforscht man das verstärkt und stellt fest, was die Germanen schon vor weit mehr als tausend Jahren wussten: Es gibt ein Kommunikationssystem im Wald, das wir nicht sehen und die meisten von uns auch nicht spüren können. Bäume können sich gegenseitig Gefahr über große Entfernungen mitteilen und darauf reagieren. Pflanzen können Gifte produzieren, weil die anderen ihnen Feinde angekündigt haben. Die Germanen wussten, dass sie den Wald achten mussten.«
Alle hingen an Ralfs Lippen, bis auf Dirk, der neben mir saß und sich offenbar Blasen gelaufen hatte. Er hatte sichtlich Schmerzen, sobald er sich bewegte, und schließlich sprach ich ihn leise darauf an. Gequält blickte er mich an und nickte. Seine Schuhe waren neu, sogar ich wusste, dass das eine dumme Idee gewesen war. Aber es war gemein, das zu denken, er war gestraft genug. Immerhin hatte ich es nicht ausgesprochen.
Auch Ralf merkte, dass Dirk litt. Er begann, etwas über die großartige Wirkung von Urin zu erzählen. »Dirk kann uns das demonstrieren«, fuhr er fort. »Er hat Schuhe, deren Leder sehr stabil ist. Das schadet auf Dauer den Füßen, aber man kann es mit Urin ohne Schwierigkeiten geschmeidig machen. Dirk wird nun in seine Schuhe pinkeln und sie dann aufrecht stellen, damit der Bereich an der Ferse ordentlich durchtränkt werden kann.« Ralf nickte Dirk freundlich zu und dieser war nicht der Typ für Widerworte, auch wenn es schien, als wäre er denen noch nie so nahe gewesen wie in diesem Moment. Widerworten oder Tränen, das hätte ich nicht sagen können. Jedenfalls verschwand er und kam kurz darauf auf Socken zurück. Ich war maßlos froh, dass ich keine neuen Wanderschuhe trug – um nichts in der Welt hätte ich in Dirks Haut stecken und als Lehrauftrag in meine Schuhe pinkeln wollen. Das Experiment als solches fand ich höllisch interessant, allerdings auch ziemlich unappetitlich, obwohl ich mir einredete, dass so etwas völlig natürlich war. Ich sah den anderen an, dass sie dieselbe Mischung aus Interesse und leisem Ekel spürten. Die Kinder waren von Julia passgenau abgelenkt worden, vermutlich hätte sich sonst der Rest des Wochenendes um nichts anderes mehr gedreht.
Ralf lächelte den zurückgekehrten Dirk an wie einen folgsamen Schüler. Er hatte in der Zwischenzeit etwas gefunden, was er nun zwischen den Fingern knetete, um uns danach zu zeigen, wie man den Brei auf die roten Stellen an Dirks Füßen auftragen konnte. »Das ist Breitwegerich«, erklärte er. »Wanderer können bei Beschwerden einfach ein Blatt auf die Ferse auflegen. Es ist ein ziemlich potentes Heilkraut mit vielen verschiedenen Inhaltsstoffen.« Er zählte an den Fingern ab: »Allantoin unterstützt die Zellregeneration, Aucubin wirkt antibiotisch, Gerbstoffe, das sind echte Alleskönner, sie schützen das Gewebe vor dem Eindringen von Bakterien und Pilzen, hemmen Entzündungen, wirken schmerzlindernd, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und die Feuchtigkeit kühlt.«
Ich staunte nicht zum ersten Mal über Ralfs ausgedehntes Wissen und war besorgt, ob ich mir auch nur einen Bruchteil davon würde merken können. Ralf zeigte uns das unscheinbare Wunderkraut und ich hoffte, dass ich es mir einprägen würde.
Rita hatte offenbar den gleichen Gedanken: »Wenn du uns unsere Handys gibst, können wir es fotografieren«, sagte sie, doch Ralf zog nur bedauernd die Augenbrauen hoch.
Ich suchte mir eine Breitwegerichpflanze, riss vorsichtig das Stück eines Blattes ab und rieb es zwischen Daumen und Zeigefinger. Zunächst passierte gar nichts, aber als ich den Druck erhöhte, wurde es nach und nach zu einem matschigen Brei, dunkler als das Blatt. Ich hielt ihn unter die Nase, er roch nach saftiger Wiese. Genießbar war er allerdings nicht, ich prüfte es mit der Zungenspitze und er schmeckte leicht bitter.
Einige von uns saßen auf ihren Jacken, ich hatte mich direkt auf den Waldboden gesetzt. Es gefiel mir hier und ich mochte es, nur meine Hose zwischen mir und dem Boden zu spüren. Ich hätte das niemals laut ausgesprochen, weil es so sonderbar klang, aber ich fühlte mich zwischen den Bäumen wie von ihnen beschützt. Als würden sie wohlwollend auf uns herabblicken, weil wir ihnen nichts Böses wollten, sondern von ihnen lernen.
Ich konnte mittlerweile verschiedene Vogelstimmen voneinander unterscheiden. Auch das Wasser machte Töne, helle und durchscheinende. So gut hörte ich normalerweise selten hin, in der Stadt wollte ich Geräusche ausblenden und nicht voneinander unterscheiden.
Das Gesicht von Dirk neben mir war immer noch rot, es nahm erst wieder eine halbwegs normale Farbe an, nachdem die Aufmerksamkeit der Gruppe sich dem nächsten Thema zuwandte: dem Bach. Ralf erzählte uns, wie wichtig Wasserläufe nicht nur für unseren Flüssigkeitsbedarf waren, sondern auch zur Orientierung und Ernährung. Er nutzte die Gelegenheit und wies uns auf den nächsten Überlebenstrainingskurs hin, in dem man lernen konnte, Netze aus Naturmaterialien zu knüpfen und Fische zu fangen. Dann zeigte er uns ein paar Kräuter, die in Wassernähe wuchsen, und erklärte uns, welche davon essbar waren und welche als Heilkräuter Verwendung fanden. Ich merkte, wie ungeheuer hungrig ich war. »Doch ehe wir uns um unser Essen kümmern, werden wir uns einen Unterstand für die Nacht bauen«, sagte Ralf.
Während wir anderen handliche Rucksäcke getragen hatten, war seiner so groß gewesen, als würde er zu einer vierwöchigen Weltreise aufbrechen. Aus diesem zog er nun fünf schwere Planen. Ich war beeindruckt. Ralf war groß und breitschultrig, aber eher sehnig als muskulös. Jeweils zwei von uns sollten sich eine der Planen teilen, eine besonders große war für Julia, Andreas und die beiden Kinder gedacht. Ich teilte mir eine Plane mit Jennifer, die beiden Frauen waren so selbstverständlich ein Team, dass sie nicht einmal einen Blick wechseln mussten, und Dirk und Ralf teilten sich ebenfalls eine.
Unser Waldführer wies uns ein, nachdem wir Ideen darüber zusammengetragen hatten, worauf wir bei der Suche nach einem idealen Schlafplatz achten mussten. Auf den Untergrund. Auf die Windrichtung. Wir brauchten ziemlich lang, bis wir alle in einem halbwegs akzeptablen Umkreis eine Stelle für unser Schlaflager gefunden hatten. Jennifer hatte ein gutes Auge sowohl für einen guten Baum als auch für zumutbaren Untergrund, aber der Familie gelang das nur mit Ralfs Hilfe.
Wir stellten uns unterschiedlich geschickt an, ich zum Beispiel eher ungeschickt. Es war nicht so einfach, die Ecken der Plane, an denen praktischerweise verknotbare Schnüre angebracht waren, so an unserem ausgewählten Baum zu befestigen, dass wir eine Art Dach hatten. Unser erster Baum hatte seine ersten Äste zu weit oben, aber der zweite war passend. Ich versuchte, die Blätter zu identifizieren, aber ich musste passen. Keine Eiche, kein Ahorn, keine Birke, keine Kastanie: Das waren die einzigen Bäume, die ich zweifelsfrei identifizieren konnte. »Ist eine junge Esche«, erklärte Jennifer. Von so einem Baum hatte ich noch nie gehört. Jennifer lachte über mich, aber sie schien mich nicht auszulachen.
Endlich hatten wir einen brauchbaren Unterstand gebaut. Die Plane bildete Dach und Boden und wir legten unsere Schlafsackrollen hinein. Nach meinem alten Schlafsack hatte ich am Tag zuvor schier endlos gesucht, keine Ahnung, wann ich das Ding das letzte Mal benutzt hatte. Schwungvoll zog ich ihn aus seiner Hülle und rollte ihn aus. Er roch nach den Zeltwochenenden, als die Kinder noch klein gewesen waren und wir nur dafür Geld gehabt hatten. Er roch nach Nächten mit meinem Bruder, als wir Kinder und im Sommerurlaub an der Ostsee gewesen waren, auch wenn das damals in Wahrheit ein anderer Schlafsack gewesen sein musste. Mein Vater tauchte in meiner Erinnerung auf, wie er in kurzen Hosen den Grill bediente, es war eine schöne und friedliche Erinnerung.
In der vor uns liegenden Nacht wartete kein Zelt auf mich. Ich war aufgeregt wie ein Kind. Heute Nacht würde ich im Freien schlafen, dafür hatte ich mir gerade fast ganz allein mein Lager gebaut. Ich konnte mich nicht erinnern, wann ich zuletzt so zufrieden mit mir gewesen war. Während Jennifer und ich auf unseren Schlafsäcken einträchtig unter unserer dunkelgrünen Plane saßen, sprachen wir über uns und unsere Pläne der nächsten Zeit. Sie wollte eine mehrmonatige Reise in den Kaukasus unternehmen und formulierte das gar nicht überheblich mir und meinem kleinen Leben gegenüber. Trotzdem kam ich mir lang nicht mehr so kümmerlich vor wie in diesem Moment. »Du hast dich auch auf die Reise gemacht, Ellen«, sagte Jennifer. Wir saßen nebeneinander und blickten weiter in den Wald hinein. Es war einfacher, persönliche Dinge zu besprechen, wenn man sich dabei nicht ansah. Es war einfacher, persönliche Dinge mit einer beinahe Fremden zu besprechen. »Eine Reise geht immer nur Schritt für Schritt. Manchmal hebt man den Kopf und schaut in die Ferne, aber meistens sieht man nur auf den nächsten Schritt, damit man auf dem unebenen Weg nicht stolpert.«
»Und zwischendurch pinkelt man in seine Schuhe«, sagte ich und wir lachten leise. Es war gut, zu lachen. Es fühlte sich viel zu ungeübt an.
Nachdem alle ihre Unterstände gebaut hatten, machten wir uns an das Abendessen. »Denkt daran, dass ihr in der Wildnis immer zuerst euer Nachtlager baut und erst dann für das Abendessen sorgt«, schärfte uns Ralf ein. »Wenn es plötzlich dunkel wird, könnt ihr im Notfall auf das Essen verzichten, aber auf keinen Fall auf den Schlafplatz.«
Während wir Kräuter sammelten, förderte Ralf aus seinem Rucksack einige Schalen zutage und eine prall gefüllte Papiertüte. Unsere Kräutersuche war nur mäßig erfolgreich. Greta krähte: »Ich will keine Wiese essen«, und Gustav nickte, als hätte ihm seine Schwester das Wort aus dem Mund genommen. Andreas redete mit seiner Kinderstimme auf die beiden ein, dass sie in der Kita doch immer Salat essen würden, aber Greta meinte, dass der Salat in der Kita auch nicht schmecken würde, und Gustav nickte dazu.
Die fruchtlose Diskussion wurde durch Ralf beendet, der ankündigte, uns nun mit dem Feuermachen vertraut zu machen. »Jetzt kommt eure Birkenrinde zum Einsatz«, sagte Ralf. »Außerdem braucht ihr Distelsamen. Erinnert ihr euch, dass ihr jede Gelegenheit nutzen solltet, Birkenrinde mitzunehmen? Das Gleiche gilt für Distelsamen.« Er zeigte uns ein paar hüfthohe Disteln, die in der Nähe wuchsen, und erklärte uns genau, woran man Disteln erkennen konnte, sowohl im blühenden als auch im abgeblühten Zustand. Vorsichtig lösten wir Distelsamen von der trockenen Pflanze. Greta stach sich an den Stängeln und fing an zu weinen. Julia wollte sie trösten, doch Greta strampelte sich frei und schrie, dass sie Samen brauchte und alle ihr die wegnehmen würden, wenn ihre Mutter sie nicht sofort losließ. Julia ließ sie fallen wie einen heißen Gegenstand und Greta warf sich mit so viel Schwung auf die Distel, dass sie beinahe wieder in den Dornen landete, doch diesmal ging es gut. Zuletzt zeigte uns Ralf, woran man Feuersteine erkannte. »Das ist die schwierigste Aufgabe«, betonte er. »Das ist etwas für Könner. Ich weiß, dass es an diesem Bachlauf Feuersteine gibt.« Er zeigte uns ein regelrechtes Nest aus dunklen Steinen. »Aber manchmal kann man sehr lang suchen, bis man welche findet. Am besten ist, wenn man in der Wildnis immer einen Feuerstein dabeihat.« Gustav räumte daraufhin seinen kleinen Rucksack mit den Feuersteinen aus dem Bachlauf voll.
Wir setzten uns wieder in einen Kreis und Ralf präsentierte uns ein extravagant geformtes Stück Metall. Es war ungefähr handtellergroß, besaß eine schmale Fläche und lief in zwei geschwungenen Enden aus, die sich beinahe trafen. Auf diese Weise konnte man es gut festhalten, um mit der schmalen Fläche am Feuerstein entlangzuschlagen. Was bei Ralf so einfach aussah, erwies sich als nahezu unmöglich: Nur Jennifer gelang es, ein paar Funken zu erzeugen, wir anderen reichten nach mehreren erfolglosen Versuchen Feuerstein und Schlageisen weiter. »Ihr müsstet ein wenig üben«, tröstete uns Ralf und förderte eine Art Metallstift am Ring zutage. Er hatte einen Durchmesser von etwa einem halben Zentimeter und bestand aus einem stumpf dunkelgrauen Material. »Das ist ein Magnesiumstab«, sagte Ralf und ließ auch diesen herumgehen. »Mit eurem Taschenmesser könnt ihr damit Funken erzeugen«, erklärte er und zeigte es uns. Diesmal hatten wir alle Erfolgserlebnisse. Es war lustig, wie ungeheuer ausgelassen die Stimmung in der Gruppe wurde. Vor allem der kleine Gustav geriet in einen richtigen Rausch und gab den Stab erst her, als Ralf eingriff. Er reichte ihn Rita weiter und sie und die Frau mit C öffneten einander die Taschenmesser und schlugen im Wechsel Funken. Sie verstanden sich wortlos und plötzlich fühlte ich mich unendlich einsam. Für mich schien es nur Menschen zu geben, mit denen ich sprechen konnte, aber niemanden, mit dem ich mich wortlos verstand. Diese beiden brauchten sich nur zu einem Überlebenswochenende anzumelden und fanden schon einen solchen Menschen. Überleben schien etwas zu sein, in dem ich nicht einmal Anfängerin war, das schien mir einfach nicht zu liegen.
»Was gehen dir denn für traurige Gedanken durch den Kopf?«, Jennifer hatte sich zu mir gebeugt. Beinahe überrumpelt, sprach ich sie aus: »Ich glaube, Überleben liegt mir irgendwie nicht«, antwortete ich leise und lachte ein wenig hilflos.
Jennifer betrachtete mich lange von der Seite. »Du stehst an einem Scheideweg«, sagte sie leise. Die anderen in unserem Kreis waren mit anderen Dingen beschäftigt, mit den Kräutern oder dem Magnesiumstab, und ich fühlte mich beinahe ungestört. »Wenn du deinem Herzen folgst, wirst du schon den richtigen Weg einschlagen«, fügte Jennifer hinzu. Zu einem anderen Zeitpunkt hätte ich vielleicht die Augen gerollt über solch einen Satz. Zu einem anderen Zeitpunkt hätte ich gedacht, den Spruch kann sie meinetwegen auf ein Kissen sticken. Doch in diesem Moment schien es genau der richtige Satz für mich zu sein. Als wäre er gerade zum ersten Mal ausgesprochen worden und ganz allein für mich. Ich griff nach Jennifers Arm, der sich unter meiner Hand unerwartet muskulös anfühlte, und drückte ihn. Und dachte, ich schweige nicht mit allen Menschen in meinem Leben, mit Jennifer zum Beispiel tue ich das nicht.
Nun durften wir den Magnesiumstab nutzen, um unser eigenes kleines Feuer zu entzünden. Es war ein echtes Abenteuer und ich erkannte an den andächtigen Gesichtern der anderen, dass das nicht nur mein Eindruck war. Die Funken entfachten im Handumdrehen die Distelsamen, dadurch wurde die Birkenrinde entzündet und diese wiederum entzündete Späne und schließlich größere Holzstücke. Es war immer aufs Neue aufregend und nutzte sich überhaupt nicht ab. Ich war froh, dass ich nicht zu wenig Birkenrinde mitgenommen hatte, und als wir unzählige Male kleine Feuer entfacht und wieder gelöscht hatten, war kein einziger Distelsamen in der näheren Umgebung mehr übrig. Greta heulte deswegen und Gustav pirschte sich stattdessen an das große Feuer an. In der Zwischenzeit hatte Ralf nämlich aus seinem Feuer ein ansehnliches Lagerfeuer gemacht. Er schickte nun Rita los, um den mitgebrachten Topf mit Wasser zu füllen. Danach zeigte er uns, wie man eine Vorrichtung baute, mithilfe derer er den Topf über das Feuer hängen konnte. Es kam mir vor wie ein Zaubertrick, was er alles aus ein paar Ästen konstruieren konnte. »In Russland ist Buchweizengrütze ein Grundnahrungsmittel. Wir lassen unsere Grütze quellen und würzen sie mit den Kräutern, die wir gefunden haben. Dies ist ein Survivalkurs, da machen wir alle die Erfahrung, mit sehr wenig auszukommen. Ich habe trotzdem Salz mitgebracht, damit ihr eure Grütze zusätzlich würzen könnt.« Er förderte neben der größeren Papiertüte auch eine kleinere Tüte mit Salz zutage.
Es war keine leichte Aufgabe, unsere Portion quellen zu lassen, weil die Metallschüsseln entsetzlich heiß wurden und wir sie nicht festhalten konnten. Ein Wunder, dass trotz des unebenen Uferbodens niemandem von uns die Schüssel umkippte, während wir das heiße Wasser einfüllten.
»Igitt!«, Greta war ganz offensichtlich nicht so hungrig wie ich. Mir kam die gesalzene Grütze mit den Kräutern, die ich mir ausgesucht hatte, wirklich lecker vor. Zumindest enorm nahrhaft. Der Brei blieb auch nach dem Quellen ein wenig körnig und man schmeckte eine leicht bittere Note. Ich erinnerte mich, dass meine Großmutter keine Grütze gemocht hatte, und jetzt fiel mir auch wieder ein, dass sie sie immer zu bitter gefunden hatte. Trotzdem das ideale Essen nach einem Tag im Wald, fand ich. Mit dem warmen Schleim im Bauch stellte ich fest, wie erschöpft ich war. Den anderen schien es ähnlich zu gehen. Stumm saßen wir um das Lagerfeuer herum, angefüllt von den vielen Eindrücken.
Julia fragte irgendwann Ralf nach seiner Qualifikation und ich war nicht sicher, ob sie Konversation machen oder ihn abfragen wollte. Ralf erzählte etwas von einer Pädagogikausbildung und zahlreichen Fortbildungen, doch ich hörte nur mit halbem Ohr zu, weil ich das eigentlich gar nicht wissen wollte. Es kam mir vor, als würde sie damit Ralf entzaubern, als wollte sie beweisen, dass man ihn aus verschiedenen Aus- und Weiterbildungen zusammensetzen konnte, als könnte jeder so werden wie Ralf, selbst ein so linkischer Mensch wie Andreas, der gleich den ersten Löffel seiner Grütze auf seinen Pullover kleckerte und sie aus unerfindlichen Gründen inzwischen auch auf der Stirn kleben hatte. Stattdessen wollte ich, dass Ralf einfach nur der war, der im Wald nicht nur selbst überleben, sondern auch noch ganze Gruppen aus jeder Notlage retten konnte. Das hatte er nicht gelernt, er war einfach so. Es kam mir plötzlich unendlich tröstlich vor, dass es Menschen wie Ralf gab. Ich blendete die Diskussion zwischen Eltern und Kindern aus.
Ralf fragte uns, ob wir gemeinsam singen wollten. Er hatte eine Mundharmonika dabei und eine Maultrommel, ließ uns aber auch die Wahl, uns zurückzuziehen. Nur Jennifer und ich entschieden uns gegen Gesang am Lagerfeuer. Unser Unterstand befand sich aber so nah, dass wir gut hören konnten, wie sie »House of the Rising Sun«, »Sag mir, wo die Blumen sind« und andere Klassiker anstimmten.
Ralf hatte uns ökologische Zahnpasta gegeben, die die Umwelt nicht belastete, und wir putzten uns einträchtig nebeneinander die Zähne.
Jennifer hatte ein Öl gegen Mücken dabei, das wunderbar roch, frisch und ein wenig nach Zitrone. »Zitronella«, erklärte sie, während wir uns den Inhalt des kleinen Fläschchens teilten. »Das kenne ich aus Australien.«
»Wo warst du eigentlich noch nicht?«, fragte ich. Jennifer lachte. Sie lachte immer mit weit offenem Mund und ich sah, dass sie sowohl Füllungen aus Gold als auch solche aus Silber in den Backenzähnen hatte. »Ich habe jede Menge noch nicht gesehen«, sagte sie, »die Welt ist so groß.«
»Ich war noch nie außerhalb von Europa«, sagte ich, als wir mit unseren Zahnbürsten in der Hand zu unseren Schlafsäcken zurückkehrten.
»Europa ist herrlich vielfältig«, sagte Jennifer. »Ich kenne noch gar nicht genug von Europa.«
Wir schwiegen, während wir unsere Schlafsäcke ausrollten. Am Feuer versuchte offenbar Rita gerade, den anderen »When Israel Was in Egypt’s Land« beizubringen, und Ralf konnte gar nicht zu lachen aufhören. Ich mochte sein Lachen. Gustav schien es auch zu mögen, denn ich hörte seine helle Kinderstimme heraus. Der mürrische Junge war mir den Tag über nicht besonders sympathisch gewesen, umso mehr freute es mich, ihn nun lachen zu hören.
»Was musst du denn gerade überleben?«, fragte mich Jennifer, als wir nebeneinander in den Schlafsäcken lagen. Es war eigentlich noch zu früh, um ins Bett zu gehen, meine Uhr zeigte noch nicht einmal zehn Uhr, aber es war gemütlich wie eine Übernachtung bei einer guten Freundin, bei der das Quatschen im Bett den Höhepunkt darstellt.
Eine Psychofrage, so nannte Carola das immer. Wahrscheinlich nennt das in Wirklichkeit Alexander so und Carola plappert es nur nach. Ich erschrak. So gemein dachte ich sonst nie über meine Freundinnen. Wie sehr hatte es mich gekränkt, dass sie so belustigt auf meine Überlebenskurspläne reagiert hatten? Wie nah, wie fern fühlte ich mich meinen Freundinnen eigentlich? Im Moment schien mir nur Jennifer nah, die mir eine Frage gestellt hatte, die ich gern von einer meiner Freundinnen gehört hätte. Ich brummte, um zu zeigen, dass ich nachdachte.
»Ich weiß es nicht«, der Satz kam mehr wie ein Seufzen heraus. Jennifer war so viel jünger als ich, sicher mehr als zehn Jahre, sie würde nicht verstehen, was mein Problem war. Das verstand ich ja selbst kaum. »Hast du eigentlich Kinder?«
Jennifer schüttelte den Kopf. »Noch nicht den Richtigen gefunden. Lenk nicht ab!« Sie schubste mich und dann schubste sie mich noch mal und ich merkte, dass sie dabei war, mich in meinem Schlafsack aus dem Unterstand zu rollen.
»He«, rief ich, »hör auf!« Wir kicherten, dann wurden wir wieder ernst. Am Lagerfeuer gab es gerade eine Diskussion, die mal lauter, mal leiser geführt wurde. Es klang, als sollten die Kinder ins Bett.
»Meine Kinder sind ausgezogen«, sagte ich schließlich. »Und meine Tochter kann mich irgendwie nicht leiden.« Ich spürte, wie mir die Tränen kamen, aber ich schluckte sie hinunter und sprach weiter. »Und außerdem weiß ich nicht, wie ich ohne die Kinder weiter mit meinem Mann zusammenleben soll. Das klingt jetzt vielleicht seltsam«, fügte ich eilig hinzu. »Ich hab einen guten Mann, wirklich, aber«, ich stockte und wusste nicht, wie dieser Satz weitergehen sollte. Ich flüsterte: »Er ist so langweilig geworden, dass ich manchmal eine richtige Wut bekomme.« Ich brach erschrocken ab. Ich spürte Jennifers Blick auf mir ruhen. »Das ist so ungerecht von mir.« Ich flüsterte immer noch, als wäre das ein Geheimnis – als wäre es etwas, das ich selbst vor mir geheim halten musste. »Ich bin bestimmt auch langweilig«, flüsterte ich weiter, aber dann schüttelte ich den Kopf, nickte, schüttelte wieder den Kopf. Wir lachten leise. »Ich versuche immerhin, dagegen anzuleben«, sagte ich trotzig wie ein Kind, das die Einwände der Eltern längst kennt.
»Du bist hier«, sagte Jennifer und ich schnaubte. »Was macht einen Menschen langweilig?«
»Wenn er nicht spricht«, antwortete ich. Diese Antwort schien schon sehr lang darauf gewartet zu haben, ausgesprochen zu werden. »Wenn er nur das Nötigste sagt, wenn überhaupt. Wenn er nicht antwortet und nichts erzählt. Wie ein ausgetrockneter Brunnen. Ich bin das so leid.« Mir war gar nicht klar, dass mich das Zusammenleben mit Jens tatsächlich zornig machte.