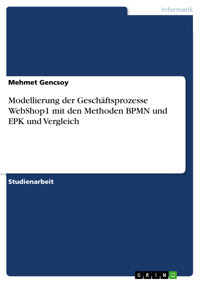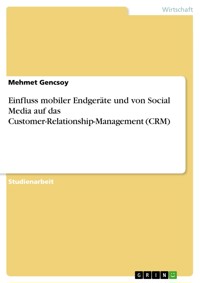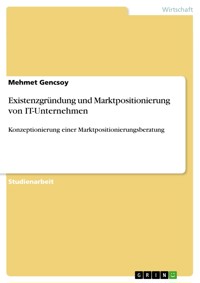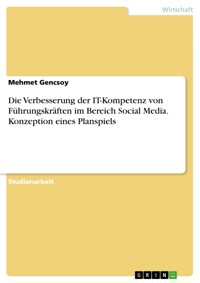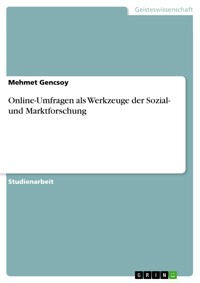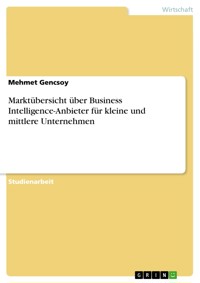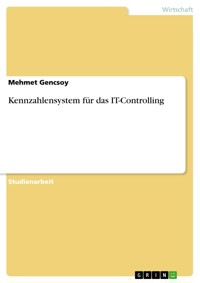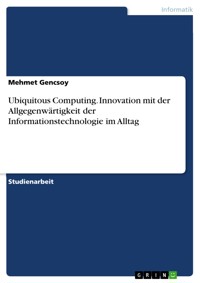
Ubiquitous Computing. Innovation mit der Allgegenwärtigkeit der Informationstechnologie im Alltag E-Book
Mehmet Gencsoy
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Informatik - Wirtschaftsinformatik, Note: 1,0, AKAD University, ehem. AKAD Fachhochschule Stuttgart, Veranstaltung: Wirtschaftsinformatik Bachelor, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Begriff Ubiquitous Computing wurde erstmals 1988 von Mark Weiser während seiner Forschungstätigkeit für das PARC verwendet. Hierbei wurde ein Programm gestartet, um die Defizite bei Nutzung von Computern zu erforschen. Im Rahmen dieses Programms wurden neue Ideen entwickelt, die zum Entwurf des Ubiquitous Computing führten. Dieses Assignment hat das Ziel den Begriff Innovation und Ubiquitous Computing näher zu erläutern. Dabei sollen folgende Fragen beantwortet werden: – Was bedeutet Ubiquitous Computing? – Was bedeutet in diesem Zusammenhang Innovation? – Welche Einsatzmöglichkeiten des Ubiquitous Computing gibt es bereits? – Ist Ubiquitous Computing bereits eine Innovation oder bzw. kann es sich zu einer Innovation entwickeln? Dazu werden im zweiten Kapitel die Begriffe Ubiquitous Computing, Innovation und RFID (Radio Frequency identification) sachlich definiert. Im dritten Kapitel werden die aktuellen Einsatzmöglichkeiten mit Ubiquitous Computing vorgestellt. Im letzten Kapitel werden Ubiquitous Computing und dessen Einsatzmöglichkeiten bewertet. Dabei wird auf dessen zukünftige Chancen aber auch Risiken eingegangen. Hierbei soll auch die Frage beantwortet werden, ob Ubiquitous Computing eine Innovation ist oder bzw. sich als eine Innovation durchsetzen kann. Angesehene Vertreter der Organisationslehre gingen in den 50er Jahre davon aus, dass Computer niemals eine wichtige Bedeutung für die Betriebswirtschaft erlangen wird. Niemand konnte damals vorausahnen, dass irgendwann in fast jedem Haushalt ein Computer stehen wird und diese sogar miteinander über das Internet vernetzt sind. Computer und Internet gehören mittlerweile zum Alltag. Mit Smartphones, das aktuellen Trend in diesem Bereich, ist man sogar überall und jederzeit online im Internet. Man kann Nachrichten abrufen, Musik hören, Videos ansehen, per GPS (Global Positioning System) eine Navigation starten oder standortbezogene Dienste nutzen. Ein weiteres Trend sind zurzeit Tablet-PCs. Damit kann man auch im Internet surfen, E-Mails abrufen, Spiele spielen und Bücher lesen, alles bequem auf der Wohnzimmer Couch oder im Schlafzimmer Bett. Beide Produktfamilien sind Innovationen der Informationstechnologie und revolutionieren den Alltag der Menschen. Mit Ubiquitous Computing will man einen Schritt weiter gehen. Computer sollen allgegenwärtig sein. Sie sollen die Menschen bei alltäglichen Arbeiten unterstützen und dabei unsichtbar sowie unaufdringlich bleiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Grundlagen
2.1. Innovation
2.2. Ubiquitous Computing
2.3. RFID (Radio Frequency Identification)
3. Ubiquitous Computing – Einsatzmöglichkeiten
3.1. Einleitung
3.2. Automatische Produktidentifikation im Einzelhandel
3.3. Smart Living
3.4. Smart Grid
4. Kritische Würdigung
Literaturverzeichnis
Online-Quellen
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Zusammenhang von Invention und Innovation
Abbildung 2: Zusammenhang Invention, Innovation und Imitation
Abbildung 3: Grundbestandteile eines RFID-Systems
Abbildung 4: Eurostat, Information society statistics RFID 2009
Abbildung 5: Vernetzung einer smarten Umgebung - das smarte Zuhause
Abbildung 6: Aufbau von Smart Grids
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
Angesehene Vertreter der Organisationslehre gingen in den 50er Jahre davon aus, dass Computer niemals eine wichtige Bedeutung für die Betriebswirtschaft erlangen wird.[1] Niemand konnte damals vorausahnen, dass irgendwann in fast jedem Haushalt ein Computer stehen wird und diese sogar miteinander über das Internet vernetzt sind. Computer und Internet gehören mittlerweile zum Alltag.
Mit Smartphones, das aktuellen Trend in diesem Bereich, ist man sogar überall und jederzeit online im Internet. Man kann Nachrichten abrufen, Musik hören, Videos ansehen, per GPS (Global Positioning System) eine Navigation starten oder standortbezogene Dienste nutzen. Ein weiteres Trend sind zurzeit Tablet-PCs. Damit kann man auch im Internet surfen, E-Mails abrufen, Spiele spielen und Bücher lesen, alles bequem auf der Wohnzimmer Couch oder im Schlafzimmer Bett. Beide Produktfamilien sind Innovationen der Informationstechnologie und revolutionieren den Alltag der Menschen.[2]
Mit Ubiquitous Computing will man einen Schritt weiter gehen. Computer sollen allgegenwärtig sein. Sie sollen die Menschen bei alltäglichen Arbeiten unterstützen und dabei unsichtbar sowie unaufdringlich bleiben. Dieses Assignment hat das Ziel den Begriff Innovation und Ubiquitous Computing näher zu erläutern. Dabei sollen folgende Fragen beantwortet werden:
Was bedeutet Ubiquitous Computing?
Was bedeutet in diesem Zusammenhang Innovation?
Welche Einsatzmöglichkeiten des Ubiquitous Computing gibt es bereits?
Ist Ubiquitous Computing bereits eine Innovation oder bzw. kann es sich zu einer Innovation entwickeln?
Dazu werden im zweiten Kapitel die Begriffe Ubiquitous Computing, Innovation und RFID (Radio Frequency identification) sachlich definiert. Im dritten Kapitel werden die aktuellen Einsatzmöglichkeiten mit Ubiquitous Computing vorgestellt. Im letzten Kapitel werden Ubiquitous Computing und dessen Einsatzmöglichkeiten bewertet. Dabei wird auf dessen zukünftige Chancen aber auch Risiken eingegangen. Hierbei soll auch die Frage beantwortet werden, ob Ubiquitous Computing eine Innovation ist oder bzw. sich als eine Innovation durchsetzen kann.
2. Grundlagen
2.1. Innovation
In der wissenschaftlichen Forschung, sowie in der Unternehmenspraxis gibt es keine einheitliche Definition für den Begriff Innovation.[3]
Als einer der ersten hat Joseph Alois Schumpeter in seinem 1912 erschienenen Werk „Die Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“ den Begriff Innovation definiert. Dabei hat er eine klare Abgrenzung zwischen Invention, Innovation und Imitation gezogen.[4]
Dabei wird die Invention als eine notwendige Vorstufe der Innovation definiert. Mit dem Begriff Invention wird heute die Erfindung, die neuartige technische Ausführung einer neuen Problemlösung interpretiert. Die Invention kann dabei entweder geplant oder ungeplant erreicht werden. Bei einer ungeplanten Invention, wobei Erfindungen aufgrund von Zufällen entstehen, spricht man von einem Serendipitäts-Effekt. Erst wenn die Invention auch einen wirtschaftlichen Erfolg verspricht und als Produkt oder Dienstleistung in den Wirtschaftskreislauf eingeführt wird, spricht man von einer Innovation. [5]
Im Gegensatz zu einer Invention ist die Innovation nicht nur auf die Problemlösung mit einer Erfindung fixiert, sondern auch auf den wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet. Eine Innovation wird damit erst erreicht, wenn die Invention als Produkt oder Dienstleistung der breiten Masse auf dem Markt zugänglich gemacht wird und damit eine entsprechende gewinnbringende Marktdurchdringung erreicht. Mit Abbildung 1 wird der Zusammenhang zwischen Invention und Innovation verdeutlicht:
Abbildung 1: Zusammenhang von Invention und Innovation[6]
Im weiteren Sinn wird der Begriff Innovation auch mit dem Prozess der Markteinführung interpretiert. Dies beinhaltet neben dem Anstoß zur Idee und der Forschung und Entwicklung auch die Diffusion sowie die eigentliche Markteinführung. Dieses Assignment befasst sich jedoch nicht mit dem weiten Sinn des Begriffes Innovation.
Innovationen werden nach Schumpeter folgendermaßen definiert:[7]
Neuheit oder (Er-)Neuerung eines Objekts oder einer Handlungsweise.
Veränderung bzw. Wechsel durch die Innovation in und durch die Unternehmung.
Innovation muss entdeckt bzw. erfunden, eingeführt, genutzt, angewandt und institutionalisiert werden.
Die Innovation wird damit erst mit einer gewissen Marktdurchdringung erreicht.
Letztlich versteht man unter Imitation die Nachahmung. Dabei werden bereits eingeführte Innovationen von anderen Unternehmen oder Organisation ebenfalls eingesetzt. Zeitlich ist damit die Imitation immer nach der Innovation angesiedelt. Auf Anwendungsebene weist die Imitation ähnliche Eigenschaften auf wie die Innovation. Erst auf der Technologieebene kann man die Imitation klar identifizieren und von der Innovation abgrenzen. Hierbei übernimmt die Imitation im Großen und Ganzen die Technologien der Innovation.[8]
Die Abbildung 2 verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Invention, Innovation und Imitation genauer. Dabei wird auch die Definition der Innovation im weiteren Sinne veranschaulicht:
Abbildung 2: Zusammenhang Invention, Innovation und Imitation [9]
2.2. Ubiquitous Computing
Der Begriff Ubiquitous Computing wurde erstmals 1988 von Mark Weiser während seiner Forschungstätigkeit für das PARC (Xerox Palo Alto Research Center) verwendet. Hierbei wurde ein Programm gestartet, um die Defizite bei Nutzung von Computern zu erforschen. Im Rahmen dieses Programms wurden neue Ideen entwickelt, die zum Entwurf des Ubiquitous Computing führten.[10]
Mark Weiser formulierte diese Ideen zu einer Vision und veröffentlichte es.[11] Der Beitrag von Weiser fand große Beachtung, so dass seither Weiser als der Vater der Vision „Ubiquitous Computing“ gilt.
Die Vision von Weiser besteht darin, dass allgegenwärtige Computer, die fast unsichtbar und unaufdringlich sind, den Menschen bei alltäglichen Tätigkeiten unterstützen.[12] In diesem soziotechnischen Ansatz arbeiten Computer teilweise autark und unbemerkt im Hintergrund. Sie werden dabei vom Anwender nicht mehr bewusst wahrgenommen. Der Anwender kann sich damit voll und ganz auf seine Tätigkeit konzentrieren. Eine Interaktion mit der Informationstechnologie ist nicht mehr notwendig. Dadurch wird der Anwender bei der Bedienung der Informationstechnologie nicht abgelenkt und kann selber entscheiden, welche Informationen aufgenommen werden sollen.[13]
Um Ubiquitous Computing in der Evolution der Informationstechnologie einordnen zu können, kann man die Entwicklung der Informationstechnologie anhand des Verhältnisses von Maschine und Mensch folgendermaßen aufzählen:[14]
Mainframe – Ära (1 Großrechner : Mehrere Anwender)
Personal Computer – Ära (1 Rechner : 1 Anwender)
Ubiquitous Computing – Ära (Mehrere Rechner : 1 Anwender)
Die Ubiquitous Computing – Ära ist dadurch bestimmt, dass ein Anwender von einer großen Menge von Prozessoren, Speichern, Sensoren und entsprechenden Energiequellen umgeben ist. Wobei die Objekte allgegenwärtig und zugleich intelligent sind. Die Technik ist dabei in Alltagsgegenstände, wie Bekleidung, Kühlschränke, Autos oder Kinderspielzeug eingebettet. Aber auch die Integration der Technik in die Umgebung ist möglich, wie zum Beispiel in eine Brücke, ein Haus oder in die Straße. Diese intelligente Omnipräsenz ermöglicht das Verschmelzen der Informationstechnologie mit physischen Objekten. Damit kann auch die Informationsverarbeitung sofort an Ort und Stelle stattfinden, ohne eine Zeitverzögerung hinnehmen zu müssen. Die ubiquitäre Informationstechnologie unterstützt die Anwender unmittelbar und aktiv oder passiv. Meistens jedoch ohne dass die Anwender darüber bewusst werden. Hiermit gewinnt auch die Erreichbarkeit von Personen und Objekten eine neue Bedeutung.[15]
Aufgrund den neuen Möglichkeiten und Entwicklungschancen wird Ubiquitous Computing, vom Marktforschungsunternehmen Gartner Inc., als einer der Top 10 zukunftsträchtigen und erfolgsversprechenden Technologien für Unternehmen eingeschätzt.[16]
2.3. RFID (Radio Frequency Identification)
RFID ist einer der Basistechnologien, welche für die Entwicklung von Ubiquitous Computing benötigt wird. Deswegen wird die RFID-Technologie in diesem Abschnitt kurz vorgestellt.
Die RFID-Technologie ist keine neue Technologie. Es ist eine Weiterentwicklung von Radiowellen, welche zur Ortung von Flugzeugen benutzt wird. Die ersten Einsätze fanden gegen Ende des zweiten Weltkrieges statt. Dabei hat die amerikanische Armee ihre Flugzeuge mit Transponder ausgestattet, damit man auf dem Radar feindliche und eigene Flugzeuge besser unterscheiden konnte.[17]
Die Transponder-Technologie zielt auf die Übertragung von Daten ab, genauso wie die Barcode-Technologie. Der Datenaustausch findet hierbei jedoch berührungslos über die Luft statt. Das RFID-System besteht dabei aus einem Lesegerät, einer Antenne und dem Transponder. Der Transponder ist somit der Datenträger worauf sich die Daten befinden. Die folgende Abbildung stellt ein RFID-System mit dessen Grundbestandteilen übersichtlich dar:
Abbildung 3: Grundbestandteile eines RFID-Systems[18]
Der Transponder besteht dabei aus eine Koppelelement und einem Mikrochip. Auf dem Markt befinden sich zurzeit passive und aktive Transponder. Bei einem passiven Transponder ist der Transponder außerhalb des Wirkungsbereiches eines Lesegerätes vollständig inaktiv. Hierbei besitzt der Transponder keine eigene Stromversorgung und wird erst vom Lesegerät aktiviert sowie mit Energie versorgt. Im Gegensatz besitzt der aktive Transponder eine eigene Stromversorgung (meist Batterie), womit sich auch höhere Reichweiten erreichen lassen. Dies ist aber auch mit höheren Kosten verbunden. Die nachfolgende Tabelle stellt die Eigenschaften von aktiven und passiven Transpondern gegenüber:
Tabelle 1: Vergleich aktive und passive Transponder[19]
Aufgrund der hohen Kostenvorteile werden zurzeit ausschließlich passive Transponder eingesetzt. Trotz der enormen Einsparpotentiale, durch zum Beispiel schnellere Prozesse, konnte sich die Transpondertechnologie in der Betriebswirtschaft noch nicht durchsetzen. Lediglich 3% aller Unternehmen der 27 EU (Europäische Union) Staaten setzten im Jahre 2009 RFID ein. Bei großen Unternehmen wird vermehrt auf RFID gesetzt. Hierbei setzen bereits 15% der Unternehmen auf die Transpondertechnologie. Bei kleineren Unternehmen setzen jedoch lediglich nur 2% RFID ein. Als einer der Hauptgründe wird hierbei die hohen Investitionskosten aufgezählt.[20] Die folgende Grafik stellt das Ergebnis der eurostat (Statistische Amt der Europäischen Union)-Untersuchung dar:
Abbildung 4: Eurostat, Information society statistics RFID 2009[21]
3. Ubiquitous Computing – Einsatzmöglichkeiten
3.1. Einleitung
Die Einsatzmöglichkeiten von Ubiquitous Computing sind sehr vielfältig. Eine genaue und vollständige Ausführung aller Einsatzmöglichkeiten würde jedoch den Rahmen dieses Assignments weit sprengen. Deshalb beschränken wir dieses Assignment mit der Vorstellung der folgenden drei Einsatzmöglichkeiten von Ubiquitous Computing:
Automatische Produktidentifikation im Einzelhandel
Smart Living
Smart Grid
Auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat die besondere Bedeutung von Ubiquitous Computing erkannt und hat im Jahre 2005 eine Studie an das ULD (Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein) und HU (Institut für Wirtschaftsinformatik der Humboldt-Universität zu Berlin) in Auftrag gegeben. Das daraus entstandene Projekt TAUCIS (Technikfolgenabschätzung Ubiquitäres Computing und Informationelle Selbstbestimmung) stellt die Auswirkungen von Ubiquitous Computing umfangreich und detailliert dar. Die folgende Auflistung stellt, in Anlehnung an das TAUCIS Projekt, einen kurzen Überblick über die Einsatzmöglichkeiten von Ubiquitous Computing vor: [22]
Fahrzeugkontrollsysteme
Das intelligente Haus (Smart Living)
Medizinische Anwendungen (Kennzeichnung von Medikamenten, Erkennen von Kontraindikationen, usw.)
Warenwirtschaft und Logistik (Einsatz von RFID, Verbesserter Schutz vor Schwund, Bessere Lieferprozesse, usw.)
Nahrungsmittel und Tierhaltung (Rückverfolgbarkeit von Nahrungsmittel, Frischegrad, Kennzeichnung von Tieren, usw.)
Dokumentensicherheit (Pässe, Geldscheine, usw.)
Ticketing (Großveranstaltungen, Identifikation von Personen, usw.)
Bildung und Ausbildung (Adaptive Lernsysteme, Open Content, usw.)
Arbeitswelt (Bildschirmarbeitsplätze, weitere Vernetzung, usw.)
Reisen, Freizeit und Erholung (Zurechtfinden in unbekannter Umgebung, Lokalisierungsdienste wie GPS mit weiterführenden Informationen, usw.)
Militärische Anwendungen
Wearable Computing
Smart Grid
3.2. Automatische Produktidentifikation im Einzelhandel
Der Einzelhandel steht, aufgrund des hohen Wettbewerbes, permanent unter Kostendruck. Die Gewinnmargen erreichen lediglich den unteren einstelligen Prozentbereich. Mit neuen Technologien wird in den letzten Jahres verstärkt versucht die Kosten weiter zu senken und die Prozesse weiter zu optimieren.[23]
Im Bereich Supply Chain Management sind noch große Kosteneinsparpotentiale vorhanden. Genau in diesem Bereich setzt auch die RFID-Technik an. Dabei sollen mit RFID-Chips die Produkte eindeutig identifiziert werden. Es soll jederzeit ermöglicht werden, den genauen Hersteller der Produkte und dessen einzelne Stationen entlang der Lieferkette festzustellen. Damit soll die Lieferkette optimiert und unnötige Lieferzeiten oder Überproduktion vermieden werden.
Als einen weiteren Vorteil kann man die mögliche Automatisierung der Verkaufsvorgänge nennen. Hierbei müssen die Produkte nicht einzeln von einem Verkaufspersonal gescannt werden. An der Kasse kann man den Inhalt vom Einkaufswagen komplett automatisiert ermitteln. Somit kann man beim Einsatz der RFID-Technik sogar auf den Einsatz von Verkaufspersonal verzichten. Außerdem bietet die Technik einen Komfortvorteil und erhebliche Zeitersparnisse für die Kunden. Die Kunden müssen den Einkaufswagen an der Kasse nicht aus- und später wieder einladen und das Schlange stehen ist nicht mehr notwendig.
Ein weiterer hoher Kostenfaktor sind die Aufwände für die Inventur, die im Einzelhandel, fast täglich durchgeführt werden. Dementsprechend werden nämlich auch die Regale wieder aufgefüllt. Die RFID-Technik ermöglicht dabei eine schnelle Inventur der Bestände. Die Produkte müssen nicht einzeln und manuell gescannt werden, wie bei einem Barcode, sondern können jederzeit und automatisiert über RFID-Lesegeräte gezählt und ausgewertet werden.
Insgesamt bietet die automatische Produktidentifikation im Einzelhandel folgende Vorteile: [24]
Schnelle Inventur
Diebstahlsicherung / Vermeidung von Schwund
Unverkäufliche Produkte erkennen und vermeiden (Mindesthaltbarkeitsdatum)
Automatisierter Verkaufsvorgang
Rückverfolgbarkeit von Produkten
Optimierung der Lieferkette
Optimierung Lagerbestand
Trotz der oben erwähnten Vorteile, wird die RFID-Technologie auf Produktebene von keinem Einzelhandelsunternehmen in Europa eingesetzt. Hierbei sind die Kosten mit 0,05 USD pro RFID-Tag zu teuer. Die einmaligen Investitionen in RFID-Lesegeräte sind zu hoch. Des Weiteren herrschen in Europa, vor allem in Deutschland, erhebliche Bedenken in Bezug auf Datenschutzrechte. Hierbei befürchten die Einzelhandelsunternehmen nach Einführung der RFID-Technologie juristische Klagen. In den USA finden bereits erste Einführungen statt. Vorreiter in diesem Bereich sind die Unternehmen Gilette, Philips, Wal-Mart und Tesco. Auf Karton- oder Palettenebene spielen die Kosten für den RFID-Tag keine Rolle. Hier wird die RFID-Technologie für die Optimierung der Lieferkette bereits weit verbreitet und intensiv eingesetzt. [25]
3.3. Smart Living
Unter Smart Living versteht man ein Haus oder eine Wohnung mit intelligent vernetzten Gegenständen. Ziel der Vernetzung ist die Steigerung der Effizienz im Bereich Haushaltssteuerung, Sicherheit, Kommunikation, Pflege und Energie. Dabei sollen zum Beispiel bestimmte Haushaltsgeräte keinen Strom mehr verbrauchen, wenn niemand mehr im Haus ist. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die intelligente Steuerung von Energie Anwendungen. Dabei sollen regenerative Energien, wie eine Photovoltaik-Anlage oder Wärmepumpe eingesetzt werden. Ziel dabei ist das komplett emissionsfreie Haus.[26]
Bei Smart Living spielt die RFID-Technologie keine Rolle. Wichtig ist die Vernetzung und Verkabelung der physischen Objekte im Haus sowie dessen Steuerung. Die folgende Abbildung stellt die notwendige Vernetzung mit den „smarten“ Gegenständen im Haus dar:
Abbildung 5: Vernetzung einer smarten Umgebung - das smarte Zuhause[27]
Die Möglichkeiten beim Smart Living sind dabei sehr vielfältig. Im nachfolgenden Abschnitt werden einige dieser Möglichkeiten aufgelistet:[28]
Das System prüft Fenster und Türen und verrät, was offen steht
Elektronik ermittelt den Warmwasserbedarf und schaltet den Brenner ein
Jalousien lassen sich einzeln oder in Gruppen steuern
Eine Fernabfrage verrät auch am Urlaubsstrand, ob Herd oder Bügeleisen abgeschaltet wurden und schaltet die Geräte bei Bedarf auch aus
Ein Sensor ermittelt die Windstärke und fährt Markisen oder Jalousien ein
Außentemperatur, Luftfeuchte und Helligkeit wird gemessen und gegebenenfalls Heizung oder Licht an- oder ausgeschaltet
Regenfühler melden Regen und schließen die Dachfenster
Mit einer Anwesenheitssimulation wird Einbrechern ein bewohntes Haus vorgegaukelt. Rollladen auf/zu, Licht an/aus, Markisen rauf/runter
Individuelle Temperaturprofile für jeden Raum und für jede Tageszeit (z.B. Bad wird morgens vorgeheizt, Schlafzimmer wird abends runter geregelt)
Die Beleuchtung wird automatisch und zeitabhängig gesteuert.
Per Knopfdruck lässt sich eine bestimmte Lichtstimmung erzeugen.
Zu- und Abluft der Lüftungsanlage wird automatisch geregelt.
Nach langer Reise lässt sich die Heizung per Telefon einschalten für einen warmen Empfang.
Mit dem System lässt sich das Garagentor und die Wegebeleuchtung steuern
Die Gartenbewässerung kann gesteuert werden
Störungen werden gemeldet und angezeigt
Der Kundendienst findet den Defekt in der Waschmaschine mittels Ferndiagnose
Beim Verlassen des Hauses werden die Temperaturen in allen Räumen abgesenkt und verschiedene Stromverbraucher einfach abgeschaltet
Beim Öffnen eines Fenster senkt sich die Temperatur des Heizkörpers
Bei Einbruchversuch wird eine Abschreckungsbeleuchtung und/oder eine Sirene ausgelöst, telefonisch wird ein Notruf abgesetzt und der Sicherheitsdienst verständigt
Die Auflistung der Möglichkeiten kann noch weiter fortgeführt werden und besitzt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Diese Auflistung verdeutlicht schnell den hohen Innovationspotential vom Smart Living. Jedoch hat sich Smart Living noch nicht auf dem europäischen Markt durchgesetzt.[29] Das „Smart Home“ ist zu teuer. Komfortvorteile sind nicht Anreiz genug um die notwendigen hohen Investitionen bei einem Neubau zu tätigen. Die Kostenvorteile, wie zum Beispiel die Senkung der Stromkosten, sind auch nicht ausreichend, um die hohen Investitionen zu gerecht fertigen. Das Vernetzen von Altbauten ist dabei vom vorherein viel zu aufwendig und nicht rentabel. Deshalb findet die Marktdurchdringung in diesem Bereich sehr langsam statt. Nur bei Neubauten, wo finanzieller Spielraum herrscht, wird eine Vernetzung vorangetrieben.
3.4. Smart Grid
Das Smart Grid geht einen Schritt weiter als das Smart Living und bezieht sich auf die komplette Energie-Infrastruktur. Das Smart Grid soll alle Energielieferanten und Energiekonsumenten energetisch und vor allem kommunikationstechnisch miteinander verbinden. Smart Grids sollen dabei die Erzeugung und Last von Energienetzen anhand Preissignale harmonisieren.[30] Das Problem, dass der Zeitpunkt der Energieerzeugung bei regenerativen Energien, wie die Windenergie und Sonnenenergie, nicht gesteuert werden kann, soll durch gezielte Änderung des Energieverbrauchszeitpunktes behoben werden. Das Speichern von Energie ist zu aufwendig und teuer. Deswegen werden neben den Preissignalen auch intelligente Geräte benötigt.
Die Entscheidung die Atomkraftwerke in Deutschland bis 2022 abzuschalten, welche aufgrund der Nuklearkatastrophe in Japan im Jahre 2011 getätigt wurde, führt dazu, dass das Smart Grid an Bedeutung gewinnt. Diverse Forschungs- und Entwicklungsarbeiten beschäftigen sich zurzeit intensiv mit Smart Grids. Die folgende Abbildung stellt den Aufbau von Smart Grids übersichtlich dar:
Abbildung 6: Aufbau von Smart Grids[31]
Die Smart Grids weisen dabei folgende Eigenschaften auf: [32]
Konvergenz von Strom, Gas und Wärme
Kontinuierliche Messung von Erzeugung und Verbrauch entlang der gesamten Netzstränge
Multidirektionale Kommunikation (Erzeuger informieren Verbraucher über Erzeugung in der Zukunft, Verbraucher informieren Erzeuger über Bedarf in der Zukunft)
Konvergenz von Netz- und Kommunikationsinfrastrukturen
Hohe Flexibilität und hoher Automatisierungsgrad an sich ändernde Netzzustände und Auslastungen
Zurzeit sind keine Smart Grids in Deutschland vorhanden.[33] Der Ausbau der Netze wird aber Schritt für Schritt vorangetrieben. Vor allem die Vernetzung der Netze ist nur möglich, wenn ausreichend „Smart Homes“ existieren. Damit ist die Entwicklung der Smart Grids mit der Entwicklung von Smart Homes verbunden.
4. Kritische Würdigung
Die Vision von Mark Weiser ist sehr spannend. Die Vorstellung, dass das Leben in allen Situationen von Computern unterstützt wird ist greifbar nahe. Eine Vorreiterrolle spielt hier längst das Auto. Moderne Autos sind bereits mit sehr vielen kleinen Computern ausgestattet, die beim Fahren unterstützen. Dabei wird zum Beispiel bei einer Vollbremsung der Bremsweg vom ABS (Antiblockiersystem) verkürzt. Bei zu starker Geschwindigkeit in einer Kurve, wird die Geschwindigkeit entsprechend vom ESP (elektronisches Stabilitätsprogramm) verringert Bei Regen wird der Scheibenwischer vom Regensensor gesteuert. Genauso geht auch das Licht automatisch an, weil der Lichtsensor die Dunkelheit erkennt. Dabei werden die kleinen Assistenten wie ABS, ESP und diverse Sensoren so in das Objekt Auto integriert, so dass der Mensch es fast gar nicht mehr bewusst wahrnimmt. Schafft man es nun diese Integration der Mini-Computer auf alle Bereiche des Lebens zu strecken, dann wird auch die Vision von Weiser Wirklichkeit. Ubiquitous Computing wird zu einer Innovation.
Ubiquitous Computing hat aber in den vorgestellten Einsatzbereichen noch keine ausreichende Marktdurchdringung erreicht. RFID wird nur von 3 % aller Unternehmen der EU eingesetzt. Im europäischen Einzelhandel hat noch kein einziges Unternehmen komplett auf RFID umgestellt. Das „Smart Home“ wird zu selten gebaut. Die Smart Grids werden erst Schritt für Schritt umgestellt und benötigen das „Smarte Home“. Deswegen bleibt Ubiquitous Computing noch auf der Stufe der Invention.
Ausreichende Technologien, wie die RFID-Technologie oder aber auch Netzwerktechnologien, für die Diffusion von Ubiquitous Computing sind vorhanden. Jedoch hindern drei Aspekte die Diffusion von Ubiquitous Computing: Hohe einmalig notwendige Investitionen, Datenschutz und Datensicherheit.
Die hohen Investitionskosten entstehen zum Beispiel bei der Einführung von RFID-Systemen für RFID Lesegeräte und Infrastruktur. Bei einem „Smart Home“ entstehen ebenfalls sehr hohe Kosten für die Verkabelung der einzelnen Objekte im Haushalt.
Im Bereich Datenschutz werden seitens der Unternehmen juristische Auseinandersetzungen befürchtet. Hierbei können nämlich anhand RFID Tags das Nutzungsverhalten der Kunden unbemerkt ermittelt werden. Über GPS kann man sogar den Aktionsradius der eigenen Produkte ermitteln. Hierbei gibt es diverse Ansatzmöglichkeiten.
Im Bezug auf Datensicherheit wird Ubiquitous Computing skeptisch betrachtet. Hierbei können zum Beispiel bei einem „Smart Home“, durch den Einbruch in das Hausnetzwerk, die Bewohner ausspioniert und ein Einbruch leichter vollzogen werden. Bei einem Smart Grid könnten sich Hacker in das entsprechende Netzwerk hacken und Stromleitungen von ganzen Ländern ausschalten. Dies ermöglicht sogar einen Terroranschlag direkt über das Internet. Aber auch die RFID Technologie kann dazu führen, dass ganze Preis- und Produktportfolio von Unternehmen „unerwünscht“ ausspioniert werden.
Ferner gibt es auch gesundheitliche Bedenken bezüglich der verursachten elektronischen Strahlung durch Ubiquitous Computing. Hierbei sind die Auswirkungen von Strahlungen durch ubiquitäre Geräte noch nicht ausreichend erforscht.
Trotzdem schreitet die Entwicklung von Ubiquitous Computing voran. Immer mehr Unternehmen machen sich Gedanken über den Einsatz von RFID. Größere Unternehmen, wo die einmaligen Investitionen leichter getragen werden können, setzen vermehrt auf die RFID Technologie. In Bezug auf Smart Living und Smart Grid muss die Bauindustrie sowie Energielieferanten noch weitere vor allem günstige Einsatzmöglichkeiten entwickeln.
Literaturverzeichnis
Amberg, Michael und Lang, Michael:
Innovation durch Smartphone & Co., Düsseldorf 2011.
Bizer, Johann und Spiekermann, Sarah und Günther, Oliver:
Studie TAUCIS - Technikfolgenabschätzung Ubiquitäres Computing und Informationelle Selbstbestimmung, Kiel 2006.
Britzelmaier, Bernd und Geberl, Stephan und Weinmann, Siegfried:
Der Mensch im Netz - Ubiquitous Computing, Wiesbaden 2002.
Brockhoff, Klaus:
Forschung und Entwicklung: Planung und Kontrolle, 5., ergänzte Auflage, Wien 1999.
Diekmann, Thomas:
Ubiquitous Computing - Technologien im betrieblichen Umfeld, Göttingen 2007.
Finkenzeller, Klaus:
RFID Handbuch, 5. Auflage, München 2008.
Franke, Werner (Hrsg.) und Dangelmaier, Wilhelm (Hrsg.) und Sprenger, Christian und Wecker, Frank:
RFID - Leitfaden für die Logistik, Wiesbaden 2006.