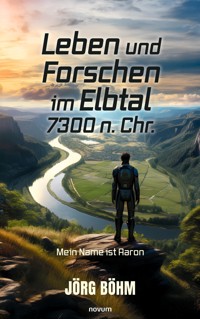Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
DU HAST GESÜNDIGT. DU KAMST DAMIT DURCH. JETZT WIRST DU DAFÜR STERBEN. Emma Hansens zweiter Fall Ein ungewöhnlicher Todesfall führt Emma Hansen in das kleine Dorf Burrweiler in der Pfalz: Der Winzer Alois Straubenhardt wird tot in seinem Weinberg gefunden – vom eigenen Traktor überfahren. Ein tragischer Unfall? Als ein weiterer Dorfbewohner auf mysteriöse Weise ums Leben kommt, gerät die Hauptkommissarin immer stärker unter Druck, die Vorfälle aufzulösen. Zu spät erkennt sie, dass eine lange verdrängte Schuld endlich gesühnt werden will …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Titelseite
Impressum
Über den Autor
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Epilog
Danksagung
Jörg Böhm
Und die Schuld trägt deinen Namen
Im Verlag CW Niemeyer sind bereits folgende Bücher des Autors erschienen:
Moffenkind
Und nie sollst du vergessen sein
Und ich bringe dir den Tod
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.ddb.de
© 2016 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hameln
www.niemeyer-buch.de
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Carsten Riethmüller
Der Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.com
eISBN 978-3-8271-8321-7
EPub Produktion durch ANSENSO Publishing
www.ansensopublishing.de
Der Journalist Jörg Böhm (*1979) war nach seinem Studium der Journalistik, Soziologie und Philosophie unter anderem Chef vom Dienst der Allgemeinen Zeitung in Windhoek/Namibia. Danach arbeitete Jörg Böhm als Kommunikationsexperte und Pressesprecher für verschiedene große deutsche Unternehmen. Seit 2014 widmet er sich nur noch seinen schriftstellerischen Tätigkeiten. Neben dem 1. Kreuzfahrtkrimi „Moffenkind“, den er exklusiv in Kooperation mit der Reederei AIDA Cruises geschrieben hat, sind mittlerweile drei Krimis um seine dänisch-stämmige Kriminalhauptkommissarin Emma Hansen erschienen. Aktuell schreibt er an seinem vierten Emma-Hansen-Krimi, der im März 2017 erscheinen wird. Als bester Nachwuchsautor wurde er für seinen ersten Krimi „Und nie sollst du vergessen sein“ mit dem Krimi-Award „Black Hat“ ausgezeichnet.
Mehr über Jörg Böhm und seine Aktivitäten erfahren Sie unter jörgböhm.com
Der Roman spielt hauptsächlich in bekannten Regionen, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.
Meinem Mann Boris Henn
–
in Liebe
„Die wahre Liebe verausgabt sich nie. Je mehr du gibst, desto mehr verbleibt dir.“
Antoine de Saint-Exupéry
Prolog
Sonntag, 8. Dezember 2013
Als er in seinen Weinkeller hinabstieg, wusste Günther Rabold noch nicht, dass er in wenigen Minuten sterben würde. Und doch war es eine unbestimmte Vorahnung, die ihn innerlich so bewegte. Es war dieser zeitlich kaum erfassbare Moment, in dem das eigene Leben wie im Schnelldurchlauf an einem vorüberzog und in dem man sich noch einmal fragte, ob alle Entscheidungen, die man getroffen hatte, auch wirklich richtig gewesen waren.
War es wirklich sinnvoll gewesen, sich gegen eine Lehre als Bäcker und für ein Leben als Winzer zu entscheiden? Hatte er damals wirklich richtig gehandelt, als er noch mal von vorne angefangen und das alte, heruntergekommene Weingut gekauft hatte, um es eigenhändig und mit viel Liebe zum Detail zu renovieren? Und war er wirklich glücklich mit der Frau, die nun seit mehr als 45 Jahren das Leben mit ihm teilte und neben der er jeden Abend einschlief?
Eigentlich hätte er dies alles mit Ja beantworten können. Wenn er damals nicht eine große Schuld auf sich geladen hätte.
Eine Schuld, die ihn auffraß, die ihn zu einem Gefangenen seines eigenen Lebens machte.
Eine Schuld, die ihn von Jahr zu Jahr mehr zerstörte.
Und die ihn nun töten würde.
Dabei hatte der Tag für Günther Rabold ganz normal angefangen. Er hatte die gesamte Helligkeit des Wintertages ausgenutzt und im Weinberg gearbeitet. So war er durch jede Reihe seines Weinbergs gegangen und hatte dort, wo es nötig gewesen war, Reben nachgeschnitten, verfaulte Weinstöcke ausgegraben, die er im Frühjahr durch neue ersetzen würde, und die kleinen braunfarbigen Pheromonspender, die Schädlinge von seinen Reben fernhalten sollten, ausgetauscht. Er hatte sich auch die Drahthalterungen angesehen und jene erneuert, die durch die schweren Reben verbogen worden waren. Müde und erschöpft, aber auch zufrieden ob der getanen Arbeit, hatte er sich dann auf den Heimweg gemacht, als die Dämmerung längst eingesetzt und alles verschluckt hatte, was ihr keinen Widerstand bot.
Nun lag tiefe Dunkelheit über dem Ort und seinem Weingut. Das Haus war hell erleuchtet. In der Küche sah er, wie sich der Schatten seiner Frau hin- und herbewegte. Im angrenzenden Wohnzimmer lief der Fernseher und im Esszimmer brannte auf dem großen Tisch eine Kerze munter vor sich hin. Er hatte einen Bärenhunger, doch er wollte noch schnell in seinen Weinkeller und nach seinen Schätzen schauen, ehe er sich an den gedeckten Tisch setzte.
Bei der Gelegenheit kann ich ja auch gleich einen guten Tropfen mitbringen, da wird sich Eva sicher freuen, dachte er und schloss das Eichentor der Scheune auf, in der sich der Eingang zu seinem Weinkeller befand. Die Scheune war erfüllt vom rauchigen Duft der Barriquefässer, den er bereits als kleiner Junge als Prädikat ausgezeichneter Weine kennen- und liebengelernt hatte.
Schon sein Urgroßvater hatte seinen Lebensunterhalt als Winzer verdient. Eine Tradition, die er nun fortführte, die aber auch mit ihm enden würde, da es ihm, im Gegensatz zu seinen kinderreichen Geschwistern, Onkeln und Tanten, nicht vergönnt gewesen war, eigenen Nachwuchs zu haben. Er blieb für einen kurzen Augenblick im Halbdunkel stehen und atmete tief ein. Ein letztes Mal klopfte er sich seine Stiefel ab, zog sich seinen Anorak zurecht und fuhr sich mit der linken Hand durchs Haar, ehe er die Tür zum Weinkeller aufschloss.
Ein modrig-wohliger Geruch von Holz, Vanille und Mandarine empfing ihn, als er die Tür öffnete.
Mein Zuhause. Hier will ich sterben, sollte meine letzte Stunde geschlagen haben, dachte er und lächelte, während er die Kerze und die Streichholzschachtel vom Regal nahm, das Streichholz mit einem kräftigen Schwung über die Zündfläche zog und dann die Kerze anzündete. Er stockte kurz, als er sah, dass sie bereits zu einem kaum mehr vorhandenen Stumpen heruntergebrannt war.
Mensch Eva, du wolltest doch die Kerze austauschen, ärgerte er sich über seine Frau, um sich im nächsten Augenblick daran zu erinnern, dass der Weinkeller ja eigentlich seine Sache war und er sowieso nur kurz nach seinen Lieblingen schauen und eine Flasche Wein aus dem Keller holen wollte. So ließ er auch die Taschenlampe auf dem Regal stehen.
Noch bevor er die erste Stufe der Treppe betreten hatte, drückte er den Schalter der Deckenlampe. Das Gewölbe unter ihm war in ein warmes, einladendes Licht getaucht.
Er war schon zur Hälfte hinabgestiegen, als er plötzlich jemanden hinter sich wähnte. Er drehte sich ruckartig um. Auf der Schwelle zum Gewölbekeller stand Ben, sein irischer Setter, und schaute ihn mitleidig an. Zumindest war es ein Hauch von Mitgefühl, das Günther Rabold meinte, in den Augen seines treuen Gefährten gesehen zu haben.
„Ben, es ist alles okay. Ich komm ja gleich. Du weißt doch, das hier ist nichts für Hunde.“ Er war mittlerweile die Stufen wieder hochgegangen, beugte sich über seinen Hund und kraulte ihm den Nacken. „Lauf schon mal vor, gleich gibt’s was zu fressen“, sagte er, ehe er den Vierbeiner mit einem leichten Klaps auf die Hinterläufe davonschickte.
Für einen kurzen Moment sah er ihm hinterher, dann lehnte er die Tür des Weinkellers hinter sich an und stieg erneut die Treppenstufen hinunter.
Unten angekommen stellte er zuerst die Kerze auf den Boden, um für einen kurzen Augenblick innezuhalten. Das Gewölbe war niedrig und trotzdem hatte man bei Weitem nicht das Gefühl, eingeengt oder gar erdrückt zu werden. Die Luft war mit Gärstoffen, Aromen und einer gewissen Feuchte erfüllt, dafür war es im Raum nahezu still, als habe jemand die Pausentaste vom hektischen Treiben außerhalb des Weinkellers gedrückt.
Es waren diese alten Steinmauern, die in sich ruhenden Fässer und das wärmende Licht der indirekten Wandleuchten, die ihn tief in seinem Innersten so berührten. So muss sich Glück anfühlen, dachte er, während er an den Fässern vorbei zu seinen Weinregalen ging und Flasche für Flasche umdrehte. Es war ein wichtiges Ritual, das er jeden dritten Tag vollführte und das seinem Wein – so sagten es zumindest die Weinkenner unter seinen Kunden – eine ganze besondere Note verlieh. Nachdem er fertig war, nahm er den großen Besen, den er hinter dem letzten Fass gegen die Wand gestellt hatte, und kehrte den feinen Staub zusammen, der seit seinem letzten Gang durch den Keller von der Sandsteindecke heruntergerieselt war.
Von Minute zu Minute wurde die Luft dünner. Er atmete schwer. Aus den Augenwinkeln sah er bereits, wie die Flamme der Kerze im Kampf zwischen Sauerstoff und Kohlendioxid um ihr Leben tanzte. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit, ermahnte er sich, seine Kehrarbeiten zu beschleunigen und sich dann mit einer Flasche Rotwein auf den Rückweg zu machen.
Er beeilte sich, den Staub zusammenzutragen, als plötzlich etwas die Stille unterbrach. Hatte da eben Ben gebellt?
Er hielt kurz inne, aber er vernahm keinen Laut. Er wollte gerade das Kehrblech holen, als er wieder ein Geräusch vernahm. Doch ehe er registrierte, was es war, ging plötzlich das Licht der Decken- und Wandleuchter aus.
„Hey, ist da jemand?“, rief er und drehte sich in Richtung Ausgang. Die Tür war ins Schloss gefallen. Hatte der Hund sie vielleicht versehentlich zugedrückt? Langsam und schwer atmend stieg Rabold die steile Treppe hoch. Er war fast an der Tür angekommen, als diese sich plötzlich wie von alleine wieder öffnete. Rabold wollte eben die letzten Stufen hochsteigen, als unvermittelt eine Gestalt im Türrahmen auftauchte. Noch ehe der Winzer erkennen konnte, wer es war, spürte er einen kräftigen Tritt gegen den Brustkorb. Er verlor das Gleichgewicht, stürzte die steile Treppe hinab und schlug auf dem steinigen Boden auf. Rabold krümmte sich vor Schmerzen. Bei dem Sturz musste er sich das Bein verletzt haben, denn er konnte es nicht mehr bewegen. Minutenlang versuchte er, sich irgendwie an der Treppe hochzuziehen, doch seine Kraft reichte nicht aus und durch die starken Schmerzen verlor er das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, wusste er nicht, wie lange er schon auf dem kalten Steinboden des Weinkellers gelegen hatte. Er blickte nach oben und sah die Gestalt immer noch im Türrahmen stehen. Sie schien ihn die ganze Zeit beobachtet zu haben. Er wollte laut um Hilfe rufen, doch seine Stimme versagte. Seine Frau hätte ihn sowieso nicht gehört, denn die Scheune lag zu weit entfernt vom Wohnhaus und der Keller war zu tief. Er wusste, dass er in der Falle saß.
Er hörte noch, wie der Schlüssel der Eichentür zweimal umgedreht wurde, ehe ihm das Kohlendioxid langsam die Sinne raubte. Noch einmal rappelte er sich hoch und versuchte, zur Treppe zu gelangen, doch die schwindende Kraft seines Körpers ließ ihn wieder zu Boden stürzen. Er röchelte. Mit letzter Kraft robbte er sich auf die erste Stufe, als er erneut das Bewusstsein verlor.
Vergebung – das war das Letzte, was er dachte, als das Flackern der Kerze erlosch.
Kapitel 1
7 Wochen später
Sonntagabend, 26. Januar 2014
Auf den Feldern rechts und links der Straße lag Reif, der die aufgewühlte Erde durch seinen eisigen Glanz unwirklich und abweisend aussehen ließ, als Emma Hansen ihren schwarzen Mini von Freinsheim über die A 650 nach Ludwigshafen lenkte. Es war ihr täglicher Weg ins Kommissariat, der sie bereits seit nun schon gut vier Jahren in die Industriestadt führte.
Doch heute nahm sie nicht die Ausfahrt Zentrum/Walzmühle, sondern fuhr die Bundestraße 37, in die die Autobahn nahtlos überging, einfach weiter. Über die Konrad-Adenauer-Brücke überquerte sie den Rhein nach Mannheim, vorbei am Schlossgarten, und fuhr in südöstlicher Richtung weiter auf der Bundesstraße. Sie folgte der Hauptstraße links in die Möhlstraße, um kurz hinter dem Europaplatz in die Theodor-Heuss-Anlage abzubiegen. Nach weiteren gut zwei Kilometern hatte sie ihr Ziel endlich erreicht: den City-Airport Mannheim.
Seit knapp einem Jahr verbrachte sie hier nun ihre Sonntagabende. Nahezu genauso lange, wie es nun auch schon das Tanzstudio „Flying Tango“ gab, das nach der Insolvenz des Flughafens und den dadurch eingestellten Flugbetrieb hier eröffnet hatte. Die Stadt Mannheim, so wusste sie aus den unzähligen Zeitungsberichten, hatte eigens ein finanziell großzügiges Wirtschaftsentwicklungsprogramm für kleinere Unternehmen aufgelegt, um das Flugplatzgelände inmitten der Stadt nicht verkommen zu lassen. Nun hatten sich neben dem Tanzstudio und verschiedenen Restaurants auch erste Geschäfte und kleinere Betriebe angesiedelt.
Sosehr Emma die heißen Rhythmen von Salsa und Merengue, die erotische Faszination des Tangos oder die schwungvolle Samba auch liebte, die nun vor ihr liegenden zwei energiegeladenen Stunden bedeuteten für sie die größte Herausforderung seit Langem.
Es war gerade einmal einen guten Monat her, dass sie ihren Vater Knut hatte zu Grabe tragen müssen. Wie gerne hätte sie alles das, was zwischen ihnen gestanden hatte, noch einmal mit ihm besprochen. Sich mit ihm versöhnt oder zumindest noch einmal kurz mit ihm gesprochen. Doch ihr größter Wunsch war ihr nicht erfüllt worden.
Sie hatte noch im Waldshuter Krankenhaus gelegen, als Luciana, die Freundin ihres Vaters, Emma auf ihrem Handy angerufen hatte. Emma war in der Klinik behandelt worden, nachdem sie über ein Jahr zuvor im November 2012 bei der Suche nach ihrer verschwundenen Ferienfreundin Charlotte in Nöggenschwiel fast ums Leben gekommen wäre. Sie hatte dank der Rettung in letzter Sekunde mit viel Glück überlebt und hatte immer noch leicht unter Schock gestanden, als ihr Luciana abgehackt und wegen der schlechten Telefonverbindung in mehreren Anläufen vom angeblichen Tod ihres Vaters erzählt hatte. So war sie dann – noch völlig erschöpft und ohne Erlaubnis der behandelnden Ärzte – unverzüglich in die Pfalz zurückgekehrt.
Ihr Vater war zwar nicht tot, aber er lag in der Ludwigshafener Uniklinik und kämpfte um sein Leben. Als Schichtführer im Kombiverkehrsterminal bei „PalPha“, dem großen Chemiekonzern in Ludwigshafen, hatte er versucht, einen Kran zu reparieren, als sich ein Starkstromkabel gelöst, ihn erfasst und ihm dabei einen lebensgefährlichen Stromschlag versetzt hatte. Wie durch ein Wunder hatte er diesen schlimmen Unfall überlebt, doch seine Organe waren so geschädigt worden, dass er nach mehr als einem Jahr im künstlichen Koma am 1. Weihnachtstag 2013 gegen 16 Uhr gestorben war.
Emma hatte nahezu jeden Tag an seinem Bett gesessen, ihm sanft die durch den Stromschlag verbrannte Hand gestreichelt und gehofft, dass er wenigstens noch einmal die Augen öffnen würde. Doch Knut Hansen zeigte keine Reaktion. Aber das Allerschlimmste war, dass der Mann, der auf der Intensivstation lag und nur noch von Maschinen am Leben gehalten wurde, so gar nichts mehr mit dem Mann gemein hatte, der bisher ihr Vater gewesen war.
Knut Hansen, ein moderner Wikinger mit tiefer Stimme, breiten Schultern und dichtem, rötlich-blondem Haar, war stets ein Lebemann gewesen, der nichts ausgelassen und der sein Leben in vollen Zügen genossen hatte: lebendig, unaufhaltsam, stark. Der Mann, den Emma tagein, tagaus besucht hatte, war genau das Gegenteil gewesen: kraftlos, entwürdigt, dem Tode geweiht.
Sie musste schlucken, als sie die Treppen zum Studio emporstieg. Mit Bitterkeit, Trauer und Wut dachte sie an das vergangene Weihnachtsfest zurück, das sie so gerne bei ihrem Vater in der Klinik verbracht hätte. Doch wegen eines ignoranten Kollegen, der partout nicht mir ihr tauschen wollte, und eines Überfalls auf einen Geldtransporter zwischen Ludwigshafen und Frankenthal konnte sie weder am Heiligabend noch tags darauf ihren Vater besuchen.
So war es dann der Anruf der Stationsschwester, der ihr die Endgültigkeit des Lebens ihres Vaters bewusst werden ließ. Ein persönlicher Abschied sieht anders aus, dachte sie und knallte die Tür ihres Spinds zu. Ob sich auch Luciana von ihrem Vater verabschiedet hatte, überlegte sie, während sie sich umzog. Die brasilianische Schönheit hatte sich seit diesem Telefonat nicht mehr bei ihr gemeldet und auch im Krankenhaus hatte sie sich nie blicken lassen, wie Emma von der leitenden Stationsschwester erfahren hatte.
Sie überprüfte ein letztes Mal die Schnürsenkel ihrer Tanzschuhe, strich sich noch einmal ihre schwarzen, dreiviertellangen Leggings glatt und band sich ihre blonden Haare zu einem Pferdeschwanz zusammen, ehe sie, 25 Minuten zu spät, das Studio betrat.
„Die Hüfte rausnehmen, den Körper gerade strecken und die Spannung ...“, hörte sie einen Mann sagen, der abrupt seine Ausführungen unterbrach, als Emma die Tür hinter sich zuzog und mit einem Kopfnicken grüßend auf die Formationstanztruppe, bestehend aus sechs Pärchen und ihrem etwas abseitsstehenden Tanzpartner Oliver, zuging und sich neben ihn gesellte. Der Tanzlehrer folgte ihr mit seinem Blick, während er immer noch eine dunkelhaarige und gut proportionierte Frau im Arm hielt.
„Hej, wo ist denn Amanda?“, flüsterte Emma Oliver zu, der gerade ansetzen wollte, ihr zu antworten, als er unterbrochen wurde.
„Oh, guten Abend und schön, dass Sie es einrichten konnten.“
„Es tut ...“
„Was tut Ihnen leid? Dass Sie zu spät sind, ohne zu grüßen hier einfach reinkommen, mich während des Trainings unterbrechen und ihren Tanzpartner wie einen begossenen Pudel alleine rumstehen lassen?“
„Also erstens bin ich kein Pudel und fühle mich auch nicht wie einer, nur weil ich ein paar Minuten ohne Partnerin tanzen musste. Und zweitens ist Emma beruflich sehr eingespannt“, erwiderte Oliver Becker, der Emma einen aufmunternden Blick zuwarf.
„Lass gut sein, Olli, aber danke. Ich brauche mich nicht ...“
„Wir haben alle einen stressigen Job“, schnitt der Tanzlehrer ihr das Wort ab. „Und auch beim Tanzen zählt Disziplin, Disziplin und noch mal Disziplin, und wer das nicht schafft, der sollte vielleicht lieber Hallenhalma spielen. So, und jetzt wärmen Sie sich auf, am besten mit zehn Liegestützen extra, und versuchen dann, wenn Ihnen das genehm ist, mit uns mitzuhalten und die Musik zu fühlen.“
Auch wenn Emma innerlich kochte und ihm am liebsten ins Gesicht gesprungen wäre – so sehr ärgerte sie sich über diesen ungerechtfertigten Einfall dieses selbstverliebten Schnösels –, sie musste sich insgeheim eingestehen, dass der neue Tanzlehrer, der Matthias hieß, wie sie von Oliver erfahren hatte, sie mehr als nur als Tänzer faszinierte. Es waren dieser selbstsichere, nahezu unverwundbare Ausdruck und diese besondere Form seiner Männlichkeit, gepaart mit einer hundertprozentigen Körperbeherrschung, die sie in seinen Bann zogen. Und auch wenn sie wusste, dass sie Matthias von ihren weiblichen Reizen niemals würde überzeugen können, so würde sie ihn gewiss nicht von der Bettkante stoßen, würde sich diese Chance einmal ergeben. Und, wer weiß, am Ende musste man sich seiner eben nur annehmen, dachte sie und sie musste auf einmal verstohlen grinsen.
Sie wunderte sich selbst, wie schnell sie die deprimierenden Gedanken an den Tod ihres Vaters überwunden hatte.
Und wenn es auch nur für diese Tanzstunde gewesen war.
Kapitel 2
Montag, 27. Januar 2014
Pfälzer Nachrichten
Als die Person den Artikel fertiggelesen hatte, blieb ihr Blick am großen Foto haften, das von der Überschrift und dem Textlauf eingerahmt wurde.
Es war der besondere Ausschnitt des Fotos, den ihre Augen fokussierten.
Der sich in ihre Seele brannte.
Den sie nie mehr vergessen würde.
Mit einem Lächeln faltete sie die Zeitung zusammen und legte sie auf den Altpapierstapel.
Endlich war die Zeit gekommen, das Schicksal in die richtige Bahn zu lenken.
Kapitel 3
Der Winter hatte Burrweiler an diesem Morgen fest im Griff. Schon seit Tagen hatte die eisige Kälte aus dem Osten ihr glitzerndes Gewand über der gesamten Region ausgebreitet. Während die Dächer und Giebel der Häuser aussahen, als wären sie unter der Eisschicht geschrumpft, wirkten die abgemähten Felder und knorrigen Rebstöcke wie erstarrt, nicht in der Lage, gegen die eisige Kälte ankommen zu können.
Der verträumte Ort, an der alten Weinstraße gelegen, der sonst mit seinen romantischen Innenhöfen, den ausgezeichneten Weingütern sowie als idealer Ausgangspunkt für Wanderungen durch den Pfälzer Wald von den Touristen vom Frühjahr bis spät in den Herbst hinein stark frequentiert wurde, wirkte wie ausgestorben. Ab und zu fuhr ein Auto die Kirchstraße oder die Weinstraße Richtung Gleisweiler entlang. Hier und da trauten sich einige Schulkinder auf die Straße, die schnell zur Bushaltestelle hasteten, um keine Sekunde länger als unbedingt nötig die Kälte ertragen zu müssen.
Selbst von den Feierlichkeiten des renovierten und am Samstag eröffneten Umbaus der St.-Anna-Klinik war nichts mehr zu spüren. Nur ein paar vereiste Girlanden hingen noch an den Stromkabeln, die die Dorfstraßen überspannten. Vereinzelt standen noch Plakate an einigen Straßenlaternen und an den wenigen Straßenkreuzungen. Sie erinnerten an das Fest und den Tag der offenen Tür in der Klinik, die nicht nur viele Besucher und Angehörige der Patienten angelockt, sondern über die auch Funk und Fernsehen in den Nachrichten landesweit ausführlich berichtet hatten.
Doch keine 48 Stunden später war der Alltag längst ins Dorf zurückgekehrt. Es schien ein ganz normaler friedlicher Tag zu werden, so wie alle anderen 364 Tage im Jahr auch.
Das dachte auch Rosa Gadinger, als sie kurz nach 7 Uhr mit der Tageszeitung unterm Arm das Pfarrhaus neben der großen, im spätgotischen Stil erbauten Kirche betrat. Sie liebte es, früh in den Tag zu starten. Im Gegensatz zu Pater Clemens Bauer, der sich im Badezimmer im ersten Stock gerade rasierte und seiner Morgentoilette nachging, wie sie mit einem Lauschen ins Treppenhaus vernahm, war sie bereits jeden Tag gegen 5.30 Uhr auf den Beinen. Wenn es mal später wurde, dann blieb sie bis um 6 Uhr liegen, aber spätestens nach den Morgennachrichten auf SWR4 stieg sie aus dem Bett. Während sich ihr Mann noch einmal für einige Minuten umdrehte – er war ein ausgewiesener Morgenmuffel und meistens schlecht gelaunt, wenn sie ihn vor seiner zweiten Tasse Kaffee ansprach –, ging sie in die Küche, setzte eine große Kanne Kaffee auf, schob drei Aufbackbrötchen für ihren Mann in den Backofen, nahm sich eine Scheibe Vollkornbrot aus dem Brotkasten, holte die Butter aus dem Kühlschrank und ging dann wieder hoch ins Badezimmer, um sich frisch zu machen. Auf ihrem Weg zurück in die Küche ging sie zur Haustür, um dort die im Briefschlitz steckende Zeitung mitzunehmen und in Ruhe bei ihrer ersten Tasse Kaffee am gebeizten Esstisch darin zu blättern.
So war es ebenfalls an diesem Morgen gewesen, auch wenn sie heute wegen dieses alltäglichen Rituals fast zu spät das Haus verlassen hätte.
Der große Artikel auf Seite neun war es, der ihre volle Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Immer und immer wieder musste sie den Bericht zur Neueröffnung des renovierten Altenheims lesen, in dem nun auch eine Abteilung für Mütter mit Neugeborenen und Kleinkindern eröffnet worden war. Eine bessere Erholung für ausgebrannte Mütter konnte man sich hier, in der deutschen Toskana zwischen dem Pfälzer Hügelland und der sonnengeküssten Rheinebene, auch wahrlich nicht vorstellen.
Doch es waren nicht nur die ausführlichen Erklärungen zur neuen St.-Anna-Klinik, die Dankesworte des Landrats oder die Beschreibungen der Therapien, die sie faszinierten. Es war das große Aufmacherbild, das Rosa Gadinger magisch anzog, das sich in ihre Pupillen einbrannte und das sie nie wieder loslassen würde.
Sie hatte die grinsenden Gesichter aller wichtigen Personen, die sich für die feierliche Wieder- beziehungsweise Neueröffnung verantwortlich zeigten, auch dann noch in ihrem Kopf, als sie gedankenverloren ein „Guten Morgen, Pater“ ins Treppenhaus hinaufrief, in die Resopalküche aus den 60er-Jahren ging, Wasser für den grünen Tee des Paters aufsetzte und anschließend im kleinen Pfarrbüro nebenan ihren Computer hochfuhr.
Sie nahm gerade einen Ordner aus dem Aktenschrank, der hinter ihrem Schreibtisch stand, als die Tür des Büros aufgerissen wurde. Es war gerade erst 7.45 Uhr, wie sie der Uhr am rechten unteren Ende der Menüleiste auf dem Flachbildschirm ihres Computers entnehmen konnte.
„Wo ist er?“, schnaubte Alois Straubenhardt. Der Kopf des 1,70 Meter kleinen Mannes war rot angelaufen, die Vene an seiner Schläfe pochte merklich und seine Mundwinkel wiesen bereits erste Speichelfäden auf. Er fuchtelte wild mit der Zeitung herum, die er in seiner rechten Hand hielt. „Guten Morgen, Alois. Pater Bauer ist sicherlich noch ...“ Doch so weit kam Rosa Gadinger nicht, denn der Winzer hatte längst auf dem Absatz kehrtgemacht und sie hörte, wie er, zwei Stufen auf einmal nehmend, die Holztreppe in den ersten Stock und damit in die Gemächer des Pfarrers hinauflief.
„Hallo Alois ...“, hörte sie, wie der Pater den frühen Gast willkommen hieß, um im nächsten Augenblick von einem wilden Verbalangriff überrascht zu werden.
„Was fällt dir ein? Wie kannst du dich nur so aufspielen und über mein Grundstück und vor allem über meinen Kopf hinweg entscheiden?“, kläffte Straubenhardt und beschallte damit das gesamte Treppenhaus.
Gut erzogen, wie sie nun einmal war, und weil sie noch dringend etwas zu erledigen hatte, stand Rosa Gadinger auf und schloss vorsichtig die Tür. Was er nun schon wieder hatte, dieser alte Schreihals, überlegte sie und kehrte zu ihrem Schreibtisch zurück. Der Arme konnte einem wirklich leidtun, dachte sie und mit einem Seufzer widmete sie sich wieder den Akten für die Buchhaltung, während sie Straubenhardt durch die geschlossene Bürotür weiter auf den Pater einreden hörte.
„Du hast mich vor dem gesamten Ort blamiert, vor dem Landrat und meinen Kunden. Was fällt dir eigentlich ein?“ Straubenhardt hatte mittlerweile die Zeitung mit dem Lokalteil für die Südliche Weinstraße aufgeschlagen und streckte dem Pfarrer den Artikel entgegen. „Hier, es steht alles schwarz auf weiß da!“
„Jetzt beruhig dich doch erst mal ...“
„Wieso sollte ich, du hast mir alles ruiniert! Schon wieder ...“
„Weil es das Beste ist.“ Clemens Bauer war mittlerweile aus dem Flur, wo er vor wenigen Augenblicken Alois Straubenhardt in die Arme gelaufen war, in sein Ankleidezimmer getreten. Er ging zum schweren Kleiderschrank aus Kirschholz, der am anderen Ende des Raumes stand, nahm die Soutane heraus und hängte sie von außen an die Schranktür. Bevor er sie überzog, nahm er seine anthrazitgraue Strickjacke vom Bügel und streifte sie sich über sein von Rosa Gadinger frisch gestärktes und gebügeltes Oberhemd.
„Das Beste? Das Beste?“ Straubenhardt schrie regelrecht. „Dass ich nicht lache! Du machst das sofort wieder rückgängig, hörst du ...“
„Mein lieber Alois. Vertrau mir doch einfach. Du wirst mit keinem deiner Weine auch nur annähernd so viel Anerkennung bekommen, wie du sie mit dieser überaus großzügigen Geste erhältst.“
„Ich soll dir mein Grundstück auch noch schenken? Das war so nie abgemacht.“
„Manchmal ändern sich eben die Dinge, aber Gott wird dich dafür reichlich belohnen. So wie er alle guten Schäfchen reichlich belohnt.“ Der Pater steckte sich seinen Stehkragen zurecht und betrachtete sich ausgiebiger als sonst im großen Spiegel, der in der Innenseite der anderen Schranktür angebracht war.
„Bleib mir bloß weg mit deinem Gott. Ich glaube eher, du spielst den lieben Gott und willst großzügige Geschenke verteilen, und zwar an dich selbst. Damit du gut dastehst, nach allem, was du dir hast zuschulden kommen lassen“, sagte Alois Straubenhardt, der laut trampelnd die Treppe hinunterlief. Unten angekommen drehte er sich noch einmal um und blickte erst zornerfüllt, dann aber mit einem kaum merklichen, aber doch vielsagenden Lächeln nach oben, dem Pater, der mittlerweile an die Treppe getreten war, tief in die Augen. Beide Männer fokussierten sich für den Bruchteil einer Sekunde, wie in einem Duell, abwartend, wer den ersten Fehler machte, ehe Straubenhardt weiter durch den Flur in Richtung Haustür marschierte, sich noch einmal umdrehte und dem Pater zurief: „Du wirst noch sehen, wozu ich in der Lage bin.“
„Alois, hüte deine Zunge. Du wirst gar nichts unternehmen, sonst ...“
Aber die Tür war bereits mit einem lauten Knall ins Schloss gefallen.
Kapitel 4
Im Nachbarzimmer klapperte jemand mit Geschirr, vor der Tür schob eine Schwester den Tablettwagen vorbei und auf dem Innenhof hinter ihrem Fenster kehrte ein Mitarbeiter des Hausdienstes die letzten Überreste der Feierlichkeiten vom Wochenende zusammen.
Gefangen in der Tristesse des Lebens und der Langeweile völlig ausgeliefert, saß Ruth Martin in ihrem roten Ohrensessel und starrte das Fernsehgerät an.
Auch wenn sie weder genau wusste, wo sie sich gerade befand noch wer sie war, so wusste sie doch, dass irgendetwas ganz Merkwürdiges vor sich ging. Sie fühlte sich mehr und mehr beobachtet. Vorsichtig schaute sie sich nach rechts um. Aber da, wo vor wenigen Minuten noch Marlene Dietrich mit ihr und Bette Davis Kaffee getrunken hatten, standen jetzt nur ihr Bett und im Hintergrund der aus Eichenholz gefertigte Kleiderschrank.
Komisch, ich könnte schwören, dass jemand anderes mich die ganze Zeit angestarrt hat, dachte sie und versuchte angestrengt, sich daran zu erinnern. Aufgeregt schaute sie sich immer wieder im gesamten Raum um, der in hellem Gelb gestrichen war. Neben ihrem Schreibtisch schlossen sich direkt der Nachttisch und das Bett ihrer Mitbewohnerin Elisabeth an. Eigentlich konnte sie Elisabeth gut leiden, wenn diese nicht so ein bisschen verrückt im Kopf wäre und andauernd etwas von Außerirdischen und der Kaiserin Sissi faseln würde. Dabei wusste doch jeder, dass es die Kaiserin Sissi gar nicht gegeben hatte und die Außerirdischen bestimmt nicht den weiten Weg geflogen kamen, nur um ihre Mitbewohnerin Elisabeth zu besuchen.
Da! Da war es wieder. Fast wäre sie hochgesprungen, doch ihre müden Beine versagten ihr den Dienst. Sie drehte ihren Kopf wieder zurück in Richtung Fernseher, in dem ein Mann im eleganten Anzug in einem blauen Studio saß und die Nachrichten des Tages verlas.
Durch die Tür hörte sie jemanden schreien. Ob es wieder diese Babys waren? Das ging schon die ganze Zeit so. Auch wenn sie sich nicht mehr daran erinnern konnte, wann diese Schreierei losgegangen war, so hatte sie besonders zugenommen, seitdem diese ganzen Mütter mit ihren Kindern hier eingezogen waren. Was die hier eigentlich wollten? Diese schreienden Babys? Und warum bekamen Mütter, die es nicht schafften, ein Kind zu beruhigen, dann überhaupt welche?
Man müsste sie ihnen einfach wegnehmen, denn anscheinend hatten sie es nicht verdient, Mutter zu sein und ein Kind großzuziehen, sonst würden die Kinder ja nicht die ganze Zeit und unablässig wie am Spieß schreien, dachte Ruth und lächelte.
Sie wusste, was es bedeutete, für Gerechtigkeit zu sorgen und das Schicksal im Sinne der Vernunft zu beeinflussen. Auch wenn dafür jemand anderes hatte sterben müssen. Und sie dafür den Tod verdiente.
Nur noch ein Zimmer, dachte Maria Kuhnert, die von den jungen Müttern liebevoll nur Schwester Maria genannt wurde, während sie gerade ein weiteres Wasserglas auf den Tablettwagen in den dafür vorgesehenen blauen Plastikkorb stellte. Jeden Morgen und Mittag und, wenn sie Spätdienst hatte, dann auch am Abend, machte sie die gleichen Handgriffe bei der Essensausgabe. Zuerst wurde der silbergraue Wagen aus Aluminium von der Küche aus in den Gang der Station geschoben, dann verteilte das Pflegepersonal die Tabletts mit den Mahlzeiten an die hauptsächlich an Demenz erkrankten Patienten. Nach gut 30 Minuten wurden die nur selten vollständig leer gegessenen Tabletts wieder eingesammelt und zurück in die Schubfächer des Wagens geschoben. Bis dahin kümmerte sie sich um die ihr zugewiesenen Patienten, die nicht mehr selbstständig essen und trinken konnten oder deren Beutel mit Flüssignahrung ausgetauscht werden musste. Eine liebevolle Geste hier, ein beruhigendes Wort dort, für mehr blieb ihr meist keine Zeit, denn die 30 Minuten waren immer mit der Gewissheit verbunden, gefühlt bereits nach 15 Minuten abgelaufen zu sein.
Vorsichtig und doch beherzt klopfte sie an Ruth Martins Zimmertür. Es war ihr erster Tag auf dieser neuen Station, auf der die besonders schwer demenzkranken Patienten nun gemeinsam mit Müttern wohnten, die bedingt durch ihre postnatale Depression erst wieder lernen mussten, ihre Kinder anzunehmen und sie zu lieben. Hier wurden in speziellen Therapieeinheiten auch die Mütter mit ihren Kindern zusammen mit den Demenzkranken betreut. Ärzte, Psychologen und Therapeuten versprachen sich von den Begegnungen eine Anregung für beide Patientengruppen, die den Verlauf der Therapien positiv beeinflussen sollte.
„Hat es Ihnen geschmeckt?“, fragte Schwester Maria, als sie den Raum betrat. Ruth Martin bemerkte sie nicht oder zumindest hatte es nicht den Anschein, denn obwohl Maria laut gesprochen hatte, starrte Ruth Martin unentwegt auf den Fernseher. Die Nachrichten waren mittlerweile vorbei und gerade lief eine Reportage über das Schicksal verstoßener Kinder.
Wie passend, dachte Maria, die das Tablett nahm, das hinter Ruths Ohrensessel auf dem kleinen Beistelltisch am Bett stand. Als sie wieder um den Ohrensessel herumgegangen war und sich nach vorne beugte, um Ruth einen schönen Nachmittag zu wünschen, kreuzten sich für den Bruchteil einer Sekunde die Blicke der beiden Frauen.
In dem Moment erstarrte Ruth. Ihre Augen waren weit aufgerissen. Maria Kuhnert wollte gerade etwas zu ihr sagen, als Ruth plötzlich anfing zu schreien.
Maria erschrak wegen dieser unerwarteten Reaktion so sehr, dass sie das Tablett fallen ließ. Während der Teller, das Salatschälchen und der Nachtischbecher aus Porzellan mit lautem Knall zu Boden krachten und dabei in tausend Scherben zersplitterten, ergoss sich die Champignoncremesuppe über Ruths Schoß, was sie noch mehr dazu animierte, in höchster Frequenz und ohne Unterlass wie um ihr Leben zu brüllen.
Ein Pfleger, der gerade zwei Zimmer weiter dabei gewesen war, eine pflegebedürftige Patientin zu waschen, kam genauso angerannt wie ein junges Mädchen, das gerade ihr soziales Jahr auf der Station absolvierte.
Er, mit großen, hellblauen Papiertüchern bewaffnet, versuchte, Ruths Rock trocken zu tupfen, während die junge Frau alles daran setzte, beruhigend auf die alte Frau einzureden. Als die Stationsleitung mit einem Kehrblech und Handfeger sowie einem Eimer mit Spülwasser das Zimmer betrat, nutzte Maria Kuhnert das hektische Treiben und schlich sich aus dem Zimmer. Sie war immer noch ganz benommen. Auf dem Flur angekommen ging sie in den gegenüberliegenden Wäscheraum, schloss vorsichtig die Tür und lehnte sich mit ihrem gesamten Gewicht gegen die Wand. Sie atmete tief durch und genoss die Ruhe. Minutenlang stand sie zwischen Handtüchern, Bettwäsche und Tischdecken in der länglichen Kammer, in der auch die Plastikstühle für den Sommer aufbewahrt wurden. Mit beiden Zeige- und Mittelfingern massierte sie ihre Schläfen, während sie ihren Kopf tief in den Nacken legte.
Es war ihr auch jetzt immer noch nicht möglich, das gerade Erlebte einzuordnen oder gar zu verstehen. Warum hatte die Frau sie so entgeistert angestarrt? Und wer war diese Frau überhaupt, dass diese so zusammengefahren war, als sie in das Zimmer gekommen war, nur um das Tablett abzuräumen und sich nach dem Wohlbefinden der Patientin zu erkundigen?
Sie spürte immer noch den Blick dieser Frau in ihrem Nacken, als sie, zehn Minuten später und mit mehr Mühe als sonst, den Essenswagen zurück an den Aufzug zur Küche schob.
Ihr war, als habe ihr der Tod höchstpersönlich in die Augen geschaut.
Kapitel 5
Alois Straubenhardt war immer noch aufgebracht, als er die Haustür seines Weinguts aufschloss. Wie hatte der Pfarrer ihn nur so übers Ohr hauen können, nachdem sie gemeinsam so füreinander eingestanden waren, ärgerte sich Straubenhardt und warf seine ärmellose Fleeceweste achtlos in die Ecke.
Für einen kurzen Moment streiften seine Augen sein Spiegelbild, in dem er einen Mann sah, der seiner Ansicht nach noch ziemlich gut aussah, auch wenn die jahrzehntelange schwere Arbeit im Weinberg ihre Spuren hinterlassen hatte. Er war mit seiner etwas untersetzten Figur kein besonders stattlicher Mann, aber er war auch nicht dick. Er hatte große, wache Augen, dickes, silbergraues Haar und ein markantes Gesicht. Besonders herausstechend war seine Nase: fleischig, großporig und dank seiner Liebe zum vergorenen Saft auch schon stark rot-bläulich angelaufen.
„Paul, wo bist du, du fauler Hund?“, rief er ins Treppenhaus hoch, während er in den offenen Essbereich ging, der die kleine und dunkle Küche mit dem großen und im Sommer lichtdurchfluteten Wohnbereich verband, den er ein Jahr vor dem Tod seiner Frau hatte umbauen lassen. „Nie ist der Kerl da, wenn man ihn braucht.“
Erneut nahm er die Zeitung, breitete sie ganz auf dem Esszimmertisch aus und schlug den Teil auf, der ihn so aus der Fassung gebracht hatte.
Das Bild des Seitenaufmachers mit den grinsenden Fratzen sprang ihn förmlich an, während er immer und immer wieder diesen einen Satz lesen musste: „Unterstützt werden wir dabei von Alois Straubenhardt, der uns den Großteil seines Weinbergs schenkt. Am kommenden Dienstag werden wir dazu die letzten notariellen Hürden nehmen.“
Was hatte sich der alte Tattergreis nur dabei gedacht, ihn so zu düpieren und auch noch Spaß daran zu haben? Und das, obwohl er ihn stets davor gewarnt hatte. Dann wird er eben jetzt dafür büßen, dachte Straubenhardt, der plötzlich erschrak, als sein Sohn Paul ins Esszimmer trat.
„Warum schreist du denn so?“, fragte Straubenhardt junior und schaute seinen Vater intensiv an.
Paul war ein eher unscheinbarer Mann. Sein Körper war schlaksig, ohne dabei wirklich eine Figur zu haben. Er hatte schlanke, aber kräftige Finger, die einem aber nicht das Gefühl von Sicherheit vermittelten. Und dünne Lippen, etwas zu große Ohren und kleine Augen, die ihn mit ihrem aggressiven und oft besserwisserischen Blick nicht gerade sympathischer machten. Seine fast pechschwarzen Haare waren das auffälligste Zeichen seines Äußeren.
„Ach, hast du den Artikel also auch schon gelesen?“ Paul hatte sich mittlerweile über den Tisch gebeugt und schaute seinen Vater süffisant von der Seite an.
„Dieser Schwachsinn, man müsste den Schmierlappen dafür eigenhändig erschießen.“
„Der Redakteur kann nichts dafür, und das weißt du.“
„Er hätte mich fragen müssen. Dann hätte ich ihm die ganze Wahrheit erzählt.“
„Wahrheit? Welche Wahrheit denn?“ Paul hatte seinen Blick, ohne mit der Wimper zu zucken, fest auf seinen Vater gerichtet.
„Was fragst du denn so blöd? Nie und nimmer werde ich mein Grundstück für diesen Laden hergeben.“
„Dir wird beim Pfaffen nichts anderes übrig bleiben“, sagte Paul, während er in die Küche ging, die Kaffeemaschine einschaltete und sich Milch in einen Kaffeebecher goss, der mit einem Werbeaufdruck des lokalen Energieversorgers beschriftet war.
„Das werden wir noch sehen.“ Alois Straubenhardt brütete immer noch gedankenverloren über der Zeitung.
„Du hättest das Grundstück uns geben sollen, da wäre dir ...“ Doch Paul schaffte es nicht, seinen Satz zu vollenden. Wie ein in die Enge getriebener Hund stürzte Alois Straubenhardt in die Küche. Fast wäre er seinem Sohn an die Kehle gesprungen, hätte dieser sich nicht gerade umgedreht, um die Kaffeemaschine mit Wasser aufzufüllen.
„Ich hätte was? Dir und diesem durchgeknallten Weltverbesserer mein Grundstück, mein Grundstück überlassen sollen?“ Alois Straubenhardts Gesicht war erneut knallrot angelaufen. Doch dieses Mal zitterte er am ganzen Körper, während seine sonst eher tief innenliegenden Augen fast vollständig hervorquollen.
„Ich muss dich schon durchfüttern, weil du nichts Gescheites lernen und das Weingut übernehmen willst. Und jetzt willst du dir auch noch das Wertvollste, was ich habe, unter den Nagel reißen und für deine hirnverbrannten Versuche missbrauchen?“
„Vater, ich ...“
„Halt einfach dein Maul und scher dich zum Teufel. Lass mich endlich in Ruh.“ Alois Straubenhardt hob noch einmal die Hand, um mit einer abwinkenden Geste das Gespräch zu beenden, drehte sich um, ging durch den Flur und knallte die Tür hinter sich zu.
Paul hörte noch, wie sein Vater in die Gerätescheune ging, die sich direkt an das Haupthaus anschloss, den Motor des großen Traktors anließ und schneller als gewöhnlich vom Hof fuhr.
Schrei du nur, das wird dir auch nichts mehr nutzen, dachte Paul Straubenhardt und grinste. Es ist alles nur noch eine Frage der Zeit, freute er sich, griff nach den Autoschlüsseln, die im Flur am Haken hingen, und verließ das Haus – mit dem einen Ziel vor Augen.
Kapitel 6
Der Morgen war eisig und klar. Die Hausdächer, Autos und Gehsteige waren mit leichtem Raureif überzogen und es glitzerte alles ganz verwunschen, als Emma Hansen aus dem Fenster ihrer Wohnung in der Freinsheimer Innenstadt schaute. Wobei Innenstadt vielleicht etwas großspurig klang, war der romantische Ort an der Weinstraße mit seinen knapp 5000 Einwohnern eigentlich viel zu klein, um ein Stadtzentrum im klassischen Sinne zu besitzen.
Doch mit der nahezu vollständig erhaltenen, spätgotischen Stadtmauer unterteilte sich die Stadt in einen neueren Teil mit den Straßenzügen, die außerhalb der Mauer lagen, und einen historischen Stadtkern, in dem die Zeit stehen geblieben zu sein schien. Als Emma mit ihrer Freundin Rike zum ersten Mal Freinsheim, das die Einwohner liebevoll Fränsem nannten, besucht hatte, da hatte sie sich sofort und auf Anhieb in das Städtchen verliebt.
Mit seinen gut erhaltenen und aufwendig restaurierten Sandsteinhäusern, dem gepflegten Kopfsteinpflaster und den kleinen, von ihren Besitzern mit viel Leidenschaft und Hingabe geführten Geschäften besaß Freinsheim einen Charme, der einen immer wiederkehren ließ. So auch Emma.
Bereits seit drei Jahren wohnte Emma nun schon hier, nachdem sie sich zuvor erst mit Rike in Büchenbeuren im Hunsrück eine Wohngemeinschaft geteilt hatte, als sie dort zur Polizeischule gegangen war, während Rike vom Flughafen Hahn aus als Stewardess für eine irische Fluglinie die Welt bereist hatte.
Ihre Wohnung unterm Dach befand sich direkt an der Freinsheimer Stadtmauer, keine hundert Meter vom Eisentor entfernt. Schwere, dunkelbraun lackierte Holzbalken stützten und verzierten gleichzeitig den großen Wohnbereich, in dem sich neben dem Wohnzimmer auch eine kleine Essecke befand. Während die schrägen Wände hier nicht so stark auffielen, hatte man in der Küche wie auch im Badezimmer das Gefühl, von den angewinkelten Wänden förmlich erdrückt zu werden. Auch nach drei Jahren stieß sich Emma immer wieder den Kopf an einer der Schrägen und verfluchte die Wohnung dafür mit einem lautstarken „Ich zieh hier aus!“ Aber sie liebte ihr knapp 50 Quadratmeter großes Domizil und wollte es um nichts auf dieser Welt mehr hergeben. Auch wenn sie dafür einen weiten Anfahrtsweg zum Polizeipräsidium Ludwigshafen auf sich nehmen musste. Im Präsidium war auch ihre Dienststelle, die „Zentrale Kriminalinspektion“ – landläufig auch Mordkommission genannt – untergebracht, die für alle Kapitalverbrechen in der Vorder- und Südpfalz wie auch an der Südlichen Weinstraße zuständig war.
Dieser Tag sollte ein besonderer werden, weswegen sie extra eine halbe Stunde früher aufgestanden war, um entspannt in den Morgen zu starten und sich etwas mehr Zeit für Make-up und Kleidung zu nehmen.
Emma bekam heute einen neuen Kollegen, mit dem sie zukünftig ihren Dienst verrichten durfte. Sachlich ausgedrückt. Doch emotional war der neue Kollege mehr als nur irgendein Kollege. Der Neue, dessen Name sie noch nicht kannte, sollte ihr Mitstreiter, ihr Vertrauter, ihr Partner werden. Eine Beziehung, die oftmals gut und gerne ein ganzes Berufsleben halten konnte. Und in der der andere, wollte man einen guten Job machen, am Ende mehr von einem wusste als man selbst. Es war dieses bedingungslose Einstehen füreinander, das diese Partnerschaft charakterisierte. Und genau diese Verlässlichkeit wünschte sich Emma von ihrem künftigen Partner, als sie ihren schwarzen Mini auf den Parkplatz des Präsidiums fuhr.
Sie hatte vor Ludwigshafen fast 20 Minuten im Stau gestanden, und dann war in der Stadt fast jede Ampel rot gewesen, trotzdem kam Emma mehr als pünktlich im Präsidium an der Wittelsbachstraße an.
So ging sie zuerst in ihr Büro in der Mordkommission, das sie sich ab sofort mit ihrem neuen Kollegen teilen würde, um kurz durchzulüften, den Computer hochzufahren und sich anschließend ihre Karaffe am Wasserautomaten in der Abteilungsküche aufzufüllen.
„Guten Morgen Emma“, begrüßte sie Joachim Hellmann, der als Erster Kriminalhauptkommissar und Leiter der Zentralen Kriminalinspektion Ludwigshafen Emmas direkter Vorgesetzter war.
„Hej Chef“, antwortete sie und schaute Hellmann nach. Auch ihr Chef hatte sich offensichtlich in Schale geworfen, denn außer zur Weihnachtsfeier oder zum Geburtstag des Polizeipräsidenten sah sie Hellmann nie eine Krawatte tragen. Doch heute zierte ein Schlips seinen dunklen Anzug und gab zusammen mit dem weißen Hemd und der goldenen Krawattennadel mit Ludwigshafener Stadtlogo ein durchaus stimmiges Bild ab. Auch wenn Emma dieser Auftritt zu konservativ, für ihren Chef gar zu spießig vorkam. Sie mochte Hellmann viel lieber, wenn er in Jeans, offenem Hemd und sportlichem Sakko im Büro erschien.
„Kommst du?“, fragte Hellmann, der gerade dabei war, seine Mannschaft für den Empfang des Neuankömmlings zusammenzutrommeln.
„Wie heißt er eigentlich?“, rief Emma ihrem Chef hinterher.
„Wer?“, fragte er, während er den Kopf in ein weiteres Büro steckte, um auch dort die Kollegen noch einmal persönlich einzuladen.
„Na, der Neue ...“
„Du bist doch gleich auch dabei, da sage ich dann alles. Sonst muss ich ja alles doppelt und dreifach erzählen“, erwiderte er und so folgte Emma ihm und einer Traube von Kollegen in den Konferenzraum.
Sie zog sich eine heiße Schokolade am Automaten, nahm sich ein belegtes Käsebrötchen von der Schnittchenplatte und stellte sich ans Fenster neben Annegret Bender, der Abteilungssekretärin und rechten Hand ihres Chefs.
„Na, auch schon aufgeregt?“, fragte die 48-Jährige und lächelte. „Er sieht gut aus, wenigstens auf dem Foto.“ Annegret Bender, glücklich verheiratet, aber um einen Flirt nie verlegen, strahlte.
„Er muss gut sein und zuverlässig, so wie Martin Jost.“
„Das war aber auch die einzige Stärke deines ehemaligen Partners.“ Annegret Bender musste immer die Augen verdrehen, wenn Josts Name nur erwähnt wurde. Sie mochte Emmas ehemaligen Kollegen nicht, der sich vor ein paar Wochen in den Ruhestand verabschiedet hatte. Daher freute sie sich besonders auf den Neuen in der Abteilung.
„Ich meine, so was fürs Auge ist doch auch nicht schlecht.“ Emma verkniff sich einen Kommentar und lächelte milde, aber etwas gequält, denn sie wusste genau, was jetzt wieder kommen würde.
„Ich versteh dich nicht. Du siehst so gut aus, aber bist immer noch Single.“
„Vielleicht bin ich ja ...“ wollte Emma kontern, als sie von Hellmann, der gerade den Raum betrat, unterbrochen wurde. Selten war sie ihrem Chef so dankbar gewesen wie in diesem Moment.
„Es ist so weit: Ich möchte euch unseren neuen Kollegen vorstellen, der ab sofort nicht nur mit unserer hochgeschätzten Kollegin Emma Hansen das Büro teilt ...“ Annegret Bender konnte sich ein Quieken nicht verkneifen, das abrupt endete, als sie Emmas bösen Blick sah.
„... sondern mit ihr gemeinsam auch den Bereich Südliche Weinstraße, das Pfälzer Hügelland wie auch die Rheinebene von Speyer bis Wörth betreut und verantwortet. Herzlich willkommen, Matthias Roth.“
Applaus brandete auf und die ersten Kollegen, die Hellmann am nächsten standen, begrüßten den 36-Jährigen.
„Hab ich doch gesagt, er sieht gut aus, oder?“, sagte Annegret Bender. Sie war offensichtlich sehr angetan von der Attraktivität des Neuen. Als ob sie ihn schon für Emma vorgesehen hatte, stupste sie Emma an. Als keine Reaktion kam, drehte sie sich zu ihr um. Sie erschrak, als sie Emmas Gesicht sah. „Emma? Hallo? Was hast du denn, alles in Ordnung mit dir?“
„Was ...?“
„Ich hab dich was gefragt ...“
„Äh, ja, also ...“
„Emma, auch wenn er vielleicht nicht dein Typ ist, so ein Gesicht hat der arme Kerl nun aber wirklich nicht verdient ...“
Doch bevor Emma irgendetwas antworten konnte, kamen bereits Joachim Hellmann und Matthias Roth auf die beiden Frauen zu.
„So, bekanntlich kommt das Beste ja zum Schluss: Einmal Annegret Bender, unsere Sekretärin, unsere gute Seele, an die du dich in allen organisatorischen und bürokratischen Belangen wenden kannst. Sie wird immer ein offenes Ohr für dich und deine Bedürfnisse haben.“ Hellmann nickte Annegret Bender wohlwollend zu, die seine Worte mit ihrem breitesten Grinsen quittierte.
„Und das ist, darf ich vorstellen, deine neue Kollegin, Emma, äh, Emma Hansen.“
„So schnell sieht man sich also wieder, liebe Kollegin.“ Matthias lächelte leicht süffisant.
„Ihr kennt euch?“ Hellmann schien mehr als überrascht zu sein und schaute von Emma zu Matthias und wieder zurück. Emma wollte gerade ansetzen, als Matthias ihr zuvorkam.
„Ja, Joachim. Und besser, als du dir vorstellen kannst.“
Kapitel 7
Eigentlich wollte er einfach nur seine Ruhe haben, als er mit seinem Traktor in seinen Weinberg fuhr. Für Alois Straubenhardt bedeuteten die Reben alles: Sie waren seine Inspiration, wenn er einen neuen Wein kreierte, sie gaben ihm Kraft, wenn er die Menschen um sich herum satthatte, und sie waren seine Geliebten, denen er öfter verfiel, als ihm guttat.
Sein Weingut war das vorletzte vor dem Ortsausgang und an der Straße gelegen, die zur St.-Anna-Klinik und St.-Anna-Kapelle hinaufführte. Nach seinem großzügigen Hof folgte nur noch das Weingut der Gadingers, das komplett von seinen Weinbergen eingeschlossen war. Auch auf der anderen Seite waren die Reben, die von einem zarten Eiskristallkleid eingehüllt waren, sein Eigentum. Bis an die angrenzende Gemarkung Gleisweiler gehörten alle Rebstöcke ihm, wie auch die Ländereien hinter seinem Weingut, hoch zur Klinik und den Berg entlang Richtung Modenbachtal.
Er war nach seinem überhasteten Aufbruch und dem vorausgegangenen Streit mit seinem Sohn fast schon in Höhe der St.-Anna-Klinik, von der aus man nach links zu seinem größten und ertragreichsten Weinberg, dem Teufelsberg, gelangte, als ihm sein Nachbar Jakob Gadinger mit seinem Traktor den Weg versperrte.
„Ey, Gadinger, mach Platz“, rief Straubenhardt, und es war nicht das erste Mal, dass er sich seinem Nachbarn überlegen fühlte.
„Wieso sollte ich?“, schrie Jakob Gadinger zurück und schaltete demonstrativ den Motor seines Treckers ab, der mitten auf der St.-Anna-Straße stand.
„Ich muss dir nix erklären. Du blockierst mich, also fahr zur Seite. Ich muss da durch.“
„Doch, du musst mir so einiges erklären.“ Mittlerweile war Gadinger von seinem Traktor gestiegen und hatte sich neben Straubenhardts Gefährt gestellt. In der Hand hielt er die heutige Ausgabe der Pfälzer Nachrichten, aufgeschlagen auf die erste Lokalseite, auf der der Seitenaufmacher über die Neueröffnung der St.-Anna-Klinik thronte.
„Jetzt habe ich dir einmal vertraut und dann muss ich das hier lesen?“
Gadinger streckte Straubenhardt die Zeitung ins Gesicht, der diese nur verächtlich wegschlug.
„Ich habe diesen Mist ebenfalls gelesen.“
„Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Du ..., du ... egoistischer Verräter! Unter richtigen Männern zählt noch ein Wort, aber du hast ja sowieso immer nur deinen Vorteil im Auge gehabt. Phhh ...“ Gadinger wollte gerade wieder zu seinem Traktor gehen, als er sich noch einmal umdrehte: „Alois, du bist kein Winzer, kein Nachbar, kein Freund. Du bist eine Schande!“
„Wie kommst du dazu, mir so etwas zu unterstellen und mich als Verräter abzustempeln? Als ob ich diesen Scheiß geschrieben hätte.“
„Nein, aber gesagt. Du hast deine Entscheidung zuerst dem Zeitungsmenschen mitgeteilt, bevor du mit mir sprechen wolltest. Wenn du es überhaupt vorgehabt hast.“ Gadinger schüttelte den Kopf, während er die ganze Zeit ins Nichts schaute. Als er sich wieder gefangen hatte, fügte er mit einer gewissen Hilflosigkeit in der Stimme an: „Wie würdest du so etwas denn sonst bezeichnen?“
„Ich habe niemandem etwas gesagt.“
„Dann hat der sich das also alles ausgedacht?“ Gadinger erhob die Stimme. Mittlerweile ärgerte er sich mehr darüber, dass Straubenhardt ihn vorsätzlich anlog, als über den Verrat seines vermeintlichen Freundes an sich.
„Hör doch auf, verdammt noch mal. Ich war das nicht. Entweder glaubst du’s oder du lässt es bleiben.“
„Ich werde nichts bleiben lassen. Es reicht mir. Damit wirst du nicht durchkommen, niemals!“
„Ah, ist ja interessant. Und was willst du dagegen tun? Mich etwa umbringen?“
„Ich hätte das eigentlich schon damals längst tun sollen!“
„Fängst du jetzt auch damit an. Ihr habt sie doch nicht mehr alle.“ Straubenhardt, der die ganze Zeit den Motor hatte laufen lassen, legte den ersten Gang ein, drückte das Gaspedal durch und fuhr schnurstracks auf Gadinger und seinen Trecker zu. Kurz bevor er ihn erreicht hatte, lenkte er sein Fahrzeug scharf nach links von der Straße ab, durchpflügte dabei die Randbegrenzung seines eigenen Weinbergs, wobei er sogar den äußersten Rebstock mitriss, um anschließend wieder auf die Straße zurückzukehren.
Du Idiot, dachte Gadinger, der Straubenhardts Manöver fassungslos verfolgt hatte. Er wollte gerade seinen Traktor besteigen, als er plötzlich erschrak. Wie aus dem Nichts kommend stand Elvira Paulus auf einmal hinter seinem Traktor.
„Guten Morgen, Jakob.“
„Morgen Elvira“, erwiderte Gadinger kühl, ließ den Motor an und fuhr zurück auf seinen Hof.
Elvira schaute ihm kopfschüttelnd hinterher, um dann ihren Blick Richtung St.-Anna-Berg zu richten, wo sie Straubenhardts Traktor gerade nach rechts in dessen Weinberg abbiegen sah.
Es wird Zeit, dass jemand dem alten Choleriker endlich mal seine Grenzen aufzeigt, dachte sie und schob ihr gelbes Fahrrad mit den gefüllten Posttaschen links und rechts des Hinterrads weiter den Berg hinauf in Richtung St.-Anna-Klinik.
Der Teufelsberg war sein größter Schatz. Direkt unter dem St.-Anna-Berg gelegen waren die Abhänge besonders steil, dafür galt der Boden als äußerst fruchtbar, und mit seiner exponierten Steillage konnte die Sonne fast den ganzen Tag über den Weinberg bestrahlen und damit den Trauben so ihre vorzügliche Süße geben.
Daher musste er seinen Traktor auch am Wegrand, der Verlängerung der St.-Anna-Straße, stehen lassen und zu Fuß in seinen Weinberg absteigen. An diesem Morgen wollte er einfach nur nach dem Rechten sehen, hier und da neue Pheromonspender anbringen oder verfaulte, zu schwach ausgebildete und verwachsene Reben aus den gesunden und kraftvollen Weinstöcken herausschneiden. Er kam gut voran und er spürte, wie die Arbeit ihn beflügelte und ihm neue Kraft gab. Endlich hatte er wieder Zeit und vor allem Muße, seine Gedanken zu sortieren. Erst der Zeitungsartikel über die neue St.-Anna-Klinik, dann der ärgerliche Streit mit dem alten Pfarrer und im Anschluss noch die mehr als völlig unnötige Diskussion mit dem einfältigen Gadinger – Alois Straubenhardt war mehr als bedient.
Warum hatten sich auf einmal alle gegen ihn verschworen? Was wollte der alte Pfaffe nur damit erreichen? Und wieso musste sich jetzt auch noch sein Nachbar so aufspielen? Auch wenn er es nicht zulassen wollte, es war doch diese kleine innere Stimme, sein Gewissen, die in ihm erwachte und die er nicht mehr überhören konnte. Aber was soll ich tun, grübelte er, während er einen verkümmerten Trieb in den Plastikeimer warf, den er neben einem speziellen Scherenset für Äste, Triebe und Pflanzen aller Art, der kleinen Säge und verschiedenen Kabelbindern aus Plastik und Draht in seinen Weinberg mitgenommen hatte.
Wie konnte er den Fehler, den er vor vielen Jahren begangen hatte, je wieder gutmachen? Ach, es ist so lange gut gegangen, was sollte jetzt schon passieren, dachte er und widmete sich wieder seiner Arbeit. Die Reben, der Weinberg und er ganz alleine, was konnte es schon Schöneres geben, sinnierte er, und ein Lächeln huschte über sein sonnenzerfurchtes Gesicht.
Alois Straubenhardt hatte seinen Traktor abschüssig, mit der Motorhaube voran abgestellt. Es war ein Leichtes, sich von hinten an den Trecker heranzuschleichen und ins Führerhaus einzusteigen. Als sich die Person in den Fahrersitz gesetzt hatte, hielt sie für einen kurzen Moment inne.
Sie holte noch einmal tief Luft, dann nahm sie den Rückwärtsgang heraus und löste vorsichtig die Handbremse. Die Person konnte gerade noch rechtzeitig vom Traktor herunterklettern, als sich das schwere Fahrzeug langsam, aber mit stetig zunehmender Geschwindigkeit in Bewegung setzte und den Abhang hinunterfuhr.
Alois Straubenhardt band gerade einen neuen Pheromonspender am gespannten Drahtseil fest, als er etwas vernahm. Es hörte sich an, als würde sich etwas Mächtiges auf ihn zubewegen. Und dabei alles über den Haufen fahren, was ihm in die Quere kam, wie Weinstöcke, die unter der Last brachen wie Streichhölzer. Und das in seinem Weinberg.
Angsterfüllt und voller Panik schaute er auf, als er ihn kommen sah. Er wollte noch aufspringen, aber der Traktor hatte ihn bereits erfasst.
Vielleicht hat sich nun ja doch der Teufel gerächt. Das war das Letzte, was er dachte, als es über ihm schwarz wurde.
Kapitel 8
Es war ein gutes Gefühl, dem Haus der Gerechtigkeit einen weiteren Baustein hinzugefügt zu haben. Auch wenn es das einst Geschehene nie wieder ins Lot bringen würde. So musste sich Glück anfühlen. Sein Tod war notwendig, es musste sein, das wusste die Person. Und es war schon schlimm genug gewesen, dass sie so viele Jahre hatte darauf warten müssen.
Es musste eine höhere Macht, eine göttliche Fügung gewesen sein, dass sie ausgerechnet vor einigen Wochen die Pfälzer Nachrichten zum ersten Mal in die Hand bekommen hatte. Was sie dann zu lesen bekommen sollte, hatte ihr die Füße unter dem Boden weggezogen.
Hatte sie an ihren schlimmsten Moment in ihrem Leben erinnert.
Hatte ihr schlagartig klargemacht, wofür es sich noch zu leben lohnte. Die Person stand auf dem Kirchturm der St.-Anna-Kapelle, die in einen dichten Nebel gehüllt war. Direkt unter dem sonst schon von Weitem sichtbaren Gotteshaus lag die St.-Anna-Klinik und linker Hand der Teufelsberg. Darunter schloss sich der Ort Burrweiler an und dahinter begann die Rheinebene mit Landau in greifbarer Nähe und den Städten Ludwigshafen, Mannheim und Karlsruhe am Horizont. Nur, heute lag alles in dichtem Nebel und es schien, als sei man in seiner eigenen kleinen Welt gefangen.
Ein eisiger Wind umspielte den Kirchturm. Der Winter hatte die Region noch fest im Griff. Leichter Schneefall wechselte sich immer mal wieder mit klaren, aber eiskalten Momenten ab, in denen die Sonne schon zaghaft ihre potenzielle Kraft zeigte. Doch die Strahlen waren noch zu schwach, um dem Winter wirklich Einhalt gebieten zu können.
Sie wollte sich nicht lange ausruhen, dafür gab es noch zu viel zu tun. Aber sie wusste, sie war auf dem richtigen Weg, auch wenn dieser noch für einen weiteren Menschen würde enden müssen.
Die Person knöpfte sich ihren Mantel zu und stieg wieder vom Kirchturm hinab. Für einen kurzen Moment hatte sie das Gefühl, dass die Sonne ihr aus der dichten Nebelbank zugelächelt hatte, um sie zu bestärken, bloß nicht damit aufzuhören.