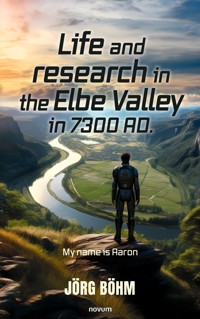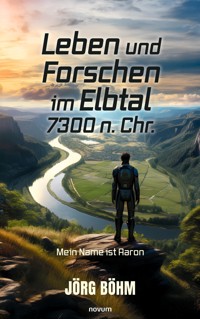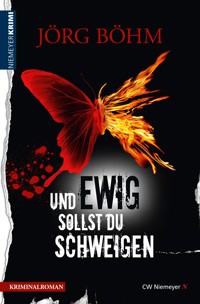
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
DU BIST JUNG … DU BIST SCHÖN ... UND AUF DICH WARTET DER TOD … Emma Hansens fünfter Fall Ein abgelegener See in der Pfalz. Ein versenktes Auto. Auf dem Fahrersitz eine grausam entstellte Frauenleiche – die Haare verbrannt, die Zähne gezogen, das Gesicht zertrümmert. Als Emma Hansen übernehmen soll, ahnt sie noch nicht, dass dieser Fall persönlich wird. Denn die Tote kümmerte sich als Kindergärtnerin auch um Emmas Sohn Luiz. Wie sich herausstellt, führte Josephine "Josy" Neufeld ein geheimes Doppelleben. Musste sie deshalb sterben? Oder ist sie einem Serientäter in die Hände gefallen, der seinen Opfern ihre Schönheit rauben will? Schon einmal ist eine junge Frau auf grausame Weise ermordet worden. Und der Täter ist bis heute nicht gefasst ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Jörg BöhmUnd ewig sollst du schweigen
Der Roman spielt hauptsächlich in bekannten Regionen, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.ddb.de.© 2019 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerDer Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.comEPub Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbHeISBN 978-3-8271-8357-6
Jörg BöhmUnd ewig sollst du schweigen
Zum Glücklichsein gibt es nur einen Schlüssel: die Dankbarkeit.Ernst FerstlFür meinen Rechtsmediziner – in Dankbarkeit
Der Journalist Jörg Böhm (*1979) war nach seinem Studium der Journalistik, Soziologie und Philosophie unter anderem Chef vom Dienst der Allgemeinen Zeitung in Windhoek/Namibia. Danach arbeitete Jörg Böhm als Kommunikationsexperte und Pressesprecher für verschiedene große deutsche Unternehmen. Seit 2014 widmet er sich nur noch seinen schriftstellerischen Tätigkeiten. Neben den Kreuzfahrtkrimis „Moffenkind“ und „Niemandsblut“ , welche er exklusiv in Kooperation mit der Reederei AIDA Cruises geschrieben hat, sind mittlerweile fünf Krimis um seine dänisch-stämmige Kriminalhauptkommissarin Emma Hansen erschienen. Als bester Nachwuchsautor wurde er für seinen ersten Krimi „Und nie sollst du vergessen sein“ mit dem Krimi-Award „Black Hat“ ausgezeichnet.Mehr über Jörg Böhm und seine Aktivitäten erfahren Sie unter www.jörgböhm.comFoto von Beate Zoellner
Prolog
Sonntag, 27. August 1995
Der Abend, der alles veränderte, war ein ganz gewöhnlicher Sonntagabend. So wie alle anderen Sonntagabende auch, an denen Dennis Schäfer kurz nach 21 Uhr seine Wohnung im Süden Frankenthals verließ.
Sein Weg führte ihn zu seinem Arbeitgeber, einer großen internationalen Spedition in Ludwigshafen, für die er mit seinem Tiefkühltransporter Waren durch ganz Europa transportierte.
Fünf Tage war er zumeist unterwegs mit langen Fahrten auf Hunderten Kilometern eintönigem Asphalt, einsamen Fernsehabenden in seinem Führerhaus auf verwahrlosten Rastplätzen ohne Duschen und funktionierenden Toiletten und schlechtem Handyempfang, um sich bei seinen Liebsten zu melden. Wenn er überhaupt eine Verbindung herstellen konnte, was in den meisten europäischen Ländern nicht der Fall war. Dafür war er dann wenigstens am Wochenende zu Hause, was ihn für all diese Strapazen entschädigte. Und zu Hause, das bedeutete, bei seiner Frau Jessica und seiner kleinen Tochter Lilly zu sein, die nach den langen Sommerferien gerade erst seit wenigen Tagen wieder in den Kindergarten ging.
Lilly, meine kleine Prinzessin, dachte er wehmütig und musste sich zusammenreißen. Nicht schon wieder über das Für und Wider seines Jobs nachdenken. Über die vielen Stunden, in denen er nicht bei ihr sein und sie aufwachsen sehen konnte. Wenn er die Stunden zusammenrechnete, die er nicht zu Hause bei seiner Familie war, dann ergaben sie schon mehr als ein halbes Jahr. Am liebsten würde er sofort umkehren.
So, wie er es am Abend vor ihrem vierten Geburtstag getan hatte, vor knapp sechs Monaten. Wie immer hatten sie miteinander telefoniert, so gut es eben ging – er war längst auf der Autobahn Richtung Spanien unterwegs gewesen –, und sie hatte ihm von ihrem Geburtstag erzählt, von ihren Freundinnen, die alle in ihrem Wohnblock lebten und die morgen alle mit ihr feiern würden. Vom Schokoladenkuchen, den Mama zum ersten Mal für sie backte. Und von seinem Geschenk, das er ihr schon gezeigt hatte, das sie aber erst am nächsten Morgen nach dem Aufstehen und Zähneputzen öffnen durfte. Er konnte sich jetzt noch sehr gut daran erinnern, wie aufgeregt sie gewesen war, und er wusste, dass es nicht nur an der Größe seines Geschenks lag, das er sehr vorsichtig in Zeitungspapier eingewickelt hatte.
Eigentlich hatte er seine Überraschung schön einpacken und mit buntem Glitzer und roten Herzen verzieren wollen, doch seine Frau hatte ihm empört einen Vogel gezeigt und gemeint, er solle bloß kein teures Geschenkpapier kaufen, das nach dem Auspacken sowieso nur weggeworfen werden würde. Das Geld brauchen wir für Lillys Schuhe, einen neuen Staubsauger oder den nächsten Einkauf, hörte er auch jetzt noch ihre Worte nachklingen.
„Schade, dass du nicht da bist, Papi. Aber ich werde dir morgen Abend alles erzählen. Versprochen!“, hatte Lilly gesagt und mit einem „Hab dich lieb!“ das Telefonat beendet.
Er war dann noch knapp 20 Kilometer weitergefahren, mit Tränen in den Augen, einen weiteren Geburtstag seiner Tochter nicht miterleben zu können, ehe er die nächste Ausfahrt genommen, seinen Truck gewendet hatte und zurück nach Hause gefahren war.
Kurz nach 23 Uhr hatte er Lilly dann völlig übermüdet, aber überglücklich aus ihrem Kinderbett gehoben und sie fest an sich gedrückt, um dann mit seiner Tochter in ihren Geburtstag hineinzufeiern. Sie hatten gemeinsam Kuchen gegessen – er hatte vorher noch schnell einen kleinen eingeschweißten Kuchen von der Tankstelle besorgt -, Fangen und Versteck-Dich gespielt und gekuschelt. Doch am schönsten war ihre überschwängliche Freude gewesen, als sie um kurz nach Mitternacht endlich ihr Geburtstagsgeschenk auspacken durfte. Das übergroße Plüschpferd mit braunem Fell, weißer Blesse und schwarzem Schweif hatte er für sie vor gut einem Jahr auf dem Strohhutfest geschossen und bei einem Kumpel versteckt, damit seine kleine vorwitzige Tochter es nicht schon vor ihrem Geburtstag entdecken würde.
„Papi, Papi, ein Pferd, ich habe ein Pferd“, hatte sie gerufen und war wie ein kleiner Gummiball durch die Wohnung gehüpft. Ihm jagte heute noch eine Gänsehaut über den Körper, wenn er sich daran zurückerinnerte, wie sehr sie sich an das Pferd aus Kunstfell geschmiegt hatte. Er wusste, er würde ihr niemals ein Pony, vielleicht nicht einmal Reitstunden, schenken können, aber dann sollte sie wenigstens das schönste und größte Plüschpferd der Welt besitzen.
So war er erst gut vier Stunden später als geplant losgefahren und im weiteren Verlauf gar mit einer Verzögerung von fast zehn Stunden auf der iberischen Halbinsel angekommen, was verärgerte Kunden in Spanien, eine Ausfallgebühr für die Spedition und eine Abmahnung für ihn bedeutet hatte.
Dabei war eine Abmahnung gerade das, was sich seine kleine Familie am allerwenigsten leisten konnte. Der nächste, auch noch so kleine Vorfall würde seine Entlassung bedeuten, so hatte es sein Chef sehr deutlich formuliert. Sie waren angewiesen auf das Geld, das er verdiente. Seine Frau und er hatten keine Ausbildung und sie hatten sich immer mit Gelegenheitsjobs und Aushilfstätigkeiten durchgeschlagen, ehe sie schwanger geworden war und er vor mittlerweile drei Jahren diese Arbeit als Fernfahrer angenommen hatte.
Sollen sie mich doch rausschmeißen! Ich würde es immer wieder tun, dachte er an Lillys Geburtstag zurück und wählte die Nummer von zu Hause. Vielleicht verlier’ ich meinen Job, dachte er, aber meine Tochter verlier’ ich nie.
„Hi, ich bin’s“, begrüßte er Jessica, die wie immer leicht gehetzt klang.
„Geh’ mal ran, da ist wer für dich“, hörte er sie dann auch sagen, ehe sie den Hörer direkt weiterreichte.
„Kommst du schon wieder nach Hause?“, fragte Lilly erfreut.
„Ich bin doch gerade erst losgefahren und wollte dir nur schnell noch mal ‚Gute Nacht‘ sagen.“
„Wohin fährst du denn?“
„Nach Spanien“, sagte Dennis und setzte den Blinker, um seinen Laster auf die Abbiegespur zu lenken, die ihn von der Autobahn 61 auf die Autobahn 65 und damit weiter in die Südpfalz und dann Richtung Frankreich führte. „Bis kurz vor Afrika.“
„Bringst du mir was mit?“
„Lilly!“, rief Jessica dazwischen, aber Lilly ließ sich vom genervten Zwischenruf ihrer Mutter nicht beirren: „Ja, Papi? Bitte!“
„Und was hättest du gerne?“
„Ein Pferd!“
„Aber du hast doch schon eins.“
„Ein echtes Pferd, Papi. Das mäht ...“
„Du meinst wiehert.“ Dennis musste grinsen. „Ein Pferd passt doch gar nicht in meinen Lkw oder soll es erfrieren?“
„Dann ein Pony.“
Dennis lachte auf.
„Ein kleines Pony, zum Kuscheln.“ Seine Tochter ließ nicht locker.
„Jetzt ist es aber gut!“, hörte er erneut seine Frau aus dem Hintergrund.
„Versprichst du es mir, Papi? Bitte!“, schob Lilly noch schnell hinterher, ehe ihr der Hörer aus der Hand gerissen wurde.
„Fertig machen, Lilly. Es ist Heia-Zeit. Morgen ist wieder Kindergarten. Und Zähne putzen nicht vergessen.“
„Jessy ...“
„Nichts Jessy! Du musstest ja auch heute unbedingt mit ihr zum Ponyhof.“
Auch durch den Hörer konnte er sehen, wie Jessica die Augen rollte.
„Sie war so glücklich ...“
„Ich brauche jetzt wieder Tage, ihr diesen Floh aus dem Ohr zu holen. Ich bin mit ihr die Woche über allein, während du dich vor solchen Dingen drücken kannst.“
„Jessy, das ist jetzt unfair.“
„Ist doch wahr! Ich kann manchmal einfach nicht mehr.“
„Wegen eines Ponys?“ Dennis lachte erneut. Aber es klang gequälter als noch wenige Augenblicke zuvor.
„Warum will mich nur niemand verstehen?!“ Er hörte, wie Jessica resigniert durchschnaufte, dabei hatte er sie nur etwas necken wollen. Ihr die Leichtigkeit zurückgeben wollen, die er so an ihr liebte. Geliebt hatte.
„Wir beide wissen doch ganz genau, woher sie das hat. Du wolltest doch auch immer ein Pferd haben, als du ein kleines Mädchen warst.“
„Das war doch ganz was anderes. Damals, Dennis! Wir waren Kinder und saßen im Sandkasten. Aber ist ja auch egal. So, Lilly, und du sagst jetzt ‚Gute Nacht’ und dann heißt es ab ins Bett. Es wird höchste Zeit und morgen geht’s wieder früh raus.“
„Tschüss, Papi“, hörte er im Hintergrund Lilly schreien, während sich das Rauschen der Toilettenspülung unter ihren Abschied mischte.
„Lilly, Hände waschen nicht vergessen, Lilly!“, brüllte plötzlich Jessica in sein Ohr.
„Und nein, es wird jetzt keine Schokolade mehr gegessen, junges Fräulein. Lilly! Warte, Fräulein, wenn ich dich erwische ...“
„Lass sie doch!“
„Dennis, ich muss jetzt ... Deine Tochter bringt mich noch um ...“
Jetzt ist sie wieder meine Tochter, dachte er, und jetzt war er es, der tief Luft holen musste, ehe er sagte: „Drück’ sie noch mal ganz lieb von mir.“ Aber da hörte er bereits das Besetztzeichen im Telefon.
Ja, Lilly konnte einem wirklich alles abverlangen. Mit einem Lächeln konzentrierte er sich jetzt wieder auf die Straße. Die A 65 war kaum befahren. Wie so häufig an einem Sonntagabend. Die Hauptrouten für Brummis waren andere Autobahnen. Diese Autobahn diente lediglich als Zubringer nach Karlsruhe und weiter nach Stuttgart, München und zum Balkan. Sein Ziel lag jedoch auf der anderen Seite Europas und er würde an der Ausfahrt Kandel Süd und einem kurzen Stück über die Bundesstraße 9 auf die französische Autobahn 35 über Straßburg und dann weiter über Besançon und Lyon bis ans Mittelmeer fahren. Von dort ging es an der Küste entlang weiter nach Spanien. Barcelona, Valencia und Sevilla waren seine Ziele für diese Tour.
Ja, es sollte eine ruhige Nacht werden. In den Verkehrsnachrichten hatten sie keine Meldungen von Staus, stockendem Verkehr oder gesperrten Straßen durchgegeben und auch im CB-Funk war bisher alles ruhig geblieben. Ab und zu meldete sich ein anderer Fahrer und gab seine philosophischen Ansichten in Reimform wieder. Ansonsten lag nichts vor, die Autobahnen waren frei und so würde seine einzige Aufgabe darin bestehen, lange genug wach und voll konzentriert zu bleiben. Gegen 2 Uhr würde er dann die erste kurze Pause einlegen, sich kurz die Beine vertreten, die Toilette aufsuchen, von seinem Brot abbeißen und mindestens fünf schnelle Zigaretten rauchen, ehe er nach 30 Minuten seine Fahrt fortsetzen wollte. Am Dienstagmorgen musste er in Barcelona sein und seine Waren bis Mittwochnachmittag mit dem letzten Stopp in Sevilla ausgeliefert haben, wollte er pünktlich am frühen Freitagabend wieder in Frankenthal und bei Jessy und Lilly sein.
Dankbar für dieses kleine bisschen Glück, schaute er durch die große Frontscheibe in den schwarzen Nachthimmel, der von grau getünchten Wolken gehalten wurde. Hin und wieder leuchteten gelbe Punkte auf der Gegenfahrbahn auf, um schnell wieder im Dunkel der Nacht wie tieffliegende Sternschnuppen zu verglühen.
Die Autobahn zog sich wie eine gerade gezeichnete Linie durch die flache Landschaft. Er konnte von seiner erhöhten Position die ganze Landschaft überblicken. Selbst über die Gegenfahrbahn hinweg.
Komisch, dass hier die Böschung fehlt, dachte er und kniff die Augen zusammen. Er hatte mal gelesen, dass manche Autobahnabschnitte als Notlandebahnen für Flugzeuge dienten, weswegen es in diesen Bereichen keine hohe Bepflanzung auf dem Grünstreifen zwischen den beiden Fahrspuren gab.
Waren die zwei Lichter auf seiner Fahrspur oder auf der Gegenfahrbahn? Vielleicht steht jemand auf dem Seitenstreifen, dachte Dennis, um sich zu beruhigen, und drosselte etwas das Tempo seines schweren Gefährts. Erneut fokussierte er die beiden Abblendleuchten. Aber warum stand der Wagen in entgegengesetzter Richtung zur Fahrbahn? Eigentlich dürfte man doch nur die dunklen Umrisse eines Fahrzeugs sehen, die orangefarbenen Warnblinker oder die rot leuchtenden Rücklichter.
Aber die Lichtpunkte waren gelb und sie wurden mit rasender Geschwindigkeit immer größer. Und dann sah er, wie der Wagen direkt auf ihn zukam.
Wo kam der so schnell her? Und warum fuhr er auf seiner Spur? Seine Gedanken flogen in seinem Kopf herum und schlugen wie Kometen gegen seine Schädeldecke. Schmerzverzerrt kniff er die Augen zusammen, während er gleichzeitig krampfhaft das Lenkrad festhalten musste, so sehr zitterte er plötzlich vor der Kälte, die seinen Körper ergriffen hatte.
Was sollte er jetzt machen? Was wäre das Sinnvollste? Einfach stehen bleiben oder draufhalten? Zur Seite in den Graben fahren oder sich quer zur Fahrbahn stellen und so den Geisterfahrer aufhalten? Die Polizei verständigen oder seine Tochter noch einmal Papa sagen hören?
Den starren Blick nach vorne auf das anrasende Unheil gerichtet, löste er seinen Fuß langsam vom Gaspedal, während seine Hand zitternd sein Telefon abtastete, das festgeklemmt in der Halterung an den Lüftungsschlitzen ruhte. Er wollte gerade sein Handy aus dem Schlafmodus wecken und die Wahlwiederholung drücken, als der Wagen direkt unter ihm in den Motorblock seines Lastwagens einschlug.
Kapitel 1
20 Jahre späterDonnerstag, 8. Januar 2015
Sie liebte diesen ersten Schnee, der in der Pfalz häufig erst viel später fiel als in den meisten anderen Regionen Deutschlands. Die Luft war dann klar und so gesättigt mit frischem Sauerstoff, dass man das Gefühl hatte, jeder Atemzug würde kleine Schnitte in den Lungen verursachen.
Doch das Beste an jenem ersten Schnee war, dass er sich sanft wie eine zweite Haut über die Landschaft legte und dabei alles unsichtbar erscheinen ließ. Als wären die Felder und Wiesen, Straßen und Gehwege, die Blätter und Pflanzen, die er bedeckte, überhaupt nicht da. Wie wegretuschiert.
Jener Schnee hatte aber nicht nur etwas Magisches, etwas Zauberhaftes. An dem Tag, an dem er das erste Mal nach seiner langen Pause die Welt wieder beglückte, da besaß er auch etwas Jungfräuliches. Nur ein einziges Mal im Jahr. Aber dafür war er dann vollkommen und rein.
An einem solchen Tag hatten sie sich hier zum ersten Mal getroffen. Wie heute war es ein ebenso kalter wie auch klarer Januartag gewesen.
Für Wanderer wie auch Hundebesitzer galt der Parkplatz „Drei Buchen“ zwischen Weyher und Ramberg als idealer Startpunkt für ausgedehnte Spaziergänge durch den Pfälzer Wald. Während sich die meisten Spaziergänger vom kleinen Parkplatz direkt an der Straße aus in den höher gelegenen Wald aufmachten, um nach gut drei Kilometern das Wanderlokal „Landauer Hütte“ zu erreichen, waren sie ins gegenüberliegende Modenbachtal hinabgelaufen. Mit einem verlegenen Lächeln und einem elektrisierenden Kribbeln, auch daran erinnerte sie sich noch ganz genau.
„Komm, lass uns unsere Runde drehen“, sagte sie zu Balu, ihrem Australian Shepherd, ließ ihn aus dem Wagen und versuchte so, die immer noch präsenten Gedanken an jenen Tag weit von sich zu schieben.
Sie folgte ihrem Hund auf den kleinen Wanderpfad, der weiter ins Tal hinunterführte. Schon nach der ersten Biegung hatte man die Straße hinter sich gelassen und war nun auch vom Parkplatz aus nicht mehr zu sehen.
Das war auch damals ihre Absicht gewesen, an diesem ersten Tag. Beide wollten damals allein sein mit sich und ihrer Unsicherheit. Das erste Date. Wie sollte man damit umgehen? Welche Themen sollte man anschneiden, welche besser nicht? Wie würde man auf die Ansichten des anderen reagieren und an den richtigen Stellen lachen, selbst wenn man das, was der andere gerade von sich gegeben hatte, eigentlich gar nicht wirklich lustig fand. Aber sie waren beide mittleren Alters gewesen, nach langen Ehen gerade mehr oder weniger frisch geschieden und völlig unerfahren darin, wie man einen möglicherweise neuen Lebenspartner kennenlernte und es schaffte, sich nur von seiner besten Seite zu zeigen. Denn sie wussten, für einen ersten Eindruck gab es keine zweite Chance – erst recht nicht in ihrem Alter.
Wie heute so stand auch damals kein anderes Auto auf dem Parkplatz. Es war ein Wochentag, und die meisten Menschen waren bei der Arbeit. Sie beide waren selbstständig und konnten sich ihre Zeit frei einteilen und sich auch über Mittag mit einem Fremden einfach mal zu einem Rendezvous mitten im Nirgendwo verabreden.
Sie waren damals lange durch den Wald gelaufen, hatten sich unterhalten, Weltanschauungen ausgetauscht, Ansichten geteilt, Wünsche geäußert und angefangen, Träume zu formulieren. Träume, die man sich am besten in einer Beziehung erfüllte und die erst dann zu einer perfekten Vollendung führten. So, wie man einen Sonnenuntergang auch am besten zu zweit genoss. Sie hatten sich im ersten Augenblick ineinander verliebt. Nur leicht, aus Angst, verletzt zu werden. Aber es hatte sich ein sanftes Band um sie gelegt, das von Tag zu Tag immer fester wurde.
Von dieser ersten Begegnung an hatten sie gewusst, dass sie zusammengehörten. Dass sie die zweite Lebenshälfte gemeinsam verbringen wollten. Nach wenigen Monaten hatten sie beschlossen, auch zusammenzuleben. Sie hatte ihre exklusive Maisonette-Wohnung aufgegeben und war von Neustadt an der Weinstraße zu ihm aufs Land und auf sein weitläufiges Anwesen in Kallstadt in der Nordpfalz gezogen. Es waren schöne, unbeschwerte Jahre gewesen – voller Glück und gegenseitiger Liebe.
Es dauerte nicht lange und der Waldweg hatte das Tal erreicht. Sie lief den Pfad weiter, der sie nach knapp 250 Metern an der Burgruine Meistersel vorbeiführte, die nun rechter Hand lag, ebenfalls im Winterschlaf.
„Balu, komm’ her. Ich hab’ hier ein Leckerli!“, rief sie in den Wald, der jetzt majestätisch schweigend vor ihr stand. Sie wusste, dass die Jagdinstinkte ihres Hundes geweckt waren und er sich nur schwerlich von Fuchsbauten und Erdlöchern, in denen er Hasen vermutete, abbringen ließ. Sie brachte es aber nicht übers Herz, ihn anzuleinen und ihm so seinen natürlichen Auslauf und den Jagdtrieb zu verwehren, selbst wenn ihr das wieder eine Rüge des Försters einbringen würde.
„Balu?!“ Ihre Stimme hallte durch das Tal. Sie folgte seinen Pfotenabdrücken, die sich mit den Spuren von Rotwildhufen und mindestens eines anderen Hundes abwechselten. Es war nicht mehr weit bis zu ihrer Lieblingsstelle, einer kleinen Lichtung, die sie schon bei ihrem zweiten Ausflug entdeckt hatten. Auch mit Balu kehrte sie öfter an den Ort der liebevollen Erinnerung, der körperlichen Leidenschaft und intensiven Hingabe zurück.
Sie verließ den Waldweg in Höhe des Baumes, den sie mit einem blauen Graffiti-Spray markiert hatten. Nur sie wussten um diese Markierung, da niemandem, der nicht genau danach suchte, der horizontale Strich mit den zwei kleinen Punkten knapp oberhalb des Erdreichs aufgefallen wäre.
Im Nu war sie im dichten Unterholz verschwunden. Geschickt und erfahren kletterte sie über die von den letzten Winterstürmen abgebrochenen Kiefernäste, kämpfte sich durch strauchige Wacholdergruppen und schob schwer ausladende Farne auseinander, ehe sie kurz vor ihrer Lichtung ein Rascheln vernahm, das von einem freudigen Bellen untermalt wurde.
„Balu, braver Junge!“ Sie ging in die Hocke, fischte mit der linken Hand einen Hundekeks aus ihrer Jackentasche und streckte ihm diesen entgegen, während sie ihm mit der anderen Hand liebevoll den Nacken kraulte. Langsam erhob sie sich aus ihrer Position und schaute sich wehmütig um. Auch jetzt im Winter, wo der Boden feucht und matschig war, die Buchen ihr Blätterkleid verloren hatten und die gesamte Szenerie für einen flüchtigen Betrachter eigentlich unromantisch und kalt wirkte, hatte diese Lichtung für sie trotzdem nichts von ihrer besonderen Anziehungskraft und natürlichen Schönheit eingebüßt.
Hier hatten sie sich zum ersten Mal geliebt wie zwei Teenager, deren Hormone nicht zu bändigen gewesen waren. Es war für beide die schönste und glücklichste Zeit ihres Lebens gewesen. Unbefangen und leicht.
Der Schneefall setzte erneut ein. Puderfeine Kristalle schwebten zur Erde nieder und setzten sich wie gehauchte Küsse auf die bereits in Weiß gekleidete Umgebung. Sie breitete die Arme aus und hoffte, dass sie jene unbeschwerten Momente von einst wieder gefangen nahmen. Sie nie mehr losließen.
Doch heute hatte der Schnee etwas Bleiernes, als würde er alles lähmen und alle Lebendigkeit unter sich begraben und ersticken.
Und wieder musste sie an jenen Tag denken, als er sich entschieden hatte, sie allein zu lassen. Es war nicht so, dass sie irgendetwas geahnt hatte. Er hatte ihr keinen Grund gegeben, dass ihre Liebe bald auf unwiederbringliche Art und Weise zerstört werden würde. Es war der Ausdruck des Bedauerns in den Gesichtern der Polizisten, die ihr die traurige Nachricht überbringen mussten, der ihr die Endlichkeit des Glücks unmissverständlich klarmachte.
Sie spürte, wie ihr Tränen über die Wangen liefen. An jenem Tag hatte sie gedacht, sämtliche Tränen vergossen zu haben, die sie jemals würde weinen können. Doch es hatte nicht aufgehört. Jeden Tag bahnten sie sich ihren Weg, mindestens einmal, immer dann, wenn sie wieder an den Ort ihrer gemeinsamen Erinnerung zurückkehrte.
Einzig Balu, den sie gemeinsam aus dem Tierheim geholt hatten, war ihr geblieben. Ein treuer Gefährte, ihr Seelenhalt in jedem noch so traurigen Moment.
In diesem Moment hörte sie ihren Hund wild und aufgeregt bellen. Ein Bellen, das sie so noch nie von ihm gehört hatte.
Sie wischte sich hektisch die Tränen aus dem Gesicht und rief seinen Namen, wobei ihre Rufe sich gebrochen und quietschig anhörten.
„Balu? Balu? Wo bist du?“, rief sie, als in dem Augenblick ihr Hund aus dem Dickicht geschossen kam, aufgeregt vor ihr herumtänzelte, wieder laut bellte und versuchte, sie zum Mitkommen zu bewegen.
„Ja, ja, ich komm’ ja schon. Was ist denn los?“ Erst jetzt sah sie, dass an seiner Schnauze dunkle Matschklumpen und feuchter Schnee klebten.
„Balu? Was hast du da?“ Sie wollte sich zu ihm hinunterbeugen und seine Schnauze näher begutachten, als er sie laut anbellte und wieder durch das Unterholz verschwand, durch das er gerade gekommen war. Er bellte erneut, als er hinter den dichten Hecken und Sträuchern herausgefunden hatte.
„Wir müssen los, Balu! Zum Spielen habe ich jetzt keine Zeit mehr ...“ Doch Balu wollte nicht hören. Unentwegt bellte er hinter der grünen Wand.
„Ich geh’ jetzt!“ Sie machte sich schon auf den Rückweg, als Balu erneut aus dem Unterholz gesprintet kam und sie wieder und noch lauter als bisher anbellte.
„Balu, das nächste Mal. Versprochen!“, sagte sie, doch da hatte sich Balu bereits in ihrer Jeanshose verbissen und versuchte sie nun Richtung Dickicht zu zerren. „Balu, das ist jetzt nicht mehr witzig!“
Aber Balu ließ nicht locker. Immer und immer wieder zerrte er an ihrer Hose. Sie versuchte, sich zu befreien, und holte bereits mit ihrem Arm aus, um nach ihm zu schlagen. Dabei wollte sie genau das nie tun. Verängstigt ließ Balu los und knurrte sie kurz an, ehe er dann wieder in ein ausgelassenes Bellen verfiel.
„Okay, dann zeig’ mir, was du entdeckt hast ...“ Sie folgte ihrem Hund durch das dichte Gestrüpp. Äste schlugen ihr ins Gesicht, einmal wäre sie fast hingefallen und konnte sich gerade noch auffangen, doch ein abgebrochener Buchenast bohrte sich tief in ihre Jacke und riss ein Loch hinein.
„Scheiße!“, fluchte sie und versuchte mit brachialem Ziehen und Zerren, ihre Jacke von dem Ast zu befreien. Sie hatte es fast schon geschafft, als sie sich an der ausgefransten Holzrinde an einer weiteren abgebrochenen Stelle des Astes die Hautinnenfläche der linken Hand schrammte, während Balu auch weiterhin in einer Tour bellte.
Erneut war sie den Tränen nahe, doch sie kämpfte sich weiter durch das Unterholz, bis sie ihren Hund endlich erreicht hatte, der aber nicht vorhatte, auf sein Frauchen zu warten. Er lief einige Meter weiter durch den Wald, der auch hier lichter war.
Sie sah bereits wieder den Waldweg, der sich hier weiter Richtung Norden schlängelte und der mittlerweile unter einer leichten Schneedecke lag.
Und jetzt sah sie, wie sich Balu an einer aufgewühlten Stelle im Erdreich zu schaffen machte. Er buddelte, nahm beide Vorderpfoten zu Hilfe, um nach kurzem intensivem Graben wieder mit seiner Schnauze im Erdloch zu verschwinden.
„Balu, was hast du da?“, fragte sie, als sie ihren Hund erreicht hatte. Er stoppte kurz mit seinen Ausgrabungen und bellte sie erneut heftig an, dann versuchte er weiter, das matschige und teilweise angefrorene Erdreich zu bewegen.
Sie musste schlucken, als sie sah, was er da gerade freilegen wollte. „Nicht! Aus! Hör sofort auf!“, rief sie und stieß ihren Hund zur Seite. „Das ist ein totes Tier“, sagte sie und ekelte sich bei der Vorstellung, dass ihr Balu seine Nase tief in ein verwestes Aas gesteckt hatte. Der Australian Shepherd bellte immer noch, während sie versuchte, ihn mit einem weiteren Leckerli zu beruhigen.
Sie nahm ein Taschentuch aus ihrer Manteltasche, ging in die Hocke und putzte Balu energischer als gewöhnlich seine Schnauze ab, was er nur widerwillig über sich ergehen ließ.
Sie hatte sich gerade wieder erhoben und wollte das Tuch wegstecken, da versuchte Balu erneut, erst mit seinen Vorderpfoten und dann mit der Schnauze weiter die Erde auszuheben.
„Jetzt ist es aber gut!“ Sie wollte ihren wieder wild bellenden Jagdhund wegziehen, als ihr Blick auf das aufgewühlte Erdloch fiel.
Und als sie die freigelegte menschliche Hand zwischen den Erdklumpen sah, da hatte jener erste Schnee endgültig seine Vollkommenheit verloren.
Kapitel 2
Donnerstag, 20. August 2015
„Emma, ich überlege ernsthaft, im kommenden Monat zu dir zu ziehen!“
„Zu mir?“ Kriminalhauptkommissarin Emma Hansen wäre fast über ein Bobby Car gestolpert. Sie starrte ihre Mutter völlig entgeistert an. Mit einem großen Ausfallschritt konnte sie sich gerade noch auf den vom Regen der vergangenen Nacht durchweichten Grünstreifen neben dem Gehweg retten.
„Ich kann erst mal in dem Weingut wohnen, in dem ich jetzt untergebracht bin, bis ich eine Wohnung in deiner Nähe gefunden habe“, konkretisierte Marit Hansen ihr Vorhaben, bereits in wenigen Tagen ihren Wohnsitz von Dänemark nach Deutschland zu verlegen.
„Scheiße!“, fluchte Emma, die mittlerweile die körperliche Balance wiedergefunden hatte. Sie betrachtete ihren Bastschuh, der an der Spitze vollkommen durchnässt war, ehe sie ihrer Mutter weiter den gepflasterten Gehweg folgte, der sie zum Kindergarten St. Peter und Paul in Freinsheim führte.
Emma spürte bereits eine unangenehme Feuchtigkeit an ihren Zehenspitzen, die langsam die Sohle entlangwanderte und bei jedem weiteren Schritt ein schmatzendes Geräusch verursachte.
„Na, na, Emma, solche Worte habe ich dir aber nicht beigebracht!“
„Du siehst doch, was mir gerade passiert ist!“ Ein Wunder, dass nicht noch mehr passiert ist, schob Emma in Gedanken hinterher. Sie wollte nicht glauben, was ihre Mutter da gerade von sich gegeben hatte. Das muss ich ihr ganz schnell wieder ausreden!
„Ich finde, das ist eine sehr gute Idee ... Du kannst dich auf deine Polizei-Karriere konzentrieren, kannst wieder Vollzeit arbeiten, dich um deine Verbrecher kümmern. Und ich kümmere mich dann um meinen Enkel. So wie heute. Dann müsstest nicht du Luiz abholen und mit ihm zum Kinderarzt fahren, sondern ich werde das künftig übernehmen.“
Sie hat ja wirklich schon alles geplant! „Du willst also zu mir ziehen? In die Pfalz? Und zu deinem Enkel?“ Emma hatte sich nun demonstrativ vor ihrer Mutter aufgebaut und schaute sie mit durchdringendem Blick an. Sie erinnerte sich nur zu gut, wie abfällig sich ihre Mutter noch vor einem Jahr über Luiz geäußert hatte. Was nicht nur an Luiz leicht gebräunter Hautfarbe lag, die eindeutig nicht auf ein dänisches Kind schließen ließ, das sich Marit Hansen in ihrer Vorstellung für Emma so sehr gewünscht hatte.
Luiz war eigentlich auch nicht Emmas leibliches Kind. Er war ihr Halbbruder, der Sohn ihres verstorbenen Vaters mit Luciana Santos, einer brasilianischen Tänzerin. Für diese Tänzerin hatte Knut Hansen seine Frau vor gut acht Jahren Knall auf Fall verlassen. Marit Hansen hatte nicht die kleinste Chance gehabt, um ihren Mann zu kämpfen. Doch dann wurde alles noch viel schlimmer. Emmas Papa war Weihnachten 2012 in einem Krankenhaus an den Folgen eines tragischen Arbeitsunfalls gestorben. Und Luciana hatte das gemeinsame Kind einfach im Polizeipräsidium Ludwigshafen abgegeben. Sie hatte sich aus dem Staub gemacht und sich damit jeglicher Verantwortung für den eigenen Sohn entzogen. Emma hatte sich seitdem um ihren Halbbruder Luiz gekümmert wie um ein eigenes Kind. Doch Marit Hansen hatte für Luiz nie so empfunden, wie es eine Oma für ein Enkelkind oder eine Mutter für einen Stiefsohn tun sollte.
Luiz war ihr Feindbild schlechthin und schuld an allen Konsequenzen, die mit seinem Dasein zusammenhingen und die Emma und Marit nun allein bewältigen mussten. Wobei Marit Hansen ihrer Meinung nach den größten Part zu übernehmen hatte – vor allem emotional und psychisch.
„Emma, Menschen können ihre Meinung ändern und ich habe ja nur ihn ...“
„Und was ist mit deinen zwei anderen Enkeln ...“ Emma schnaufte verächtlich durch, ehe sie merkte, worauf das Ganze hinauslief. „Ach, so ist das! Erik will dich nicht mehr um sich haben, weil du dich ständig in sein Leben einmischst.“ So, wie du es bei mir auch andauernd tust!
„Dein Bruder legt auf meine aufopferungsvolle Hilfe keinen Wert. Aber ich bin mir sicher, daran ist sie schuld! Seine Frau hat was gegen mich und stachelt ihn gegen mich auf. Aber ich konnte Liv Grete noch nie leiden. Ich frage mich sowieso, was er an ihr findet.“
„Mutter, was du dir immer anmaßt!“
„Ist doch wahr oder seid ihr die dicksten Freundinnen?“
„Was hat denn jetzt die Beziehung zwischen meiner Schwägerin und mir damit zu tun?“
Emma schüttelte so energisch den Kopf, dass sich eine Strähne aus ihrem Pferdeschwanz löste und nun direkt vor ihrem Gesicht baumelte.
„Manchmal frage ich mich wirklich, ob wir beide miteinander verwandt sind.“
„Wie meinst du das denn jetzt schon wieder?“ Nun war es Marit, die Emma fassungslos anstarrte. Ihre Gesichtszüge hatten sich mittlerweile verfinstert und die beiden leuchtend blauen Augen waren zwei schwarzen Schlitzen gewichen.
„Weil wir so wenig gemeinsam haben, Mutter. Empathie, Mitgefühl, Toleranz scheinen absolute Fremdwörter für dich zu sein.“ Und auch sonst sind wir uns alles andere als ähnlich, dachte Emma und betrachtete ihre Mutter, die zweifelsohne mit Anfang 60 immer noch sehr gut aussah, aber fast einen Kopf kleiner war als sie selbst.
Auch sonst hatten die beiden Frauen körperlich nicht viel gemeinsam. Marit war etwas kräftiger in der Statur mit einem fülligeren Busen und ausladendem Becken, während Emma athletisch-schlank war und damit von der Figur eher ihrem Vater glich. Die meisten Leute, die Emma und ihren Vater Knut kannten, sagten, dass sie auch die Augenpartie von ihm geerbt hatte. Das Grübchen im Kinn und das volle kräftige Haar dagegen hatten auch schon ihren Opa charakterisiert, der ebenfalls Kommissar gewesen war, in Kopenhagen. Selbst Emmas blondes, schulterlanges Haar, das sie meistens zu einem lose gebundenen Pferdeschwanz trug, war bei ihrer Mutter längst vergangen und einem stumpfen Grau gewichen. Marit Hansen versuchte bereits seit Jahren mehr oder weniger erfolgreich, die Farbe ihrer Kurzhaarfrisur aufzufrischen. Zu renaturieren, wie der Friseur ihr versicherte.
„Na, wenn du das sagst! Aber auch das wird an meinem Entschluss nichts ändern!“
„Ich werde dir Luiz nicht überlassen, um die Leere in deinem Leben zu füllen.“ Emma biss sich auf die Lippe, doch da waren die Worte längst bei Marit angekommen.
„Das denkst du also von mir ... Luiz als mein Lebensinhalt. Emma, du solltest froh und dankbar sein, dass ich dir den Rücken freihalten will.“
„Es tut mir leid ... Ich wollte das nicht sagen ... Es stimmt auch einfach nicht“, versuchte Emma, das Gesagte irgendwie abzuschwächen. Aber sie wusste, dass ihre Entschuldigung Marit nicht mehr erreichte. Erreichen konnte. Dafür kannte sie ihre Mutter gut genug.
„Ich weiß, was dein Vater mir angetan hat. Vor allem, wie. Aber immerhin hatte ich einen Mann, der mich geliebt hat, ehe diese ... dieses ... ach, auch egal, wie man sie nennt, in sein Leben getreten ist und mir Knut entrissen hat. Ich war lange und glücklich verheiratet, was du von dir ja nicht behaupten kannst. Oder?“
„Mama?!“ Emma wollte schreien, versuchte es aber mit einer noch versöhnlicheren Tonlage, auch wenn ihr Innerstes mehr und mehr dagegen rebellierte. Sie ahnte, dass Marit noch nicht fertig war.
„Und ich bin mir sicher, ohne Luiz würde ich nie Oma von dir werden. Wirklich traurig, Emma. Dabei hatte ich mir das gerade von meiner Tochter so sehr gewünscht. Aber irgendwie ist da was falsch gelaufen und ich frage mich mittlerweile, warum dich bloß kein Mann will.“
Mit offenem Mund sah Emma ihrer Mutter nach, die schnurstracks auf den Kindergarten-Eingang zulief. Und ich habe mich noch bei ihr entschuldigt, ärgerte sich Emma über ihre Nachsicht, und sie spürte, wie sich der verbale Gegenschlag nun in einen allumfassenden Schmerz verwandelte, der ihren gesamten Körper wie ein Virus befiel.
„Darüber reden wir noch, Mutter!“, sagte Emma, als sie Marit erreicht hatte, die mittlerweile im Garderobenbereich stand und sich bereits die blauen Kunststoff-Einwegüberzieher über ihre Schuhe gestülpt hatte. Der Kindergarten beherbergte insgesamt drei Altersgruppen, die in Tiernamen unterteilt waren, jeweils mit einem eigenen Bereich mit Küche, Toiletten, Spiel- und Ruheraum, Freianlage, Bastel- und Malecke, Sitzgruppe zum Lesen und jeweils eigener Garderobe. Die Vorschulkinder waren in der Elefanten-Gruppe zusammengefasst, die Vier- und Fünfjährigen spielten, bastelten und tobten als „Igel“ und die kleinsten Kinder ab einem Alter von sechs Monaten bis drei Jahren, zu denen auch Luiz mit seinen zweieinhalb Jahren gehörte, hießen „Mäuse“.
„Und nur dass du es weißt: Luiz ist mein Sohn, ich habe die Verantwortung für ihn. Ist das klar?“, unterstrich Emma mit einem giftigen Unterton, über den sie sich fast selbst etwas erschreckte. Aber manchmal muss man eben Gleichem mit Gleichem begegnen.
Doch Marit hatte nicht vor, auch nur ansatzweise darauf einzugehen. Sie war bereits an der nur angelehnten Tür des Spielsaals angelangt, die auch gleichzeitig den Eingang zur Mäuse-Gruppe markierte, und rief nun freudig: „Luiz, hier ist die Oma!“
„Mutter!“, zischte Emma und kämpfte immer noch mit den Überziehern. „Scheiß drauf!“, fluchte sie, knüllte die beiden Schutzschuhe zusammen und warf sie in eine Ecke der Garderobe, ehe sie ihrer Mutter in den Bereich der „Mäuse“-Gruppe folgte.
„Hej, Yvonne“, begrüßte Emma die Erzieherin, die sie zuvor noch nie gesehen hatte, die ihren Namen aber auf einem Smiley als Namensschild in Brusthöhe ihres T-Shirts trug.
„Sie müssen sich die Überzieher überstreifen, sonst dürfen Sie hier nicht rein“, überging die junge, etwas korpulente Frau mit Brille und vielen Sommersprossen im Gesicht die Begrüßungsfloskel freundlich, aber bestimmt.
„Ich will nur meinen Sohn abholen. Ich bin schon etwas spät dran. Wir haben einen Termin beim Kinderarzt und die Parkplatzsituation ist da eine Katastrophe.“ Emma sah sich nach ihrem Sohn um. Warum kommt mir Luiz nicht entgegengelaufen?
„Sie dürfen hier nicht mit Straßenschuhen herumlaufen, die Kinder krabbeln auf dem Boden und verschlucken sich am Ende an kleinen Steinchen, die Sie vielleicht hier mit reingetragen haben, nur weil Sie keine Überzieher anziehen wollten.“ Yvonne reichte Emma zwei weitere blaue Schutzfolien, die sie zuvor aus ihrer Hosentasche gezogen hatte.
Wir haben früher auch den Sand im Sandkasten gegessen und sind nicht daran gestorben, dachte Emma, verkniff sich aber diesen bissigen Kommentar und versuchte erneut, die Überzieher über ihre Bastschuhe zu streifen.
„Wo ist denn Luiz?“, fragte sie, als sie es endlich geschafft hatte und nun in ein zufriedenes Gesicht blickte.
„Sie meinen Luiz? Luiz Hansen?“
„Ja!“ Emma untermalte ihre Antwort mit einem energischen Nicken, das nicht verhehlte, wie sinnfrei sie diese Nachfrage empfand.
„Ich dachte, der wäre schon in der Igel-Gruppe.“
„Nein, erst zum neuen Jahr.“ Emma spürte, wie eine gewisse Unruhe in ihr aufflammte. Und ihre Verspätung war nicht der Auslöser.
„Ich betreue normalerweise die Kinder in der Elefanten-Gruppe und bin heute nur ausnahmsweise hier, weil eine Erzieherin fehlt. Krankheit.“ Yvonne zuckte verständnisvoll die Achseln.
„Ich habe ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen ... Die Tür stand offen, vielleicht ist er ja ...“
„Die Tür stand offen? Muss die nicht immer geschlossen sein?“, fragte Emma erbost, ließ die leicht verdutzte Yvonne stehen und rief nun ihrerseits: „Luiz? Luiz, wo bist du?“
„Ich bin mit meiner Kollegin allein, wir können unsere Augen nicht überall haben ...“, rechtfertigte sich die Erzieherin und folgte Emma weiter ins Spielzimmer hinein.
„Luiz? Luiz? Hier ist Mama!“ Emma hörte, wie ihre Stimme immer brüchiger wurde. Das darf alles nicht wahr sein oder soll sich der Albtraum etwa wiederholen? Nur dieses Mal mit einem anderen Ausgang?
„Luiz? Wo bist du? Und Sie schauen mal draußen im Vorraum und in den anderen Gruppen nach!“, forderte Emma Yvonne auf.
Emma überprüfte, ob sich unter den vielen kleinen Kinderköpfen und den krabbelnden, sitzenden und liegenden Körpern nicht doch irgendwo ihr Sohn versteckte. Sie schaute in jedem Schrank, in jeder Truhe und hinter jedem Regal nach, durchsuchte die Toiletten und wühlte sich durch die Bällebox und die Kuscheltierecke, rollte Matten auf und schlug im Schlafraum alle Decken zurück, ehe sie durch die großen Schiebetüren nach draußen in den Freibereich rannte und hier ebenfalls nach ihrem Sohn suchte. Aber Luiz war nirgendwo zu finden.
„Luiz, wo bist du nur?“, krächzte sie heiser und kehrte wutentbrannt in den Spielbereich zurück.