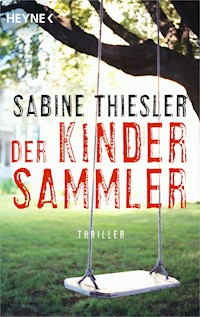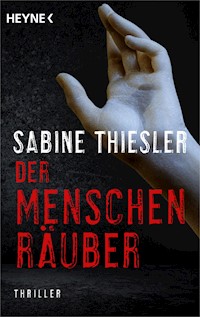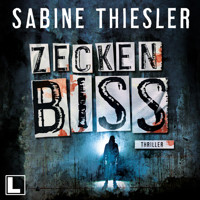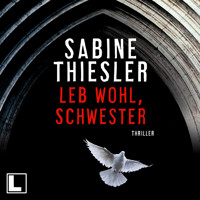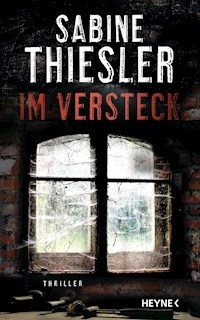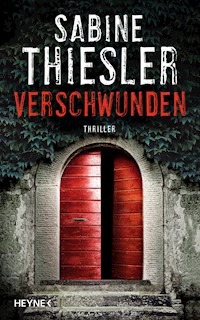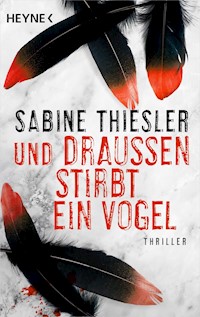
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nervenzerreißende Spannung in der Toskana
Hasserfüllt beobachtet er die Autorin Rina Kramer bei ihrer Lesung. Jedes Wort von ihr macht ihn wütend. Sie hat ihn bestohlen, hat seine Ideen und Gedanken geraubt. Er reist ihr nach, findet sie in ihrem idyllischen Landhaus in der Toskana und mietet sich bei ihr ein. Wie ein harmloser Urlauber, aber besessen davon, sie zu vernichten.
Rina ahnt nicht, was der eigentümliche Gast plant. Als sie endlich die Gefahr erkennt, ist es bereits zu spät.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Zum Buch
Es ist ihr letzter Auftritt nach einer langen Lesereise. Die erfolgreiche Autorin Rina Kramer weiß nicht, dass sie schon lange verfolgt wird und der Stalker wieder im Publikum sitzt.
So ist er ihr auch völlig fremd, als er kurz darauf am Tor ihres einsam gelegenen toskanischen Anwesens auftaucht und das Ferienhaus mieten will. Rina, die gerade mit ihrem Sohn allein ist und ein bisschen Abwechslung gut gebrauchen kann, willigt gern ein. Außerdem ist ihr der Mann durchaus sympathisch.
Aber der Gast benimmt sich eigentümlich und wird ihr immer unheimlicher. Bei seiner Ankunft gab er sich überrascht, dass sie Romane schreibt, doch als sie herausfindet, dass er sämtliche Bücher von ihr kennt und alles über sie weiß, bekommt sie Angst. Dabei ahnt sie noch gar nicht, was er Schreckliches plant. Als sie endlich erkennt, in welch großer Gefahr sie und ihr Sohn schweben, ist es zu spät. Und es gibt niemanden, der ihr in der Einsamkeit helfen kann.
Zur Autorin
Sabine Thiesler, geboren und aufgewachsen in Berlin, studierte Germanistik und Theaterwissenschaften. Sie arbeitete einige Jahre als Schauspielerin im Fernsehen und auf der Bühne und schrieb außerdem erfolgreich Theaterstücke und zahlreiche Drehbücher fürs Fernsehen (u. a. Das Haus am Watt, Der Mörder und sein Kind, Stich ins Herz und mehrere Folgen für die Reihen Tatort und Polizeiruf 110). Ihr DebütromanDer Kindersammlerwar ein sensationeller Erfolg, und auch all ihre weiteren Thriller standen monatelang auf der Bestsellerliste. Zuletzt bei Heyne erschienen:Versunken.
www.sabinethiesler.de
SABINE THIESLER
UND DRAUSSEN STIRBT EIN VOGEL
THRILLER
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2016 by Sabine Thiesler
und Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-16441-6V005
www.heyne-verlag.de
www.sabinethiesler.de
Es war finster geworden, Himmel und Erde verschmolzen in eins. Es war, als ginge ihm was nach und als müsse ihn was Entsetzliches erreichen, etwas, das Menschen nicht ertragen können, als jage der Wahnsinn auf Rossen hinter ihm.
GEORG BÜCHNER, LENZ
ERSTER TEIL
RINA
1
Nur eine fahle Leselampe beleuchtete Gesicht, Lesepult und Buch. Der übrige Raum lag im Stockdunkeln.
Sie sprach langsam und sehr leise ins Mikrofon. Niemand bewegte sich oder gab irgendeinen Laut von sich. Es war, als hätte das Publikum aufgehört zu atmen.
Er stand hinten, direkt neben der Tür, konnte den Saal überblicken und wusste ganz genau, dass sie ihn nicht sehen konnte. Dass sie ihn noch niemals, auch nicht bei den vorangegangenen Lesungen, gesehen hatte. Durch die Lampe geblendet, konnte sie kein einziges Gesicht der Zuhörer erkennen. Der Raum lag vor ihr in undurchdringlichem Schwarz.
Von dem, was sie las, kannte er jede Zeile, jedes Wort, er setzte in Gedanken Kommata und Punkte. Sie las gut, das musste er ihr lassen, besser hätte er es auch nicht gekonnt, sie wusste, was sie sagte. Anscheinend hatte sie sich lange und intensiv mit dem Text beschäftigt.
Er schloss die Augen, ließ die Worte auf sich wirken und spürte ein leises Vibrieren, als würde ihr die Stimme versagen. Sein Puls beschleunigte sich. Die Geschichte ging ihr offenbar selbst an die Nieren.
Es wurde dunkel. Die Sonne versank hinter den Bergen und machte ihr Unglück endgültig. Lisa wusste, dass er jetzt ganz bestimmt nicht mehr kommen würde. Nicht in der Nacht. Dennoch hörte sie nicht auf zu hoffen.
Immerhin war die Nacht warm. Schwüle Luft lag über dem Haus wie eine dicke Decke, unter der man kaum atmen konnte. Ihr Herz krampfte sich zusammen, wenn sie an den Streit am Nachmittag dachte. Sonst wäre Leo vielleicht nie weggelaufen.
Sie war schuld. Und Ben hatte keine Ahnung davon. Er hatte Leo stundenlang gesucht, hatte nach ihm gerufen, hatte geweint und geschrien, und jetzt wagte sie es nicht mehr, ihm auch nur einen Ton von dem Streit zu erzählen. Der wegen einer absoluten Nichtigkeit begonnen hatte.
Zwei Zuhörerinnen putzten sich die Nase. Er lächelte. Das war wunderbar. In seinen Träumen hatte er sich vorgestellt, dass sie weinten. Ein unglaubliches Glücksgefühl breitete sich in ihm aus. Die eigenen persönlichen Probleme der Zuhörer waren ein Klacks gegenüber dieser Geschichte. Sie sollten an nichts anderes mehr denken.
Als er Rina zum ersten Mal begegnete, hatte er sie sich jünger vorgestellt. Vermutlich war das Foto in den Büchern mehr als zehn Jahre alt. Erneut schloss er die Augen. Die Stille im Saal war fast unheimlich. Niemand räusperte sich, niemand hustete, kramte in irgendeiner Tasche herum oder knisterte mit einer Bonbontüte. Man hätte die berühmte Stecknadel fallen hören können. Die Zuhörer hatten die Welt vergessen und waren vollkommen gefangen von dem, was Rina Kramer ihnen vorlas.
Nie würde sie darüber hinwegkommen, dass sie es gewesen war, die »Verschwinde!« und »Geh mir aus den Augen!« gebrüllt hatte.
Diesen entsetzten Ausdruck im Gesicht ihres Kindes würde sie nie mehr vergessen. Danach hatte sich Leo einfach umgedreht und war weggelaufen. Aus dem Haus, aus ihrem Leben und vielleicht in den Tod.
Jetzt horchte sie in die Nacht und betete, wie sie noch nie gebetet hatte, aber da war nur Stille. Unendliche, brutale Stille.
In diesem Moment klingelte ein Handy. Das Geräusch fuhr ihm wie ein Stich ins Herz und erschien ihm so laut und durchdringend wie der Feueralarm in einer Grundschule.
Hör auf!, schrie er innerlich, hör endlich auf!, und presste mit aller Kraft beide Hände auf die Ohren.
Welches verdammte Arschloch hatte bei so einer Lesung sein Handy nicht ausgeschaltet?
Er beobachtete jeden Einzelnen im Publikum. Irgendjemand musste ja nach seinem Handy suchen, um es mit zitternden Händen und beschämt zum Schweigen zu bringen.
Aber nichts passierte.
»Was ist hier los?«, schrie er laut und wunderte sich, wie schrill seine Stimme in dem stillen Saal klang. »Welcher Idiot hat sein verdammtes Handy angelassen und ist jetzt noch nicht mal in der Lage oder zu feige, es auszuschalten?«
Eine Frau zuckte zusammen. Sie trug ein beigefarbenes Chanel-Kostüm, eine geschmackvolle Goldkette, kurze, dauergewellte Haare, sah aus wie eine Gymnasiallehrerin für Latein und Geschichte und knipste nun hektisch ihr Handy aus.
»Entschuldigung«, hauchte sie. »Tut mir wirklich leid.«
Er wurde fast ohnmächtig vor Hass. So viel Kaltschnäuzigkeit brachte ihn um den Verstand.
Was für eine dumme Schlampe. Er konnte es nicht fassen.
Aber Rina Kramer meisterte die Situation. Sie sah ins Dunkel und atmete tief ein. Ihm war klar, dass sie versuchte, ihre Konzentration zurückzugewinnen.
Dann las sie leise weiter.
Mein Leben ist zu Ende, dachte Lisa, ich halte es nicht aus, ohne Leo und mit dieser Schuld bin ich nichts, bin ich zerstört. Ihr Mann würde sie hassen. In ihrem Leben gab es niemanden mehr.
Ben stand auf und zog sich die Jacke an. Er war wahnsinnig, er wollte sogar in der Nacht nach draußen und weitersuchen. Sie konnte es verstehen, aber jetzt hatte sie Angst um beide.
Die Frau mit dem verdammten Handy hatte alles kaputt gemacht. Zauber und Atmosphäre der Geschichte waren dahin. Er konnte seine Wut kaum unterdrücken, schaukelte von einem Bein auf das andere und massierte seine Fingerknöchel. Hörte gar nicht mehr zu. Die Worte plätscherten an ihm vorbei.
Jetzt las sie die gesamte Passage von der Nacht, in der sie auf das Kind warteten, hin- und hergerissen zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Jedes Wort kannte er auswendig. Es war die stärkste Szene des Buches. Einfach großartig.
Er schloss die Augen und vergaß endlich die Frau mit dem Handy. Ließ sich fallen und hörte nur noch die Geschichte.
Nun kam die Stelle, wo das Käuzchen schrie, Lisa jede Hoffnung aufgab, Leo jemals lebend wiederzusehen, und angstgeschüttelt nur noch darauf wartete, dass ihr Mann irgendwann wiederkam.
»Ich will dich nicht verlieren«, flüsterte sie, »dich nicht auch noch. Auch wenn wir Leo niemals wiederfinden, bleib bei mir, Ben. Bitte, hilf mir. Ich bin so allein.«
Ben stand Stunden später vom Regen völlig durchnässt in der Küche, machte aber keine Anstalten, die Jacke auszuziehen und sich abzutrocknen, reagierte nicht, sagte kein Wort, sondern sah nur stumm aus dem Fenster und starrte in die Nacht.
Sie wusste, dass er nie darüber hinwegkommen und niemals mehr einen Weg zu ihr finden würde.
Rina Kramer blickte auf, atmete tief und deutlich aus, lächelte ein wenig und klappte das Buch zu.
Das war ein Zeichen, das jeder verstand. Die Lesung war beendet.
Niemand rührte sich. Totenstille. Es rückte noch nicht einmal jemand seinen Stuhl zurecht.
Doch nach unendlich langen Sekunden begann jemand zu klatschen. Dann drei, dann zehn, dann fünfzehn Personen, und schließlich gab es donnernden Applaus.
Die Bibliothekarin schaltete das Licht an, und langsam wurde der Saal hell.
Er setzte sich schnell auf den frei gewordenen Stuhl und bemühte sich, hinter dem Rücken seines Vordermannes zu verschwinden.
»Aaaahh!«, sagte Rina. »Danke. Ich danke Ihnen sehr. Das ist wundervoll. Und jetzt sehe ich Sie wenigstens alle und weiß, vor wem ich gelesen habe.« Sie lächelte. »Ich hoffe, meine Lesung hat Ihnen trotz der kurzen Störung gefallen, und ich habe Sie ein bisschen neugierig auf das Buch gemacht. Wenn wir uns jetzt noch etwas unterhalten möchten: herzlich gerne. Ich bin hier, ich habe Zeit, und Sie können mich fragen, was Sie mich immer schon einmal fragen wollten. Und ich verspreche: Ich beantworte alles!«
Niemand rührte sich, denn niemand traute sich, eine Frage zu stellen.
»Nur zu!«, ermunterte Rina die Zuhörer erneut, die zwar immer noch schwiegen, aber auch keine Anstalten machten zu gehen.
»Wir möchten Frau Kramer für diese wunderbare, intensive Lesung herzlich danken«, sagte die Bibliothekarin mit so leiser, zittriger Stimme, dass man sie kaum verstand, obwohl sie in ein Mikrofon sprach.
Was für eine verlogene Tante, dachte er, du hast doch gar nicht richtig zugehört. Ihm wurde schlecht.
Nach einer Pause fragte er mit leiser, aber klarer Stimme: »Woher nehmen Sie eigentlich die Ideen für all Ihre Romane?«
Rina hatte nicht mitbekommen, wer gefragt hatte, aber antwortete sofort. »Es sind eigentlich Kleinigkeiten, die mir auffallen und die zu einer Idee werden. Ein einsames Haus im Wald, ein außergewöhnlicher Charakter oder auch eine Situation. Eine kurze Zeitungsnotiz oder etwas, das man über sieben Ecken von einem Freund erfährt. Wichtig ist, dass mich das Thema tief berührt. Manchmal überlege ich: Wovorhast du Angst? Und dann fallen mir Situationen ein. Und aus der Situation, die mir am wichtigsten ist und die mich am meisten interessiert, versuche ich eine Geschichte zu entwickeln, mit der ich mich dann sehr lange und eigentlich täglich beschäftige.
Man muss über das schreiben, was einem selbst wehtut. Und dass das eigene Kind verschwindet – etwas Schlimmeres kann einem im Leben, glaube ich, nicht zustoßen. Jeden Tag, vierundzwanzig Stunden Angst, Hoffnung und Ungewissheit. Das ist kaum auszuhalten.«
Dreist, dachte er. Sie lügt und weiß es ganz genau. Er rutschte auf seinem Stuhl noch tiefer und begann die Haut auf seinem Handrücken blutig zu kratzen, ohne es zu merken.
»Wie können Sie so etwas schreiben, wenn Sie es nicht selbst erlebt haben?«, fragte eine Frau mit extrem kurzem Haar in der letzten Reihe.
»Ich kann mich gut in jemanden hineinversetzen, der sein Kind verliert. Ich kann mich aber auch gut in einen Mörder hineinversetzen, weil ich davon überzeugt bin, dass jeder von uns in einer extremen Lebenssituation zum Mörder werden könnte.« Rina schien froh zu sein, dass das Gespräch jetzt endlich in Gang kam.
»Dann ist alles das, was Sie so wunderbar und so einmalig beschreiben, reine Fantasie?«, fragte eine alte Dame in der vorletzten Reihe.
»Ja.«
Sie war eine gottverdammte Lügnerin, aber nun gut, wie sollte sie sich bei derartigen Fragen auch anders aus der Affäre ziehen, überlegte er und schluckte seinen Ärger hinunter. Sie konnte ja gar nicht anders reagieren. Ich müsste sie bloßstellen und alles auffliegen lassen.
»Sie schließen sich in Ihrem Zimmer ein und schauen nur in Ihren eigenen Kopf?«
»So ist es.«
Die alte Dame nickte bewundernd.
»Ich meine, geht Ihnen das nicht selbst zu Herzen, wenn Sie so etwas schreiben? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man sich solche Geschichten ausdenkt.« Die Frau, die jetzt fragte, war die, deren Handy geklingelt hatte.
»Das ist schwer zu erklären, weil ich es leider selbst nicht weiß.«
Natürlich weißt du das nicht, natürlich nicht. Ein eiskalter Schauer lief ihm über den Rücken. Aber bald wirst du es wissen. Ganz bestimmt.
»Ich sitze oft am Computer und weine, während ich schreibe. Das lässt sich wahrscheinlich gar nicht vermeiden. Aber wenn das Buch dann erschienen ist, geht es mir besser. Ich habe sehr viele Ängste, und Bücher zu schreiben hilft mir, damit umzugehen. Vielleicht ist es eine Art Therapie.«
»Das verstehe ich«, sagte die Frau und wirkte sehr zufrieden.
Und dann hagelte es Fragen.
»Wie lange schreiben Sie an einem Buch?«
»Das ist ganz unterschiedlich. Mal ein Jahr, mal drei Jahre.«
»Und da sind Ideenfindung und Recherche schon dabei?«
»Ja.«
»Machen Sie sich ein Konzept?«
»Nein. Ich bin vom Verlauf und Ausgang des Buches genauso überrascht wie der Leser. Und das macht meine Arbeit so spannend.«
Er hielt die Luft an. Auf seiner Stirn bildeten sich kleine Schweißperlen. Jetzt, jetzt würde sie es zugeben, woher ihre Ideen stammten, jetzt würde sie die Wahrheit sagen, endlich.
Ihm wurde immer heißer, und dennoch zitterte er.
Aber sie sagte nichts.
Er biss sich auf die Lippen, um nicht laut zu schreien vor Wut.
»Haben Sie Kinder?«, fragte jemand aus der zweiten Reihe, aber er hörte gar nicht richtig hin.
»Ja. Einen Sohn«, antwortete sie.
»Und Sie sind verheiratet?«
»Ja.«
»Glücklich?« Die Frau, die gefragt hatte, räusperte sich. »Entschuldigen Sie, dass ich so direkt frage, aber ich habe Ihr Buch ›Die Witwe‹ gelesen, und da fragt man sich natürlich, ob es Ihrem Mann noch gut geht.«
»Natürlich. Das verstehe ich. Aber ich kann Sie beruhigen. Es geht ihm sehr gut, und ich habe auch nicht vor, ihn demnächst umzubringen.«
Einige Leute lachten, die Frau grinste und schwieg.
Er wurde wütend über die Lacher. Was waren das bloß alles für Menschen. Sie verstanden nichts. Gar nichts. Hatten nicht die geringste Ahnung davon, wie es war, wenn eine geniale Idee ganz langsam in den Kopf kam, aufquoll und in den Gedanken immer mehr Platz beanspruchte, bis man glaubte zu platzen … Das Schreiben war dann wie eine Entspannung, eine Erlösung.
Aber Rina Kramer konnte dies natürlich nicht erklären.
Jetzt lächelte er in sich hinein, sackte noch tiefer in seinen Sitz, denn der Gedanke, dass sie ihm nicht das Wasser reichen konnte, war wunderbar.
»Wieso spielen eigentlich Ihre letzten Bücher in der Toskana?«, fragte eine Dicke mit Haarausfall.
»Weil ich vor drei Jahren da hingezogen bin und mich dort mittlerweile ganz gut auskenne. Ich weiß, wie es riecht, wenn Oleander, Rosmarin und Jasmin blühen, wenn die Sonne aufgeht und das Land noch feucht ist, wenn das Heu gemäht ist und wenn die Hitze über dem Land liegt. Ich kenne die Geräusche, höre innerlich das Singen der Vögel, das Grunzen der Wildschweine, die Schreie der Fasane und das Heulen der Wölfe. Ich kann in Gedanken auf den Bergen, in den Wäldern, in mittelalterlichen Dörfern und in einsamen, zerfallenen Burgen spazieren gehen. Und ich weiß, wie die Menschen reagieren, wenn irgendetwas passiert. Nur so kannich Atmosphäre schaffen, und das brauche ich für meine Bücher.«
Ihm brach erneut der Schweiß aus. Sie war also in die Toskana gezogen. Das hatte er bisher immer nur vermutet, aber nicht definitiv gewusst, denn so deutlich hatte sie es noch nie gesagt.
Jetzt schaltete sich wieder die verschüchterte Bibliothekarin ein, die die Diskussion offensichtlich beenden wollte, und säuselte in ihr Mikro, während sie nach vorn zum Pult ging. »Ganz ganz herzlichen Dank, Frau Kramer, für den schönen Abend.« Sie drückte Rina eine Flasche Wein der Region in die Hand und wandte sich ans Publikum. »Frau Kramer ist selbstverständlich bereit, ihre Bücher zu signieren.«
Vor dem Lesepult stand nach kurzer Zeit eine endlos lange Schlange von Personen, und einige trugen einen ganzen Stapel Bücher, die sie alle signiert haben wollten.
Er stellte sich hinten an. In der Hand hielt er sein völlig zerlesenes Exemplar von »Das Lächeln des schwarzen Mannes«, und er hatte Zeit.
Sechsunddreißig Personen waren noch vor ihm.
Er fixierte Rina Kramer. Registrierte, wenn sie ganz automatisch ihren Namen schrieb und das nächste Buch zur Hand nahm oder wenn ein Lächeln sie einen Moment entspannte.
Noch achtzehn Leute. Die Bibliothekarin stellte ihr ein Glas Wein auf den Tisch. Sie bedankte sich, nahm einen Schluck und signierte weiter. Es war überdeutlich, wie müde sie war.
Noch sechs. Jetzt wurde er nervös. Der Schweiß lief ihm den Rücken hinunter, sodass es kitzelte.
Sie schrieb und schrieb. Aber auch wenn sie aufsah und ihrem Leser eine spannende Lektüre wünschte, bemerkte er deutlich, dass sie nicht mehr in der Lage war, die einzelnen Gesichter zu registrieren. Sie lächelte freundlich und sah durch sie hindurch. Sie war einfach zu erschöpft.
Dann stand er vor ihr. Ganz nah. Nur circa sechzig Zentimeter trennten sie voneinander. Er hatte eine Wollmütze aufgesetzt, trug jetzt eine Sonnenbrille, stand über ihr, sah auf sie hinab und sagte, bevor sie ihn ansprechen konnte: »Guten Abend, Frau Kramer. Bitte schreiben Sie: Danke für alles, Manuel. Und dann Ihre Unterschrift natürlich.«
Er tippte auf die freie Seite direkt neben ihrem Porträt.
»Ma-nu-el. Wie man’s spricht.«
Rina sah ihn kurz irritiert an. »Warum denn ›danke‹?«
»Weil ich es mir wünsche. Bitte, schreiben Sie.«
Sie zuckte kaum merklich mit den Schultern, und er ging davon aus, dass sich die Leute wahrscheinlich dauernd irgendwelche merkwürdigen Sachen wünschten. Schon schrieb sie, worum er gebeten hatte, und gab ihm das Buch zurück.
»Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch«, flüsterte er, nickte ihr kurz zu, nahm sein zerlesenes Buch, drückte es an die Brust, drehte sich um und ging. Bahnte sich einen Weg durch die Herumstehenden, die alle ein Glas in der Hand hielten und Käsekräcker aßen.
2
Sein Wohnmobil hatte er auf dem großen Parkplatz gegenüber der Bibliothek geparkt.
Er saß im Dunkeln hinter dem Steuer und starrte in die Nacht. Noch war die Bibliothek hell erleuchtet, aber es kamen kaum noch Leute heraus. Rina Kramer war nicht darunter.
Er wartete und wurde immer ungeduldiger.
Warum kam sie nicht? Was machte sie denn noch? Oder hatte er sie verpasst?
Mit dem rechten Fuß tippte er rhythmisch auf das Gaspedal. Komm!, schrie er innerlich, verdammt noch mal, wo bist du?
In unmittelbarer Nähe der Bibliothek gab es mehrere kleine Kneipen und Restaurants, vielleicht ging sie ja noch mit der Bibliothekarin was trinken, dann würde er sich an einen anderen Tisch in der Nähe setzen. Vielleicht bekam er ein bisschen von der Unterhaltung mit.
Endlich ging die Tür auf, und Rina Kramer kam heraus. Hinter ihr ein großer, breitschultriger Mann mit ansatzweise grauem Haar und die Bibliothekarin, die sich vor der Tür von beiden verabschiedete. Rina Kramer lächelte freundlich, dann legte der Mann einen Arm um ihre Schultern, und beide gingen quer über den Parkplatz zu einem großen, dunklenSUV, stiegen ein und fuhren davon.
Manuel wischte sich mit dem Unterarm den Schweiß von der Stirn.
Ihr Mann war diesmal also auch dabei gewesen, er hatte ihn schon ein paarmal bei Lesungen bemerkt. Sympathisch fand er ihn nicht.
Verdammt. Wahrscheinlich fuhren sie gleich ins Hotel.
Heute war ein ganz besonderer Abend. Es war ihre letzte Lesung gewesen. Für ihn gab es vorerst nichts mehr zu tun.
Ein Gefühl von Wehmut überkam ihn.
Er startete den Motor und fuhr aus der Stadt, auf der Suche nach einem ruhigen Stellplatz für die Nacht.
Wenig später parkte er sein Wohnmobil dicht neben der Bundesstraße auf einem festgetretenen Stück Acker. Er hatte das Fahrzeug vor einigen Jahren preiswert gebraucht gekauft, und es war alles, was er an materiellen Gütern besaß. Es war sein Zuhause, beherbergte seine ganze Existenz und gab ihmein Gefühl von Freiheit. Wenn er Rina Kramer nicht zu ihren Lesereisen nachfuhr, wohnte er auf einem Dauercampingplatz in Drage, in der Nähe von Hamburg. Das kostete nicht viel, und abgesehen davon, dass er sich mehr nicht leisten konnte, reichte ihm dieses Leben im Wohnmobil völlig.
Als er den Motor ausschaltete, pfiff er leise. Eine dünne graue Ratte schoss unter dem Bett hervor, sprang an ihm hoch und setzte sich auf seine Schulter. »Hallo, Toni«, flüsterte Manuel und kraulte dem Tier den Bauch, »ich hab dich vermisst, meine Süße.«
Toni, offensichtlich hocherfreut, dass ihr Kumpel und Ernährer wieder zu Hause war, turnte auf ihm herum. Jagte wie wild unzählige Male um seinen Hals, krabbelte durch seine Haare, knabberte zärtlich am Ohrläppchen und putzte sich mit beiden Pfoten die Schnauze.
Vorsichtig nahm er das von Rina Kramer signierte Buch und strich noch einmal liebevoll über das Cover. Er stellte es ein wenig schräg ins Regal, damit das Titelbild gut zu sehen war. Stand sekundenlang davor und lächelte. Dann öffnete er eine Schublade und nahm »Die Witwe« heraus. Stellte das Buch neben »Das Lächeln des schwarzen Mannes«. Ja, das war die Lesung in Dinslaken gewesen. Er erinnerte sich gut. »Das Vergehen«, die Lesung in Stuttgart, »Schatten über Siena« in München, aus »Der Verrat der Töchter« hatte sie in Hannover gelesen … Alle zwölf Bücher, die Rina Kramer geschrieben hatte, drapierte er sorgsam auf dem Regal.
Minutenlang sah er sie alle an. Stolz erfasste ihn. Und Wut.
Immer bei der letzten Lesung ließ er sich das aktuelle Buch, mit dem Rina Kramer auf Lesereise war, von ihr signieren. Noch nie hatte sie ihn wiedererkannt und wusste nicht, dass er ihr folgte. Sie hatte keine Ahnung.
Manuel goss sich ein Glas halb voll mit Wasser und trank einen kleinen Schluck.
»Auf dein Wohl, Toni«, sagte er und fügte in Gedanken hinzu: Du bist das Beste, was mir je im Leben begegnet ist.
»Süße, ich hab eine Idee!«, sagte er plötzlich laut. »Was hältst du davon, wenn wir eine große Reise machen und in die Toskana fahren?«
Toni krabbelte ihm auf den Kopf.
»Okay. Du bist begeistert. Dann machen wir das.«
Allmählich spürte Manuel, dass er ruhig wurde. Die Ratte war jetzt unter seinem Pullover, genoss den säuerlichen Schweißgeruch, verlor ein paar Köttel und schlief ein.
Es störte ihn nicht. Er liebte sie, und sie liebte ihn. Seit Toni bei ihm war, hatte er sich nie mehr allein gefühlt.
Vor anderthalb Jahren hatte sie eines Morgens neben der Spüle gesessen und einen Kuchenrest vom Teller gefressen.Manuel war weder erschrocken, noch hatte er die Ratte eklig gefunden, im Gegenteil. Er schloss das Tier augenblicklich in sein Herz, und Toni blieb bei ihm. Sie wurden ein gutes Team.
Aber Manuel wusste nicht, wie alt Toni war, als sie sich das Wohnmobil als neue Heimat ausgesucht hatte. Und bei einer Rattenlebenserwartung von zweieinhalb bis maximal vier Jahren war ein Ende dieser Freundschaft abzusehen.
Manuel durfte sich den Tag X gar nicht vorstellen.
Er setzte sich aufs Bett, nahm Toni in die Hand und kraulte ihr den Bauch.
Auf der Bundesstraße donnerten die Lastwagen vorbei. Kein guter Ort, dachte Manuel, aber egal, er würde ja morgen früh weiterfahren. In Richtung Süden.
Er klappte sein Laptop auf und fuhr Google Earth hoch.
Die italienischen Orte, die Rina in ihren Büchern erwähnt hatte, lagen im Dreieck Florenz-Siena-Arezzo. Er hatte sie sich nicht nur herausgeschrieben, sondern in Google Earth auch gelbe Markierungen gesetzt. Mittlerweile war die Karte übersät mit diesen Zeichen, denn das Gebiet, in dem drei ihrer Bücher spielten, war klar begrenzt. Dort in der Nähe würde sie auch wohnen, da war er sich ziemlich sicher. Sie hatte in allen Interviews immer wieder ausdrücklich betont, dass sie die Orte, über die sie schrieb, kennen müsse, um dort in Gedanken spazieren gehen zu können, also hatte sie da wohl auch ihren Lebensmittelpunkt.
Und er würde sie finden. Da gab es gar keinen Zweifel. Schriftsteller hatten die Manie, sich immer verstecken zu wollen, aber das war eine Illusion. Wenn man wollte, fand man sie auch. Ein Untertauchen in den Wäldern war ein romantischer Traum, aber vergebens.
In der »Witwe« schrieb sie davon, dass man auf einer engen Straße von Casina aus vierzehn Serpentinen bis zu dem Haus hinauffahren müsse. Das musste doch zu finden sein.
Er suchte konzentriert und akribisch. Scrollte hin und her, betrachtete die Karte aus großer Höhe und so nah wie möglich. Da. Da war eine Straße, die sich in engen Kurven den Berg emporschlängelte. Sein Pulsschlag erhöhte sich. Er zoomte näher heran und zählte die Kurven. Es waren vierzehn.
Er sprang auf, lief im Wohnmobil hin und her und schlug sich bestimmt zwanzigmal gegen die Stirn.
Wirklich vierzehn! Verdammt!
Vielleicht wohnte sie dort.
Natürlich würde er sie finden! Und wenn er drei Jahre lang suchen musste. Er hatte alle Zeit der Welt und würde jeden noch so kleinen Hinweis in Google Earth eingeben.
In »Das Lächeln des schwarzen Mannes« erwähnte sie einen Fluss und einen See. Er riss das Buch aus dem Regal und suchte die Stelle.
… Bei klarem Wetter konnte man vom Dorf aus den See in der Ferne liegen und in der Sonne funkeln sehen …
Ja, dann musste es hier, dieser See sein. Und direkt am Ufer stand das Haus, in dem das Kind gefangen gehalten wurde. Vom Tal ging man zuerst bergauf, dann durch dichten Wald wieder bergab, und dann lief man über eine Wiese, die nie geschnitten wurde und in der es von Schlangen nur so wimmelte.
Manuel hatte einen hochroten Kopf, aber bei dem Gedanken, durch das hohe Gras dieser Wiese gehen zu müssen, lief es ihm eiskalt den Rücken hinunter.
Das Tal hatte er auf der Karte schnell gefunden, da nur ein einziger Weg vom Dorf zum Tal führte, und auch der Bachlauf an den beiden Häusern vorbei war charakteristisch. Das musste es einfach sein.
Am Ausgang des Tals teilte sich der Weg. Der linke Weg führte ins Dorf, also musste er den rechten nehmen, um zum See zu gelangen. Ja, hier war er auf der richtigen Spur, und das dichte Grün musste der Wald sein, und daran anschließend die freie, helle Fläche war sicher die Schlangenwiese. Es konnte gar nicht anders sein.
Die Serpentinenstraße war nur zwölf Kilometer Luftlinie davon entfernt.
Aber den Fluss fand er nicht. Verdammt noch mal, wo war der Fluss? Auch der Bachlauf des Tals war irgendwo versiegt.
Er bekam Herzklopfen und spürte, wie sein Blutdruck anstieg, aber versuchte sich damit zu beruhigen, dass bei Google Earth Flüsse fast nie vernünftig zu sehen und beschriftet waren. Er sollte sich lieber auf den See konzentrieren.
Immer hektischer schob er die Google-Earth-Karte hin und her. Da! Da war ein hoher Schatten. Das musste die riesige Zypresse sein, von der sie geschrieben hatte. Genau. Und da begann der Weg an der Schlucht. Wahrscheinlich würde er hier auch irgendwo die ganz in der Nähe liegende Burg finden. Aber danach würde er später suchen, jetzt interessierte ihn erst mal der See.
Er spürte, dass seine Nervosität ihn daran hinderte, sich zu konzentrieren.
Daher stand er auf, trank noch ein Glas Wasser und suchte dann weiter. Minutenlang.
Und endlich: Da war er. Manuel jubilierte innerlich. Er konnte am Ufer sogar ein Haus entdecken. Nur eines. Ein einsames. Das Kindergefängnis. Oder ihr Wohnhaus?
Eine wohlige Wärme zog durch seine Adern, so sehr freute er sich.
Auch die buschige Zeder an der Nordseite des Hauses konnte er jetzt ausmachen. Wenn man wusste, dass sie da stehen musste, erkannte man sie.
Es war fantastisch.
Manuel zog sich den schon wieder klatschnass geschwitzten Pullover aus. Toni fiepte leise und flüchtete hinter die Gardine.
Die Scheiben seines Wohnmobils waren von seinen Ausdünstungen beschlagen.
Er nahm Toni in die Hand und hauchte ihr warmen Atem ins Gesicht. Das beruhigte sie.
Die Liste, die er abzuarbeiten hatte, war lang. Aber er sollte sich nicht beklagen, denn für die langen Abende im Wohnmobil gab es keine sinnvollere Beschäftigung.
In »Schatten über Siena« schrieb sie von einem Haus, weit ab von einer Straße, nur durch einen langen Fußmarsch zu erreichen. Ein kleines Haus im Wald. Ohne Strom, ohne Wasser, ohne Handyempfang.
Er suchte die Straße. Von Fionino aus an einem zerfallenen Castello vorbei, dann eine schmale Asphaltstraße zwischen Weinbergen hinauf bis zu einer Kapelle. Dort ging ein Feldweg rechts ab, durch den Wald, an ein paar Bretterbuden vorbei. Bei der nächsten Weggabelung durfte man keinen der beiden Wege nehmen, sondern musste sich wieder rechts durchs Gebüsch schlagen, die steinernen Terrassen hinuntersteigen, bis man zu dem alten, verwunschenen, einsamen Haus kam.
Manuel suchte, wurde immer fahriger, verirrte sich auf Feldwegen, nein, der konnte es nicht sein, der hatte eine viel zu lange Gerade, der Weg war viel kurviger beschrieben, er wanderte mit dem Cursor vor und zurück, rechts und links, hoch und runter und verzweifelte fast. Der Schweiß lief ihm übers Gesicht. Er sprang auf und rannte wie ein Tiger im Käfig die paar Schritte, die im Wohnmobil möglich waren, immer hin und her, bis er sich wieder setzte und schließlich – schon völlig entnervt – die Kapelle fand und auch den Wald. Sogar die Bretterbuden, wahrscheinlich provisorische Hütten für Jäger, konnte er erahnen und wurde ganz euphorisch.
Langsam scrollte er weiter, suchte die einsame Hütte jenseits jeden Weges und entdeckte sie endlich.
Ja. Das musste sie sein. Hierhin hatte sich die Hauptfigur, eine Nymphomanin, zurückgezogen. Hier hatte sie die Männer getroffen und die Beine breit gemacht.
Er würde überall hingehen und sich alles ansehen. An jedem Ort würde er das denken, was dort gedacht worden war.
Plötzlich tauchte auf dem Bildschirm ein zarter Schatten auf. Zuerst nur ein vager, undeutlicher, gräulicher Strich, aber dann sah er genauer hin und vergrößerte das Bild, bis er ganz sicher war.
Das war ein Strommast. Ein kleiner zwar, aber immerhin ein verdammter Drecks-Strommast. Ganz in der Nähe des Hauses. Er maß die Entfernung aus. Der Strommast stand keine fünfzehn Meter vom Haus entfernt.
Eine unbändige Wut stieg augenblicklich in ihm hoch. Sie hatte geschrieben, im Haus gebe es keinen Strom. Das war also nicht wahr. Er schlug auf den Tisch. Sie war eine Lügnerin. Er durfte jetzt nicht aufhören, musste weitermachen, musste alle Orte, die sie in ihren Büchern beschrieben hatte, überprüfen, es war wichtig, und wenn er die ganze Nacht durcharbeitete.
3
»Du bist ja so still«, stellte sie fragend fest, als sie ins Auto einstieg.
Eckart biss sich auf die Lippen. »Das war ja wohl das Letzte, mit dieser dummen Nuss und ihrem Handy. Ich fasse es nicht! Das hat den ganzen Abend kaputt gemacht. Und dann gerade an dieser Stelle!«
»Ach komm. So was passiert halt manchmal. Dafür sind wir live.« Sie legte den Arm um seine Schultern. »In dem Moment hab ich auch gedacht, ich werde wahnsinnig. Aber jetzt ist es vorbei. Feierabend. Es war meine letzte Lesung. Wir haben Urlaub!«
»Du. Ich nicht.«
Er startete den Motor.
Und dann musste sie wieder daran denken. In ein paar Tagen würde er nach Paris fliegen und drei Monate drehen. Er führte Regie bei einer schmalzigen Liebesserie an der Seine, mit Herz, Schmerz, ein bisschen Crime und vielen bunten Bildern.
Und wie immer war Anja dabei. Seine Regieassistentin mit dem glänzenden, glatten, brünetten Haar und den dicken Titten, die er seit drei Jahren vögelte. Es hatte bei einem Rosamunde-Pilcher-Film angefangen und war so geblieben, weil er sie von da an als Assistentin in jede Produktion mitbrachte.
Seit drei Jahren ging das jetzt und brach ihr das Herz, obwohl sie in langen nächtlichen Gesprächen übereingekommen waren, dass jeder tun und lassen konnte, was er wollte.
Aber man konnte viel beschließen.
Sie kam damit einfach nicht klar.
Zum Hotel fuhren sie schweigend. Eckart sagte keinen Ton. Nach einer Weile meinte sie: »Nun denk nicht dauernd an dieses blöde Telefon! Ansonsten war die Lesung doch völlig okay, oder?«
Eckart nickte. »Sicher. Du kannst ja auch nichts dafür.«
»Warum hast du mir nicht gleich, als ich angefangen hab zu signieren, ein Glas Wein vorbeigebracht?«
»Weil es einfach zu voll war. Du wirst es nicht glauben, ich wollte dir eins bringen, aber es ging nicht. Ich bin einfach nicht durchgekommen bei diesem Gedränge.«
»Ist ja irre.«
»Ja, das finde ich auch. Aber das Handyklingeln hat deine wichtigste Szene kaputt gemacht.«
»Eckart, bitte, hör auf. Wenn sich jemand darüber aufregen sollte, dann ich. Lass es. Erinnere mich nicht andauernd daran. Es war ein guter Abschluss der Tour mit einem kleinen Schönheitsfehler und fertig. Ende. Abgehakt.«
»Wenn du es so siehst, bitte schön.«
»Meinst du, es bringt was, sich noch stundenlang darüber aufzuregen?«
»Das nicht. Aber trotzdem.« Eckart schwieg, und bis zum Hotel sprach sie ihn nicht wieder an.
Eckart betrat das Hotelzimmer, steckte die Plastikkarte in die Box, sodass in Zimmer und Bad das Licht anging, zog sein Jackett aus, hängte es in den Schrank, ging auf die Toilette, spülte, wusch sich die Hände, durchquerte das Zimmer, nieste zweimal laut, öffnete die Balkontür, trat hinaus auf den Balkon, blieb eine halbe Minute stehen, nieste weitere fünf Mal, kam wieder herein, ließ aber die Balkontür offen, ging zum Tisch, nahm sich ein Päckchen Taschentücher, schnaubte sich die Nase, stopfte das benutzte Taschentuch in seine vordere linke Jeanstasche, schaltete den Fernseher an, nahm sich ein Bier aus der Minibar, trat die Kühlschranktür mit dem Fuß zu, öffnete das Bier, trank ein paar Schlucke, stellte es auf seinen Nachttisch, zog sich die Schuhe aus, ließ sich aufs Bett fallen, nahm die Fernbedienung in die Hand und zappte durch die Programme.
Hundertmal hatte sie diesen Ablauf schon so erlebt, aber noch nie so schweigend und abweisend. Eckart tat, als wäre sie gar nicht im Zimmer. Er registrierte sie einfach nicht, keineinziger Blick streifte sie.
»Hast du deine täglichen Worte heute schon verbraucht?«, fragte sie schließlich.
Er antwortete nicht.
Sie warf einen Blick ins Badezimmer und in den Spiegel. Ihre Gesichtsfarbe war grau, und ihr Augen-Make-up wirkte verschmiert und schmutzig. Deshalb sah sie schnell wieder weg.
Wahrscheinlich war er in Gedanken schon in Paris.
Rina legte sich aufs Bett. Sah sich das Fernsehprogramm an, das er ausgewählt hatte, ohne irgendetwas zu begreifen. Es interessierte sie auch nicht.
»Fahren wir morgen nach Italien, oder bleiben wir noch einen Tag länger in Deutschland?«
Eckart zuckte die Achseln. »Keine Ahnung. Lust hab ich zu beidem nicht.«
»Na toll. Das erleichtert die Entscheidung.«
»Vielleicht sollte ich gleich nach Paris fliegen«, sagte er mit dem Blick zum Fernseher. »Es gibt noch eine Menge vorzubereiten.«
»Und zu vögeln.«
Nach einer Pause sagte Eckart: »Kann sein. Kann auch nicht sein.«
»Ich würde mich schämen, so etwas zu sagen.«
»Du vielleicht. Ich nicht.«
»Was ist mit Anja?«
»Sie ist meine Regieassistentin. Wie immer. Daran hat sich nichts geändert.«
Er wusste, wie sehr sie darunter litt, wenn sie in Italien auf ihrem Berg saß und sich jeden Tag vorstellte, was beim Drehen, am Set oder anschließend im Hotel ablief.
Sie kämpfte mit den Tränen.
»Vielleicht ist es wirklich besser, wenn du so bald wie möglich fliegst«, sagte sie, wischte sich mit dem Unterarm übers Gesicht, damit er nicht sah, dass sie weinte, und schloss die Augen.
Am nächsten Morgen war Eckart wie ausgewechselt.
Als das Licht trotz der dicken Vorhänge ins Zimmer drang und Rina im Aufwachen sich von einer Seite auf die andere drehte und mit ihrer Bettdecke zu kämpfen begann, legte Eckart seinen Arm um sie, als wolle er ihr damit sagen: Jetzt bleib einen Moment liegen. Gib noch ein bisschen Ruhe.
Und prompt lag sie still, wagte es nicht mehr, sich zu bewegen, wollte ihn nicht stören, ihm den letzten Zipfel seines Traums gönnen.
Ihre Schläfe juckte. Immer mehr und immer schlimmer, bis sie es nicht mehr aushielt, sich von seinem schweren Arm befreite, ihren Kopf kratzte, sich aus dem Bett schwang und ins Bad ging.
Als sie zurück ins Zimmer kam, blinzelte er und lächelte ihr zu. »Gut geschlafen, Kleines?«
»Einigermaßen.« Das war das Eckart-Phänomen. Ein neuerTag in hellem Licht – und die schlechte Stimmung vom vergangenen Abend war vergessen und wie weggeblasen. Als hätte es sie nie gegeben. Er hasste es zu diskutieren, er fing einfach jeden Tag vollkommen neu an. Als würde er seine Festplatte in jeder Nacht komplett löschen.
Vielleicht war das ein Vorteil. Auf diese Weise kam man gar nicht dazu, Dinge zu sagen, die man hinterher bereute, es blieb einfach alles ungesagt und in der Schwebe. Streitigkeiten und Probleme existierten nur noch in Gedanken und lösten sich irgendwann in Wohlgefallen auf.
Er gähnte herzhaft. »Zieh mal die Vorhänge auf, ich will sehen, wie das Wetter ist.«
Rina zog die Gardinen zur Seite und öffnete die Balkontür. »Schön, glaub ich. Es ist jetzt schon angenehm warm.«
»Komm mal her!«
Sie ging zu ihm. Noch sehr zurückhaltend und abwartend. Was wollte er denn jetzt?
Er zog sie zu sich aufs Bett, fuhr ihr mit der Hand unters Hemd und kratzte ganz zart ihren Rücken.
Sie wand sich wie eine junge Katze. Am liebsten hätte sie geschnurrt.
»Kommst du noch eine Woche mit nach Italien?«, fragte sie sanft und leise. »Die Zeit hast du doch noch.«
»Das schon, aber ich muss noch so viel besorgen. Das wollte ich eigentlich in Deutschland erledigen.«
»Eckart, bitte! Außerdem kommt Fabian. Du würdest ihn sonst gar nicht sehen.«
Eckart fuhr sich mit der Hand durch die Haare und überlegte zwei Sekunden.
»Ja, stimmt.« Er sah völlig entspannt aus. »Doch, du hast recht. Ich will Fabian sehen. Also lass uns nach Italien fahren. Gleich nach dem Frühstück. Und weißt du was? Ich freue mich auf herrliche Sommernächte auf der Terrasse.«
Er zog sie an sich und küsste sie auf die Stirn.
Dieser Mann war ihr seit beinahe zwanzig Jahren ein Rätsel.
4
Manuel hatte noch keine drei Stunden geschlafen, als ihn ein lautes Krachen hochschrecken ließ. Irgendetwas donnertean die Seitenwand des Wohnmobils.
Unwillkürlich zuckte er zusammen, machte sich ganz klein, zog den Kopf zwischen die Schultern und blinzelte auf seinen Radiowecker. Halb sieben.
Er stand auf und öffnete vorsichtig die Tür.
Vor ihm stand ein Bauer, der noch einmal mit der flachen Hand und voller Kraft gegen sein Auto schlug. »Das hier ist mein Land und kein Campingplatz!«, schrie er mit vor Zorn verzerrtem Gesicht. »Hauen Sie ab, aber ganz schnell, sonst hole ich die Polizei!«
Manuel brauchte drei Sekunden, um zu begreifen. Registrierte die wütende Fratze eines cholerischen Bauern, der offensichtlich tierisch frustriert war, wahrscheinlich schon drei Jahre nicht mehr aus seiner speckigen Weste und seinen stinkenden Gummistiefeln herausgekommen war und jetzt einfach nur Ärger machen wollte.
Manuel lächelte beschwichtigend und sagte: »Oh, das tut mir leid! Ist das hier ein Privatgrundstück? Das habe ich nicht gewusst. Bitte entschuldigen Sie vielmals. Natürlich werde ich sofort weiterfahren, wenn Sie dies wünschen.«
Damit nahm er dem tobenden Bauern jeglichen Wind aus den Segeln. Dieser wusste so schnell gar nicht, was er sagen sollte, sondern schnaufte nur.
»Stand hier irgendwo ein Schild?«, redete Manuel weiter. »Das hab ich gar nicht gesehen. Gott, wie peinlich. Aber keine Sorge, in zehn Minuten bin ich weg.«
»Schon gut«, murmelte der Bauer, »ich mein ja nur. Kann ja nicht jeder, wie er will. Und wenn hier alle parken, wo kommen wir denn da hin?«
»Ja, da haben Sie recht. Es tut mir wirklich leid.«
Manuel knallte die Tür zu.
»Was für ein Arschloch!«, zischte er durch die Zähne, raufte sich die fettigen Haare und schlug mit der Faust auf den Beifahrersitz. »Komm her! Trau dich noch einmal hier rein, und ich schlag dir alle Zähne aus, du widerlicher, kleiner Schleimscheißer!«
Gestern Abend war er in unmittelbarer Nähe über eine kleine Brücke gefahren und hatte eigentlich vorgehabt, sich zu rasieren und im Flüsschen ausgiebig zu waschen, vielleicht auch ein paar T-Shirts im fließenden Wasser durchzuspülen. Aber das wurde ja nun nichts, weil dieser Kotzbrocken da draußen nicht ertrug, wenn jemand ein paar Stunden auf seinem ungenutzten, festgetretenen, vertrockneten Acker parkte. Was für ein dämliches Spießerarschloch.
Er gurgelte kurz, klappte sein Bett hoch, wobei er aufpasste, dass er Toni dabei nicht aus Versehen zerquetschte, und registrierte, dass der vorbeirasende Verkehr auf der Bundesstraße eigentlich unerträglich war.
Toni kam und schmiegte sich zwischen seine Oberschenkel. Er streichelte ihren Kopf.
Auf der Fahrt in die Toskana würde er sich Zeit lassen. Es war nicht eilig. In seinem Leben war überhaupt nie etwas eilig.
Bis auf das dämliche Frage-und-Antwort-Spielchen mit der Tante-Erika-Scheiße für eine Illustrierte. Jede Woche nervte ihn seine Redakteurin Iris mit Leserfragen, die er beantworten sollte. Immer ganz eilig, immer in allerletzter Minute. In dieser Redaktion ging es ständig um Leben und Tod. Es hing ihm zum Hals heraus, er konnte es kaum ertragen, aber er verdiente damit seinen Lebensunterhalt. Das bisschen, das er in seinem Wohnwagen zum Leben brauchte, sprang dabei heraus, dass er Tante Erika war und Fragen beantwortete wie: »Vor zwei Jahren hatte ich eine Totaloperation. Seitdem will mein Mann keinen Sex mehr mit mir. Was soll ich tun?« Oder: »Mein Mann ist ein Tyrann, er quält und schlägt mich, aber droht mit Selbstmord, wenn ich ihn verlasse …«
Manuel seufzte. Anfang nächster Woche würde Iris wieder anrufen.
Aber immerhin war er frei. Konnte sich aufhalten, wo er wollte, Hauptsache, er hatte Internet und einen Telefonempfang, damit die liebe Iris nicht verrückt spielte und er zu den Leserproblemchen seinen Senf dazugeben konnte.
Rina Kramer lief ihm nicht weg. Auf ihrer Homepage hatte sie geschrieben, dass sie sich darauf freute, nach ihrer letzten Lesung wieder nach Italien zu fahren und einen neuen Roman zu beginnen. Wie schön. Er würde da sein, aber es kam nicht auf zwei oder drei Tage an.
Sein Leben war dabei, sich zu verändern. Das spürte er.
Er setzte Toni auf die Sitzbank am Tisch.
Dann öffnete er den Kühlschrank, nahm sich eine Flasche Wasser, einen Energydrink, eine Mini-Salami und einen Apfel heraus, spülte den Apfel kurz unter fließendem Wasser ab, trocknete ihn, schmiss die Kühlschranktür mit einem kurzen Tritt zu, setzte sich ans Steuer und fuhr los.
5
Nach zwölf Stunden Fahrt erreichten sieStradella, ihren Landsitz in der Toskana. Rina hatte jeden Augenblick ihrer Lesereise genossen, aber jetzt war sie glücklich, wieder zu Hause zu sein. Endlich Ruhe. Frieden. Zeit, über einen neuen Roman nachzudenken.
Eckart war während der gesamten Fahrt sehr schweigsam gewesen, hatte, wenn Rina fuhr, Zeitung gelesen oder geschlafen. Miteinander geredet hatten sie so gut wie gar nicht, aber vielleicht gab es auch nicht mehr viel zu sagen. Die Situation war, wie sie war. Eckart würde in einer Woche nach Paris fliegen, dort eine Fernsehserie drehen und mit Anja, seiner Regieassistentin und Geliebten, zusammen sein.
Und sie würde aufStradellavielleicht wieder anfangen zu schreiben und mit Fabian, ihrem elfjährigen Sohn, den Sommer genießen. Wenn Eckart nicht dabei war, war er selber schuld. Eckart war mittlerweile verdammt selten da, wenn Fabian in den Oster-, Sommer-, Herbst- oder Weihnachtsferien nach Hause kam. Ständig kam irgendein Dreh dazwischen, und der Job war ihm immer wichtiger als Fabians Ferien.
Fabian ging auf ein exklusives Internat in Mecklenburg-Vorpommern an der Müritz, das er heiß und innig liebte.Dort hatte er jede Menge Freunde und Freundinnen, die Möglichkeit zu segeln, Tennis zu spielen, zu schwimmen, und er spielte in einer Band. Zurzeit war er wie immer in der ersten Ferienwoche zu Besuch bei seiner Oma in Rosenheim, aber in einigen Tagen würde er kommen. Wenn das Internet funktionierte, wollte sie gleich heute nachsehen, wann ein passender Zug von München nach Florenz fuhr.
Eckart saß am Steuer, und Rina drückte auf die Fernbedienung, sodass sich das videoüberwachte, hohe und schmiedeeiserne Tor wie durch Geisterhand öffnete und hinter ihnen automatisch wieder schloss.
Sie fuhren den gewundenen Schotterweg hinauf zum Haupthaus, das beinah bescheiden zwischen Zypressen und hinter Rosmarin-, Lavendel- und Hibiskushecken auftauchte.
Zu Hause, dachte Rina, endlich wieder zu Hause. Soll Eckart doch durch die Gegend jetten und reihenweise Frauen vernaschen, es ist mir egal, hier ist mein Nest, hier bringt mich niemand aus der Ruhe, hier fühle ich mich sicher und geborgen.
Eckart fuhr langsam, sah nach rechts und links, hielt am Sicherungskasten, und seine Miene verfinsterte sich immer mehr.
»Ich müsste mindestens einen Monat mähen, um alles in Ordnung zu bringen«, sagte er. »Ein Wahnsinn. Es macht einen fertig. Ich komme hier an und sehe nur Arbeit.«
»Ja, das müsstest du. Das wäre schön. Wir ersticken in der Wildnis.«
»Dann engagiere jemanden. Wird ja wohl möglich sein. Es ist wichtiger, dass ich einen Film drehe, als hier Hilfsarbeiten zu verrichten.«
»Natürlich«, sagte sie und hoffte, dass es nicht ironisch klang.
Der Anblick deprimierte sie auch. Das Unkraut war hochgeschossen, der Pool veralgt und grün. Sie wusste, dass sie nicht schreiben konnte, wenn um sie herum das Chaos tobte.
Aber Eckart blieb ja noch eine Woche. Vielleicht konnte er doch das eine oder andere in Ordnung bringen. Auch wenn er keine Lust dazu hatte.
Sie stieg die toskanische Außentreppe hinauf bis auf den Portico und hielt einen Moment inne. Der Blick über die bewaldeten Hügel der Toskana und kleine, mittelalterliche Dörfer bis nach Siena war einfach überwältigend und versetzte ihr einen Stich. Es ist so wunderschön, dachte sie, und ich darf hier wohnen. Glücklicher konnte man eigentlich nichtsein.
Dann schloss sie die Tür zur riesigen Wohnküche, dem Zentrum des Hauses, auf.
Obwohl sie nur drei Wochen weg gewesen war, roch es im Haus muffig und feucht und nach verfaultem Knoblauch.
Rina riss alle Fenster und Türen auf und befühlte jede Knoblauchknolle der Zöpfe, die vor dem Fenster hingen. Die stinkenden, weichen warf sie in den Abfall, auch eine Zitrone war grün verschimmelt.
Dann öffnete sie eine Flasche Wein.
»Setz dich zu mir«, sagte sie, als Eckart mit seinem Koffer nach oben in die Küche kam, »lass uns erst einmal anstoßen. Ist es nicht schön, dass wir beide zusammen hier sind? So etwas ist verdammt selten geworden.«
»Ja«, sagte er. Mehr nicht.
»Du arbeitest einfach zu viel.«
»Bitte, fang nicht wieder damit an.«
Sie schwieg und bemerkte, wie steif und verkrampft er auf dem Stuhl saß.Stradellawar schon lange nicht mehr sein Lebensmittelpunkt. In Gedanken war er irgendwo in der Welt zu Hause, und sie wusste nicht, wo. Er war ihr entglitten.
»Hast du Hunger?«, fragte sie.
Er schüttelte den Kopf.
»Soll ich uns Spaghetti kochen?«
Jetzt nickte er.
Sie versuchte, den Geruch von verfaultem Knoblauch, der immer noch in der Küche hing, zu ignorieren und begann, aus den vorhandenen, mageren Vorräten irgendein Essen zu kreieren.
Eckart stand auf dem Portico, hatte die Hände in den Hosentaschen und sah, wie die Sonne hinter den Bergen versank.
»Was denkst du?«, fragte sie laut, damit er sie draußen hörte.
»Nichts.«
Er starrte in die Ferne, und sie fragte sich, ob er an Anja dachte. Sich nach ihr sehnte und Paris nicht mehr erwarten konnte. Und kam sich vor wie eine Idiotin, die ihm Spaghetti kochte und versuchte, aus nichts eine Soße zu zaubern.
Das Handy klingelte.
»Pass mal auf die Nudeln auf, die sind jetzt zwei Minuten drin«, sagte Rina und nahm das Gespräch an. »Pronto? – Ach du bist es. Was gibt’s?«
Sie machte Eckart ein Zeichen, dass es ihre Mutter war, und ging mit dem Handy nach draußen, wo sie einen besseren Empfang hatte.
Die Spaghetti waren längst fertig, als Rina wieder hereinkam. »Meine Mutter hat erzählt, dass sie heute Nachmittag mit Pater Johannes Kaffee getrunken hat. Sie hat ihm gesagt, dass Fabian in diesen Tagen mit dem Zug zu uns nach Italien kommen will. Und da meinte Pater Johannes, dass er und Bruder Sebastian morgen nach Rom fahren. Mit lauter Firmlingen, alles Jungs, in einem Kleinbus. Bestimmt ’ne fröhliche Truppe. Für Fabian wäre es doch toll, wenn er mitführe, und auf dem Rückweg bringt Pater Johannes ihn dann hier bei uns vorbei. Das ist für ihn kein großer Umweg, da sie ohnehin über Siena nach Hause fahren. Ich finde die Idee klasse, viel besser, als wenn Fabian stundenlang allein im Zug hockt. Außerdem kommt er mal nach Rom. Das ist doch super!«
»Ich dachte, du hättest schon längst für ihn gebucht? Ich bin davon ausgegangen, dass er fliegt.«
»Nein, das hab ich bewusst nicht gemacht, weil wir noch nicht wussten, ob wir nicht noch zwei oder drei Tage länger in Deutschland bleiben, wie du dich vielleicht erinnerst«, antwortete sie scharf. »Wir wollten ja eventuell noch kurz an die Ostsee fahren.« Er wusste dies alles ganz genau, aber machte ihr dennoch durch die Blume einen Vorwurf, und natürlich antwortete er jetzt nicht.
»Ich hab meiner Mutter gesagt, sie soll Fabian ruhig mitschicken«, sagte sie, während sie die Tomatensoße aufkochte.
»Himmel, was soll das? Ein Flug wäre wesentlich einfacher, geht schneller und ist viel weniger gefährlich. Jetzt bin ich hier. Er könnte schon morgen kommen. Oder übermorgen. Aber nein – er muss erst diesen blöden Trip nach Rom machen, und ich sehe ihn noch kürzer. Sag deiner Mutter, dass es Blödsinn ist.«
»Dass du nur so wenig Zeit für ihn hast, ist nicht seine Schuld, sondern deine. Und mal nach Rom zu kommen ist eine einmalige Chance. Ich glaube, sie haben sogar eine Papstaudienz.«
»Verschone mich mit diesem ganzen Humbug. Er fährt mit Firmlingen, die er nicht kennt. Mit einem Popen, den ich nicht kenne und dem ich grundsätzlich nicht über den Weg traue. Oder kennst du ihn gut?«
»Nein, aber …«
»Was aber?«
»Nach allem, was ich von meiner Mutter gehört habe, ist er okay. Wirklich ein netter Mensch.«
Eckart schnaufte. »Ich finde die ganze Aktion nicht nötig, umständlich, langwierig und bescheuert. Sag sie ab.«
»Ich hab sie aber schon zugesagt und mach mich nicht zum Affen. Wenn, dann sag du ab. Du bist nur ein paar Tage im Jahr hier, und alles muss nach deiner Pfeife tanzen. Das kann es ja wohl nicht sein. Aber bitte: Ruf an und erkläre meiner Mutter und Fabian, warum er nicht mit dieser Gruppe nach Rom fahren darf. Ich bin sicher, er freut sich drauf. Aber gut, mach es. Ich mach es nicht. Ich bin raus aus der Nummer.«
Eckart verstummte. »Wie mir das alles auf die Nerven geht. Dieser ganze katholische Zirkus.«
»Das ist kein Zirkus. Da fahren ein paar Jungen nach Rom. Zur Papstaudienz. Und das ist sicher ein ganz besonderes Erlebnis. Schon allein in Rom zu sein ist ein besonderes Erlebnis. Ich weiß wirklich nicht, was du hast. Ich glaube echt, du spinnst ein bisschen und siehst Gespenster, wo gar keine sind.«
»Stimmt. Fabian hatte für diesen ganzen Budenzauber, bunte Gewänder und das ganze Trallala schon immer was übrig.«
»Lass ihn doch. Schadet ja nicht.«
Eckart schwieg. Die Diskussion war für ihn beendet. Er schien beleidigt zu sein, machte aber auch keine Anstalten, Oma Martha anzurufen und die ganze Aktion abzublasen.
Rina wusste, dass es jetzt verdammt gefährlich war, ihn anzusprechen. Es konnte sein, dass er explodierte, aber sie tat es trotzdem.
»Fabian kommt dann also am Dienstag. Dann habt ihr ja auch noch einige Tage miteinander.«
»Wer weiß.« Er ging zum Herd und kostete die Soße. »Schmeckt langweilig. Früher hast du die irgendwie anders gemacht.«
Er warf den Löffel in die Spüle, trat wieder hinaus auf den Portico und sah in die Ferne.
»Vielleicht bin ich noch da, wenn Fabian kommt. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber eigentlich habe ich eine verfluchte Sehnsucht nach ihm.«
Rina schwieg.
Nach ihr hatte er keine Sehnsucht. Schon lange nicht mehr.
6
Heute war Fabians letzter Tag bei seiner Oma in Rosenheim.
Das Frühstück stand auf dem Tisch. Toast mit Nutella für Fabian und dazu eine große Tasse Kakao. Er konnte es gar nicht abwarten anzufangen, aber Oma war noch nicht so weit. Sie hielt inne, atmete tief durch, lächelte, drückte noch einmal Fabians Hand und sagte: »So, mein Lieber, guten Appetit.«
Jetzt endlich ging es los. Nutella gab es im Internat nur selten, weil die Erzieher sagten, es mache dick und dann könne man nicht mehr vernünftig Sport treiben, aber bei Oma Martha gab es immer Nutella, und so war das Frühstück für Fabian die schönste Mahlzeit des Tages.
»Was wollen wir denn heute machen, mein Schatz? Heute, an unserem letzten Tag?«, fragte Oma und biss in einen Toast mit Kräuterquark, der nach Knoblauch roch. Fabian versuchte, nicht in Omas Richtung zu atmen, damit ihm von dem Geruch nicht schlecht wurde.
»Ein bisschen am Computer spielen vormittags und dann am Inn angeln gehen«, sagte er.
»Gut. Das machen wir.«
Oma goss sich Kaffee ein, und Fabian trank vorsichtig seinen Kakao, um nicht zu kleckern, denn auf dem Tisch lag eine Decke, die Oma mit unzähligen winzigen Blümchen bestickt hatte, was Jahre gedauert haben musste. Ansonsten sah die Wohnung aus wie eine Devotionalienhandlung, was er ungeheuer schön und aufregend fand. Es war so anders als bei seinen Eltern. Überall glitzerte und blinkte es, hingen funkelnde Rosenkränze und in Gold gerahmte Heiligenbildchen. Auf der Anrichte und in Regalen des Einbauschrankes im Wohnzimmer standen halb heruntergebrannte Osterkerzen der vergangenen zehn Jahre, große, kleine, dicke und dünne mit goldenen Jahreszahlen.
»Warum hast du hier die ganzen Kerzen und brennst sie nicht ab?«, fragte Fabian.
Martha sah ihn lange schweigend an und sagte dann: »Ich finde es traurig, wenn Kerzen brennen und ich allein bin. Das ist schwer auszuhalten. Da lass ich sie lieber aus. Und ich bin fast immer allein, verstehst du?«
Fabian nickte und sah auf seinen Teller.
»Es ist besser, der Fernseher läuft, wenn man allein ist.«
Fabian nickte erneut. Das konnte er gut verstehen.
Zu Weihnachten hatte er seiner Oma auch mal einen kleinen Rosenkranz aus weißen unechten Perlen geschenkt, den Martha ganz besonders in Ehren hielt und immer wieder sagte, dass er ihr schönster sei.
Aber Marthas ganzer Stolz war eine circa dreißig Zentimeter große, geschnitzte und bemalte Madonna, die im Sonnenlicht golden glänzte. Ihr hatte Martha ihren wertvollsten Rosenkranz aus Alabaster um den Hals gehängt. Sie hatte einen Extraplatz in einer kleinen Wandnische, und vor ihr stand jeden Tag ein kleiner Strauß frischer Blumen.
Fabian fand sie unglaublich schön. »Wenn du mal tot bist, will ich die Madonna erben«, hatte Fabian vor ein paar Jahren zu seiner Oma gesagt.
Diese hatte gelacht und gesagt: »Natürlich, mein Schatz, sie ist für dich. Ganz sicher.«
Doch dann wäre es beinah ganz anders gekommen.
Es passierte im April 2010. Fabian hatte Geburtstag, und Oma Martha war extra deswegen aus Rosenheim nach Buchholz in der Nordheide gekommen, wo die Familie Kramer damals noch wohnte.
Eckart ging dieser Besuch zwar fürchterlich auf die Nerven, aber er versuchte Fabian und Rina zuliebe das Beste daraus zu machen und gab sich Mühe, nicht mit Oma Martha zu streiten.
Da es Fabians größter Wunsch gewesen war, fuhr die Familie am Geburtstagsmorgen gemeinsam zum Heidepark, und Fabian konnte es kaum fassen, dass er einen ganzen Tag lang alle Karussells ausprobieren durfte und machen konnte, worauf er Lust hatte. Er wollte seinen Eltern und seiner Oma zeigen, wie mutig er war.
Am Vormittag saß er mit Oma in der Geisterbahn und schrie kein einziges Mal, obwohl er schreckliche Angst hatte, danach ließ er sich mit Papa von der Walzerbahn durch die Gegend wirbeln und aß seine geliebte Zuckerwatte.
Mittags gab es eine Bratwurst mit Brötchen, und dann ging es weiter.
»Was hältst du denn von dem Kettenkarussell?«, fragte Oma.
»Och nee«, meinte Fabian, denn es machte einen schrecklich langweiligen Eindruck.
»In meiner Jugend war es für mich immer das Allerschönste. Man fliegt so schön … es ist unbeschreiblich«, entgegnete Oma. »Willst du es nicht doch mal ausprobieren, wenn du es noch nie erlebt hast?«
Nur ihr zuliebe sagte Fabian schließlich: »Na gut, meinetwegen. Machst du mit?«
»Ich kann das nicht mehr aushalten«, sagte Oma. »Aber fahr doch allein. Das ist richtig toll.«
Fabian nickte, und Oma setzte ihn in einen Sitz, kontrollierte den Sicherheitsbügel vor Fabians Bauch, stieg vom Rondell, und nach einer halben Minute ging es los. Dazu plärrte laut der Schlager »Blue Bayou«.
Fabians Eltern und Oma sahen lächelnd zu, wie das Karussell Fahrt aufnahm, sich immer schneller drehte und die Kettensitze immer höher flogen.
Eckart stand neben seiner Frau, legte beide Hände auf ihre Schultern und drückte ihr einen Kuss auf den Scheitel.
Es war später nicht mehr zu ermitteln, ob sich der Sicherheitsbügel von allein gelöst, ob Oma den Verschluss wirklich richtig geschlossen oder ob Fabian ihn unbewusst oder bewusst aufgefummelt hatte.
Jedenfalls sah Oma Martha, wie sich ihr kleiner zarter Enkel in der Luft und völlig unerklärlich aus seinem Sitz löste. Kein Gurt, kein Sicherheitsbügel schienen ihn aufzuhalten, er rutschte immer weiter vor, konnte sich nicht mehr halten und flog aus dem Karussell.
Es war so unwirklich. Sie glaubte, seine blonden Haare im Wind wehen und ihn lachen zu sehen auf seinem Flug in dieUnendlichkeit.
Schreie brachten sie zurück in die Realität.
Fünf Meter entfernt war Fabian zu Boden gestürzt, vor das Kassenhäuschen eines Autoscooters. Menschen schrien. Die Musik verstummte. Das Kettenkarussell hörte unendlich langsam, viel zu langsam auf sich zu drehen. Martha und die Eltern liefen dorthin, wo sich augenblicklich eine Menschentraube bildete.
Er lag da. Einfach so. Wie ein Dummy, den man zu Versuchszwecken in die Luft geschleudert hatte, dem aber nichts passiert war. So unversehrt sah er aus.
Martha war unglaublich erleichtert.
Aber dann sah sie Blut aus Fabians Ohren fließen. Und hörte ihre Tochter schreien.
Rina schrie in Panik, wie eine Wahnsinnige.
Oma Martha liefen die Tränen übers Gesicht.
Sie hatte Fabian zum Geburtstag den Ausflug in den Heidepark geschenkt. Sie hatte ihn zum Kettenkarussell überredet. Sie war schuld. Nie würde sie darüber hinwegkommen.
Oma Martha registrierte nur am Rande, wie Eckart Rina in die Arme nahm. »Der Notarzt ist unterwegs«, hauchte er, und dann kniete er sich hin und streichelte den aus den Ohren blutenden Dummy.
Martha sah seine Tränen auf Fabians T-Shirt tropfen.
Rina blieb stehen. Kniete sich nicht hin, hatte Angst, ihren Sohn zu berühren.
»Der Junge hat ein Schädelhirntrauma«, hörte Oma Martha wie im Nebel, und dass eine Operation unbedingt nötig sei.
Dann brach sie zusammen.
Erst zwei Tage später setzte ihre Erinnerung wieder ein. Schemen- und bruchstückhaft.
Sie sah sich Stunden und Tage auf dem Krankenhausflur sitzen und warten. Fabian war auf der Intensivstation, und nur hin und wieder konnten sie zu ihm.
Es machte ihr nichts aus zu warten, nur so war sie ihrem Enkel wenigstens ein bisschen nah.
Wenn Eckart auftauchte, ging sie in die Krankenhauskapelle, um zu beten und eine Kerze zu spenden.
Sie spürte, dass es Eckart auf die Nerven ging.
Wenn sie wiederkam, war sein Blick voller Hass.
Und sie wusste, dass er ihr an allem die Schuld gab.
Fabian kämpfte wochenlang mit dem Tod. Dann fand er langsam ins Leben zurück, und fast genau ein Jahr später fing er zum ersten Mal wieder an zu sprechen.
7
Das Frühstücksgeschirr war abgeräumt und gespült, und Fabian machte gerade Computerspiele, als Martha ins Wohnzimmer kam.
»Ich muss noch mal kurz los, was erledigen«, sagte sie.
»Ja, klar, kein Problem«, murmelte Fabian, ohne den Kopfzu heben.
»Bin bestimmt in ’ner Stunde oder anderthalb zurück.«
»Wo gehst du denn hin?«
»Ich muss noch mal mit Pater Johannes reden. Wegen eurer Reise morgen.«
»Ach so.«
»Mach keine Dummheiten, Schatz, ja?«
»Nee, mach ich nicht.«
»Bis bald. Nachher packen wir deine Sachen zusammen.«
»Ja ja.«
Sie spürte, dass sie störte. Fabian war auf sein Spiel konzentriert und hörte gar nicht richtig zu.
Leise schloss sie die Wohnzimmertür.
Bis zum Kloster lief sie zwanzig Minuten. Das kleine Franziskanerkloster war ein schmuckloser Stadtbau der Sechzigerjahre außerhalb der Altstadt, beherbergte lediglich sieben Mönche und wirkte wie ein unscheinbares zweistöckiges Wohnhaus.
Martha klingelte.
Nach einer Weile meldete sich Bruder Daniel über die schnarrende Gegensprechanlage. Sie kannte ihn gut. Er hatte Arthrose in beiden Knien, konnte sich keinen Schritt mehr schmerzfrei bewegen, saß daher von morgens um acht bis abends um acht an der Pforte und nahm jedes Jahr vier Kilo zu.
»Grüß Gott, hier ist Martha Kasinsky«, sagte sie etwas zu laut ins Mikro, weil sie Angst hatte, dass Bruder Daniel sie nicht verstehen würde, »ich würde gern mit Pater Johannes sprechen. Das heißt, ich muss ihn sprechen! Es ist sehr wichtig!«
»Pater Johannes ist nicht da.«
»Wann kommt er denn wieder?«
»Ich weiß es nicht.«
»Noch heute Vormittag?«
»Ich denke schon. Mittagessen wollen sie alle.« Bruder Daniel lachte glucksend.
»Kann ich hier auf ihn warten?«
»Bitte.«
Der Türöffner schnarrte, und Martha betrat das Kloster.