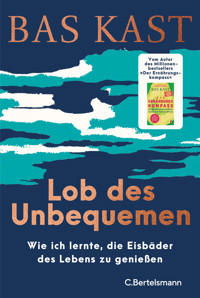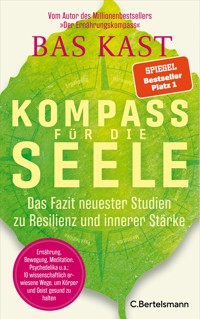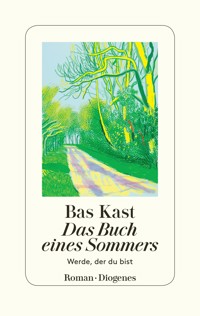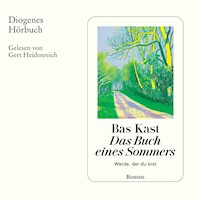9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
**Bestsellerautor Bas Kast über Kreativität, Inspiration und Innovation – denn gute Ideen sind mehr als Geistesblitze!** Kreativ kann jeder! Kreativ, das ist man oder ist es nicht. Kreativ sind Genies und Designer mit Hornbrillen. Stimmt das? Bas Kast hat sich auf den Weg gemacht und selbst nachgeforscht. In Theorie und Praxis. Er hat den Stand der Wissenschaft und die neuesten Erkenntnisse aus kognitiver Psychologie und Hirnforschung ausgewertet und die vielversprechendsten Methoden selbst überprüft. Er hat sich als Versuchskaninchen zur Verfügung gestellt, sich Datenbrillen aufgesetzt, sein Gehirn verkabeln lassen, sich in virtuelle Welten verirrt und sein Brot andersherum geschmiert. So ist ein ungemein lebendiges Wissenschaftsbuch entstanden, das die Tipps und Tricks der Kreativitätsgurus hinterfragt und uns Werkzeuge an die Hand gibt, um unsere ganz individuelle Kreativität zu entdecken. ... dann macht es plötzlich KLICK!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Bas Kast
Und plötzlich macht es KLICK!
Das Handwerk der Kreativität oder wie die guten Ideen in den Kopf kommen
Über dieses Buch
Wie kommt es, dass manche einfallsreicher sind als andere? Ist Kreativität eine besondere Gabe? Wie lassen sich unsere kreativen Kräfte im Alltag entfesseln?
Lange Zeit galt die Kreativitätsforschung als ein Randgebiet der Wissenschaft. Erst seit wenigen Jahren nehmen Kognitions- und Hirnforscher den schöpferischen Prozess genauer unter die Lupe. Ihre Erkenntnisse haben zu einem neuen Verständnis davon geführt, wie die guten Ideen in unseren Kopf kommen. Der Psychologe und Bestsellerautor Bas Kast hat sich für dieses Buch auf die Suche gemacht und die Erfolgsfaktoren der Kreativität gesammelt. Er hat Dutzende von Studien ausgewertet, er ist zu Forschungsstätten gepilgert, hat mit Wissenschaftlern gesprochen, er hat Linguisten, Architektinnen und Komponisten kontaktiert und sich als Versuchskaninchen zur Verfügung gestellt. Er hat meditiert, hyperventiliert, assoziiert, er hat sein Gehirn verkabeln lassen und sein Brot andersherum geschmiert. Um die Laborbefunde einem Praxis-Tauglichkeitstest zu unterziehen, stellt Bas Kast sie in Zusammenhang mit dem Werde-
gang, den Arbeitsweisen oder den entscheidenden Aha-Momenten hochkreativer Menschen der Geschichte und Gegenwart, von Beethoven bis Joanne K. Rowling, von Einstein bis Mark Zuckerberg. Herausgekommen ist ein lebensnahes, inspirierendes Wissenschaftsbuch, das am Ende auch den Weg aufzeigt, die eigene,
ganz individuelle Kreativität aufzuspüren.
»Kast gelingt es vorzüglich, die Ergebnisse
der Wissenschaft in eine anschauliche und gut
verständliche Sprache zu übersetzen.« dpa
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2015 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Schiller Design, Frankfurt
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402912-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Einführung: Gute Ideen sind mehr als Geistesblitze
1 Das Ungewohnte beflügelt die Phantasie
Eine Cafeteria mit schockierendem Angebot
Kreativer frühstücken
Kafka schärft den Verstand
Wie gegrillter Aal das Denken lockern kann
Zwei Sprachen, zwei Denkweisen
Ein dickes Adressbuch erhöht das Risiko für gute Einfälle
2 Mit der Entspannung kommen die Ideen
Im Meditationslabor
Ein Gorilla wird unsichtbar
Was Wodka, Schläfrigkeit und die Farbe Blau gemeinsam haben
Wenn das Gehirn offline geht, kommt die Phantasie in Fahrt
So arbeiten Genies
Je mehr Alpha, desto origineller der Einfall
Zu den Risiken und Nebenwirkungen der Ritalin-Gesellschaft
3 Über die lebenslange Lust an der Neugier
Kinder sind schöpferischer als Erwachsene – und umgekehrt
Vom Schüler zum Entdecker: Weniger Pädagogik ist mehr
Feynmans Vater oder Eine Erziehung zu eigenständigem Denken
Was einem verraten wird, kann man nicht mehr selbst herausfinden
Wer übt, begabt sich selber
4 Von der Gruppe zum kreativen Team
»In der Savanne gab es auch keine Stockwerke«
Ein Team von Stars ist nicht dasselbe wie ein Star-Team
Wie man den Gruppen-IQ steigert
Was tun mit Selbstdarstellern und Narzissten?
Gutes Brainstorming, schlechtes Brainstorming
Steve Jobs’ Ein-Klo-Prinzip
Sozialkompetente Gebäude
Vom Wert gemeinsamer Kaffee- und Bierpausen
Orte mit hohem Kreativitätsquotient
5 Wie Sie Ihre eigene kreative Nische entdecken
Genie – eine Sache von Talent oder Training?
Der weltberühmte Komponist, der keine Noten lesen kann
Was an kreativen Möglichkeiten in uns steckt, ist unvorhersagbar
Vom Rebhuhnjäger zum revolutionären Wissenschaftler
Woran erkenne ich, dass ich mein Ding gefunden habe?
Schnittstellen sind Hotspots für das Neue
In der Nische wirst du, wer du bist
Literatur
Bildnachweis
Danksagung
Einführung: Gute Ideen sind mehr als Geistesblitze
Es war ein Februarnachmittag 2013, ich stand in einem Laborraum der Universität Nimwegen, als es bei mir klick! machte. Ein Computerprogrammierer vom benachbarten Max-Planck-Institut hatte mir soeben seine 30000-Euro-Datenbrille über den Kopf gestülpt. Ein Knopfdruck, und ich würde in eine andere Welt katapultiert werden. Eine Welt, die eigens dazu geschaffen worden war, meine allzu eingefahrenen, starren Denkstrukturen aufzulockern.
Eine junge deutsche Forscherin – Sie werden sie gleich im ersten Kapitel kennenlernen – hatte verkündet, dass sich gute Ideen gezielt hervorbringen lassen. Nicht durch irgendein mystisches Verfahren, eine esoterische Reise ins Ich, sondern mit Hilfe von Technik und Wissenschaft. Ihre Hypothese: Die Routinen des Alltags, die unser Leben beherrschen, lullen das Gehirn ein. Damit wir wieder mit frischem Blick auf die Welt sehen, müssen wir unser Gehirn in Situationen versetzen, in denen es mit seinem Latein am Ende ist. Man muss das Gehirn schockieren. Die Erschütterung regt dazu an, neu zu denken, anders als zuvor, jenseits unserer alten, verkrusteten Konventionen. Wir werden, mit einem Wort, kreativer.
Ich war skeptisch. Eine Datenbrille, teurer als ein durchschnittlicher PKW, ein Laborraum gefüllt mit für das menschliche Auge unsichtbarem Infrarotlicht, und dann irgendwelche virtuelle Welten mit fliegenden Flaschen, in die ich eintauchen würde: Es klang alles ein bisschen zu sehr nach einer Mischung aus Science-Fiction und jenem hartnäckigen Mythos, demzufolge wir nur zehn Prozent unseres Gehirnpotentials nutzen, und jetzt hätte jemand einen wundersamen Weg gefunden, den schlummernden Rest aus seinem Dornröschenschlaf zu wecken.
Ich zweifelte, kannte aber den Chef des Labors, Ap Dijksterhuis, eine Koryphäe der modernen psychologischen Forschung. Ich hatte ihn vor Jahren einmal besucht, nachdem er im angesehenen US-Wissenschaftsmagazin Science erstmals experimentelle Belege dafür präsentiert hatte, dass auch das Unbewusste denken kann, teils sogar besser als der bewusste Verstand.[1] Also hatte ich mich ins Auto gesetzt und war nach Nimwegen gefahren.
Ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht, aber mit dieser harmlosen Fahrt hatte ich mich auf eine Reise begeben, von der ich erst Monate später zurückkehren sollte – ja, ich verwickelte mich in eine Recherche, die mich von einer Forschungsstation und Fragestellung zur nächsten führte. Denn was ich in dem Labor vorfand, war nicht nur eine bizarre virtuelle Welt, in der Flaschen fliegen können und Koffer verschwinden, wenn man ihnen zu nahe kommt. Nein, ich stieß auf etwas weitaus Faszinierenderes: Ich entdeckte eine vollkommen neue Perspektive auf ein uraltes Rätsel – das Rätsel der menschlichen Kreativität.
Wie kommen wir auf gute, originelle, auf kreative Ideen? Wer sich für diese Frage interessiert, und zwar auf eine handfeste Weise, der sieht sich mit einem erschlagenden Überangebot von Tipps und Tricks, von Ratschlägen, Büchern, Kreativitätsseminaren und Innovationsworkshops konfrontiert.
Beißt man sich ein wenig durch dieses bunte Büfett hindurch, wird bald klar, dass die Grundingredienz nahezu immer die gleiche ist: Irgendjemand, ein Experte, Coach oder Guru, hat einen Algorithmus, einen Fünfpunkteplan, kurz eine »Kreativitätstechnik« mit meist exotisch-eindrucksvollem Namen in petto, die uns mehr oder weniger im Handumdrehen in die Lage versetzen soll, um die Ecke zu denken. Kreativität wird dabei fast als etwas Mechanisches dargestellt, wie die Arbeit in einer Werkstatt, und was uns fehlt – nicht aber dem Guru, praktischerweise –, ist das richtige geistige Werkzeug. Manche empfehlen zum Beispiel, sich in kleinen Gruppen verschiedenfarbige Hüte aufzusetzen (die sogenannten Denkhüte von De Bono), viele schwören aufs Brainstorming, andere aufs Mindmapping, auf die Morphologische Matrix, die Reizwortanalyse, die Osborn-Checkliste, die Methode 635, die Kopfstandtechnik, die Walt-Disney-Methode oder eine Synektik-Sitzung.
Ich bin kein militanter Gegner dieser Vorschläge. Ganz im Gegenteil glaube ich, dass es ausgesprochen gewinnbringend sein kann, Kreativität als eine Art Handwerk zu verstehen, das sich bis zu einem gewissen Grad – wenn auch aus meiner Sicht indirekt – erlernen lässt. Das Problem dieser »Werkzeuge« ist ein anderes. Erstens fällt auf, dass die allermeisten bahnbrechenden Ideen, originellen Schöpfungen und Erfindungen der Geschichte nicht mit Hilfe irgendeiner dieser Verfahren hervorgebracht wurden, polemisch ausgedrückt: Beethovens Neunte war nicht das wohlklingende Resultat einer Synektik-Sitzung. Im wirklichen Leben scheint die Geburt des Neuen nach ganz anderen Spielregeln abzulaufen, als es diese Methoden suggerieren. Sollte uns das nicht zumindest zu denken geben?
Das aber ist noch nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist: Letztlich weiß niemand, was diese Techniken taugen. Ihre Erfinder haben sich nie die Mühe gemacht, ihre Wirksamkeit einer objektiven Prüfung zu unterziehen. Dort, wo Forscher dies für sie getan haben, am rigorosesten beim Brainstorming, fallen die Ergebnisse, vorsichtig formuliert, durchwachsen aus – mehr dazu in Kapitel 4. Die Wirksamkeit der herkömmlichen »Kreativitätstechniken« ist im Großen und Ganzen nicht erwiesen. Trotzdem erfreuen sie sich einer erstaunlichen Popularität.
Man könnte versucht sein, dieses Missverhältnis mit einer eigentümlichen Ignoranz der Beteiligten zu erklären. Doch es ist viel einfacher: Es liegt vor allem daran, dass lange Zeit schlicht keine Alternativen in Sicht waren. Wer sich dem schöpferischen Prozess nüchtern-sachlich nähern wollte (und nicht bereit war, sich einen Stereokopfhörer mit epileptisch anmutenden – »binauralen« – Klängen aufzusetzen, um einen okkulten Trip zum inneren Künstler anzutreten), dem blieb wohl oder übel wenig anderes übrig, als sich jenen »Kreativitätstechniken« zuzuwenden.
Diese Situation hat sich radikal geändert. In den vergangenen Jahren hat sich auch die Wissenschaft dem rätselhaften, schwer zu messenden Phänomen der Kreativität zugewandt, und zwar in nie zuvor gekanntem Ausmaß.
Schon im 20. Jahrhundert gab es die ersten Bemühungen in diese Richtung, angefangen übrigens in den 1930er Jahren in Deutschland, unter anderem mit dem Berliner Psychologen Karl Duncker – seinem berühmten »Kerzenproblem« können Sie sich auf Seite 43 stellen. Mit der Etablierung der Kognitions- und Neurowissenschaften rückte die Kreativität dann von einem nicht ganz erstgenommenen Außenseiterthema zunehmend ins Zentrum der psychologischen Forschung. Dieser Trend hält bis heute an: Die meisten maßgeblichen Studien, die dieses Buch prägen, stammen aus den letzten drei, vier Jahren.
Das Erblühen dieser Forschung hat nicht nur zu einem neuen Verständnis von Kreativität geführt. Aus den mittlerweile unzähligen Einzelbefunden lassen sich auch erstmals empirisch überprüfbare Grundfaktoren des schöpferischen Denkens herauskristallisieren, »Erfolgszutaten der Kreativität«, wenn man so will, die ihre Wirkung unter Beweis gestellt haben.
Für dieses Buch habe ich diese Erfolgsfaktoren gesammelt und zusammengefasst. Nachdem ich einigermaßen unversehrt wieder aus Nimwegen zurückgekehrt war, habe ich mich in Dutzende und Aberdutzende von wissenschaftlichen Studien vertieft. Es erscheinen wöchentlich neue, und manche sind überzeugender als andere. Die schiere Fülle ermöglicht eine strenge Auswahl. So habe ich einen Großteil der Studien verworfen, sei es, weil sie lediglich von rein theoretischem Interesse waren oder weil die Ergebnisse (bisher) nicht bestätigt werden konnten, andere Untersuchungen wiederum waren methodisch oder inhaltlich nicht überzeugend. Dort, wo ich skeptisch war und bin und die Studie trotzdem beschreibe, werde ich diese Skepsis zum Ausdruck bringen.
Zum Glück jedoch war es nicht nur ein einsames Papierstudium, das ich betrieben habe. Ich bin zu Forschungsstätten gepilgert und habe mit den Experten diskutiert, in erster Linie Kognitionspsychologen und Hirnforschern (manche Frage führte aber auch dazu, dass ich mich an eine Linguistin, Architektin oder an einen Komponisten wenden musste). Wenn sich die Gelegenheit bot, habe ich mich den Wissenschaftlern als Versuchskaninchen zur Verfügung gestellt und an ihren Experimenten teilgenommen, um deren Effekte am eigenen Leib zu erleben – ich habe meditiert, hyperventiliert, mein Gehirn verkabeln lassen und sogar mein Brot andersherum geschmiert.
Nach und nach wurde mir vor Augen geführt, wie facettenreich und umfassend das Phänomen der Kreativität tatsächlich ist. Kreativität ist nicht etwas, das sich klischeehaft auf Künstler, Werbeleute und Designer mit dicken schwarzen Hornbrillen beschränkt. Wir sprechen von »kreativen Jobs« und »kreativen Köpfen« (vermutlich im Gegensatz zu all den vermeintlich unkreativen Jobs und den Holzköpfen, von denen es da draußen wimmelt) oder von »kreativen Hobbys«, womit wir typischerweise Aktivitäten meinen wie Malen, Basteln oder Fotografie. Dabei kann man so gut wie jeden Beruf und jedes Hobby mehr oder weniger kreativ ausüben. Wer eine Canon Eos Spiegelreflexkamera mit 50 Millimeter Festbrennweite in die Hand nimmt, ist nicht automatisch kreativ. Umgekehrt können eine Hausfrau, ein Sportler oder ein Steuerberater ebenfalls ungeheuer kreativ sein, auch wenn mein Steuerberater natürlich nicht dazugehört.
Gute Ideen sind kein Exklusivprivileg einiger weniger Ausnahmemenschen mit direktem Draht zu den Musen. Kreativ zu sein, ist eine Grundeigenschaft des Gehirns. Es gibt kein menschliches Gehirn, dem die schöpferischen Fähigkeiten, die Phantasie und der Einfallsreichtum völlig fehlen. Mit der Kreativität verhält es sich eher so wie mit dem Körpergewicht: Manche mögen ein paar Kilo mehr auf die Waage bringen als andere, aber es gibt keinen Menschen ohne Körpergewicht, und es handelt sich dabei auch nicht um eine ein für alle Mal fixierte Größe.
Dies ist die Grundannahme der Kreativitätswissenschaft, und sie wirft unweigerlich Fragen auf: Wenn Kreativität in jedem Gehirn angelegt ist, warum sind manche Menschen dann trotzdem einfallsreicher als andere? Entstehen schöpferische Leistungen hauptsächlich durch hartnäckiges Üben, aus Schweiß und fachlicher Expertise? Oder ist es umgekehrt: Sind wir als Kinder alle kreativ, werden dann aber Stück für Stück zum Konformismus erzogen? Und wenn ja, wie ließe sich gegensteuern? Was kann man tun, um die eigene Phantasie zu entfesseln?
Für die Beantwortung dieser und vieler weiterer Fragen werde ich mich zwar primär auf wissenschaftliche Untersuchungen stützen, die Wissenschaft ist aber nicht die einzige Erkenntnisquelle, die ich verwenden werde. Um die Laborbefunde gewissermaßen einem Praxistauglichkeitstest zu unterziehen, habe ich sie, wo immer es möglich war, mit Beobachtungen aus dem Leben abgeglichen, etwa mit Erkenntnissen über den Arbeitsstil hochkreativer Menschen. Ziel ist es, das wissenschaftlich Stichhaltige mit dem praktisch Umsetzbaren zu kombinieren.
Dazu ein Beispiel: Mehrere neue Experimente offenbaren, dass sich kreative Aha-Erlebnisse vor allem in jenen Momenten einstellen, in denen wir uns entspannen und mental loslassen. Unser Gehirn geht dann in einen ganz bestimmten Aktivitätsmodus über, einen »Offline-Modus«, den wir uns in Kapitel 2 noch genauer ansehen werden. In diesem neuronalen Bummelzustand, der unsere Gedanken auf eine spontane Wanderschaft schickt, greift unsere Phantasie Raum: Ungewöhnliche Assoziationen und Einfälle bekommen nun am ehesten eine Chance, in unserem Kopf aufzublitzen. Kein Wunder also, dass viele hochkreative Menschen aus den unterschiedlichsten Zeiten, Kulturen und Disziplinen – von Tschaikowski bis Haruki Murakami – häufig bewusst längere Pausen in ihren Arbeitsalltag eingebaut haben und einbauen, oft in Form eines (stundenlangen) Spaziergangs. Diese Pausen werden von ihnen als essentieller Teil der Arbeit verstanden. Sie sind tatsächlich eine »Kreativitätstechnik«, die auch Beethoven nutzte, und zwar täglich, und das aus guten Gründen.
In den ersten Kapiteln werde ich so die generellen »Gesetze« der Kreativität beleuchten, wie sie sich aus zahlreichen Tests und Einzelbeobachtungen destillieren lassen. Kreativität aber ist von ihrem Wesen her etwas höchst Individuelles. Sie manifestiert sich in jedem von uns auf einmalige Weise. Man kann den raffiniertesten Strategien folgen, die sich im Allgemeinen als noch so vielversprechend herausgestellt haben – sie werden nur begrenzt nützen, solange eine ausschlaggebende Zutat fehlt. Um uns über diesen Kreativitätsfaktor Klarheit zu verschaffen, werden wir zum Schluss einen Blick auf den Werdegang einiger besonders schöpferischer Menschen werfen: Wie haben sie zu ihren Höchstleistungen gefunden? Was können wir von ihren Erfolgsgeheimnissen lernen?
Sie werden sehen: Die kreativen Kräfte freizusetzen ist weit mehr als das Anwenden einer Technik, weit mehr auch als ein spontaner Geistesblitz. Es verlangt eine gewisse Experimentierfreude, die Bereitschaft, bis an die Grenzen der eigenen Fähigkeiten zu gehen und vielleicht noch einen Tick darüber hinaus (das heißt, die Bereitschaft, mit seinen Versuchen gelegentlich danebenzuliegen und zu scheitern). Wie sich das realisieren lässt und worin die entscheidende Kreativitätszutat genau besteht, das erfahren Sie im letzten Kapitel.
1Das Ungewohnte beflügelt die Phantasie
Eine Cafeteria mit schockierendem Angebot
Da stehe ich also, im Virtual-Reality-Labor der Universität Nimwegen, die Datenbrille auf dem Kopf. Der Computerprogrammierer Jeroen Derks vom benachbarten Max-Planck-Institut für Psycholinguistik dreht an einem Knopf, wodurch das Brillenungetüm, eine Art überdimensionierte Hightech-Skibrille, fester und fester um meinen Schädel gespannt wird. Dann erklärt er mir die Technik: Sechzehn Wärmelampen füllen den 8 mal 6 Meter großen Laborraum mit Infrarotlicht. Die Lampen fungieren zugleich als Kameras, die jede Lichtreflektion im Raum registrieren. Hinten an meiner Brille sind vier Reflektoren befestigt, die aussehen wie die Fühler von Biene Maja. Je nachdem, wo sich mein Kopf befindet und wie er sich neigt, senden die Reflektoren eine einmalige, positionsspezifische Lichtspiegelung an die Kameras.
Diese Daten wiederum werden an den Laptop weitergeleitet, den ich in einem Rucksack mit mir herumschleppe und der aus unerfindlichen Gründen mindestens zehn Kilo wiegt. Aufgrund der Lichtinformationen bestimmt die Laptopsoftware blitzschnell meine Kopfposition im Raum und überträgt die dazugehörigen Videobilder auf die zwei kleinen Displays der Datenbrille. Das Resultat: Vor meinen Augen erscheint eine verblüffend echt wirkende virtuelle Welt, dreidimensional und perfekt abgestimmt auf jede meiner Kopfbewegungen – schon ein geringfügiges Drehen, und das Bild dreht sich zeitgleich mit.
»Sind Sie bereit?«, fragt eine Frauenstimme. Es ist die Stimme von Simone Ritter.
Simone Ritter ist diejenige, die sich das Experiment, an dem ich gleich teilnehmen werde, ausgedacht hat. Vor zehn Jahren verschlug es die Psychologin nach Holland, eine deutsche Studentin auf der Flucht vor dem Numerus clausus. Inzwischen ist die junge Frau – sie ist 31 – Juniorprofessorin an der Universität Nimwegen. Ritters Forschungsmission besteht darin, herauszufinden, wie wir Menschen auf neue Ideen kommen. Wie gelingt es dem Gehirn, aus seinen herkömmlichen Denkmustern auszubrechen und ungewöhnlichere Einfälle als sonst hervorzubringen? Und vor allem: Lässt sich dieser Kreativprozess von außen anregen?
Einige Monate hatte Ritter vergeblich über Fragen wie diese gegrübelt, als ihr 2010 auf einem Kongress in Las Vegas, knapp 9000 Kilometer von der Heimat entfernt, plötzlich das Virtual-Reality-Labor ihrer Universität in den Sinn kam. Wieder zurück in Nimwegen, kontaktierte sie den Computerexperten Derks, und Ritter machte sich an die Arbeit. Sie entwarf einen Versuch mit dem Ziel, sich dem Mysterium des schöpferischen Denkens empirisch-experimentell zu nähern.
Jeroen Derks hat mich per Knopfdruck in eine Computersimulation der Uni-Cafeteria versetzt (das reale Vorbild befindet sich gleich um die Ecke). Ich wandere ziellos umher, sehe mich um. Zahlreiche Tische mit Stühlen. Links ein langer Holztisch mit Bierbänken, im Hintergrund die Theke mit Espressomaschine, rechts daneben ein Snackautomat.
Fast bin ich versucht, mir einen simulierten Cappuccino zu bestellen, da erblicke ich auf dem langen Holztisch einen Koffer, den ich mir genauer ansehen will. Komischerweise wird der Koffer, je mehr ich mich ihm nähere, immer kleiner. Als ich ganz nah bin und mir den Koffer schnappen möchte (er ist inzwischen auf die Größe eines Handys geschrumpft), verschwindet er. »Uups«, sage ich enttäuscht.
»Der ist ja auch nicht zum Mitnehmen da«, höre ich die Stimme von Jeroen Derks.
Gleich darauf geschieht wieder etwas Merkwürdiges: Bei jedem Schritt, den ich mache, fliegt der Raum an mir vorbei. Es ist, als sei ich in Siebenmeilenstiefel geschlüpft, und ich fege durch die Cafeteria.
Als Nächstes erscheint ein rotes Spielzeugauto auf dem Holztisch sowie, am Tischrand, eine grüne 7up-Flasche. Abermals gehe ich zum Tisch, woraufhin das Auto auf die Flasche zufährt und sie umstößt. Ich springe zur Flasche, will sie auffangen, die Flasche jedoch fällt nicht zu Boden, sondern steigt in die Luft wie ein Fesselballon, sie steigt und steigt – und stößt schließlich an die Decke, wo sie hängen bleibt. Ich starre auf die schwebende Flasche.
Was soll das?
»Na, wie fühlen Sie sich?«, fragt Simone Ritter.
Wie ich mich fühle? Schwer zu sagen. Wie in einem Traum? Wie Alice im Wunderland? Oder nein, eher wie in dem Film Inception des Regisseurs Christopher Nolan, in dem Leonardo DiCaprio durch eine Pariser Straße geht. Auf einmal bäumt sich das Ende der Straße hoch und bricht mitsamt den Häusern über Leonardo DiCaprio hinweg wie eine Meereswelle. Es ist ein Traum, ein virtuelles Paris. So ungefähr, schätze ich, fühle ich mich. Wie die Figur im Film.[1] Die Realität ist absurd und das Absurde auf unheimliche Weise real geworden, was den Realitätssinn verunsichert wie ein Erdbeben den Gleichgewichtssinn.
Oben: Zu Besuch im Virtual-Reality-Labor der Universität Nimwegen, im Hintergrund die Kreativitätsforscherin Simone Ritter und der Computerprogrammierer Jeroen Derks (an den schwarzen Stangen unten und oben an der Wand sind die Infrarotkameras befestigt). Unten die Simulationen, die ich in diesem Moment sehe.
Ich nehme die Datenbrille vom Kopf und bin zurück im kargen Laborraum. Simone Ritter blickt mich mit einer Begeisterung an, als hätte sie ihr Experiment zum ersten Mal vorgeführt. »Wären Sie eine echte Testperson, käme jetzt der entscheidende Teil«, sagt sie.
Ritter hat bereits Dutzende von Versuchskaninchen – Studenten der Universität Nimwegen – in der virtuellen Cafeteria umherwandern lassen. Eine Gruppe, die Kontrollgruppe, erkundete eine Cafeteriaversion, in der alles brav den Regeln der Physik gehorchte: Näherte man sich dem Koffer, wurde er optisch größer, nicht kleiner. Man ging nicht plötzlich wie mit Riesenschritten durch den Raum. Wurde eine Flasche umgestoßen, fiel sie ordnungsgemäß zu Boden, und auch sonst verhielt sich der Ort, wie es sich für eine Cafeteria gehört. So, wie man das von einer Uni-Cafeteria eben erwartet.
Eine andere Gruppe dagegen erlebte, wie ich, die Inception-Cafeteria, in der die Forscher die Gesetze der Physik aus den Angeln gehoben hatten. Der Hintergedanke dabei: Wer wiederholt mit Situationen konfrontiert wird, die klar gegen die Erwartungen des Gehirns verstoßen, dessen Denkstrukturen werden systematisch aufgelockert.
Betreten wir eine Cafeteria, schaltet sich eine Art mentaler Autopilot in uns an: Wir sehen die Theke und Tische und Stühle, und unwillkürlich aktivieren diese Eindrücke in unserem Gehirn weitverzweigte »Cafeteria-Netzwerke«, die uns dabei helfen, uns auf Anhieb in der Situation namens Cafeteria zurechtzufinden. Man bezeichnet diese Netzwerke in unserem Kopf als mentale Modelle, Prototypen oder »Schemata«.
Schemata können sich auf Objekte oder Räume mit einem gewissen Standardlayout beziehen, man nennt sie dann auch »Frames«.[2] Eine Cafeteria zum Beispiel hat üblicherweise eine Theke, auf der Speisen stehen, davor erstreckt sich in der Regel ein Bereich mit Tischen und Stühlen et cetera. Das Cafeteria-Frame kodiert dieses grobe Layout in unserem Kopf wie einen gedanklichen Grundriss. Jeder, der eine Cafeteria, ein Restaurant oder einen Supermarkt betritt, hat, den Frames sei Dank, sofort eine Orientierung, wo sich was befinden könnte.
Andere Schemata speichern typische Handlungsabläufe, »Skripts«: In einer Cafeteria werden wir, im Gegensatz zu einem Restaurant, nicht bedient, wir müssen selbst mit einem Tablett zur Theke, und am Ende der Theke erwartet uns dann eine Kasse, wo wir bezahlen.
Für so gut wie jede Situation, in die wir öfter geraten, bildet das Gehirn ein Schema, das uns in Zukunft beim Meistern der Situation beispringt. Sagen wir, Sie stehen vor der Herausforderung, sich an Bord eines Flugzeugs begeben zu müssen. Spätestens sobald der Aufruf erfolgt, wird in Ihrem Vielfliegerhirn ein »Boarding-Skript« angeworfen, ein maßgeschneidertes kognitives Drehbuch, mit dessen Hilfe Ihr Gehirn das, wie jeder weiß, höchst anspruchsvolle, nervenaufreibende Manöver in den Griff zu bekommen versucht (praxisbewährter Skriptablauf: so schnell wie möglich mit dem bleischweren Handgepäck zum Gate eilen und sich in die Schlange drängeln, anschließend mindestens eine Viertelstunde warten, bis es wirklich losgeht, diese Zeit nutzen, um die plötzlich spurlos verschwundene Bordkarte aufzustöbern, während ein Reisekollege hinter Ihnen seinen Koffer liebevoll in Ihre Wade drückt, in der wohlbegründeten Hoffnung, dass es dann schneller vorangeht …).
Frames und Skripts machen uns effizient: Sobald das Gehirn die relevanten Routinenetzwerke hochgefahren hat, ist die Situation für uns eingeordnet, und die erforderlichen Verhaltensschritte laufen ab, ohne dass wir jetzt noch ausführlich nachdenken müssten. Wer zerbricht sich morgens beim Aufstehen den Kopf darüber, worin seine nächsten Schritte bloß bestehen könnten? Niemand, der am selben Tag noch etwas zustande bringen will. Stattdessen folgen wir einfach unseren vertrauten Aufsteh- und Frühstücks-Skripts. Ein Großteil unseres Alltags lässt sich auf diese Weise überstehen.
Die Schema-Vorgehensweise stößt erst an ihre Grenzen, wenn die Situation, in die wir geraten, nicht standardmäßig, sondern ungewöhnlich, wenn sie neu ist. Wenn zur Einschätzung und Bewältigung unserer Lage keine Skript-Schablone, sondern eine Spur mehr Kreativität gefragt ist. »Um das kreative Denken zu fördern, hilft es, das Gehirn mit Ungewöhnlichem zu konfrontieren«, sagt Ritter. »In ungewöhnlichen Umgebungen macht das Gehirn die Erfahrung, dass es mit seinen herkömmlichen Schemata nicht weiterkommt.«
Wie zum Beispiel in der absurden Cafeteria: Beobachten wir, wie eine Flasche von einem Tisch gestoßen wird, weckt das in unserem Kopf automatisch jene Schemata, mit denen wir den Vorgang fallender Objekte erfassen. Fast können wir vor unserem geistigen Auge sehen, wie die Flasche am Boden zerschellt. Statt aber dem gedanklichen Drehbuch zu folgen, steigt die Flasche in der absurden Cafeteria in die Luft. Das Gehirn ist irritiert, verblüfft. Offenbar scheinen seine alten Interpretationen, auf die es sich sonst immer verlassen konnte, nicht zu greifen. Es muss anfangen, die Situation neu zu deuten, es muss versuchen, einen neuen Sinn zu konstituieren – jenseits von konventionellen Schemata.
Mit anderen Worten: Die Testpersonen aus der ungewöhnlichen Cafeteria müssten, angeregt durch den wiederholten Schemaverstoß, eigentlich einen kurzfristigen Kreativschub erfahren. Falls die Theorie stimmt.
Um das zu prüfen, rückte Ritter den Kandidaten unmittelbar nach dem Cafeteria-Ausflug mit einem kleinen »Kreativitätstest«[3] zu Leibe, der in diesem Fall aus einer einfachen Frage bestand: Was macht Geräusche? Die Aufgabe lautete, binnen zwei Minuten so viele Antworten wie möglich zu liefern. Zwei unabhängige Gutachter – die natürlich nicht wussten, wer welche Cafeteria-Version erlebt hatte – sahen sich die Antworten der Testpersonen an und werteten sie aus.
Es kam tatsächlich so, wie Ritter es vermutet hatte: Die Teilnehmer, deren Schemata kurz zuvor von der bizarren Cafeteria erschüttert worden waren, schnitten beim Kreativitätstest eindeutig besser ab. Ihre Ideen zeugten von größerer geistiger Wendigkeit. Ihre Beispiele blieben nicht auf einige wenige Kategorien beschränkt (Auto, Bus, Flugzeug und Motorrad etwa wären allesamt Krachmacher aus der Kategorie Verkehrsmittel), sondern waren, verglichen mit denen der Kontrollgruppe, vielfältiger. So kamen die Testpersonen, neben den üblichen Verkehrsmitteln, beispielsweise auch darauf, dass Insekten Geräusche von sich geben können, ebenso wie eine Uhr, fließendes Wasser oder Töpfe, die gegeneinanderstoßen. »Das Denken der Versuchspersonen aus der ungewöhnlichen Cafeteria verlief mehr in unterschiedliche Richtungen, es war flexibler geworden«, sagt Ritter. Das Erlebnis Schemaverstoß hatte ihre Phantasie entfesselt.[4]
Kreativer frühstücken
Über das konkrete Resultat hinaus weist Ritters Versuch auf ein Prinzip hin, das allgemeiner Art ist und die übliche Sicht auf das Phänomen Kreativität deutlich erweitert, in mancher Hinsicht sogar radikal umkehrt. Schließen Sie bitte für einen Moment die Augen und lassen sich das Thema Kreativität durch den Kopf gehen. Was fällt Ihnen spontan dazu ein?
Ich bin in den letzten Monaten sämtlichen Freunden und Bekannten – sowie den Bekannten meiner Bekannten – mit dieser Übung auf die Nerven gegangen. Die Assoziationen gehen in die unterschiedlichsten Richtungen. Viele beschreiben spezifische kreative Tätigkeiten (fast immer mit dabei: »malen«) oder nennen Teilaspekte, Synonyme und Definitionen wie »Erfindung«, »originell und unerwartet«, »irgendwie anders«, »Ideen« …
Wenn man etwas nachbohrt, stellt man fest, dass die meisten von uns Kreativität mit Künstlern, Designern und Werbeleuten in Verbindung bringen, nicht wenige auch mit Kindern. Gelegentlich werden große Namen genannt – Beethoven, Picasso, Einstein, Steve Jobs, Namen, die verraten, dass wir bestimmten Wissenschaftlern (solchen, die auch mal die Zunge rausstrecken) sowie milliardenschweren Unternehmern in bunten Sneakers ebenfalls ein hohes Maß an Kreativität zuschreiben.
Worauf es mir hier vor allem ankommt, ist Folgendes: Von den Einzelheiten abgesehen, verraten viele der genannten Beispiele, dass wir Kreativität für eine Eigenschaft halten, die gewissen Menschen oder Menschengruppen innewohnt. Künstler und Kinder sind in unseren Augen kreativ, ebenso wie einige begnadete Ausnahmefiguren, die wir als »Genies« oder »Querdenker« bezeichnen. Fragt man Wikipedia, erhält man eine etwas breiter gefasste, aber im Kern doch ähnliche Antwort. Der erste Satz zum Eintrag Kreativität dort lautet: »Kreativität ist eine Eigenschaft lebender Systeme.«[1]
Ritters Cafeteria-Experiment dagegen lenkt den Blick auf eine ganz andere Quelle der Kreativität. Der Versuch führt uns vor Augen, dass es zu kurz greift, den Ursprung der Inspiration nur innerhalb einer Person, innerhalb von uns zu suchen: Wie flexibel wir denken, hängt offenbar nicht nur von einer Eigenschaft ab, die wir haben oder womöglich auch nicht, sondern maßgeblich auch vom Umfeld, in dem wir uns gerade aufhalten. Die Befunde aus dem Virtual-Reality-Labor legen nahe, dass es Umgebungen gibt, die unseren Einfallsreichtum wecken oder regelrecht beflügeln können (und umgekehrt). Die Resultate suggerieren damit zugleich, dass jeder von uns flexibler denken könnte, würden wir unser Gehirn nur ab und zu schemaverstoßenden Situationen aussetzen.
Das klingt natürlich gut, das klingt ermutigend. Leider gibt es auch gleich eine schlechte Nachricht. Sie lautet: Die Schemaverstöße werden im Laufe unseres Lebens nahezu zwangsläufig seltener.
Ein Baby, das zum ersten Mal auf die Welt blickt, kennt keine Routine: Alles ist neu, alles ist ungewohnt. Die ganze Welt gleicht einer hochgradig skurrilen Cafeteria. Als Kind mussten wir die unzähligen Schemata im Kopf, mit denen wir den Alltag mittlerweile so mühelos meistern, ja erst noch bilden. Die vorläufigen Schemata – besser: die ziemlich wackligen Hypothesen –, mit denen Kinder auf die Welt zugehen, werden andauernd von der Wirklichkeit widerlegt. Der Verstoß gegen die eigenen Vermutungen ist die Regel, nicht die Ausnahme. Kinder sind ständig überrascht beziehungsweise wundern sich auch über die verrücktesten Sachen nicht mehr als sonst, weil sie von Wundern umgeben sind.
Je mehr wir mit der Welt interagieren, desto präziser wird unsere kognitive Maschinerie auf die Wirklichkeit abgestimmt. Mit jeder Erfahrung werden unsere Schemata umfangreicher und genauer. Irgendwann funktionieren die ganzen Frames und Skripts in unserem Kopf reibungslos. Überraschungen, Schemaverstöße? Gehören zunehmend der Vergangenheit an.
Zugespitzt könnte man sagen, dass wir Erwachsenen uns die Welt gar nicht mehr richtig ansehen müssen. Unsere Schemata sind fertiggestellt. Wären sie nicht aus Eichenholz geschnitzt, sie würden glatt anfangen zu rosten. Unsere Augen mögen geöffnet sein, nur wir sehen nicht mehr wirklich hin, so wie wir als Kind hingesehen haben. Meist reicht ein flüchtiger Blick, und wir können getrost auf Autopilot schalten: Unsere perfekten kognitiven Modelle manövrieren uns ohne größere Zwischenfälle durch den Tag.
Vor diesem Hintergrund erscheint es vielleicht gar nicht so erstaunlich, dass wir im Durchschnittsalltag hinter unseren schöpferischen Möglichkeiten zurückbleiben: Unser Leben und auch unsere Arbeit behelligen uns mit einer bekannten Situation nach der anderen. Unser Alltag ist Routine, ist allzu schemabestätigend geworden. So, wie man sich eigentlich hin und wieder ins Fitnessstudio begeben sollte, um nicht einzurosten, müssten wir, unserer geistigen Beweglichkeit zuliebe, gelegentlich in schemaverstoßende Welten eintauchen, um unsere eingefahrenen Denkstrukturen zu trainieren, besser gesagt, zu schockieren. Blöd nur, dass nicht jeder von uns im Hobbykeller zufällig ein Virtual-Reality-Labor eingebaut hat.
Zum Glück aber ist das, wie sich herausstellt, gar nicht nötig. Wie weitere experimentelle Befunde von Simone Ritter und anderen Forschergruppen demonstrieren, lassen sich an den unscheinbarsten Stellen des Alltags schemaverstoßende Erlebnisse einbauen, die unser Oberstübchen auf Trab bringen. Das kann bereits beim Frühstück anfangen.
So bat Simone Ritter in einem Versuch eine Reihe von Testpersonen an den Laborfrühstückstisch und ließ sie Brote schmieren. In den Niederlanden gibt es eine Delikatesse, die schätzungsweise 100 Prozent der Holländer als absolut unwiderstehlich empfinden – es ist das sogenannte boterham met hagelslag (ein Butterbrot mit Schokostreuseln). Die Zutaten für diesen ultimativen Gaumenkitzler befinden sich standardmäßig in jeder holländischen Küche, die etwas auf sich hält, und da ich gerade in den Niederlanden lebe[2], kann ich mal eben ohne großen Aufwand ein solches »boterham« zubereiten.
Oben ist die übliche Skriptfolge für das perfekte boterham met hagelslag abgebildet: Man nehme eine Scheibe Brot, beschmiere sie mit Butter und streue dann ordentlich Schokostreusel drauf. Skriptende.
Für jeden Nichtniederländer, Kinder ausgenommen, stellt vermutlich schon der bloße Gedanke an ein Brot mit Schokostreuseln einen unverzeihlichen Schema- und Geschmacksverstoß dar. Echte Holländer jedoch stutzen erst bei jener verrückten Zubereitungsmethode, die Simone Ritter einem Teil ihrer Testpersonen aufnötigte: Diese Experimentalgruppe sollte ihr Brot, im Gegensatz zur Kontrollgruppe, nicht so schmieren, wie es sich gehört – stattdessen bekam sie die Instruktion, zuerst die Schokostreusel auf einen Teller zu streuen, dann das Brot mit Butter zu beschmieren und zum Schluss die bebutterte Scheibe in die Streusel zu tunken.
Beißt man hinein, schmeckt das Endprodukt identisch, für das Gehirn jedoch, wenigstens für das in Holland sozialisierte, schmeckt die zweite Zubereitungsmethode nach eklatantem Schemaverstoß. Die erhoffte Folge: Die eingenickten Hirn-Netzwerke sollten wieder aufgewacht sein.
Um den Nachweis zu erbringen, gab es im Anschluss an das Broteschmieren, wie gehabt, eine Kreativitätsübung, genau genommen, sogar zwei. Simone Ritter fragte diesmal nicht nur nach Geräuschen, sondern konfrontierte die Teilnehmer zusätzlich mit folgendem Klassiker der Kreativitätsforschung: Was lässt sich alles mit einem Ziegelstein anstellen?