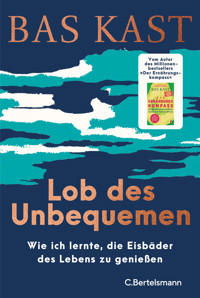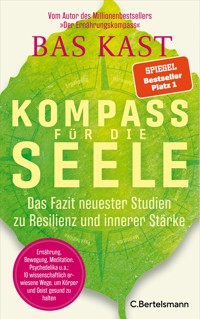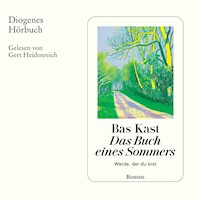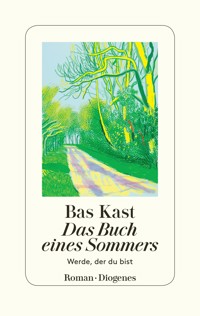
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nicolas hat einen Traum: Schriftsteller zu werden wie sein Onkel. Dann kommt das Leben dazwischen und die Firma seines Vaters, Verantwortung, Termine und lauter Zwänge. Als sein Onkel stirbt, verliert Nicolas den einzigen Menschen, der an ihn geglaubt hat. Doch dann findet er am unwahrscheinlichsten Ort den Schlüssel, um zu dem zu werden, der er wirklich ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Bas Kast
Das Buch eines Sommers
Werde, der du bist
Roman
Diogenes
Mit Dank an Ursula Bergenthal, Kati Hertzsch & Anna von Planta,
for making a dream come true
Für Joni, Benni & Maxi und für Sina
Erkenne, wer du im Kern deines Wesens bist, und dann werde es.
Pindar
Stell dir vor, du träumst einen Traum, in dem jeder deiner Wünsche in Erfüllung geht. Alles, was dein Herz begehrt, fliegt dir widerstandslos zu, Tag für Tag für Tag. Anfangs genießt du dieses leichte, mühelose Glück. Erst nach vielen Jahren immerwährender Glückseligkeit wird dir allmählich langweilig. Also änderst du deinen Traum ein wenig. Nun soll nicht mehr jeder Wunsch sofort in Erfüllung gehen. Manchmal bleiben die Dinge auch in der Schwebe. Es tun sich unerwartete Hürden auf, die dir vor Augen führen, wie wertvoll das, was du begehrst, wirklich ist. Und hin und wieder gehst du sogar leer aus oder wirst mächtig auf die Probe gestellt, und dein Traum führt dich an die Grenzen deiner Fähigkeiten und noch darüber hinaus. Verblüfft stellst du fest, dass diese neue Form des Traums weitaus abwechslungsreicher und spannender ist als jene zuvor. Und so reicherst du deine Träume fortan mit mehr und mehr Hürden und Risiko und Abenteuer an – bis du dich irgendwann in jenem Traum wiederfindest, der nichts anderes ist als dein jetziges Leben.
Ein frei nacherzählter Gedanke von Alan Watts
In einem Sommer vor langer Zeit …
Ich weiß noch, wie mir vor vielen Jahren der Sommer meines Lebens bevorstand. Oder doch eigentlich hätte bevorstehen müssen. Das Abitur in der Tasche, das Studium noch in weiter Ferne, hätte jenes ultimative Abenteuer namens Leben endlich losgehen können. In meiner grenzenlosen Freiheit musste ich nur noch zugreifen, ich musste mich bloß noch hineinfallen lassen und es in vollen Zügen genießen.
Nur fühlte ich mich überhaupt nicht frei, und das Abenteuer entfernte sich Minute für Minute mehr von mir, mit rasender Geschwindigkeit. Um genau zu sein, saß es in einer Boeing 747, auf dem Weg nach Sydney. Das Abenteuer, das schulterlanges, kastanienbraun glänzendes Haar hatte und Katharina hieß, wollte mich nicht. Es wollte, statt bei mir zu bleiben, am anderen Ende der Welt, in Australien, studieren.
So kam es, dass ich den Sommer mit meinem Onkel Valentin verbrachte, dem »Spinner der Familie«, wie mein Vater ihn nannte. »Ach, der Valentin«, pflegte mein Vater zu sagen, mit einem Seufzen, das sofort klarmachte, was er von seinem – deutlich jüngeren – Bruder hielt. »Der Valentin hat schon immer vom ganz großen Wurf geträumt. Irgendwann kommt er ganz groß raus! Aber, merk dir das, Nicolas: Den großen Wurf gibt es nicht. Was es gibt, ist, dass man als Erster bei der Arbeit erscheint und als Letzter wieder geht.«
Hatte mein Vater ihm von meinem Kummer erzählt? Oder hatte er ihn herausgehört, ihn gespürt mit seinen feinen Antennen, am Telefon, als er mich angerufen hatte, um mir zum Abitur zu gratulieren, und ich nur Einsilbiges zurückgemurmelt hatte?
Jedenfalls stand er dann plötzlich vor unserer Haustür, mein berühmter Onkel Valentin, eine sonnengebräunte Gestalt in einem beigen, zerknitterten Leinenanzug mit beigem Panamahut. Er nahm mich in seine kräftigen Arme und ließ mich sekundenlang nicht los, und ich schloss die Augen. Wie ich so dastand in seinen Armen, war es, als würde ein Teil meines Katharina-Schmerzes in ihn übergehen, absorbiert von seinem Körper, und um die so entstandene Leere in mir wieder auszufüllen, ließ er etwas von seiner Valentin-Kraft in meinen Körper zurückströmen.
Irgendwann blickte er mich mit seinem verschmitzten Lächeln an und fragte, ob ich nicht Lust auf eine kleine Reise hätte.
»Eine Reise?« Ich zuckte mit den Schultern, unentschlossen, niedergeschlagen. »Wohin?«
»Ins Leben, mein Lieber. Komm mit, Junge, ich muss dir unbedingt etwas zeigen!«
Was an ihm war es, das mich so faszinierte? War es die schlichte Tatsache, dass er Schriftsteller war und ich das damals selbst auch so gern werden wollte? War es seine Energie? Seine gelassene, zuversichtliche Art? Das verschmitzte Lächeln? War es der Umstand, dass er kaum etwas ernst nahm, nur das, was in seinen Augen seinen Ernst verdiente, wozu erstaunlicherweise auch mein Liebeskummer gehörte? Ja, all das vielleicht …
Und dann wohl auch sein exzentrischer Lebensstil. Einmal bekam ich eine Postkarte von ihm aus Lateinamerika, wo er eine Zeitlang von Land zu Land reiste, auf der Suche nach, wie er sagte, »corazón«. Zu viel Vernunft mache »genauso dumm wie zu wenig«, und er würde immer noch zu sehr mit dem Kopf und zu wenig mit dem Herzen denken, auch wenn es bei ihm in dieser Hinsicht vielleicht nicht ganz so schlimm wie bei seinem Bruder stünde.
Ein anderes Mal hatte er sich in eine Dichterin aus Ligurien verknallt, war ein paar Monate verschollen gewesen, schrieb mir dann aus Rom, er sei »auf den Spuren Senecas«, und als er wieder auftauchte, ebenso plötzlich, wie er verschwunden war, sprach er fließend Italienisch und meinte: Er müsse seinem Leben wie auch seinen Texten doch noch »etwas mehr sprezzatura einhauchen«.
Wenn mein Vater damals abends gestresst aus der Firma nach Hause kam – er hatte ein kleines Pharmaunternehmen gegründet, sein ganzer Stolz –, sagte ich: »Papa, bitte, etwas mehr sprezzatura!«, auch wenn ich keine Ahnung hatte, was das Wort bedeutete. Es klang einfach cool.
»Was?«
»Sprezzatura.«
»Ach, hör doch auf mit dem Quatsch von deinem Märchenonkel!«
Dann allerdings gelang dem Märchenonkel, ganz entgegen den pessimistischen Prophezeiungen meines Vaters, doch noch der große Wurf. Nach drei, vier Romanen, die sich eher mäßig verkauften, erfand er einen Charakter, den seine Leser liebten. Dank der begeisterten Resonanz entstand daraus eine ganze Reihe von Erzählungen. Bei dem Protagonisten handelte es sich um einen außergewöhnlich lebensklugen Helden, der vor sprezzatura nur so sprühte und den mein Onkel nach ein paar Gläsern Weißwein spontan »Christopher« taufte. Ich war noch ein kleiner Junge, als er mir bei Kerzenlicht und mit leuchtenden Augen von Christopher, den ich für eine Art Zauberer hielt, vorschwärmte und mich dann plötzlich fragte, nur halb im Scherz: »Oder sollen wir ihn Nicolas nennen?«
Spätestens mit dem dritten Band entwickelte sich ein regelrechter Christopher-Hype, die Bücher wurden zu Bestsellern, sie machten meinen Onkel zunehmend bekannt und auch wohlhabend. Schließlich hörte man von meinem Vater nur noch selten die Wörter »Spinner« und »Märchenonkel«. (Tatsächlich habe ich ihn abends einmal heimlich dabei beobachtet, wie er mit dem neuesten Christopher-Band in den Händen in seinem smaragdgrünen Ohrensessel im Wohnzimmer saß und immer wieder vergnügt vor sich hin schmunzelte, und ich weiß noch, wie ich mir vorstellte, es wäre mein Buch, das er da las, und mir wünschte, es wären meine Sätze, die ihn so schmunzeln ließen …)
Ich steckte ein paar Klamotten, meinen Walkman und meine Zahnbürste in meine blaue Sporttasche, wir riefen meinen Vater an, der seit dem Tod meiner Mutter – sie war kurz vor meinem vierten Geburtstag an Lungenkrebs gestorben – mit seiner Firma verheiratet war, und dann drückte mein Onkel mir seinen Autoschlüssel in die Hand.
»Ich? Darf ich? Wirklich?«
»Du hast doch deinen Führerschein gemacht, oder nicht?«
»Ja, klar …«
Als Katharina gegangen war, als ich allein in meinem Zimmer saß und es mit einem Mal zu mir durchdrang, dass sie weg war, wirklich weg, verschwunden aus meinem Leben, hatte sich irgendwo in meiner Bauchregion ein Schmerz mit einer Urkraft festgekrallt, von der ich nicht ahnte, dass so etwas physiologisch überhaupt möglich war. Man sagt das immer so leicht dahin: Diese oder jene Sache hat mich »umgehauen«. Damals wurde mir klar, dass selbst so überzogen klingende Redensarten einen realen Kern haben können.
Nun mischte sich in diesen Schmerz eine gewisse Aufregung, womöglich auch eine Prise Angst. Ich schaute auf den Schlüssel, dann auf den Wagen. Auf den schwarzglänzenden Porsche 911 Targa, ein G-Modell, Baujahr 1987.
Mein Herz klopfte, als ich auf das Auto zuging und die Fahrertür öffnete, die dabei ein metallisches Klacken von sich gab. Ich setzte mich auf den schwarzen Ledersitz.
Einen Moment saß ich einfach bloß da, den Geruch von Motoröl in der Nase. Dann beobachtete ich, wie meine linke Hand den Schlüssel ins Zündschloss steckte – beim 911 traditionsgemäß links vom Steuer – und ihn umdrehte. Der Porsche brüllte kurz auf wie ein kampflustiger Löwe und fing dann an zu vibrieren wie eine Waschmaschine im Schleudergang.
Da ich selbst kein Auto besaß und mein Vater mich nicht mehr in die Nähe seines alten senfgelben Mercedes ließ, seit ich beim Einparken einen seiner Außenspiegel abgebrochen hatte (»Mann, Nicolas, das muss man auch erst mal hinbekommen«), war ich nicht gerade ein geübter Fahrer, und so würgte ich den Motor zunächst mehrfach ab.
Minuten später standen wir immer noch halb in der Einfahrt. Anschließend blockierten wir eine Weile den Verkehr auf der schmalen Anliegerstraße, in der mein Vater und ich wohnten.
Mein Onkel blieb bei meinen kläglichen Auspark- und Losfahrversuchen die Ruhe selbst. »Tja, mein Lieber, keine Servolenkung, kein ABS, überhaupt keine Nanny an Bord«, sagte er, während ich mich mit der Mechanik des Wagens, der mir wie ein wildes Raubtier vorkam, das ich zu zähmen lernen musste, vertraut machte.
Um die Sache an dieser Stelle etwas abzukürzen und auf den Punkt zu bringen: Irgendwann an jenem Tag fuhren wir tatsächlich. Das heißt, ich fuhr, Porsche 911, das Targa-Dach heruntergenommen, stahlblauer Himmel über uns, hinter uns der röhrende, luftgekühlte Sechszylinder-Boxermotor. Meine feuchten Hände hielten das Lenkrad umklammert, während mein Onkel neben mir saß und eine Geschichte nach der anderen erzählte, nur gelegentlich kurz unterbrochen für eine Richtungsanweisung. Ich konnte vor lauter Aufregung und Konzentration auf das Auto kaum seinen Worten folgen, stattdessen klang seine sonore Stimme wie eine angenehme, beruhigende Hintergrundmusik in meinen Ohren.
So fing sie an, unsere Fahrt ins Unbekannte. Denn ich wusste immer noch nicht, was unser Ziel war. Gab es überhaupt ein Ziel? Was wollte mein Onkel mir denn so dringend zeigen?
»Jetzt lass dich doch mal überraschen« – mehr bekam ich nicht aus ihm heraus, und irgendwann, als wir so fuhren, stellte ich verblüfft fest, dass ich fast eine Stunde nicht an Katharina gedacht hatte. Bis mein Onkel aus heiterem Himmel fragte:
»Wie sieht sie denn aus?«
Er war der Einzige, der nicht mit Sprüchen kam von wegen »Kopf hoch« und »Das wird schon wieder« und was weiß ich. Als wäre er der Einzige, der keine Angst vor meinem Schmerz hatte. Als wäre der Sommer in ihm so groß, dass er den Winter, den ich mit mir herumschleppte und dessen eisige Luft ich nach allen Seiten hin verströmte, in sich aufnehmen könnte, und es würde immer noch genügend Wärme für uns beide übrig bleiben.
Erst wusste ich nicht so recht oder traute mich nicht, stammelte vor mich hin, als sei die schmerzhafte Erinnerung an Katharina wie ein verängstigtes Tier, das sich nicht aus dem Schutz seiner Höhle hinauswagte. Aber mein Onkel ließ nicht locker und vermittelte mir das Gefühl, als gäbe es gerade nichts Faszinierenderes auf dieser Welt als »meine« Katharina.
Und so fing ich halt an zu erzählen, versuchte es zumindest, inzwischen nur noch eine Hand am Lenkrad, das Gesicht im Fahrtwind, ich begann zu reden, auch wenn mir mein Gerede armselig vorkam, weil Katharinas wunderschönes kastanienbraunes Haar so wenig mit den schnöden Worten »kastanienbraunes Haar« gemein hatte. Onkel Valentin hörte zu, und ich beschrieb ihr Lächeln, wenn ich einen Witz erzählte, und dass es mir wie ein leicht unterdrücktes Lächeln vorkam, als gäbe es da etwas, das sie zurückhalten würde, und ich hatte das Rätsel, das hinter diesem Lächeln stand, doch eigentlich ergründen wollen, und nun würde ich wohl nie dahinterkommen, was es damit auf sich hatte. Ich erzählte und erzählte und vergaß ganz, dass ich gleichzeitig auch fuhr, durch die lauwarme Luft, neben mir mein Onkel, der sich genüsslich in seinen Sitz zurückgelehnt hatte und ab und zu ein »herrlich, herrlich« oder ein »ach, du Scheiße« von sich gab.
Wir fuhren die ganze Nacht durch, das heißt, mein Onkel übernahm schließlich das Steuer, als mir vor Müdigkeit fast die Augen zugefallen waren. Und irgendwann muss ich dann einfach eingeschlafen sein.
Als ich aufwachte, war da kein Motorenbrummen mehr. Benommen blickte ich umher. Morgendämmerung, Wärme. Hohe Bäume in der Ferne.
Offenbar waren wir gerade angekommen, der Porsche knackte vor sich hin wie Kaminholz – vermutlich das erhitzte Metall, das langsam abkühlte.
Wo waren wir? War ich wirklich wach? Oder war alles, was passiert war, seit Valentin vor unserer Haustür aufgetaucht war, nur ein Traum, und jetzt träumte ich, dass ich irgendwo in einem fernen Land erwachte?
Mein Onkel war ausgestiegen, zog seine Hose zurecht und deutete mit dem Kinn auf ein schmiedeeisernes Tor. »Tja, ich schätze, wir sind da.«
Immer noch schlaftrunken stieg ich ebenfalls aus, und wir gingen über rötlich-hellbraune, trockene Erde auf das Tor zu. Mein Onkel lehnte sich mit der Schulter dagegen, ich half mit der Hüfte nach, worauf es erst einen Spaltbreit nachgab und sich dann quietschend aufstoßen ließ.
Wir betraten das Grundstück, das in weiches, bläuliches, leicht nebliges Morgenlicht getaucht war. Staunend sah ich mich um.
Wir standen in einem halb verwilderten Park. Der Rasen war ungemäht, mit Inseln von heimischen Wiesenblumen, außerdem mehrere hohe, knorrige Bäume. Später erfuhr ich, dass es sich um Platanen handelte. Helles Vogelgezwitscher drang aus den unterschiedlichsten Richtungen, ansonsten war es vollkommen still.
Es hatte etwas Surreales, als wäre ich über Nacht in eine andere Welt entführt worden.
Erst als wir ein Stück über einen unter unseren Schritten knirschenden Kiesweg gegangen waren, erblickte ich, teilweise von einer Platane verdeckt, die Villa.
»Ist das unser Hotel?«, fragte ich in die Stille hinein.
»So ungefähr«, entgegnete mein Onkel. »Gefällt’s dir?«
Ja. Ja … Ich starrte zu der verwitterten Villa hoch, die sich aus verschiedenen Gebäudeteilen zusammenzusetzen schien. Am größten und auffälligsten war das kastenförmige Gebäude links, »das Herrenhaus«, wie mein Onkel sagte, das hellblau – wie das Blau des Himmels – verputzt war und hinten links ein, ebenfalls himmelblaues, Türmchen mit mattrötlichem Dach besaß. Rechts vom Herrenhaus befand sich eine Art Scheune. Dazwischen war ein Verbindungstrakt mit einer Haustür aus hellbraunem Holz.
Mein Onkel holte einen Schlüssel aus seinem Jackett hervor und öffnete die Tür.
Wir betraten eine Eingangshalle, betraten sie mit einer gewissen Ehrfurcht, wie man ein Museum betritt. Im Echo unserer Schritte gingen wir nach links durch eine offenstehende Tür und gelangten in ein Atrium mit einer Glaskuppel, von der an einer langen Kette ein Kristall-Kronleuchter in Sacklüsterform herabhing.
Besonders eindrucksvoll fand ich die weite, geschwungene Treppe, die nach oben in den ersten Stock des Herrenhauses führte. Unten breit und einladend, wurde sie nach oben hin zunehmend schmaler. Wie ein sich stetig verjüngender Trichter – als wollte die Villa einen unbedingt hochlocken. Als verberge sich dort ihr eigentliches Geheimnis.
»Ist das dein Haus?«, fragte ich ungläubig. Meine Worte erzeugten einen Widerhall in der Leere des Raums.
»Ach, weißt du, ich dachte mir, nachdem ich lange genug in der Welt herumgeirrt bin, wäre es vielleicht doch an der Zeit, mich an einem netten Ort niederzulassen. Irgendwo, wo es sich leben lässt.« Pause. »Was denkst du? Könntest du es hier ein paar Tage aushalten, Nicolas?«
Ich hielt es sogar sechs Wochen in der Villa meines Onkels aus. Und obwohl es natürlich nicht so war, hatte ich anfangs immer mal wieder den absurden Verdacht, dass er sich dieses extravagante Haus nur mir zuliebe zugelegt hatte. Bloß, um mir zu beweisen, dass das Leben voller verrückter Abenteuer ist, mit und ohne Katharina.
Manchmal schlenderte ich einfach durch das lichtdurchflutete Atrium, dann vom Atrium die geschwungene Treppe hinauf. Hörte meinen Katharina-Song It must have been love von Roxette, spulte zurück und hörte ihn in Dauerschleife, und es war, als schwebte ich mit Katharina durch die Räume. Vom oberen Stock des Herrenhauses führte ein Durchgang zu einem Anbau der alten Scheune, und allein dieser Scheunenanbau mit seinen muffig riechenden Rumpelkammern war für mich eine eigene Welt. Über eine Wendeltreppe ging es wieder hinunter in den düsteren Vorratsraum, der direkt neben der Küche lag, und von der Küche musste man lediglich in die Eingangshalle gehen, um erneut ins Atrium zu gelangen, wo ich Roxette dann gleich noch einmal von vorne loslegen ließ …
Eines Morgens trat mein Onkel an die Matratze, auf der ich schlief (es fehlten damals noch die meisten Möbel), stellte einen Becher mit heißem Kaffee daneben und setzte sich im Schneidersitz vor mir auf den Boden. »Na, mein Lieber, gut geschlafen? Was sagst du zu einem Ausflug in die Berge?«
Kurz darauf saßen wir in Black Beauty, wie mein Onkel seinen Porsche nannte, und fuhren, bis die hügelige Weinlandschaft, in der die Villa meines Onkels lag, allmählich in bergiges Gelände überging.
Als wir nach gut anderthalb Stunden Fahrt den Wagen abstellten, deutete mein Onkel vage zu einem Punkt weit oben auf einem Gipfel, wo es angeblich eine Gastwirtschaft mit herrlichem Ausblick gab. »Wir könnten natürlich auch hochbrettern, nur würde das Bier dann lange nicht so gut schmecken, wie wenn wir aus eigener Kraft hochmarschieren und es uns verdienen.«
Und so begann unser Aufstieg.
Die Wirtschaft erwies sich als erheblich weiter weg als gedacht. Ja, irgendwann – ich hatte bereits die ersten Blasen an den Füßen – fragte ich mich, ob es sie überhaupt gab oder ob mein Onkel sie sich bloß ausgedacht hatte, denn Realität und Phantasie gingen bei ihm fließend ineinander über. Wir kämpften uns weiter, über holprige Waldwege, an einem krummen, in die Erde gerammten Kreuz vorbei (als hätten wir den Gipfel schon erreicht), dann über felsige Gesteinsbrocken, immer weiter nach oben.
Meine Beine fingen an zu ziehen und zu schmerzen, von den inzwischen höllisch brennenden Blasen an meinen Füßen ganz zu schweigen. Und irgendwie weckte der wachsende Schmerz eine solche Wut in mir – Wut auf Katharina, Wut darüber, welche Macht sie über meine Gefühle behielt, wie hilflos ich diesen Gefühlen ausgeliefert war, während sie bestimmt das für sie neue, aufregende Leben in Sydney genoss und keinen Gedanken an das erbärmliche Häufchen Elend namens Nicolas verschwendete, das sie zurückgelassen hatte und das nun immer noch diesen beschissenen Berg hochkletterte. Ich biss die Zähne zusammen.
Ich schnaufte und schwitzte vor mich hin und begann, laut zu fluchen.
»Also, ehrlich gesagt, so langsam hätte ich auch nichts dagegen anzukommen«, stöhnte mein Onkel mit zerknirschter Stimme, als bereue er es, dass er seinen Neffen aus welchen Gründen auch immer diesen Berg hatte hochjagen wollen. Sein Kopf war knallrot angelaufen, Schweiß stand ihm auf der Stirn, von sprezzatura konnte gerade keine Rede sein.
Und es ging immer noch weiter.
Mein Onkel hatte soeben kleinlaut die Option einer kurzen Rast mit anschließender Umkehr ins Spiel gebracht, da merkte ich auf einmal, dass das Stechen in meinen Füßen, Beinen und im gesamten Rest meines Körpers den Katharina-Schmerz in meinem Bauch zu verdrängen begann.
Und zugleich tauchte, wie eine Fata Morgana, das große Wirtshaus mit den Blumenkästen an den Balkonen und den Holzbänken und -tischen vor uns auf. Mein Onkel blieb schwer atmend stehen, die Hände auf die Oberschenkel gestemmt. »Nächstes Mal fahren wir!«
Ich weiß noch, wie ich plötzlich unkontrolliert zu lachen anfing, in einer Mischung aus Erschöpfung und dann auch Erleichterung darüber, dass dieser ewige Schmerz in meinem Magen endlich abebbte. In dem Augenblick wusste ich, spürte es körperlich, dass Katharina nicht für immer in meinem Magen festgekrallt bleiben würde. Sie würde irgendwann loslassen.
Ich sah auf die Gebirgslandschaft mit den schneebedeckten Gipfeln im strahlenden Sonnenschein und fühlte mich gleichzeitig winzig und überlebensgroß.
Vielleicht hatte mein Onkel ja auch genau das mit seiner Kletteraktion bezweckt oder sich erhofft. Denn als wir schließlich ausgelaugt und verschwitzt und doch zufrieden auf einer der Holzbänke saßen, vor uns unser Bier, blickte er mich an und sagte: »Na, mein treuer Kletterkumpan, wie gefällt’s dir hier auf dem Mount Everest?«
»Gut«, sagte ich, müde lächelnd.
»Freust du dich auch schon auf den Abstieg?«
Ich schüttelte lachend den Kopf. »Nicht wirklich.«
Mein Onkel griff nach seinem Glas. »Also, ich bin mir ja nicht ganz sicher, ob mal ein Reinhold Messner aus dir wird, aber weißt du eigentlich, wie sehr ich dich mag?« Er nahm einen großen Schluck, wischte sich den Schaum vom Mund, sah auf die Berge und atmete einmal tief durch. Dann setzte er das Glas ab, beugte sich zu seinen wunden Bergsteigerknien hinab und murmelte leise: »Scheißkatharina.«
Am allermeisten genoss ich unsere spätabendlichen Gespräche im noch sonnenwarmen Garten, mit dem Sternenhimmel über und dem unermüdlichen Zirpen der Grillen um uns.
»Ich hatte auch mal eine Katharina, weißt du«, begann Onkel Valentin eines Abends, während er an einem Glas Rosé nippte, nachdem ich ihm wieder mal stundenlang mein Leid geklagt hatte. »Doch im Gegensatz zu dir hatte ich es nur mir selbst zu verdanken, dass sie mich eines Tages verlassen hat.«
Er sprach dann ungewöhnlich lange über diese Frau – Cecilia hieß sie –, die er wohl sehr geliebt hatte. »Vielleicht war mein Ehrgeiz schuld«, sagte er und starrte auf das nun leere Glas in seiner Hand. Er schenkte unsere Gläser noch einmal randvoll, nahm einen Schluck und meinte, damals habe er sich ständig »den Moment weggewünscht«, das sei seine »größte Sünde« gewesen. »Ich schrieb wie verbissen an meinem ersten Buch und konnte die Zeit mit ihr nicht genießen. Und das machte mich selbst ungenießbar. Wenn ich dieses Buch erst mal fertiggeschrieben habe, dachte ich, dann fängt mein Leben an. Immer hatte ich einen Zeitpunkt in der Zukunft im Kopf, auf den ich hingearbeitet habe. Für die Gegenwart hatte ich keinen Nerv. Irgendwann hatte Cecilia die Schnauze voll. Von mir – und zu Recht. Hat ihre Sachen gepackt und ist gegangen. Erst sehr viel später habe ich begriffen, wie unendlich kostbar die Zeit mit ihr war. Wie absurd es ist, sich den Moment wegzuwünschen, jeden Moment eigentlich, selbst die schwierigen. Denn was ist das Leben anderes als eine Aneinanderreihung von Momenten? Wenn man sich die andauernd wegwünscht, hat man sich am Ende das ganze Leben weggewünscht.«
Ich musste an meine eigene Situation denken. Wie ich mir wegen Katharina beinahe den gesamten Sommer weggewünscht hatte. Ich dachte an meinen Schmerz, den ich immer noch in mir spürte, wenn auch nicht mehr ständig und nicht mehr als dieses verzehrende Feuer. Eher wie eine Glut, von der bald bloß noch ein Häufchen Asche übrig bleiben würde.
Die Zeit heilt Wunden, heißt es. Aber das ist natürlich Unsinn. Es sind die Ereignisse, die sich in der Zwischenzeit abspielen, die uns heilen. Wie beim Körper muss auch das Abwehrsystem der Seele zuerst die Keime und den Zelltrümmerhaufen beseitigen, ehe sie genesen kann. Das allein benötigt Zeit. Danach kann die mühsame Bildung von neuem Gewebe beginnen, von neuen Blutgefäßen, neuer Haut.
Damals nahm ich mir vor, diesen Sommer mit meinem Onkel niemals zu vergessen. Seine Worte nie zu vergessen. Ich nahm mir vor, mein Leben so zu leben wie er oder zumindest so ähnlich wie möglich. Nahm mir vor, den Moment nicht dauernd wegzuwünschen. Ich nahm mir das alles ganz fest vor. Und vergaß es schließlich doch.
Ich vergaß sogar jene eigentlich unvergesslichen Worte, die Valentin mir in einer anderen dieser lauen Sommernächte im Garten der Villa noch sagte:
»Weißt du übrigens, wie ich auf Christopher gekommen bin?«
»Wie denn?«, fragte ich, wirklich sehr neugierig, denn damals träumte ich ja noch meinen großen Traum, Schriftsteller zu werden wie er.
»Du warst noch ein kleiner Junge und ein verdammt süßer obendrein, und ich dachte mir: Valentin, was machst du bloß, wenn du eines Tages, Gott behüte, vorzeitig den Geist aufgeben musst?