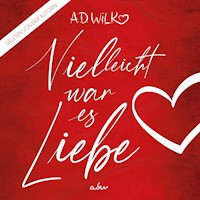7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
Was bleibt, wenn man sich selbst vergisst? Marly ist Pflegerin aus Überzeugung, doch seit acht Jahren schluckt sie im Heim ihre Gefühle runter und macht es allen recht. Als sie der Frage begegnet, welchen Wert sie hat, wenn andere ihr keinen geben, gerät ihr Leben aus den Fugen. Diese Frage löst eine Verwandlung aus, die sie zwingt, alles zu hinterfragen: ihre Arbeit, ihre Beziehungen zu ihrer Mutter und den anderen Menschen in ihrem Leben und ihr Selbstbild. Sie lernt, auf ihre innere Stimme zu hören. Unterstützt wird sie dabei von außergewöhnlichen Menschen, deren Geschichten sie berühren und inspirieren. Ein bewegender Roman über die Kunst, den eigenen Wert zu erkennen und das innere Licht endlich nach außen strahlen zu lassen. Eine Geschichte für alle, die spüren, dass in ihnen mehr steckt, als sie sich bisher zu leben erlauben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Weil du verdient hast,
zu sehen,
wie wertvoll du bist.
1
Ich betrachtete mich im Spiegel. Das gleiche Bild wie an jedem Morgen. Ich wollte mögen, was ich sah, und irgendwie tat ich das auch. Ich lächelte mir entgegen. Mein Spiegelbild erwiderte das Lächeln nicht besonders überzeugend. Nein, es war das falsche Kleid. Ein rotes Sommerkleid mit kurzen Ärmeln und einem knielangen Rock, das perfekt zu meiner leichten Sommerbräune und meinen dunkelblonden Haaren passte. Es ließ mich strahlen. Es war wunderschön und doch … es zeigte einfach zu viel von mir.
Schnell zog ich es mir wieder über den Kopf, denn ich wollte Tommy nicht länger warten lassen.
Ich entschied mich für eine Jeans, die nicht zu eng saß, und ein T-Shirt mit einem witzigen Spruch. Die Bewohner würden es mögen. Zumindest die, die meinen Humor teilten.
Ich mache keine Pausen, ich sammle Geschichten.
Noch einmal betrachtete ich mein Spiegelbild. Das Lächeln war jetzt überzeugend. Ja, so fühlte ich mich wohl. Das Kleid hängte ich zurück auf seinen Bügel, wo es noch etwas länger auf seinen ersten Einsatz warten würde. Wir hatten es vor zwei Jahren gekauft, als Tommy und ich unseren ersten gemeinsamen Urlaub auf Mallorca verbracht hatten. Er hatte es gemocht, doch ich hatte mich von Anfang an nicht wohl darin gefühlt.
Oder vielmehr sah ich mich gern darin, doch ich war nicht bereit, dass die Öffentlichkeit mich darin ansah.
»Marly, kommst du?« Er klang nicht genervt und doch löste die Frage ein paar Stresshormone aus ihren Verankerungen, die jetzt durch meine Blutbahnen schossen.
Ich warf einen Blick auf die Uhr. Es war halb sechs. In einer Stunde startete meine Schicht. Tommy begann erst um acht Uhr zu arbeiten, doch er verbrachte den Morgen im Fitnessstudio. Wenn ich Spätdienst hatte, begleitete ich ihn manchmal. Meistens war ich dafür jedoch zu müde. Und außerdem … die Vormittage wollte ich eigentlich für mein Projekt reservieren, in dem ich mich genauso gern sehen würde wie in dem roten Kleid, das jetzt wieder im Schrank hing. Doch auch das Projekt traute ich mir nicht überzuziehen. In diesem Fall jedoch nicht, weil es mich nicht strahlen lassen würde. Nein, es war einfach zu groß für mich. Und außerdem …
»Marly?«
»Ich komme.« Ich griff nach meiner Strickjacke. Am Morgen war es noch zu frisch für kurze Ärmel. Wenn ich das Haus Sophia am Nachmittag verließ, würden mich die langen Hosenbeine schwitzen lassen. Doch zu diesem Zeitpunkt wäre ohnehin jedes Kleidungsstück zu viel und das Einzige, was ich dann brauchte, wäre eine Dusche.
Tommy stand bereits vollständig angezogen im Flur. Für einen Moment betrachtete er mich. Ich konnte seinen Blick nicht deuten. Suchte er nach etwas? Hatte ich doch das falsche Outfit gewählt? War die Jeans zu eng? Doch dann lächelte er liebevoll und vertrieb damit fast alle Gedanken, die mich zuvor verunsichert hatten. »Ich mag es, dass du morgens keine Stunden im Bad damit verbringst, dein Gesicht anzumalen. So kann ich meine Marly viel besser sehen.«
Die Worte waren sicher lieb gemeint, doch erneut lösten sie Unsicherheit in mir aus. Nein, ich schminkte mich nicht. Und ich wusste, dass Tommy mich auch ohne Make-up mochte. Außerdem gab es keinen Grund, Lidschatten und Lippenstift zu tragen, wenn ich vollbepinkelte und anders besudelte Bettlaken wechselte. Doch das war nicht der Grund, aus dem ich darauf verzichtete.
»Lass uns gehen. Wir sind spät dran.«
»Und wessen Schuld ist das?« Er sagte es liebevoll und doch fühlte ich mich mies bei seinen Worten.
»Meine. Ich habe mein Outfit gewechselt.« Ich sagte es beiläufig, zog meine Sneaker an, die vor Jahren mal weiß gewesen waren, und griff nach meiner Tasche. »Wollen wir?« Ich zwang mich zu einem Grinsen. Manche Morgen begannen einfach mies.
Als wir eine knappe Minute später auf der Straße vor unserem Haus standen und uns auf den Weg zur U-Bahn machten, fühlte ich mich etwas besser. Zu dieser Uhrzeit war die Reichenberger Straße so ruhig, dass ich fast vergaß, dass wir uns mitten in Kreuzberg befanden.
»Mit wem arbeitest du heute?« Tommy verschränkte die Finger seiner linken Hand mit denen meiner rechten. Ich mochte es, dass wir auch nach vier Jahren Hand in Hand durch die Straßen liefen.
»Wenn alle kommen, die im Dienstplan stehen, sind es Jonas, Amanda von der Zeitarbeitsfirma und Gustav, der die Schichtleitung übernimmt, weil Gertrud noch krank ist.« Zu wenig Leute für die fast fünfzig Menschen, die wir betreuten. Mit Jonas kam ich in der Regel gut klar. Amanda mochte mich nicht und Gustav verteilte die Bewohner und die anderen Aufgaben so, dass er am wenigsten zu tun hatte und wir anderen noch weniger mit der Arbeit hinterher kamen, als es ohnehin schon der Fall war.
Doch ich beschwerte mich nicht. Das tat ich nie. Ich mochte meinen Job, auch wenn ich jedes Mal mitleidige Blick erntete, wenn ich jemandem erzählte, dass ich in der Pflege in einem Altenheim an der Grenze zu Marzahn arbeitete.
»Meinst du, du könntest Amanda heute mal ein bisschen Kontra geben?«
Jetzt war ich es, die die Augen verdrehte. »Wenn ich eine freie Minute finde, werde ich es tun.« Das würde ich nicht. Freie Minuten gab es nicht. Und wenn ich sie fand, nutzte ich sie, um den Bewohnern ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ich mochte die meisten von ihnen. Okay, manche hatten nicht nur die Namen ihrer Enkelkinder vergessen, sondern wussten auch nicht mehr, wie man menschlich mit anderen Menschen umging.
Doch einige von ihnen waren mir so sympathisch, dass ich mich gern auf Gespräche mit ihnen einließ, für die ich eigentlich keine Zeit hatte. Dabei würde ich sie mir gern nehmen. Diese Menschen waren es, die mich schon während meiner Ausbildung zu meinem Projekt inspiriert hatten. Ihre Lebensläufe waren interessant. Sie hatten so viel erlebt und es stimmte mich traurig, dass all ihre Geschichten ungehört blieben. Dabei war jede einzelne von ihnen es wert, dass die Welt sie kennenlernte.
Oftmals erhielten sie keinen Besuch von Verwandten. Es gab nur sehr wenige Bewohner, die gelegentlich für einen Ausflug abgeholt wurden. Die meisten verbrachten ihre Tage allein in ihren Zimmern oder in den Gruppenräumen. Zwischen manchen hatten sich Freundschaften entwickelt. Doch sie waren nicht besonders tief, denn jeder von ihnen wusste, dass das Haus Sophia kein Zwischenstopp war. Oder vielleicht war es das. Ein Zwischenstopp, von dem aus sie die letzte Reise ihres Lebens antreten würden.
»Du musst dir diese freie Minute nehmen, Marly.«
Ich atmete tief durch. »Amanda steht heute nicht auf meiner Prioritätenliste.«
»Marly. Warum setzt du sie nicht endlich drauf?« Er klang fast wütend.
Ich hatte den Fehler begangen, mich einmal zu oft über diese Frau bei Tommy zu beschweren. Beschweren. Ja, ich beschwerte mich, wenn ich über sie jammerte. Wenn Tommy mich allerdings nach meinem Tag fragte, wollte er auch immer wissen, was sie wieder getan hatte. Und dann erzählte ich es ihm. Und weil Tommy schon das ein oder andere Coaching über seinen Arbeitgeber im Bereich Persönlichkeitsentwicklung mitgemacht hatte, wollte er mir immer wieder erklären, wie ich mich in bestimmten Situationen verhalten sollte. Aber er hatte keine Ahnung, wie sich diese Situationen in der Realität anfühlten. Deshalb nützten mir seine gut gemeinten Tipps fast nie etwas und inzwischen war ich auch genervt von ihnen.
»Mal sehen.« Wir führten dieses Gespräch regelmäßig. Deshalb war ich froh, als wir die U-Bahn-Station am Kottbusser Tor erreichten. Hier würden sich unsere Wege trennen.
»Hab viel Spaß beim Training.« Ich stellte mich leicht auf die Zehenspitzen und küsste ihn.
Er erwiderte meinen Kuss. »Hab einen schönen Tag.« Mit einem Lächeln löste er die Verschränkung unserer Finger und drehte sich in die Richtung, in die sein Weg ihn führte. Ich stieg die Treppen zur Bahn hoch. Denn in diesem Teil der Stadt fuhr die U-Bahn oberirdisch auf über der Straße verlaufenden Schienen.
Ich wartete nicht auf das grüne Symbol der Ampel und überquerte die Skalitzer, während ich in meiner Tasche kramte, um einen Euro herauszuholen. Ich legte ihn der alten Frau, die an einen der riesigen Stahlpfeiler gelehnt saß, in den Becher und lächelte sie an. »Guten Morgen, Hilde.«
»Guten Morgen, Marly. Gott segne dich.« Ihre Stimme klang kratzig, ihr Gesicht wies die Spuren einer schlaflosen Nacht auf.
»Brauchst du noch einen Kaffee?« Ich sah zu dem kleinen Kiosk, der ein paar Meter entfernt stand. Eigentlich hatte ich keine Zeit, ihr einen zu kaufen. »Warte, ich bin gleich zurück.« Ich eilte zum Kiosk und fluchte innerlich, weil ein Mann vor mir ans Fenster trat. Nachdem er seine Zeitung bezahlt hatte, bestellte ich einen Kaffee mit viel Milch und Zucker.
Deniz, der Kioskbesitzer warf mir einen vertrauten Blick zu. »Du trinkst deinen Kaffee nicht mit Zucker.«
»Er ist für Hilde.« Ich deutete zu der alten Frau.
Deniz nickte, reichte mir den Kaffee und ein helles Brötchen. »Geht aufs Haus. Aber sag es ihr nicht.«
Lächelnd nahm ich den Becher und die Papiertüte entgegen. »Natürlich nicht. Mach ich doch nie.« Ich zwinkerte ihm zu, fragte mich für einen Moment, ob diese Geste zu viel war, und wandte mich dann ab. »Hab einen schönen Tag.«
»Du auch, Marly.«
Ich brachte Hilde die Sachen.
»Du bist ein Engel, Schätzchen.«
»Schau, dass du noch etwas Vernünftiges isst heute, ja?«
Sie lächelte nur matt, schnupperte an dem heißen Kaffee und versank wieder in ihrer Welt, die jetzt hoffentlich ein bisschen heller war.
Auch Hilde könnte Teil meines Projektes sein. Doch ich traute mich nicht, sie zu fragen, ob sie das wollte. Denn dies hätte bedeutet, dass ich jemandem davon hätte erzählen müssen. Auch vor Hildes Urteil hatte ich Angst.
Ich eilte die Stufen zum Bahnhof hinauf, doch als ich die Plattform erreichte, fuhr meine U-Bahn gerade davon. Mist! Die nächste würde zwar in ein paar Minuten kommen, doch meinen Anschlussbus würde ich verpassen. Das bedeutete, dass ich schon wieder zu spät kommen würde.
Resigniert ließ ich mich auf eine der Bänke sinken. Wieder einmal zeigte mir das Leben, dass Karma nur eine Erfindung von Leuten war, die anderen Angst machen wollten. Oder wie konnte es sein, dass ich etwas Gutes tat und Gustav dafür einen neuerlichen Grund gab, mich zu triezen?
2
Jetzt im Sommer war es hell, wenn ich morgens mit Bus und Bahn durch die Stadt fuhr. Im Winter waren die Frühschichten eine echte Herausforderung. In der hellen Jahreszeit blickten die Leute in den Öffis und an den Haltestellen ein bisschen weniger grimmig auf ihre Smartphones.
Ich scrollte selbst durch meinen Instagram-Feed und hatte keine Ahnung, welche Mimik ich dabei aufsetzte. Manchmal fragte ich mich, wer all die Leute waren, denen ich da folgte. Und, obwohl ich natürlich wusste, dass jeder nur die Sahnestückchen seines Lebens postete, fragte ich mich auch, wie sie es schafften, so toll auszusehen, solch fantastische Urlaube zu bezahlen und so viele Freunde zu haben.
Ich klickte auf meinen eigenen Feed. Es war Wochen her, seit ich selbst ein Bild veröffentlicht hatte. Ein großer Salat. Mein Geburtstagsessen.
Ich erreichte meine Haltestelle, ließ einem Mann in meinem Alter den Vortritt beim Aussteigen und überprüfte mein Äußeres, als ich um die Haltestelle herumlief und deren Rückseite mir mein Spiegelbild entgegenwarf. Für einen winzigen Moment sah ich mich in dem roten Kleid. Und für einen winzigen Moment bereute ich, dass ich es nicht angezogen hatte. Für den Weg zur Arbeit. Denn in ein paar Minuten würde ich ohnehin einen Kasack darüber ziehen.
Ich warf einen Blick auf die Uhr. Es war 6:33 Uhr. Verdammt. Ich beschleunigte meinen Schritt und rannte schließlich die Straße zum Haus Sophia hinauf. Schon nach wenigen Minuten kam mir Susi aus der Nachtschicht entgegen. Mal wieder hatte sie ihre Schicht ein bisschen früher als pünktlich beendet. Welche Überraschung! Ich verlangsamte meinen Schritt, um ihr trotzdem einen guten Morgen zu wünschen.
Sie strahlte mich an. »Frau Klein ist gerade gestorben. Sie steht auf deiner Liste. Tschühüss.« Sie winkte mir zu, zog genüsslich an ihrer Zigarette und spazierte dann weiter in die Richtung, aus der ich gerade gekommen war.
Ich stoppte und sah ihr nach. Frau Klein.
Ich schluckte den Kloß und das miese Gefühl hinunter, das die Diskrepanz zwischen ihren Worten und ihrem glücklichen Gesichtsausdruck ausgelöst hatte. Susi war schon seit zwanzig Jahren Pflegerin. Sie machte die Nachtschichten, weil ihr Rücken nicht mehr stark genug für den Frühdienst war. Und sie scherte sich nicht mehr darum, wenn eine Bewohnerin starb, weil es inzwischen vermutlich hunderte waren, die sie hatte gehen sehen.
Mir ging es anders.
Zwölf Minuten nach dem offiziellen Beginn meines Dienstes betrat ich das Dienstzimmer umgezogen und mit desinfizierten Händen. »Guten Morgen.«
Nur Gustav befand sich im Raum. Er starrte auf den Computermonitor, dessen Plastikrahmen breit genug war, damit wir dort Post-its anheften konnten. Es war ein alter Computer, ein altes Gebäude und die Bewohner zahlten nicht genug, damit der Träger es auf dem neuesten Stand halten konnte.
»Du bist zu spät.«
»Es tut mir leid.«
Ich betrachtete die Stecktafel. Zehn Bewohner waren mir zugeteilt, darunter die Verstorbene. »Wer hat Frau Klein gefunden?« Es erschien mir seltsam, dass ihr Tod schon festgestellt worden war, wo doch ich die Erste hätte sein müssen, die das Zimmer an diesem Tag betrat. Frau Klein wohnte allein. Es musste also während einer Runde der Nachtschicht geschehen sein.
»Susi. Vor etwa vier Stunden auf ihrer Runde über die Station. Der Arzt war sofort danach da, weil er sowieso gerade auf einer anderen Station gewesen ist.« Das bedeutete, dass mindestens drei Stunden vergangen waren, in denen Susi Zeit gehabt hätte, sich um Frau Klein zu kümmern.
Wut stieg in mir auf. Ich schluckte sie runter und fragte nicht, warum sie sich dann nicht selbst darum gekümmert hatte, sie für die Abholung durch den Bestatter vorzubereiten. Die Antwort darauf kannte ich genau. Sie hatte gewusst, dass ich kommen würde. Und sie wusste auch, dass ich mich nicht darüber beschweren würde.
»Ach, noch was. Amanda hat sich krank gemeldet. Du hast also auch die Hälfte ihrer Bewohner.«
»Schon wieder?«
»Es ist wieder Mittwoch.« Gustav zuckte nur resigniert mit den Schultern.
Fast hätte ich ihn gefragt, ob er nicht einspringen wollte, doch er hätte mir die gleiche Antwort gegeben wie jedes Mal. Keine Zeit.
Die hatte ich auch nicht. Und deshalb beeilte ich mich, um in Frau Kleins Zimmer zu gelangen. Sie war schon seit über einem Jahr hier gewesen. Ihre Familie hatte sich lange in ihrem Haus um sie gekümmert. Doch irgendwann waren sie dazu nicht mehr in der Lage gewesen. Frau Klein war eine der wenigen Bewohnerinnen gewesen, zu der jede Woche jemand kam, um ihr Geschichten von der Außenwelt zu erzählen, ihr zu zeigen, dass sie noch immer geliebt wurde und nicht allein war. Sie bekam Blumen, Schokolade und Umarmungen.
Das hatte sie auf der Station unter den anderen Bewohnern unbeliebt werden lassen. Denn die meisten hier erhielten nur sehr selten Besuch. Sie beneideten jene, bei denen das anders war. Zumindest die, die das noch wahrnahmen.
»Hallo, Ruth.« Ich schloss die Tür hinter mir und drückte auf den Schalter, der im Flur ein Licht aufleuchten ließ. Das Signal dafür, dass sich eine Pflegekraft im Zimmer befand.
Dann ging ich zu ihrem Bett und setzte mich auf einen Stuhl neben sie. Trotz der wenigen Zeit, die ich hatte, und der Minuten, die ich durch die verpasste Bahn verloren hatte, nahm ich mir diesen Moment. Ich griff nach der Hand der alten Frau, die den Holocaust überlebt hatte. Die Jahrzehnte damit verbracht hatte, Kindern in Schulen durch Vorträge und Gesprächsrunden nahezubringen, was sich in Geschichtsbüchern so trocken und unvorstellbar liest.
In den zehn Minuten, die ich mit ihr hatte verbringen können, wann immer sie auf meiner Liste stand, hatte sie mir von diesem Leben erzählt. Manchmal war ich nach meiner Schicht geblieben, um mir eine ihrer Geschichten anzuhören. Fast hätte ich sie gebeten, sie aufschreiben zu können. Sie für sie weitererzählen zu dürfen. Doch ich hatte es nicht getan. Bei keinem hatte ich es bisher gewagt.
Ihre Geschichten waren zu wichtig. Ich war nicht die Richtige, um sie festzuhalten.
Ruths Familie hatte darauf bestanden, dass sie sich um die Reinigung des Körpers kümmerten. Auch, dass sie sofort über den Tod informiert wurden, damit jemand bei dem Leichnam wachen konnte.
Erneut stieg Wut in mir auf, denn auch Susi wusste über diese Bitte Bescheid. Ruth war nicht die erste jüdische Bewohnerin, die hier starb.
Ihre Hand war kalt, als ich danach griff, und ich fröstelte etwas. Auf ihrem Gesicht lag ein friedlicher Ausdruck. So, als hätte sie ihn wirklich gefunden. Den Frieden. Fast achtzig Jahre, nachdem er offiziell verkündet worden war.
»Erzähl mir noch eine letzte Geschichte, Ruth.« Und ich lauschte. Hörte ihre Stimme, vernahm ihr Lachen und meinte, Worte zu erkennen, die sich zu einer Anekdote formten, die ich bereits kannte.
Seufzend stand ich auf. »Es war schön, dich gekannt zu haben.« Ich ging zu ihrem Kleiderschrank, nahm aus dem obersten Fach ein weißes Tuch heraus und ging zurück zum Bett. Die Familie hatte das Tuch dort deponiert und die Bitte geäußert, es nach ihrem Tod über Ruths Körper zu legen. Auch das hatte Susi gewusst. Bevor ich der Bitte nachkam, wechselte ich die Einlage in ihrer Netzunterhose. Es sollte nicht der Geruch nach altem Urin sein, der die Familie empfing, wenn sie hier auftauchte.
Als ich das Tuch über ihr ausgebreitet hatte, sah ich mich noch einmal im Zimmer um. Es gab nichts mehr für mich zu tun außer das Fenster zu öffnen. Damit die Seele den Raum verlassen kann. Noch in meiner Ausbildung hatte mich eine Sterbende darum gebeten. Seither tat ich es jedes Mal.
»Ruhe in Frieden, Ruth.« Ich wischte die Träne von meiner Wange, schaltete das Anwesenheitslicht aus und verließ das Zimmer. Susi mochte strahlen, wenn eine Bewohnerin starb. Für mich bedeutete jeder einzelne dieser Menschen etwas. Und auch wenn ich nach acht Jahren in diesem Beruf wusste, dass der Tod plötzlich kam und dazugehörte und dass es für die meisten der Bewohner eine Erlösung war, zu sterben, ließ mich ihr Gehen mit Schwermut zurück.
Zumindest für einen Moment. Und in diesem Moment wollte ich ihr Leben mit Respekt und sie nicht als einen toten Körper betrachten, um den sich gekümmert werden musste.
Zurück im Dienstzimmer fragte ich Gustav, wann die Verwandten kommen würden.
»Ich habe sie noch nicht angerufen.«
Entsetzt sah ich ihn an. »Warum nicht?«
»Es ist noch nicht mal sieben, Schätzchen. Lass die Leute schlafen.«
Schätzchen. Ich hasste es, wenn er mich so nannte. Doch ich sagte nichts. Wieder einmal schluckte ich meinen Ärger runter, denn es hätte sowieso nichts geändert, wenn ich ihm widersprochen hätte. Für Gustav war ich ein Schätzchen. Jemand, die er rumkommandieren und auf der er herumtrampeln konnte. Er würde damit nicht aufhören, nur weil ich ihn vor Wut heulend darum bat, es sein zu lassen.
Deshalb griff ich zum Telefon. »Wo ist die Nummer?«
Er reichte mir einen Zettel. Ganz so, als hätte er darauf gewartet, dass jemand kam, um ihm diesen Job abzunehmen. Dass ich dieser Jemand war, überraschte ihn vermutlich so wenig wie mich.
* * *
Acht Stunden später verließ ich das Haus Sophia durch die Glastür am Eingang. Meine morgendliche Befürchtung bestätigte sich nach den ersten Schritten. Es war viel zu warm für die lange Jeans. Die Sonne brannte vom strahlend blauen Himmel. Es mussten dreißig Grad sein. Auf dem Weg zum Bus hüpften Kinder mit Eis am Stiel an mir vorbei und ich blickte mich suchend nach der Quelle dafür um. Bestimmt hatten sie es im Supermarkt gekauft. Ich könnte die Einkäufe für das Abendessen hier erledigen und mir selbst ein Eis holen.
Ob Tommy Lust auf eine Tofu-Gemüse-Pfanne hatte?
Ich zog mein Telefon aus der Tasche, um ihn anzurufen, und sah auf dem Display drei verpasste Anrufe von meiner Mutter und fünf Textnachrichten. Etwas verkrampfte sich in mir. Ich machte mir keine Sorgen, dass etwas passiert sein konnte. Ich war ziemlich sicher, dass sie nur wieder etwas gefunden hatte, was ich falsch gemacht hatte. Vermutlich hatte ich vergessen, Großtante Irmgard zu ihrem Geburtstag anzurufen. War der nicht im Juli?
Am liebsten hätte ich die Nachrichten ignoriert und mich später mit ihnen beschäftigt. Doch jetzt, nachdem ich sie gesehen hatte, würden sie mich nicht mehr loslassen, ehe ich wusste, worum es ging, und darauf reagiert hatte.
Du hast mir noch nicht gesagt, wann ihr am Sonntag kommt.
Kein Hallo. Kein Wie geht’s dir? Stattdessen folgte fünfzehn Minuten später die nächste Nachricht:
Ich möchte meinen Tag auch planen. Gib mir bitte Bescheid.
Beide Nachrichten waren vor zehn Uhr eingetroffen. Sie wusste, dass ich arbeitete. Sie wusste, dass ich mein Telefon nicht bei mir trug, wenn ich arbeitete. Sie wusste, dass ich während dieser Zeit nicht erreichbar war. Schon wieder wurde ich wütend. Und sofort drückte ich die Wut zurück in die Ecke, in der sie seit dem Aufeinandertreffen mit Susi am Morgen hockte.
Die drei weiteren Nachrichten hatte sie über den Rest des Tages verteilt. Es waren Variationen der vorherigen.
Ich muss wissen, wann ich das Essen auf den Herd stelle.
Es dreht sich nicht alles nur um dich, Marlene. Ich habe auch ein Leben.
Wenn ihr nicht kommen wollt, sag es mir bitte rechtzeitig.
Ich seufzte tief, öffnete die Telefon-App und wählte ihre Nummer.
Sie nahm nach dem dritten Klingeln ab. »Oh, dass ich das noch erleben darf.«
»Ich habe gearbeitet.« Ich klang genervt und klein. Wie das kleine Mädchen, das ich in ihrer Gegenwart nie aufgehört hatte zu sein.
Natürlich hatte sie eine passende Antwort. »Du hättest dich gestern Abend melden können.«
Ich gab klein bei, weil es nichts brachte, mit ihr zu streiten. Es brachte nichts, sie daran zu erinnern, dass wir an jedem zweiten Sonntag zur gleichen Zeit bei ihr auftauchten und ich mich deshalb nicht gemeldet hatte. »Es tut mir leid. Ich hätte mich spätestens am Freitag gemeldet.« Es war die falsche Entschuldigung. Ich spürte es sofort.
»Freitag? Du denkst wirklich, ich hätte kein Leben, oder?«
»Nein, das glaube ich nicht. Ich weiß, du hast ein Leben. Und es tut mir leid, dass ich mich noch nicht gemeldet habe. Wir werden gegen elf Uhr da sein und wir bringen einen Kuchen mit.«
»Es wäre schön, wenn ihr dieses Mal wirklich pünktlich kommt. Und ich hoffe, es ist ein fettarmer Kuchen mit wenig Zucker. Wir müssen beide auf unsere Figur achten.«
Bähm. Zweimal. Sie hatte mir nicht nur einen Schlag verpasst, sondern mit dem ersten nur das Ziel festgelegt, um dann mit dem zweiten kräftig auszuholen und mich k. o. zu schlagen. Aus diesem Grund fehlten mir auch jegliche Worte, um etwas darauf zu erwidern.
»Was habt ihr denn heute noch vor, Schätzchen?« Für meine Mutter war nun alles gesagt, was sie gegen mich hatte richten können, und sie fand ihre liebevolle Seite wieder. Manchmal glaubte ich, dass sie selbst erkannte, wann sie zu weit gegangen war, und dann versuchte, es wiedergutzumachen, indem sie in die Rolle schlüpfte, die mich davon abhielt, den Kontakt zu ihr auf ein Minimum zu reduzieren.
Doch sie hatte mich Schätzchen genannt. Wie Gustav wusste sie nicht, dass ich das nicht mochte. Wie bei Gustav teilte ich dieses Wissen nicht mit ihr, denn es würde nichts bringen.
»Nichts. Tommy arbeitet bis sechs. Dann essen wir und vielleicht schauen wir noch einen Film. Ich war gerade auf dem Weg zum Supermarkt, um für das Abendessen einzukaufen.«
»Du solltest ihn auch mal an den Herd lassen, Marlene.« Der nächste Schlag. Natürlich unbewusst.
»Das mache ich. Aber Tommy arbeitet viel länger als ich und mir macht es Spaß, in der Küche zu stehen und das Essen vorzubereiten.«
»Arbeitet er nicht so lange, weil er morgens zum Sport geht? Dann solltest du am Abend zum Sport gehen.« Der nächste wenig dezente Hinweis auf meine Figur.
»Ich bin jetzt beim Supermarkt. Wir sehen uns am Sonntag. Schreib uns, was wir noch mitbringen sollen.«
Sie startete noch ein paar Versuche, das Gespräch aufrechtzuerhalten, doch ich würgte sie ab und beschleunigte meinen Schritt. Ganz so, als könnte sie sehen, dass ich gelogen und den Supermarkt noch gar nicht erreicht hatte.
Das führte dazu, dass ich noch mehr schwitzte, noch mehr bereute, dass ich nicht das rote Kleid angezogen hatte. Doch das war Unsinn. Es hätte dafür gesorgt, dass ich auffiel. Und zwar durch dunkle Flecken unter den Achseln. Und das war das Letzte, was ich in diesem Moment wollte.
Ich betrat den Supermarkt und ließ mich von der durch umweltvernichtende Klimaanlagen erzeugten Polartemperatur empfangen. Für einen Moment genoss ich die Abkühlung, dann nahm ich mir einen Korb, in den ich nach und nach die Lebensmittel legte, die ich für das nicht abgesprochene Abendessen brauchte. Und weil ich wusste, dass Tommy mit Tofu und Gemüse nicht ganz so glücklich sein würde, ich ihn aber jetzt nicht mehr anrufen wollte, um ihn zu fragen, legte ich schlechten Gewissens zwei Scheiben Fleisch zu den Bio-Bohnen. Konventionelles Fleisch, auch wenn ich wusste, dass dies nicht richtig war.
Fast schon suchte ich die Blicke der anderen Leute, erwartete, dass sie meinen Korbinhalt genau analysierten, um sich ein Bild von der Frau Ende zwanzig zu machen, die in viel zu warmen Hosen Dinge einkaufte, die ihren Klima-Fußabdruck enorm vergrößerten. Denn auch das Tofu war aus Umweltsicht nicht die beste Fleischalternative, oder?
Das Eisregal ließ ich unbeachtet. Zumindest versuchte ich es, denn es schrie mich fast an: Du darfst hier nichts nehmen. Du bist zu dick.
Es klang wie meine Mutter. Nur deutlich eisiger.
Der Tag hatte okay angefangen, hatte traurig und mies Fahrt aufgenommen und fand nun einen Höhepunkt, der mich bis in den Abend hinein begleiten würde. Vielleicht konnten Tommy und ich wenigstens einen schönen Abend miteinander verbringen. Doch ich sah mich schon allein vor dem Fernseher sitzen, während er in unserem gemeinsamen Arbeitszimmer an seinem unordentlichen Schreibtisch stand und sich um unsere Altersvorsorge kümmerte, während er irgendwelche Ebenen und Grafiken betrachtete, die für mich so viel Sinn ergaben wie die Zellstruktur eines Elefantenfußes. Er tat es für uns, aber manchmal wünschte ich mir, dass er einfach neben mir auf der Couch sitzen würde.
Denn ich fühlte mich mies, wenn ich es allein tat. Es war unser gemeinsames Arbeitszimmer. Wir hatten es uns mit dem Ziel eingerichtet, dass wir dort an Dingen arbeiteten, die uns irgendwie weiterbrachten. Tommy mit den Aktien und ich mit meinem Projekt, von dem ich selbst ihm nur sehr schwammig erzählt hatte.
Ich hatte also meinen eigenen Schreibtisch, weil ich selbst etwas tun wollte. Es war kein Stehschreibtisch, wie Tommy einen hatte. Aber nicht einmal sitzen tat ich daran. Der Laptop hatte eine dicke Staubschicht auf dem Deckel, weil ich ihn nicht einmal öffnete, um darauf Netflix zu gucken oder E-Mails zu beantworten. Dafür hatte ich schließlich mein Handy.
»Haben Sie unsere App?« Die Kassiererin riss mich aus meinen Gedanken.
Ich sah mich um, um mich daran zu erinnern, was das für ein Supermarkt war, und schüttelte dann den Kopf. »Nein, tut mir leid.«
Sie lächelte freundlich und ich betrachtete sie. Das ausgewaschene Uniformshirt war ihr etwas zu eng. Sie war nicht geschminkt und ihre Haare waren zu einem Pferdeschwanz gebunden, der sich langsam löste. Auf ihrem Namensschild stand Teresa Sommer.
»Nehmen Sie sich gern einen Flyer mit.« Sie reichte mir einen und ich nahm ihn, auch wenn ich wusste, dass ich mir die App nicht installieren würde. Aber ich wollte nicht, dass sie sich schlecht fühlte. Irgendwie wirkte sie traurig.
Danach schwiegen wir, bis sie mir den Betrag nannte und wir uns gegenseitig einen schönen Nachmittag wünschten.
Als ich den Supermarkt mit zwei vollen Einkaufstüten verließ, empfing mich die Hitze und die Aussicht auf die Rücklichter meines Busses, den ich soeben verpasst hatte.
3
Es dauerte über eine Stunde, ehe ich die Tür zu unserer Wohnung aufschloss. Mein T-Shirt klebte mir am Rücken, unter den Achseln hatten sich nun auch bei diesem Kleidungsstück große dunkle Flecken gebildet und die Haare klebten in meinem Gesicht.
Doch ich schwitzte nicht so sehr wie das Tiefkühl-Gemüse in meiner Tasche. Wieder konnte ich die Stimme meiner Mutter in meinem Kopf hören.
Du hättest eine Kühltasche nehmen sollen, Marlene. Wie kommst du überhaupt auf die Idee, Gefrorenes bei dieser Hitze so weit entfernt von deiner Wohnung zu kaufen? Und überhaupt, warum kaufst du im Sommer nichts Frisches?
Ich ließ die Einkaufstaschen zu Boden sinken und presste die Hände auf meine Schläfen. Seit Jahren versuchte ich, ihre Stimme zu ignorieren. Seit Jahren war mir klar, dass sie da war und dass sie nicht zu mir gehörte. Trotzdem schaffte ich es einfach nicht, sie nicht zu hören.
Meine Mutter hatte mich nie als dumm oder unfähig bezeichnet. Stattdessen hatte sie mich immer gelobt. Mir und vor allem den Leuten, die uns besuchten, immer erklärt, wie begabt und schlau ich war.
Es waren die subtilen Bemerkungen, die unterschwellige und offene Kritik an meinem Aussehen, meinen Handlungen und meinen Entscheidungen, die dazu geführt hatten, dass ich mich dumm und unfähig fühlte. Und dass es für andere leicht war, dieses Gefühl in mir zu verstärken. Es war leicht für andere, in mir das Opfer zu erkennen, zu dem meine Mutter mich gemacht hatte.
Und ich war deshalb so wütend auf sie. So viele Briefe hatte ich ihr bereits geschrieben, in denen ich sie dafür anklagte, dass sie mich zu diesem Menschen gemacht hatte. Natürlich hatte ich keinen davon an sie geschickt. Sie würde es ohnehin nicht verstehen. In ihren Augen war sie die perfekte Mutter. Sie hatte immer für mich und meinen Bruder gesorgt. Sie hatte es ohne einen Mann im Haus geschafft, uns ein gutes Leben zu ermöglichen. Wir hatten beide die Schule beendet, mein Bruder hatte studiert und praktizierte als Chirurg in einem Krankenhaus in München. Von außen betrachtet hatte sie alles richtig gemacht. Sie hatte ihr Bestes gegeben. Und dafür liebte ich sie.
Es hätte schlimmer kommen können.
Dieser Gedanke beruhigte mich. Ich wischte mir die Tränen und den Schweiß von den Wangen und atmete tief durch. In einer Stunde würde Tommy nach Hause kommen und dann wollte ich geduscht sein und das Abendessen auf den Tisch stellen. Außerdem war heute Mittwoch. Der Tag, an dem ich staubsaugte.
Ich beschloss, damit zu beginnen. Es würde keinen Sinn machen, vorher zu duschen. Also brachte ich die Einkäufe in die Küche, räumte sie eilig in den Kühlschrank, raste durch die Wohnung, um den Boden von all den Dingen zu befreien, die wir trotz des Mantras Leg es nicht ab, leg es weg. immer wieder fallen ließen. Nun ja, eigentlich war es vor allem Tommy, dessen Kram überall rumlag. Wenn ich nicht ständig hinter ihm her räumen würde, würde die Wohnung in seinem Chaos versinken. Es gab nicht viele Dinge, die mich an ihm nervten, weshalb ich es in der Regel kommentarlos tat.
Ich holte den Staubsauger aus der Kammer. Ich liebte diese Kammer. Sie verbarg all die Dinge, die ich nicht sehen wollte. So etwas brauchte ich für meinen Kopf. Eine Kammer, in die ich die Wut und all die Worte meiner Mutter schieben konnte.
Nach dreißig Minuten hatte ich unsere drei Zimmer, den Flur, die Küche und das Bad gesaugt, den Behälter des Staubsaugers in eine Mülltonne im Hof entleert und das Gerät zurückgestellt. Ich sprang unter die kalte Dusche, verzichtete auf das Haare waschen und ging mit Shorts und Tanktop bekleidet in die Küche. Auch hier räumte ich zunächst das Geschirr vom Abend in den Geschirrspüler, bevor ich ein Brett auf die Arbeitsplatte, Töpfe und Pfanne auf den Herd stellte.
Dann klingelte mein Telefon. Ich wollte es ignorieren, befürchtete einen weiteren Anruf meiner Mutter, doch ein tiefes Pflichtgefühl ließ mich den Anruf annehmen.
Es war das Haus Sophia. Helena, die eigentlich ganz nett war. Dennoch hatte ich ein mieses Gefühl im Bauch. Es konnte nicht viele Gründe geben, aus denen das Pflegeheim bei mir anrief. Und der wahrscheinlichste war, dass jemand sich krank gemeldet hatte und ich einspringen sollte. Ich hoffte nur, dass es sich um die Nachtschicht handelte, denn dann könnte ich noch ein paar Stunden schlafen.
»Hallo, Helena. Was gibt es?«
»Es geht um Ruth Klein.«
Mein Herzschlag beschleunigte sich. Hatte ich etwas falsch gemacht? In Gedanken ging ich die wenigen Minuten in ihrem Zimmer durch. Hatte ich etwas vergessen? War sie am Ende gar nicht tot gewesen und ich hatte es übersehen? Hatte Susi mich reingelegt?
»Ihre Familie hat darum gebeten, noch einmal mit dir sprechen zu dürfen.«
»Warum?« Ich hörte die Defensive in meiner Stimme so deutlich, dass ich die Augen schloss und aktiv versuchte, mich zu beruhigen. Verdammt, Marly, das hast du doch gar nicht nötig. Du hast alles richtig gemacht.
»Das weiß ich nicht genau. Sie haben mich nur gebeten, dir ihre Nummer zu geben. Ich sage sie dir durch, ja?«
Irritiert stimmte ich zu. Nachdem ich die Zahlen notiert hatte, fragte ich: »Aber warum?« Es war nicht üblich, dass Pflegerinnen sich mit Angehörigen trafen.
»Sie waren etwas enttäuscht, dich nicht angetroffen zu haben, als sie heute Vormittag hier waren, um Ruth abzuholen.«
»Niemand hat mir Bescheid gesagt. Ich war damit beschäftigt, Essen an die Bewohner anzureichen, die das alleine nicht mehr können.« Tatsächlich war ich traurig darüber gewesen, dass ich die Familie nicht mehr gesehen hatte. Irgendwie hatte ich erwartet, dass auch wir uns voneinander verabschiedeten. Das hatte ich bisher immer getan. Nicht alle Bewohner wurden von ihren Familien abgeholt, oft kam nur das Bestattungsunternehmen. Doch häufig kam später jemand, der das Zimmer ausräumte.
»Es tut mir leid. Da ist wohl etwas schiefgelaufen. Sie wollten noch einmal mit dir sprechen.«
»Okay.« Ich strich mit den Fingern über die Zahlen, unsicher, was ich damit anfangen sollte.
»Dann sehen wir uns morgen zum Schichtwechsel.« Sie zögerte für einen Moment. »Da fällt mir ein, ich weiß, Sonntag ist dein freier Tag, aber könntest du für Susi einspringen und ihre Nachtschicht übernehmen?«
Ich presste die Lippen aufeinander. Wenn ich die Nachtschicht übernahm, wäre ich nicht vor halb acht zu Hause. Dann hätte ich nicht einmal zwei Stunden Zeit, um zu schlafen, damit wir rechtzeitig zu meiner Mutter losfahren könnten.
»Marly?«
Das Nein lag mir bereits auf der Zunge, doch ich brachte es nicht heraus. »Sicher.« Erschrocken über mich selbst, wollte ich zurückrudern, doch Helene verhinderte, dass ich ein weiteres Wort sagte.
»Klasse, das erspart mir eine Menge Kopfschmerzen.« Sie bot mir keinen Ausgleich an. Keinen freien Tag, der diesen ersetzen würde. Es waren weitere Überstunden, die ich seit acht Jahren auf meinem Konto anhäufte, ohne sie in Freizeit umzuwandeln. Ich war ziemlich sicher, dass die meisten ohnehin nicht erfasst wurden. »Mach’s gut, Marly. Bis morgen.« Mit diesen Worten legte sie auf.
Und ich verfluchte mich. Die Wut, die sich seit heute Morgen gegen all die anderen Menschen in mir aufgebäumt hatte, richtete ich nun gegen mich. Ich war dumm. Dumm und unfähig, für mich selbst einzustehen. Ich ließ einfach alles mit mir machen. Dumme, kleine Marly.
Wieder rannen Tränen über mein Gesicht. All das war so unfair. Doch im nächsten Moment erkannte ich auch hier wieder den Fehler. Nein, das Leben war nicht unfair. Es war, wie es war. Ich war diejenige, die es nicht packte, damit umzugehen. Alle anderen schafften es schließlich auch. Ich kannte niemanden, der eine so unsichere Ja-Sagerin war wie ich. Ich war selbst schuld. Und das Schlimmste war: Ich sah keinen Ausweg.
Mein Blick fiel auf die Telefonnummer von Familie Klein. Jetzt würde ich sie auf keinen Fall anrufen. Ich würde es morgen tun. Vielleicht in meiner Pause. Wenn ich denn dazu kam, sie zu nehmen. Ich speicherte die Nummer ab, brachte den Zettel in unser Arbeitszimmer und legte ihn auf einen Stapel mit Papieren, um die ich mich kümmern wollte, wenn ich die Zeit dafür fand. Nein, mir die Zeit dafür nahm, wie Tommy immer so schön sagte. Er hatte ja recht. Anstatt den Abend mit der neuesten Netflix-Serie zu verbringen, könnte ich heute diesen Stapel angehen. Bei diesem Gedanken regte sich Widerstand in mir und ich verließ das Arbeitszimmer hastig und schmiss die Tür hinter mir zu.
»Hey, ist alles okay?« Tommy.
Ich warf einen panischen Blick auf die Uhr an meinem rechten Handgelenk. »Was machst du hier?«
Er legte amüsiert den Kopf schief und kam dann zu mir, küsste mich, legte seine Arme um meine Taille und ich vergaß den Stapel, den Zettel mit der Telefonnummer und überhaupt alles. Hungrig erwiderte ich seinen Kuss. Das war genau das, was ich gerade brauchte.
Ich spürte, wie sich sein Mund zu einem Grinsen verzog, und ließ im selben Moment meine Hände unter sein Shirt gleiten. Auch er war verschwitzt. Es störte mich nicht. Im Gegenteil, es machte mich an.
Ich zog ihn ins Schlafzimmer auf das ungemachte Bett, wo er mir die Shorts über die Beine streifte und sich selbst auszog. Wir waren schnell. Es war zu heiß für eine lange Nummer. Und dennoch war dieser Moment wie eine Reise in eine andere Welt. Ich spürte, wie sehr Tommy mich begehrte. Wie fokussiert er auf mich war. Er gab mir das Gefühl, geliebt zu werden, und ich, Gott, ich liebte ihn so sehr. Ich brauchte ihn, damit er mich aus diesem Höllentag befreite.
Als er in mir kam, raste Sekunden später auch durch mich das Feuerwerk, das ich nur mit ihm erreichte, und ich sank auf ihm zusammen, als der letzte Funke verglomm. Lächelnd, entspannt. Für den Moment voll Frieden und Ruhe. »Du schwitzt.«
Er lachte leise. »Das liegt an der heißen Frau auf mir.« Er drehte meinen Kopf so, dass ich ihn ansah. »Begrüßt du mich ab jetzt immer so, wenn ich früher nach Hause komme?«
»Mh, das könnte sein.« Ich betrachtete ihn. Das am Morgen frisch rasierte Gesicht wies Stoppeln auf. Sanft strich ich darüber. »Ich liebe dich, weißt du das?«
»Ja, das weiß ich. Ich liebe dich auch.«
Für einen Moment dachte ich an das Essen, den Rat meiner Mutter, Tommy an den Herd zu stellen, und darüber nach, ihm davon zu erzählen. Doch ich wollte sie nicht in diesem Moment haben. Er gehörte nur uns beiden. Für diese wenigen Minuten wollte ich den Ratschlägen all der weisen Lehrer der Persönlichkeitsentwicklung Gehör schenken. Ich wollte nur im Hier und Jetzt sein.
4
Als wir ein paar Stunden später gemeinsam an unseren Schreibtischen saßen und standen, war das Gefühl aus dem Schlafzimmer zwar abgeebbt, doch nicht verschwunden. Wir hatten es genährt, zusammen geduscht und gekocht, gegessen und über schöne Dinge gesprochen. Tommy schien überrascht, dass ich mich danach nicht auf die Couch legte und den Fernseher einschaltete, kommentierte aber nicht, dass ich ihm ins Arbeitszimmer folgte. Und ich sagte auch nichts dazu. Immerhin war ich genauso überrascht wie er.
Ein Glas Wein stand auf jedem unserer Tische und ich setzte die Kopfhörer auf, damit ich das Tippen seiner Finger auf der Tastatur nicht hörte. Er hatte eines von diesen wahnsinnig lauten Keyboards. Ich hatte keine Ahnung, wie er darüber seine eigenen Gedanken hören konnte. Ich verstand meine nicht, wenn er neben mir arbeitete.
Also wählte ich meine Spotify-Playlist aus, in der ich eine Mischung aus Songs von Singer-Songwritern, Blues und Jazz gespeichert hatte. Der erste Song war von Anna & Grace. Ich hatte die beiden im letzten Jahr mehrmals live in einer Fußgängerzone spielen sehen und ihre Geschichte bis zu jenem Konzert verfolgt, von dem sie so lange geträumt hatten. Tommy und ich waren sogar dort gewesen. This is my dream, drang Annas Stimme durch die Lautsprecher meiner Kopfhörer und ich ließ mich wie jedes Mal in den Song fallen, bis eine Träne meine Wange hinabrollte. Die Geschichte der beiden Frauen, die es gewagt hatten, ihren Traum zu leben, obwohl sie wussten, dass sie nur so wenig Zeit dafür haben würden, beschäftigte mich. Sie war der Grund gewesen, warum ich überhaupt diesen Schreibtisch hatte haben wollen. Warum ich überhaupt auf die Idee gekommen war, selbst darüber nachzudenken, wovon ich eigentlich träumte.
Doch ich hatte bisher keinen Weg gefunden, meinen Traum auch nur so weit zu leben, dass ich überhaupt daran glaubte, dass er jemals wahr werden könnte. Ich stand mir selbst im Weg und ich hatte keine Ahnung, wie ich diesen Teil von mir loswerden konnte.
Das Lied verklang und ich ließ den Blick über den Schreibtisch gleiten. Er landete bei dem Stapel Papiere, den ich heute schon einmal ignoriert hatte. Und ich tat es erneut, öffnete ein Schubfach und legte all die Formulare und Rechnungen hinein. Morgen war dafür auch noch genug Zeit. Ich würde es sofort tun, wenn ich zu Hause ankam. Und dieses Mal würde ich meinen Bus bekommen.
Als ich das Schubfach schließen wollte, fiel mein Blick auf die Telefonnummer von Frau Kleins Familie. Jetzt war es zu spät, sie anzurufen. Ohnehin wäre es am heutigen Tag sicher pietätlos, oder? Ich schüttelte den Kopf. Auch das würde ich morgen erledigen.
Ich schloss das Fach, öffnete meinen Laptop, gab meinen Code in die Anmeldemaske ein und starrte dann für einen weiteren Song auf den Bildschirm. Was genau hatte ich tun wollen? An meinem Projekt arbeiten. Doch das war keine Aufgabe, oder? Es war lediglich ein schwammiges Etwas, das ich nicht greifen und schon gar nicht durchführen konnte. Es waberte vor mir herum und ich konnte weder seine Form erfassen noch hindurchsehen.
An meinem Projekt arbeiten.
Ich öffnete den Browser und gab in die Suche ein: Wie arbeite ich an einem Projekt?
Ich kam mir so dumm dabei vor, diese Frage zu stellen. Und noch dümmer, als ich all die Blog-Beiträge und YouTube-Videos sah, die sich mit Projektmanagement, Teamleitung und irgendwelchen Software-Tools befassten, von denen ich noch nie etwas gehört hatte. Dafür war das, was ich vorhatte, ja nun wirklich zu klein. Ich fühlte mich wie eine Hochstaplerin. Projektmanagement. So ein Blödsinn.
Ich wollte aufgeben, doch auf die Couch gehen, mich in die Welt fallen lassen, die sich irgendein schlaues Serienproduktionsteam ausgedacht hatte, um Leute wie mich an diesen anderen Bildschirm zu fesseln. Und warum auch nicht? Hatte ich nicht genug gearbeitet für diesen Tag? Hatte ich nicht genug von mir verlangt?
Ich schloss die Augen, atmete tief durch und öffnete die Seite eines Chatbots, über den ich mit einer künstlichen Intelligenz sprechen konnte. Tommy hatte mir gezeigt, wie es ging, als ich auf der Suche nach Reinigungstipps für unseren Ofen mit der herkömmlichen Internetsuche nicht weitergekommen war.
Herkömmlich. Als würden wir seit dreihundert Jahren nach Sachen googeln, die wir uns nicht gemerkt hatten oder nach denen wir unsere Mütter nicht fragen konnten. Oder wollten, weil sie einem dann vorhalten würde, dass wir es überhaupt so weit hatten kommen lassen, dass der Ofen nicht mehr leicht zu reinigen war.
Ich tippte in das Eingabefeld: Wie arbeite ich an einem Projekt? Bitte erkläre es mir, als wäre ich drei Jahre alt.
Und das tat die KI:
Natürlich! Lass uns das ganz einfach machen, wie ein Spiel:
1. Was willst du bauen?
Stell dir vor, du möchtest ein tolles Lego-Haus bauen. Du brauchst eine Idee, wie es aussehen soll.
2. Welche Steine brauchst du?
Schau dir deine Lego-Steine an und überlege, welche du für dein Haus brauchst. Du brauchst vielleicht rote, blaue und grüne Steine.
3. Schritt für Schritt bauen
Fang an, dein Haus zu bauen. Erst der Boden, dann die Wände und am Ende das Dach. Immer einen Stein nach dem anderen.
4. Helfer finden
Vielleicht helfen dir Mama oder Papa oder ein Freund. Sie können dir Steine geben oder dir zeigen, wie man sie zusammensteckt.
5. Fertigstellen und spielen
Wenn das Haus fertig ist, kannst du damit spielen und stolz sein, dass du es gebaut hast!
So ist es auch bei einem Projekt. Es ist wie ein großes Lego-Haus bauen: Du brauchst eine Idee, die richtigen Teile und gehst Schritt für Schritt vor. Und manchmal helfen dir andere Leute dabei. Viel Spaß beim Bauen!
Wieder starrte ich auf den Bildschirm. Dieses Mal nicht gelähmt vor Hilflosigkeit, sondern vollkommen beeindruckt. Konnte es so einfach sein? Konnte ich mein Projekt auf die gleiche Weise bauen, wie Anton und ich als Kinder Lego-Häuser gebaut hatten?
Für einen Moment schloss ich die Augen und sofort erschien das Bild von einem riesigen Lego-Haus vor mir. Viel zu groß für mich. Doch dann erinnerte ich mich an Punkt drei. Schritt für Schritt bauen. Ich verwarf den Gedanken, dass ich das nicht hinbekommen würde, und sah mir das Haus genauer an. Ich wusste, was ich wollte.
Ich wollte einen Raum schaffen, in dem die Geschichten der Menschen weiterleben konnten. In dem sie von anderen gehört wurden. Ein Raum, in dem Menschen zusammenfinden konnten, um voneinander zu lernen. Es gab so viele wertvolle Seelen dort draußen. Und sie sollten in meinem Lego-Haus Platz finden.
Das schlechte Gewissen hämmerte gegen meinen Kopf und das Haus fiel in sich zusammen. Schnell öffnete ich die Augen, um das Bild nicht ansehen zu müssen.
Langsam schüttelte ich den Kopf. Ich tat so, als würde ich das für die anderen Leute machen, doch wenn ich ehrlich war, machte ich es vor allem für mich. Ich wollte diese Geschichten hören und damit etwas tun. Ich wollte etwas schaffen, damit ich mich gut fühlte. Das war doch nicht richtig, oder?