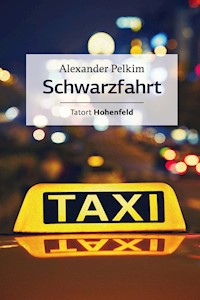Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Zwei Tote und ein Schwerverletzter in der Adventszeit - keine guten Aussichten auf "Frohe Weihnachten" in Iphofen. Theo Habich und sein Team stehen vor einer schwierigen Aufgabe. Alle anfänglichen Spuren verlaufen im Sand und es sind keine wirklich Verdächtigen in Sicht. Die Andeutung über eine Schuld aus der Vergangenheit führt den Hauptkommissar ins Iphöfer Stadtarchiv. Wirft eine dort dokumentierte alte Mordgeschichte ihre Schatten bis in die Gegenwart? Im Jahre 1852 geschahen auf Iphöfer Flur zwei Gewaltverbrechen. Die Opfer waren ein junger Handwerksmeister und ein Jagdaufseher. Doch was hat die Winzerfamilie Birkner - aus deren Reihen die aktuellen Opfer kommen - damit zu tun? Welche Rolle spielt ein amerikanischer Historiker, der mit Karola Birkner - einer der Töchter - liiert ist?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 401
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexander Pelkim
Unheilvolle Vergangenheit
Alexander Pelkim
UnheilvolleVergangenheit
Tatort : Iphofen
Die Handlung und die handelnden Personen dieses Romans sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit toten oder lebenden Personen ist nicht beabsichtigt und wäre rein zufällig.
Der Umwelt zuliebe verzichten wir bei diesem Buch auf die Folienverpackung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.d-nb.de› abrufbar.
1. Auflage 2021
© 2021 Echter Verlag GmbH, Würzburg
www.echter.de
Umschlag: Tobias Klose, Würzburg
Umschlagbild: Olaf Holland/Shutterstock
Satz: Crossmediabureau – https://xmediabureau.de
E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de
ISBN
978-3-429-05588-2 (Print)
978-3-429-05133-4 (PDF)
978-3-429-06517-1 (ePub)
Inhalt
Wilderer
Ein Todesfall
Ein alter Bekannter
Künstlerpech
Frisch gepresst
Die Rebellin
Eine alte Geschichte
Ereignisreiches Wochenende
Erster Lichtblick
Viel Vergangenes
Ermittlungsdruck
Habichs Theorie
Nachwort
Wilderer
Hunger tut weh, ob im eigenen Magen oder beim Anblick der hungernden Kinder. Dies wurde Wilhelm Burgecker angesichts der jammernden und quengelnden Sprösslinge erneut schmerzlich bewusst. Die zwei kleinen Würmer, die litten, waren seine ein- und dreijährigen Söhne, Julius und Philipp. Der große hagere Mann rieb sich nachdenklich die Hände. Von dem wackeligen Stuhl aus, auf dem er saß, beobachtete er die Kleinen. Der Jüngste lag in einem geflochtenen Wäschekorb, schrie und weinte. Sein Bruder hockte auf dem blank gescheuerten Holzboden, kaute auf einer geschnitzten Holzfigur herum und stimmte zwischendrin immer mal wieder in das Geschrei mit ein. Wilhelm besann sich auf seine eigene Kindheit, in der oftmals Mahlzeiten ausfallen mussten oder das Essen zumindest so knapp war, dass ihre Mutter verzichtete, um den Kindern das Wenige zu überlassen. Sie war gezwungen betteln zu gehen, da sie zu einer sozialen Schicht gehörte, der nichts anderes übrig blieb, wollten sie und ihre Kinder überleben.
»Sag mir, wie ich die hungrigen Mäuler stopfen soll!« Eine Frau, den Arm voller Kleidungsstücke, betrat den Raum. Mit traurigen dunklen Augen und besorgtem Blick sah sie auf die beiden Kleinen, während sie die Kleidung auf den Tisch legte. Clara Zirner, die Mutter der Kinder, wirkte müde, niedergeschlagen und ratlos. Nachdenklich beobachtete Wilhelm seine gleichaltrige Partnerin. Sie war weiß Gott keine Schönheit und sah nicht wie Ende zwanzig aus, ging es ihm durch den Kopf. Dafür war sie fleißig und treu, und das zählte für ihn mehr als Aussehen. Zudem ließen das Leinengewand, die Schürze und ihr Kopftuch die Achtundzwanzigjährige wesentlich älter erscheinen. »Es ist nichts Essbares mehr im Haus außer einer harten, trockenen Brotkante.«
»Kannst du nicht vielleicht … « Wilhelm zögerte und stammelte verlegen. » … den … den Bauern … ich meine wegen ein paar Kartoffeln … es war doch eine gute Ernte und der Keller ist gefüllt.«
»Hast du vergessen, dass ich diesen Monat schon mal bei ihm war?«
»Ja, ja, aber ich bekomme frühestens am Monatsende wieder Lohn und das ist erst in knapp einer Woche, ich habe nichts mehr«, entschuldigte sich Wilhelm. »Er bekommt es ja wieder und außerdem helfe ich, sooft ich kann, unentgeltlich auf dem Hof und im Weinberg. Ist das etwa nichts? Dafür kann er sich doch wohl mit ein paar Kartoffeln erkenntlich zeigen«, knurrte Wilhelm leicht gereizt.
»Dafür darfst du kostenfrei mit hier drin wohnen.« Clara seufzte ergeben. »Ich kann es ja mal probieren, habe aber wenig Hoffnung.«
»Das nennst du wohnen?«, schimpfte Burgecker und machte eine ausladende Bewegung mit den Armen. »Diese baufällige Bruchbude, bei der durch sämtliche Ritzen der Wind pfeift und die Feuchtigkeit dringt?«
Was er meinte, war ein zweistöckiger Anbau im Fachwerkstil, der an die Stallungen grenzte. Die Fensterrahmen und Riegelfelder zeigten Spuren von Verwitterung und Abnützung, wobei durch Spalten, die nicht da sein sollten, das Tageslicht und die Witterung nach innen drangen. Zudem fand der Regen den Weg durch das schadhafte Hausdach, zu dessen Reparatur der Hausherr keinerlei Anstalten machte. Darin untergebracht waren die Bediensteten, die auf dem Hof von Ludwig Hollbein arbeiteten. Meistens handelte es sich um zwei Knechte und zwei Mägde – eine davon war Clara –, die das ganze Jahr über den Hof versorgten. Eng wurde es, wenn in dem Häuschen zusätzlich Tagelöhner untergebracht waren, von denen immer mal wieder welche auf dem Hof mithalfen, hauptsächlich in der Erntezeit. Nur die Hauswirtschafterin, die Ludwig Hollbein den Haushalt führte, seit seine Frau vor mehreren Jahren verstorben war, hatte im Haupthaus eine eigene kleine Kammer. Eine Ausnahme bildete auch Wilhelm Burgecker, der Lebensgefährte von Clara, der, obwohl er nicht auf dem Hof angestellt war, sondern als Steinbrecher im nahen Bruch arbeitete, vom Bauern geduldet wurde. Aber nur, weil der Hausherr auch einen nicht unbeträchtlichen Nutzen davon hatte. Für die kostenlose Mitbenutzung der Kammer half Wilhelm, sooft er konnte, auf dem Hof mit, legte im Weinberg Hand an, kümmerte sich wenn nötig ums Vieh und war sich auch für kleinere und größere Handreichungen nicht zu schade.
Auf Hollbeins Ackerflächen wuchsen Kartoffeln, Rüben und Getreide, in den Stallungen standen Pferde, Kühe und Schweine. Auf einer Wiese hinter dem Haus gackerten Hühner. Im angrenzenden Wasser des aufgestauten Bachlaufes tummelten sich Enten und Gänse unter munterem Quaken und Schnattern. Zudem hatte Ludwig Hollbeins Vater, als er den Hof von seinem Vater übernommen hatte, mit dem Weinbau angefangen und der Sohn hatte das Ganze tüchtig erweitert. Inzwischen nannte er mehrere Weinberge sein Eigen. Sein größter Stolz jedoch war, neben seiner allerliebsten Tochter Elisabeth, die Mitgliedschaft im Magistrat der Stadt Iphofen. Damit war er ein Entscheidungsträger über das Wohl und Wehe seiner Mitbürger. Zu Recht zählte Hollbein aufgrund seines Besitztums und seiner Position zu den angesehenen Bürgern des Städtchens Iphofen.
»Besorge uns etwas Besseres, wenn du kannst. Ich bin froh, ein Dach über dem Kopf zu haben. Oder willst du in einer der Armenwohnungen in den Stadttürmen und Torhäusern untergebracht werden?«, gab Clara zu bedenken.
»Ich weiß nicht, was besser ist, hier bei Hollbein wegen ein paar Lebensmitteln zu Kreuze zu kriechen oder dort von den zugeteilten Lebensmittelrationen zu leben. Zumindest bekommt man da Kartoffeln, Kraut, Rüben und dergleichen ohne zu betteln.« Was Burgecker damit meinte, war die Versorgung der Bedürftigen durch den Armenpflegerat der Stadt. Damit versuchte man die »unterprivilegierten Bevölkerungsschichten« – wie es im Amtsdeutsch hieß – vom Betteln abzuhalten, das zu dieser Zeit durch die allgemeine wirtschaftliche Situation weit verbreitet war.
Gerne hätte Burgecker Clara und den Kindern mehr geboten als dieses zugige, feuchte Loch, aber daran war ganz und gar nicht zu denken. »Aber vielleicht … «, überlegte Wilhelm, » … vielleicht ist der Bauer im Moment ein bisschen großzügiger als sonst … «
»Wie kommst du darauf?«
»Nun, man munkelt etwas von einer Hochzeit seiner Tochter mit Franz Joseph Dannemann, dem Sohn eines Magistratskollegen. Der junge Handwerksmeister soll eine gute Partie sein.«
»Na gut, ich spreche mit Hollbein, wenn ich mit der Stallarbeit fertig bin.« Clara seufzte resigniert. Sie hatte wenig Hoffnung auf Erfolg. »Aber so kann es doch nicht weitergehen. Wir haben immer wieder das gleiche Problem. Es langt hinten und vorne nicht, um uns und die Kinder satt zu bekommen«, meinte sie dann vorwurfsvoll.
»Was erwartest du? Was sollen wir …?«
Die Unterhaltung wurde unterbrochen, als sich die Tür öffnete. Herein trat ein junger Mann, von der Statur her genauso schmächtig wie Wilhelm Burgecker, aber gut einen halben Kopf kleiner als dieser. Das lange rotblonde Haar hing ihm bis auf die Schultern. Wegen der leicht stechenden Augen, dem etwas verschlagenen Blick und der spitzen Nase hatte er Ähnlichkeit mit einem Fuchs. Nie und nimmer hätte man ihn und den größeren dunkelhaarigen Wilhelm Burgecker für Brüder gehalten. Nicht nur äußerlich, auch vom Charakter her waren die zwei grundverschieden. Wilhelm wirkte, trotz seiner angespannten Lebenssituation, ruhig und freundlich. Ferdinand dagegen war der rastlose rebellische Taugenichts, der hier und da als Tagelöhner arbeitete und sich so durchs Leben schlug. Eigentlich waren er und Ferdinand Burgecker auch nur Halbbrüder, da jeder einen anderen Vater hatte, den die beiden aber nicht kannten. Den gemeinsamen Nachnamen hatten sie durch einen Knecht erhalten, der ihre Mutter geheiratet hatte und die zwei Jungen als seine Kinder anerkannte. Leider hielt die Ehe ihrer Mutter nur zehn Jahre, dann verließ der Stiefvater die Familie, ihre Mutter starb vor mehreren Jahren an Typhus. Seitdem waren sie auf sich alleine gestellt gewesen.
Beide waren schon in jungen Jahren durch Diebstähle mit dem Gesetz in Konflikt gekommen und dadurch mit »verschärftem Arrest« durch »Entziehung warmer Kost und das Nachtlager auf bloßen Brettern« bestraft worden. Während die Maßnahmen bei Wilhelm Wirkung gezeigt hatten und er sich eines Besseren besann, war Ferdinand weiter auf die schiefe Bahn geraten und erst vor Kurzem aus dem Ebracher Zuchthaus entlassen worden. Trotzdem hielt Wilhelm an seinem vier Jahre älteren Halbbruder fest und versuchte ihm zu helfen – bisher allerdings mit wenig Aussicht auf Erfolg.
»Was habt ihr für Probleme?«, fragte Ferdinand, der die letzten Worte Wilhelms mitbekommen hatte. Sein Blick richtete sich auf die quengelnden Kinder. »Geht es um eure Bälger?«
»He, rede nicht so von meinen Kindern!«, fuhr Wilhelm seinen Halbbruder an. »Verdammt, ja, sie haben Hunger und ich weiß nicht, woher ich etwas zu essen nehmen soll.« Dann wurde er kleinlaut. »Clara soll mal beim Bauern wegen ein paar Kartoffeln fragen.«
»Schon gut, ich habe es nicht so gemeint«, beschwichtigte Ferdinand, »ich mag die beiden doch auch.« Er überlegte kurz und trat zu Wilhelm hin, um ihm die Hand auf die Schulter zu legen. »Aber Kartoffeln und immer wieder Kartoffeln? Vielleicht sollten wir mal wieder auf die Jagd gehen.«
Wilhelm schüttelte den Kopf. »Du weißt doch, dass es inzwischen für uns verboten ist. Nur noch die hohen Herren und Grundbesitzer haben das Recht zur Jagd.«
Worauf Wilhelm Burgecker hinauswollte, war die Tatsache, dass bis vor zwei Jahren jeder die Niedere Jagd auf Reh, Hasen und Federwild ausüben durfte. Dann hatte man 1850 Jagdgesetze erlassen und nur noch Jäger und Grundbesitzer mit einer bestimmten Mindestfläche waren jagdberechtigt. Für alle anderen wurde das Erlegen der Wildtiere unter strenge Strafe gestellt.
»Papperlapapp, das interessiert mich nicht«, wehrte Ferdinand ab und deutete auf die beiden Kinder. »Willst du lieber deine Kleinen verhungern lassen? Was ist schon dabei, wenn wir uns ein oder zwei Hasen holen.«
»Und wenn wir erwischt werden?«
Mit bedeutungsvoller Miene meinte Ferdinand: »Dann lassen wir uns eben nicht erwischen. Wir gehen doch nicht zum ersten Mal auf die Jagd.«
»Ja, schon, aber es wird immer riskanter. Weißt du noch, wie wir gleich in dem Jahr, als das Jagdverbot in Kraft trat, zweimal dem Forstaufseher des Grafen nur knapp entgangen sind? Der hatte unsere Schlingfallen für die Hasen gefunden. Dass wir ihn entdeckt haben, bevor er uns gesehen hat, war reiner Zufall. Und dann das letzte Mal kurz vor deinem Haftantritt, der Gendarm, der uns beinahe erwischte. Du konntest gerade noch rechtzeitig den Rucksack mit den beiden erlegten Hasen im Gebüsch verstecken.«
Wilhelms Halbbruder lachte. »Siehst du. Das Glück gehört den Tüchtigen. Wir lassen uns nicht erwischen … «
»Ach ja, und warum bist du dann im Zuchthaus gelandet?«
»Das war etwas anderes, ich wurde verpetzt.«
»Man hat jetzt ein Auge auf dich. Du musst vorsichtig sein, sonst landest du gleich wieder hinter Gittern.«
»Und trotzdem«, meinte Ferdinand mit trotzigem Gesicht, »ich sehe nicht ein, warum das Wild nicht weiterhin auch für uns da sein soll. Diese verdammten Großkopferten sehen die Jagd als reines Vergnügen an, das sie mit niemand teilen wollen. Die müssen aber auch ohne die erlegten Tiere nicht verhungern. Was ist dagegen mit uns? Schau dir deine weinenden Kinder an … schreien vor Hunger … nichts zu beißen … und es wird nicht besser werden. Wilhelm, wach auf, du hast keine Wahl, wenn du nicht jedes Mal bei anderen zu Kreuze kriechen willst. Hast du immer noch deinen wahnwitzigen Traum, dich hier ansässig machen zu können und die Bürgerrechte zu bekommen?«, lachte Ferdinand bei dem letzten Satz ironisch. Worauf Wilhelms Halbbruder anspielte, war der begehrte soziale Aufstieg, auf die die verarmte Unterschicht wenig oder gar keine Chance hatte. Dazu fehlte es den Armen nicht nur an den nötigen Gulden für die Aufnahmegebühr. Als anerkannter Bürger genoss man Vorteile und hatte Rechte, die den Nichtansässigen verwehrt blieben.
Energisch schüttelte Wilhelm den Kopf. »Wir warten erst ab, was Clara bei dem Bauern erreicht.«
»Wie weit wirst du mit einer Hand voll Kartoffeln kommen? Ich sage dir, der Wald bietet uns Nahrung genug, holen wir sie uns.«
»Hast du im Zuchthaus nichts dazugelernt? Wie lange soll das gut gehen, bis sie uns erwischen? Es bringt nichts, sich aufzulehnen.« Dieses Mal war es Wilhelm, der sich erhob und seinem Halbbruder die Hand auf die Schulter legte. »Sieh es doch ein, das Gesetz hat den längeren Arm.«
Ferdinand streifte Wilhelms Hand ab und hob beide Arme, als Zeichen der Ergebenheit. »Gut, gut, ich habe verstanden. Dann leidet weiter zusammen mit euren Kindern Hunger.«
Die beiden Männer wandten sich einem anderen Thema zu und kurz darauf verschwand Clara zu ihrer abendlichen Fütterungsrunde.
»Sie ist eine alte Hexe«, ereiferte sich Clara, als sie zwei Stunden später wieder zurückkam.
»Von wem sprichst du?«
»Na, von wem wohl! Von Auguste Perlacher.«
Mit aufgebrachter Stimme nannte Clara den Namen der Haushälterin des alten Hollbein, einer in die Jahre gekommenen Jungfer, die sich nach Claras Einschätzung immer noch einbildete, nach dem Tod von Hollbeins Frau vor fünf Jahren bei dem Witwer landen zu können.
»Warum? Was hast du mit ihr zu schaffen?«
»Ich wollte zum Bauern wegen der Kartoffeln, aber der ist nicht da, also habe ich Auguste gefragt, ob sie mir eine Hand voll geben könnte. Sie hat mich zuerst wie ein Rindvieh angeglotzt und dann losgelegt: wie ich mich erdreisten könnte, wegen Lebensmitteln zu fragen. Ich würde doch für meine Arbeit anständig entlohnt. Da könnte ja jeder kommen und den Bauern um Almosen anbetteln, ich sollte mich schleichen. Dabei hat sie getan, als wenn das alles ihr gehören würde. Wie ein Drache, der den Goldschatz bewacht, hat sie sich aufgeführt. Zum Glück kam das junge Fräulein, erkundigte sich, was denn los sei, und half mir.« Voller Hochachtung sprach Clara von Elisabeth Hollbein, der bildhübschen Tochter des Bauern, die das Gekeife der Haushälterin mitbekommen hatte. »Auguste hat ihr mit zänkischer Stimme alles berichtet. Elisabeth hat mich dann nach dem ›Warum‹ gefragt und ich habe ihr von den Kindern erzählt, dass sie Hunger leiden und wir nichts mehr haben. Da ist sie in den Keller und kam mit einer Schürze voll Kartoffeln zurück. Die Perlacherin hat noch ein bisschen gemault, aber Elisabeth hat ihr den Mund verboten und zu ihr gesagt: ›Wenn ich etwas verschenke, geht dich das gar nichts an‹.« Clara lehrte die Schürze auf dem Tisch aus. »Elisabeth ist eine gute Seele.«
Wilhelms Vorsatz, nicht auf die Jagd zu gehen, hielt genau vier Tage. Die letzten Essensvorräte waren aufgebraucht und das Hungerproblem stand wieder vor der Tür. Ferdinand brauchte nicht einmal viel zu tun, um die Meinung seines Bruders zu ändern. Selbst Clara, die Wilhelm schon mehrmals vor diesem Schritt abgehalten hatte, ließ es geschehen. Trotzdem konnte sie sich eine Bemerkung nicht verkneifen, die Ferdinand galt.
»Es ist nicht richtig, wenn du deinen Bruder zu etwas Ungesetzlichem verführst, aber … die Not zwingt uns dazu.«
Noch am gleichen Tag frühabends machten sich die Brüder auf den Weg, ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. Wilhelm immer noch mit sich hadernd, ob es die richtige Entscheidung war, Ferdinand zuversichtlich, mit dem Bewusstsein, der Obrigkeit ein bisschen schaden zu können. Wohlweislich hatte Ferdinand in den Tagen zuvor etliche Hasen- und Kaninchenbauten ausfindig gemacht. Als bevorzugtes Revier hatte er sich den Wald des Grafen von Rechteren-Limpurg-Speckfeld ausgesucht, in dem die verlassene und im Verfall begriffene Burg Speckfeld stand. Durch die Lange Gasse und das anschließende Stadttor verließen sie Iphofen. Vorbei am Zimmerplatz über den Kalbweg strebten sie dem Schießgrund zu, von wo aus sie bergaufwärts in den Wald eindrangen.
Die ganze Strecke über schritt Wilhelm mit einem mulmigen Gefühl im Bauch neben seinem Halbbruder her. Immer wieder sah er sich um und fixierte die Umgebung. Hochgradig nervös reagierte er auf jede Bewegung und auf jeden Laut. Dagegen wirkte Ferdinand locker und entspannt. Zielstrebig bahnte er sich schließlich den Weg durch den Wald. Mit traumwandlerischer Sicherheit fand er die Hasenbaue wieder. Ohne viele Worte gingen sie an die Arbeit. Erst in fast völliger Dunkelheit kehrten sie zurück, die Fallen waren gestellt.
Am darauffolgenden Tag wollten die beiden wieder losziehen. Es war Wilhelms freier Tag, Ferdinand arbeitete sowieso nur dann, wenn er Lust hatte, und das war selten genug. Schon früh an dem sonnigen Spätsommernachmittag machten sie sich auf den Weg zu ihrem Kontrollgang. Sie wollten nach den Schlingen sehen, die sie tags zuvor angebracht hatten. Erneut mussten sie sich in Acht nehmen, um nicht gesehen zu werden. Tatsächlich hatten sie Glück und in zwei ihrer Fallen hing ein Hase. Mit einem Klappmesser tötete Wilhelm die Tiere und ließ sie ausbluten, dann verstaute er sie in seinem Rucksack. Nachdem die Fallen wieder ausgelegt waren, machten sich die beiden auf den Rückweg. Sie waren noch im Wald, als sie Stimmen hörten. Ferdinand wies seinen Halbbruder an, sich zu verstecken, während er nachschauen wollte, ob ihnen Gefahr durch Entdeckung drohte. Es dauerte zehn Minuten, da war Ferdinand wieder zurück.
»Wer war das?«, erkundigte sich Wilhelm nervös. Ihm war die Anspannung deutlich anzumerken.
»Unwichtig, niemand Besonderes«, winkte Ferdinand ab, »gib mir den Rucksack, wir gehen getrennt nach Hause. Sollte ich erwischt werden, so hast du wenigstens nichts damit zu tun.«
»Warum jetzt plötzlich diese Vorsicht?«
»Alleine fallen wir weniger auf und einer kann sich besser verstecken als zwei«, erklärte ihm Ferdinand, während er den Rucksack in die Hand nahm. »Wenn es dunkel ist, komme ich und bringe dir unsere Beute. Ich hoffe, ich bekomme auch ein Stück vom Hasenbraten«, grinste er und verschwand im Dickicht.
Erst zögernd, dann immer schneller strebte Wilhelm dem Waldrand zu, als er plötzlich mehrmals hintereinander einen Hilfeschrei hörte. Es klang, als wenn jemand in höchster Not wäre. Abrupt stoppte er und lauschte, aber es blieb still. Der junge Burgecker hörte nur seinen eigenen leicht keuchenden Atem, der von seinem hastigen Laufen gekommen war. Standen die Schreie mit seinem Bruder in Verbindung?, überlegte er. Sollte er zurückgehen und nachschauen? Sich dorthin wenden, wohin sein Bruder verschwunden war? Nein, das war nicht empfehlenswert, so seine Überlegung. Außerdem war er sich sicher, dass die Hilferufe nichts mit Ferdinand zu tun hatten, der konnte auf sich aufpassen. Er hatte auch nicht genau lokalisieren können, woher die Stimme gekommen war. Es war besser, sich weiter auf den Heimweg zu machen, entschied Wilhelm, sich um fremde Angelegenheiten zu kümmern, war nie gut. Eiligen Schrittes ging er weiter. Kurz vor dem Waldrand blieb Wilhelm fast vor Schreck das Herz stehen, als plötzlich eine gebeugte Gestalt vor ihm auftauchte. Beinahe wäre er in sie hineingelaufen. Erst bei näherem Hinsehen entpuppte sich die Erscheinung als eine Person, die auf dem Waldboden etwas aufsammelte. Dann erkannte Wilhelm, wen er vor sich hatte. Die Person hob ihren Kopf, blickte in seine Richtung und kniff die Augen zusammen. Es war die halb blinde und halb taube betagte Minna Rathke, die ihn mit einem zahnlosen Grinsen und zusammengekniffenen Augen anstarrte. Sie schien etwas sagen zu wollen, aber Burgecker schritt eilig und kommentarlos an ihr vorbei. Normalerweise wäre Wilhelm nicht so stillschweigend vorübergegangen, aber irgendetwas sagte ihm, dass es besser war, nicht mit ihr zu reden. Vielleicht hatte sie ihn ja nicht erkannt, worauf er hoffte. Die alte Rathke war eine bedauernswerte Seele, die ihre städtischen Zuwendungen durch das Sammeln von Reisigholz aufbesserte, was von den Stadtvätern und den Waldbesitzern geduldet wurde. Einen Teil davon behielt sie als Eigenbedarf für den Winter, den Rest verkaufte sie für ein paar Kreuzer an die Bäcker im Ort und an Privatpersonen, die ihr die Holzbündel mehr aus wohltätigen Gründen abnahmen. War es kein Holz, so sammelte sie Pilze und Kräuter, die im heimischen Wald wuchsen und für die sie ebenfalls ihre Abnehmer hatte.
Mit erwartungsvollen Blicken wurde Wilhelm von Clara zuhause in Empfang genommen. Seine leeren Hände sorgten bei Wilhelms Partnerin für einen enttäuschten Gesichtsausdruck. Er beruhigte sie mit den Worten: »Wir hatten Erfolg, haben uns aber getrennt, Ferdinand hat die Beute.«
»Was ist passiert?«
»Nichts, mein Bruder hielt es nur für besser, dass wir uns auf dem Heimweg trennen.« Die Schreie im Wald erwähnte er nicht, da er Clara nicht verunsichern oder ängstigen wollte.
Mit dem letzten schwachen Schein des Tageslichtes tauchte Ferdinand mit dem Rucksack auf. Er öffnete den Sack und legte die beiden Hasen und ein Huhn auf den Tisch.
»Woher kommt denn das Federvieh?«, fragte ihn Wilhelm erstaunt.
Grinsend antwortete sein Bruder: »Es ist mir über den Weg gelaufen und plötzlich war es im Sack.«
»Mensch, Ferdinand! Wild zu jagen ist schon riskant genug, aber jetzt wirst du auch noch zum Hühnerdieb. Ich will keinen Ärger mit den Leuten hier im Ort.«
Mit unschuldiger Miene hob Ferdinand die Achseln. »Das Vieh lief alleine draußen vor der Stadtmauer herum. Wahrscheinlich hat es den Weg in den Stall nicht mehr gefunden. Wenn ich es nicht mitgenommen hätte, wäre es sicherlich vom Fuchs geholt worden.«
»Hoffentlich hat dich niemand gesehen.«
»Da kannst du sicher sein.«
Wilhelm nahm seinen Bruder auf Seite und fragte ihn flüsternd: »Hast du die Hilferufe im Wald auch gehört?«
»Ja, klar habe ich das.«
»Und, hast du etwas mitbekommen, wer das war oder was passiert ist?«
»Nein, keine Ahnung.«
»Da muss doch irgendein Unglück geschehen sein. Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich den Rufen nicht nachgegangen bin.«
»Ach, in anderer Leute Angelegenheiten sollte man sich nicht einmischen.«
»Du bist gut«, meinte Wilhelm vorwurfsvoll, »da war vermutlich ein Mensch in Not.«
»Deine Reue kommt etwas spät«, entgegnete Ferdinand mit leichtem Sarkasmus. »Lass uns die Sache vergessen.«
*
Leider sollten die Brüder den Vorfall im Wald nicht so schnell vergessen können. Am übernächsten Tag verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer durch Iphofen. Man hatte am Waldessaum, in einem Dickicht am Wegesrand, die Leiche des jungen Franz Joseph Dannemann gefunden. Der junge Mann hatte schon als vermisst gegolten, da er nicht von seiner Arbeitsstelle nachhause zurückgekehrt war. Sein Körper wies unzählige Hieb- und Stichverletzungen auf, die zum Tode geführt haben mussten. Nicht weit entfernt von der Leiche fand man eine kleine hölzerne Werkzeugkiste mit Handwerkerutensilien und daneben einen blutigen Stechbeitel und eine Axt voller Blutspuren. Die Untersuchungen ergaben, dass mit den beiden Werkzeugen aus Dannemanns Kiste die Tat begangen wurde. Weitere zwei Tage später standen Gendarmen vor Wilhelms und Claras Tür. Die alte Minna Rathke schien doch nicht so blind und taub zu sein, wie alle glaubten oder wie alle glauben sollten. Sie hatte überall herumgetönt, am besagten Tag jemand im Wald nahe des Tatortes gesehen zu haben. Natürlich wurden die Gesetzeshüter hellhörig und nahmen sie ins Gebet. Schließlich gab sie an, kurz nach den Hilfeschreien, die sie trotz ihrer angeblichen Schwerhörigkeit vernommen hatte, Wilhelm Burgecker gesehen zu haben. Dieser sei, laut ihrer Beschreibung, »wie der leibhaftige Teufel« an ihr vorbeigerannt. Da man die Übertreibungen der alten Rathke kannte, nahm man das mit dem Teufel nicht so ernst, aber die Aussage an sich schon.
Der Angeschuldigte war zuerst sprachlos hinsichtlich des Vorwurfes, beteuerte dann aber vehement, nichts mit der Tat zu tun zu haben. Sein Bruder Ferdinand stand ihm bei und bezeugte, »dass sie nur im Wald gewesen seien wegen der Pilze und nichts und niemand etwas zuleide getan hätten«. Da Wilhelm auch den Pfarrer als Fürsprecher hatte, der ihm, abgesehen von ein paar Jugendsünden, einen einwandfreien Leumund bescheinigte, wurde der Verdacht gegen Wilhelm fallen gelassen. Es gab keine weiteren Verdächtigen und so trat die Gendarmerie bei den Ermittlungen auf der Stelle.
»Gut, dass mir das mit den Pilzen eingefallen ist«, lachte Ferdinand, nachdem die Vernehmung beendet war, »sonst hätten sie bestimmt wissen wollen, warum wir im Wald waren. Ich habe mich daran erinnert, dass unser Stiefvater um diese Jahreszeit immer Pilze gesammelt hat.« Er kniff die Augen zusammen und überlegte. »Da war so ein komischer Name wie Bovist dabei … und natürlich Waldchampignons und anderes Zeugs.«
»Ich denke, wir sollten vorerst mal nicht mehr auf die Jagd gehen«, meinte Wilhelm Burgecker, dem hinsichtlich der Verdächtigungen die Knie geschlottert hatten. Aber der Drang zu überleben und den Kindern genügend Nahrung zu bieten, war stärker und so waren die beiden Halbbrüder schon zwei Wochen nach dem Ereignis wieder unterwegs.
*
Die Bluttat geriet langsam in Vergessenheit, als zwei Monate später ein weiterer Leichenfund in Iphofens näherer Umgebung für Entsetzen sorgte. Dieses Mal betraf es Gustav Herbrecht, den Jagd- und Forstaufseher des Grafen von Rechteren-Limpurg-Speckfeld, aus Markt Einersheim. Unweit der Stelle, an der der junge Dannemann im Spätsommer zu Tode gekommen war, fand man den Leichnam des Aufsehers. Er war, ebenso wie das vorhergehende Opfer, mit zahlreichen Stichverletzungen ermordet worden. Aufgrund anderer Verletzungen am Kopf mutmaßte man, dass Gustav Herbrecht zuerst niedergeschlagen wurde. Vermutlich hatte man ihn dann mit einem Messer oder Ähnlichem brutal erstochen. Neben Herbrechts Gewehr fehlten eine wertvolle Taschenuhr und seine Geldbörse, weswegen zuerst von einem Raubmord ausgegangen wurde.
Tags darauf erschienen die Gendarmen erneut bei Wilhelm Burgecker. Dieses Mal nahmen sie ihn mit und beschuldigten ihn direkt, etwas mit dem Mord zu tun zu haben, da es einen Zeugen gebe. Der junge Georg Birkner, Spross eines angesehenen Großbauern aus der Nachbargemeinde Markt Einersheim, hatte sich gemeldet und ausgesagt, Burgecker am Tatort gesehen zu haben. Ein weiterer Zeuge wurde gefunden, der Wochen zuvor einen Disput zwischen Wilhelm Burgecker und Gustav Herbrecht mitbekommen haben wollte. Tatsächlich hatte der Forstaufseher ihn verdächtigt, gejagt zu haben, konnte es aber nicht beweisen, da Wilhelm keine Beute dabeihatte. Daraufhin hatte Herbrecht ihn gewarnt, dass er jetzt Augen und Ohren noch mehr aufhalten werde, um ihn zu erwischen. Jeder wusste, dass Herbrecht ein »scharfer Hund« war, der gegen Verstöße in seinem Revier rigoros vorging. Trotzdem habe er dem Bediensteten des Grafen nichts zuleide getan, versicherte Wilhelm den Gendarmen. Weder das Gewehr noch die Taschenuhr oder die Geldbörse wurden bei Burgecker gefunden. Dagegen fanden die Gendarmen bei der Durchsuchung des Anbaus, in dem Wilhelm mit Clara und den Kindern wohnte, in einem Schubfach der leeren Räume, die für Tagelöhner freigehalten wurden, ein blutiges Messer. Man erinnerte sich an den vorhergehenden Mord und Minnas Aussage. Dieses Mal schenkten die Gesetzeshüter Burgecker keinen Glauben, als er erneut seine Unschuld beteuerte. Auch sein Bruder Ferdinand oder der ortsansässige Pfarrer konnten ihm in diesem Falle nicht helfen. Er wurde ins Untersuchungsgefängnis nach Windsheim überstellt.
Drei Monate nach der Inhaftierung war die Verhandlung am Schwurgerichtshof Ansbach. Durch den Messerfund, die bestehenden Zeugenaussagen von Minna Rathke und dem jungen Birkner sowie die nachweisliche Auseinandersetzung zwischen Wilhelm Burgecker und dem Jagd- und Forstaufseher Herbrecht war für das Gericht die Sachlage klar. Sowohl der getötete Franz Joseph Dannemann als auch Gustav Herbrecht hatten, laut Gericht, den Angeklagten beim »Jagdfreveln« ertappt, woraufhin Burgecker sie tötete, um nicht verraten zu werden. Wenig oder gar keine Berücksichtigung fand die Tatsache, dass man Herbrechts verschwundene Sachen bei Burgecker nicht gefunden hatte. Gewehr, Taschenuhr und Geldbörse blieben auch darüber hinaus unauffindbar. Das Schwurgericht war unerbittlich und erklärte den Angeklagten des zweifachen Totschlags und wegen seiner Uneinsichtigkeit – Wilhelm beteuerte bis zum Schluss seine Unschuld – für »im vollen Maße schuldig«. Zwar kam er um den Galgen herum, musste aber für das Höchststrafmaß von 20 Jahren ins Zuchthaus.
Seit seiner Gefangennahme verstand Wilhelm die Welt nicht mehr. Bis zum Schluss hatte er gehofft, dass sich alles als ein großer Irrtum herausstellen würde. Erst der Schuldspruch öffnete ihm endgültig die Augen. Jetzt erst wurde ihm so richtig bewusst, wo er die nächsten Jahre verbringen würde. Er bat seinen Bruder, sich um Clara und die Kinder – deren Wohlergehen seine größte Sorge war – zu kümmern in dem Bewusstsein, dass sein Halbbruder dafür eigentlich nicht der Richtige war.
Hatte der Verlust des Verlobten Elisabeth Hollbein schon schwer getroffen, so wurde die Tatsache dadurch verstärkt, dass der Täter unter ihrem Dach gewohnt hatte. Nur wenige Tage nach dem Schuldspruch legte der Bauer Clara nahe, die Stellung bei ihm aufzugeben. Zu sehr würde seine Tochter bei ihrem Anblick und dem ihrer Kinder an den Mörder ihres Liebsten erinnert. Da sie keine neue Anstellung bekam, siedelte Clara Zirner schweren Herzens in eine der Iphöfer Armenwohnungen um. Keiner wollte der Lebensgefährtin eines Mörders Arbeit geben.
Überraschenderweise nahm Ferdinand die Bitte seines Halbbruders – sich um Clara und die Kinder zu kümmern – durchaus ernst. Leider färbte die Verurteilung seines Bruders auch auf ihn ab. Mit dem Namen Burgecker bekam er nicht mal mehr als Tagelöhner eine Beschäftigung. Tagelang beratschlagte Wilhelms Halbbruder mit Clara über die neue Lebenssituation, bis ihm der Ausspruch eines Bauern, bei dem er um Arbeit nachgefragt hatte, die Idee lieferte. »Hier findet der Bruder eines Schwerverbrechers keine Arbeit mehr, am besten du wanderst aus.«
Auswandern – der Gedanke ließ Ferdinand nicht mehr los. Wochenlang besprach er mit Clara das Thema, redete auf sie ein, doch mitzukommen. Zuerst lehnte sie vehement ab, da sie auf Wilhelm, den Vater ihrer Kinder, warten wollte, bis der wieder aus der Haft entlassen würde. Als Ferdinand ihr die lange Zeit von 20 Jahren vor Augen hielt, begann sie sich langsam mit dem Gedanken vertraut zu machen. Aber wohin sollten sie auswandern? Für Ferdinand kam eigentlich nur Amerika in Frage. Er hatte schon einiges von dem Land »mit den unbegrenzten Möglichkeiten« gehört. Man könne ja wieder zurückkommen, wenn Wilhelm seine Strafe abgesessen habe, oder ihn nach Amerika nachholen, argumentierte Ferdinand. So langsam nahm der Plan der Auswanderung Gestalt an und Clara war nicht mehr abgeneigt, nachdem sie bei der Arbeitssuche weiterhin nur Absagen und Ablehnung erfuhr. Nun blieb nur noch die Frage: Woher das Geld für die Überfahrt nehmen?
Überraschend erhielten sie Hilfe von der Stadt Iphofen. Der Magistrat unterstützte hin und wieder Auswanderungspläne und übernahm die Kosten der Bahnfahrt und der Schiffspassage. Man wollte damit soziale Spannungen entschärfen und die Armenkasse dauerhaft entlasten. So entschieden die Stadtväter – unter besonderer Fürsprache von Ludwig Hollbein – im Falle von Ferdinand Burgecker und Clara Zirner, ihr Vorhaben zu finanzieren. An einem nasskalten trüben Tag Anfang November des Jahres 1853 machte sich Ferdinand Burgecker zusammen mit Clara und den beiden Kindern auf den Weg. Zuerst mit dem Pferdewagen und dann mit der Bahn ging es Richtung Norden. Ihr Ziel war Bremen, von wo aus sie ihre Reise nach Amerika antreten wollten.
Ein letztes Mal hatte Clara alles darangesetzt, Wilhelm im Gefängnis besuchen zu können, bevor sie auf die große Reise gingen. Aufgrund ihrer sozialen und finanziellen Situation wurde es ein langer und beschwerlicher Weg bis nach Kaisheim ins Donau-Ries, wo Burgecker im dortigen Zuchthaus seine Strafe absitzen musste. Natürlich war er zuerst alles andere als begeistert, als er von den Auswanderungsplänen hörte. Ferdinand, der Clara begleitete, und auch Clara selbst schilderten ihm die schwierigen Lebensumstände in Iphofen, die sie seit seiner Verurteilung hatten. Trotzdem wurde es für Wilhelm schwer, zu akzeptieren, dass er seine Partnerin und seine Kinder womöglich nie mehr sehen würde, obwohl Ferdinand und Clara ihm versprachen, ihn nach der Entlassung nach Amerika nachzuholen oder zurückzukommen. Beides Vorsätze, die schwer zu verwirklichen waren, wie sich nicht nur der inhaftierte Burgecker eingestehen musste. Es wurde ein wehmütiger Abschied von Wilhelm. Weniger Tränen weinten sie ihrer alten Heimat nach, als das Fuhrwerk über das Kopfsteinpflaster zum Tor hinausrumpelte.
Ein Todesfall
»Opa ist verunglückt! Ich glaube, er ist tot!« Mit diesen Worten stürmte ein schlanker junger Mann atemlos ins Zimmer. Die Worte galten einer älteren korpulenten Person hinter einem Schreibtisch. Der Mann erhob sich trotz seiner Körperfülle so schwungvoll, dass der Bürostuhl an die Wand knallte, stützte sich mit beiden Händen auf der Tischplatte ab und schaute den jungen Mann entsetzt an.
»Wie? … Wo? … Was ist passiert?«, stammelte er dann irritiert.
»Ich habe ihn im untersten Gewölbekeller gefunden. Er muss die Treppe hinuntergestürzt sein.«
»Hast du die Rettung gerufen?«
Aufgeregt nickte der junge Mann. »Ja, ja, selbstverständlich.«
Eilig kam der Ältere hinter dem Schreibtisch hervor. »Warte du im Hof, bis die Rettungskräfte kommen, und zeige ihnen den Weg, ich werde nach Vater sehen.«
Bei den beiden Männern handelte es sich um den derzeitigen Chef des bekannten Iphöfer Weingutes Birkner, Hermann Birkner, und seinen Sohn Stefan, der die schreckliche Nachricht überbracht hatte. Der Siebenundfünfzigjährige mit dem spärlichen Haarkranz und dem stattlichen Bauchumfang hastete aus dem Zimmer, gefolgt von seinem Sohn. Beide stürzten aus dem Haus und wandten sich nach verschiedenen Richtungen. Hermann rannte, so schnell es sein Alter und sein Körpergewicht zuließen, auf die Hallen zu und Stefan zur Hofeinfahrt, um das Sanitätsauto und den Notarzt in Empfang zu nehmen.
Mit Schwung riss Hermann Birkner die Hallentür auf und lief an einer Weinpresse, gestapelten Holzkisten, Behältern und Bottichen vorbei zum Treppenabgang, der in die zwei Stockwerke tiefen Gewölbekeller führte. Sich krampfhaft am eisernen Geländer festhaltend nahm er hin und wieder zwei Stufen auf einmal. Feuchtkalte Luft schlug ihm entgegen, als er sich abwärtsbewegte. Er beachtete weder die Edelstahltanks noch die im Weg stehende Filteranlage oder die Schläuche, die sich an den Tanks entlangschlängelten. Hier unten waren die Vorbereitungen für den Ausbau der Jungweine im Gange. Die einen Sorten lagerten in hochmodernen Tanks aus Edelstahl, andere in traditionellen Holzfässern. Birkner erreichte die Treppe, die in die zweite Gewölbeetage führte, und sah schon von oben seinen Vater liegen. Die verdrehte Körper- und Kopfhaltung ließ nichts Gutes erahnen. Hastig stieg er hinab. Laut keuchend erreichte er das untere Gewölbe und beugte sich über seinen Vater. Mit Zeige- und Mittelfinger suchte er dessen Schlagader am Hals zu ertasten, so wie er es vor Jahren mal in einem Rotkreuz-Kurs gelernt hatte, aber er konnte nichts erfühlen. Betroffen von der Tatsache, dass sein Vater vermutlich nicht mehr lebte, erhob er sich und atmete heftig aus. Viel Zeit zum Nachdenken blieb ihm nicht, als er von oben Stimmen und eilige Schritte hörte. Stefan Birkner tauchte auf, hinter ihm der Notarzt und zwei Sanitäter. Hermann und sein Sohn sahen sich schweigend an, während sich die Rettungskräfte um den Verunglückten kümmerten.
»Weiß es Mutter schon?«, fragte Hermann Birkner schließlich.
Stefan schüttelte den Kopf. »Vermutlich nicht, sie bereitet eine Weinprobe vor. Aber dass etwas passiert ist, war wegen der Sirene und dem Blaulicht nicht zu überhören.«
»Dann geh und informiere sie.«
Im selben Moment vernahm man Schritte von hochhackigen Schuhen im Gewölbe darüber. Das pausbackige Gesicht einer Frau, umrahmt von dunkelblonden schulterlangen Haaren, tauchte an der Treppe auf. »Was ist denn …? Ach herrje, Karl!«, rief sie entsetzt, nachdem sie die Situation erkannt hatte. »Ist er …?«
Bevor jemand antworten konnte, hob der Notarzt seinen Kopf und sah in die Runde. »Tut mir leid, da ist nichts mehr zu machen. Wahrscheinlich Genickbruch. Er muss sofort tot gewesen sein.«
Eine Etage höher ertönte ein Aufstöhnen. Schwiegertochter Waltraud lehnte mit kreidebleichem Gesicht an der Mauer, ihr Mann und ihr Sohn standen stumm und betroffen neben dem Leichnam.
»Wie ist es passiert, war jemand dabei?«, fragte der Notarzt.
Die beiden Männer sahen sich an und schüttelten einstimmig den Kopf.
»Als ich ihn fand, war weit und breit niemand zu sehen«, antwortete der junge Birkner.
»Ich habe auch keine Ahnung, was er so früh hier unten alleine wollte«, sagte Hermann Birkner.
Hermann stieg die Treppe hinauf und wollte seine Frau in den Arm nehmen, doch sie entzog sich seiner Umarmung und blickte ihren Mann vorwurfsvoll an.
»Ich sage die ganze Zeit schon, dein Vater gehört nicht mehr hier in den Betrieb. Außerdem hat er manchmal unsicher und verwirrt gewirkt. Es musste ja mal so kommen.«
»Quatsch!«, unterbrach ihr Mann sie. »Papa war fit. Der Betrieb war sein Ein und Alles und die Kellerführungen sein Steckenpferd. Das hätte ich ihm nicht nehmen können.«
»Aber vielleicht würde er dann noch leben«, entgegnete sie vorwurfsvoll und stutzte dann. »Wieso Kellerführung? Ich denke, er war alleine?«
»Scheinbar schon.« Hermann zuckte mit den Schultern. »Aber er hat gestern Abend etwas von einer Kellerführung gebrummt. Leider habe ich nicht genau zugehört, da ich ein Telefonat hatte.«
Hermanns Sohn mischte sich ein. »Es kann aber doch niemand dabei gewesen sein, sonst wäre derjenige oder diejenigen doch da. Ich glaube kaum, dass jemand Opa alleine gelassen hätte.«
Nachdenklich nickte Stefans Vater. »Eigentlich hat er die Treppe auch nur noch genutzt, wenn er Besucher dabeihatte, ansonsten hat er den Aufzug genommen.« Schon vor rund 100 Jahren hatte der Großvater des jetzt verunglückten Karl Birkner nachträglich einen Lastenaufzug einbauen lassen. Damit wurden die Arbeit im Keller und der Transport schwerer Teile wesentlich erleichtert. Gerade in der zweiten Gewölbeetage lagerten die edlen Tropfen. Dort in der untersten Etage reiften besondere Weine, in der Hauptsache Rotweine in Eichenfässern, und andere alkoholische Getränke, wie Schnäpse, Brände und Liköre, heran. Ein Teil davon flaschenweise einzeln in Regalen aufgereiht oder in Kisten gestapelt, der Rest im Keller nebenan in Weinballons oder Holzfässern. Nicht umsonst war dieser Bereich Karl Birkners ganzer Stolz.
»Ich denke nicht, dass es heute Morgen passiert ist«, unterbrach der Notarzt die Diskussion zwischen Vater und Sohn.
»Wann denn dann?«
»Der Tod dürfte schon vor Stunden eingetreten sein.«
»Vor Stunden?«, fragte Hermann Birkner ungläubig. »Was bedeutet das?«
»Womöglich liegt Ihr Vater schon seit gestern Abend hier, aber Genaueres kann nur ein Rechtsmediziner feststellen. Ich werde die Polizei verständigen.«
»Warum denn Polizei? Ist das notwendig? Das hier war doch ein Unfall, oder nicht?« Hermann Birkner dachte an das Aufsehen, wenn heute Uniformierte auf dem Anwesen hier auftauchten. Jeden ersten Samstag im Monat veranstaltete Birkner den »Markttag im Weingut« mit Weinproben, Kellerführungen und dem Verkauf seiner eigenen und anderer regionaler Produkte. Heute war dieser Tag und im Dezember war es nochmal etwas Besonderes, da sich der Markttag jedes Jahr an dem Adventswochenende in einen kleinen Weihnachtsmarkt verwandelte. Ab zehn Uhr sollten Tür und Tor geöffnet werden. Hermann sah auf die Uhr, noch nicht mal mehr eine Stunde bis dorthin.
Der Notarzt schüttelte nur den Kopf. »Tut mir leid, aber das ist meines Empfindens nach ein ungeklärter Todesfall und da sind wir angehalten, die Polizei hinzuzuziehen.«
*
Es war so ein trüber grauer Samstagvormittag, der gar nicht zu der vorweihnachtlichen Stimmung passen wollte und an dem man am besten im Bett blieb. Genau das plante Kommissar Rautner auch zu tun. Mit seiner neuesten weiblichen Eroberung unter der Bettdecke würde es bestimmt nicht langweilig werden. Das hatte Julianna, die brasilianische Studentin, in der Nacht schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Chris sah zuerst auf die schlafende Bettnachbarin und dann auf seinen Chronometer. Es war zwar erst kurz nach acht Uhr in der Frühe, aber der Hunger hatte ihn wach werden lassen und für seine weiteren Vorhaben brauchte er neue Energie, so seine kurze Schlussfolgerung. Vorsichtig, um die junge Frau nicht zu wecken, erhob er sich und entschloss sich, den Tag mit einem ausgiebigen Frühstück im Bett zu beginnen. Eine halbe Stunde später kam er mit einem vollen Serviertablett ins Schlafzimmer. Er hatte sich richtig Mühe gegeben und alles aufgefahren, was sein Kühlschrank so zu bieten hatte. Gott sei Dank hatte er unter der Woche noch – auf Anraten und mit Hilfe seiner Mutter – mal wieder seine Vorräte aufgefüllt. Leider hatte er keine Ahnung, was eine Brasilianerin so aß, so konnte er nur hoffen, dass auch was Essbares für sie dabei sein würde. Auf dem Tablett dampften zwei Tassen frisch gebrühter Kaffee, ein Teller voll Rühreier mit Speck, mehrere Scheiben Toastbrot, alternativ hatte er Käse, Marmelade, Müsli und Obst anzubieten. Kaffee- und Speckgeruch ließen die dunkelhäutige Schönheit erwachen. Aus tiefbraunen, fast schwarzen, halbverschlafenen Augen sah sie Chris erwartungsvoll an. Bei diesem Blick und dem Anblick des perfekten textilfreien Körpers konnte er sich nur schwer auf sein Frühstückstablett konzentrieren, das er mitten im Bett platzierte. Ein betörendes Lächeln, ein heißer Kuss und dann machte sich Julianna über die Rühreier her, sodass Chris sich beeilen musste, seinen Anteil zu bekommen. Nach den Eiern vertilgten sie den Käse und zum Schluss folgte noch ein Marmeladenbrot.
Gerade hatte Chris das Tablett auf den Fußboden gestellt, um sich wieder den »äußerst angenehmen Dingen« – wie Chris es nannte – zuzuwenden, als es an der Tür Sturm klingelte. Sein erster Gedanke war, das Läuten zu ignorieren, aber der Ton war penetrant und wollte nicht enden. »Wehe, es ist nichts Wichtiges«, fauchte er genervt, stand auf und zog sich etwas über. In Unterhose und Shirt ging er zur Wohnungstür. Sein Blick durch den Spion ließ ihn erkennen, wer der Störenfried war.
»Hallo Christoph, komme ich ungelegen?«, erkundigte sich eine weibliche Stimme mit unverschämtem Grinsen, als er die Tür öffnete. Die junge Frau drängte sich durch die Tür in den Flur. »Du gehst nicht an dein Handy und dein Telefon hörst du auch nicht. Scheinst ja wieder ein ereignisreiches Wochenende anzupeilen.« Der provokante Kommentar kam von seiner Kollegin Jasmin Blume, die ihn dabei von oben bis unten musterte. Immer wenn die Kommissarin ihren Kollegen ärgern wollte nannte sie seinen korrekten Vornamen, was dieser nicht ausstehen konnte, da ihn alle Welt nur als ›Chris‹ kannte und er auch so angesprochen werden wollte.
»Oh tatsächlich, ich habe vermutlich beides stumm gestellt«, brummte Rautner daraufhin missmutig, »aber so wie es aussieht, nützt mir das auch nichts.« Jasmin wollte weitergehen, aber Rautner versperrte ihr demonstrativ den Weg und knurrte gereizt: »Ich habe Besuch, wenn du verstehst, was ich meine.«
Mit gespieltem Bedauern meinte sie: »Ach, das ist aber ärgerlich.« Jasmins Aufmerksamkeit wurde abgelenkt. Chris’ Besuch bewegte sich nackt mit aufreizender Gelassenheit vom Schlafzimmer ins Bad. »Dein privates Vergnügen musst du jetzt leider abbrechen, wir haben Arbeit«, eröffnete sie ihm mit einem spöttischen Tonfall in der Stimme.
Ein leises »Sch… « war sein einziger Kommentar, dann wurde er sachlich. »Was ist passiert?«
»Ein Todesfall in Iphofen. Die Sachlage ist nicht ganz klar und so hat der Notarzt die Polizei verständigt.«
»Ich mach mich fertig. Bin sofort zurück.«
Chris verschwand im Bad, wie kurz zuvor sein weiblicher Übernachtungsgast auch. Er wollte retten, was noch zu retten war. »Sorry, mein Job ruft mich. Bist du noch da, wenn ich zurückkomme?«, erkundigte er sich mit einem Kuss in Juliannas Nacken.
»Wann du zurück?«, fragte sie in gebrochenem Deutsch.
Er zuckte hilflos mit den Schultern. »Kann ich nicht sagen.« Während er sich anzog, fragte sie: »Glaube nicht, was ohne dich hier alleine? Besser nachhause.«
»Okay, ich rufe dich wieder an.« Chris nickte und betrachtete sich im Spiegel. Er strich mit den Fingern durchs Haar und begutachtete seinen Drei-Tage-Bart, der auf eine Rasur noch warten musste. »Mach bitte die Tür hinter dir richtig zu, wenn du gehst.« Ein letzter sehnsüchtiger Blick auf Juliannas Körper, die sich anschickte unter die Dusche zu gehen, dann verließ er fluchtartig das Badezimmer.
Verdammt, verdammt, verdammt, fluchte er in sich hinein. Bei solchen Gelegenheiten überkam ihn immer mal wieder die Überlegung, seinen Job zu wechseln, etwas mit geregelter Arbeitszeit anzustreben, aber nichtsdestotrotz liebte er seinen Beruf und die damit verbundenen Aufgaben. Seufzend ergab er sich in sein Schicksal und das hieß eben, Opfer zu bringen.
Seine Kollegin stand immer noch wartend im Flur und grinste breit beim Anblick seines Gesichtsausdruckes. Sie wusste genau um Rautners Stimmungslage. Irgendwie konnte sie ihn ja auch verstehen. Ihr würde es sicherlich ähnlich ergehen, wenn Jan da wäre und sie zum Dienst müsste.
»Dienstwagen oder Mini?«, fragte Chris im Treppenhaus. Das einzige Dienstfahrzeug für ihre Abteilung wurde fast ausschließlich von Rautner benutzt. In Zeiten von Sparmaßnahmen und Etatkürzungen hatte auch die Abteilung der Würzburger Mordkommission unter Fahrzeugmangel zu leiden. Daher hatten sich ihr Chef, Hauptkommissar Habich, und die Kommissare Blume und Rautner darauf geeinigt, dass Rautner den Dienstwagen nutzte und er sowie Jasmin ihre Privatwagen.
»Den Mini, ich stehe eh im Halteverbot.«
»Nichts Neues bei dir! Weiß Theo schon Bescheid?«
Jasmin sah in nachdenklich von der Seite an. »Irgendwie bist du verplant. Liegt das an deiner neuen Flamme?«
»Was ist los mit dir, bist du neidisch?«, konterte Chris.
»Nee, weiß Gott nicht, aber wenn du noch nicht mal mehr weißt, dass Theo dieses Wochenende in seiner alten Heimat ist, dann mache ich mir schon so meine Gedanken.«
»Ach, stimmt ja. Da war doch etwas mit Geburtstag.« Rautner kratzte sich am Kopf.
Der, von dem sie sprachen, war ihr Chef, Hauptkommissar Theo Habich, der Leiter des Teams. Ein ehemaliger Halbschwergewichtsboxer aus Frankfurt am Main, der durch seinen Sport und seinen Beruf nach Würzburg gekommen war und sich in die Stadt und die Region verliebt hatte. Seit dieser Zeit zog es ihn, wenn überhaupt, nur noch zu besonderen familiären Anlässen in die hessische Metropole.
»Genau! Sein Onkel, ich glaube, es ist der Bruder seiner Mutter, wird 80 Jahre alt.«
»Dann bin ich ja als Dienstältester sein Stellvertreter«, grinste Rautner, »und dir weisungsbefugt.«
»Bilde dir bloß nichts ein«, entgegnete Jasmin, die drei Schritte vor ihm lief und die Außentür vor seiner Nase zufallen ließ.
»Hat nichts mit Einbildung zu tun«, belehrte sie ihr Kollege und ignorierte die Provokation mit der Tür, »Ordnung muss sein und Rangordnung eben auch.«
Kommissarin Blume öffnete mit der Fernbedienung ihren Wagen, setzte sich hinters Steuer und rief. »Also gut. Komm endlich ins Auto … Chefchen!«
Demonstrativ stöhnend zwängte sich Rautner in den kleinen Wagen und Jasmin gab Gas. Der Wagen schoss von der schraffierten Fläche auf die Fahrbahn.
Chris hielt sich mit der rechten Hand am Haltegriff fest und fragte: »Wissen wir schon Näheres über den Todesfall?« Eine Bemerkung über Jasmins Fahrstil verkniff er sich, es hätte nur wieder zu einer unnötigen Diskussion geführt und nichts an ihrer Fahrweise geändert.
»Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es um einen Treppensturz mit Todesfolge in einem Weingut, aber mehr weiß ich auch nicht.«
Der Rest der Fahrt verlief schweigsam. Jasmin konzentrierte sich auf den Verkehr und Chris trauerte dem ganz anders geplanten Wochenende nach.
Gut zwanzig Minuten später passierte Jasmins Mini die beiden geschmückten Tannenbäume an der Zufahrt zu Iphofens Altstadt, die Einheimische und Besucher an das bevorstehende Weihnachtsfest erinnern sollten, und rumpelte anschließend über das Kopfsteinpflaster. Sie fuhren stadteinwärts, vorbei am Hotel Zehntkeller, einem historischen Gebäude, das seit Mitte des 16. Jahrhunderts als Gerichtsgebäude – das sogenannte »Zentgericht« – gedient hatte, bevor es dann irgendwann später seine jetzige Bestimmung erlangte.
»Jetzt müssen wir hier abbiegen«, bemerkte Jasmins Beifahrer, als ein Gotteshaus ins Blickfeld kam, die Kirche »zum Heiligen Blut«. Ein durchaus geschichtsträchtiges Gebäude, dessen Ursprung – basierend auf einem Blutwunder nach einer Hostienschändung – um 1300 als Kapelle »zum Heiligen Grab« begann und die bald darauf Ziel zahlreicher Wallfahrten wurde. Der von den Einheimischen nur liebevoll genannten »Blutskirche« schenkten die Kommissare aber nur wenig Beachtung. Chris vergewisserte sich stattdessen anhand der Handynavigation, dass sie richtig waren. »Genau hier am Julius-Echter-Platz rechts fahren«, gab er Anweisung.
»Das ist aber ein allerliebstes Städtchen«, meinte die junge Kommissarin. Ihr Blick hing an den farbenprächtigen Fassaden der teils jahrhundertealten Fachwerkhäuser. Viele neu renoviert und die meisten anderen gut erhalten. »Ich muss mir mal die Zeit nehmen und privat hierherkommen.«
»Kannst ja mal einen Gang außen um die Stadtmauer herum am Herrengraben entlang machen. Soll echt erholsam und sehenswert sein. Die Befestigungsanlage ist noch ziemlich gut erhalten und sehr imposant«, brummte Jasmins Kollege.
»Du redest schon wie ein Stadtführer. Woher weißt du das?«
»Ich kenne Iphofen von einem früheren Fall her«, bemerkte Chris. Der fragende Blickseiner Kollegin nötigte ihn zu einer weiteren Erklärung. »Das ist schon über vier Jahre her, also vor deiner Zeit. Hatte auch irgendwie mit einem Weingut zu tun.« Etwas mürrisch meinte er: »Es scheint hier vieles mit Wein in Verbindung zu stehen. Na ja, wenn man sich umsieht, gibt es ja auch reichlich Weinberge ringsherum. Wenn man Theo glauben darf, sind die Weine hier sehr gut. Also ich bin jetzt nicht so der Kenner, aber unser Chef schon«, hob Rautner abwehrend die Hände.
»Ich frag jetzt lieber nicht, was du gerne so trinkst.«
»Ist auch besser so«, gab Chris kurz angebunden zurück.
Das Weingut Birkner lag im Kern des Altstadtbereiches, nur einen Steinwurf vom Museum und vom Benefizium entfernt – einem ehemaligen Besitztum der katholischen Kirche und zuletzt Unterkunft von Klosterschwestern –, das ein privater Investor vor nicht allzu langer Zeit zu neuem Leben erweckt hatte. Zwei Polizeiautos auf der Straße bestätigten Jasmin, dass sie an der angegebenen Adresse richtig war. Trotz des mausgrauen Himmels und nasskalter einstelliger Temperaturen waren schon am Vormittag reichlich Menschen in Iphofen unterwegs. Viele strebten zu dem Weingut, dessen beide Torflügel weit geöffnet waren. Neugierig schielten die Besucher zu den Uniformierten. Es bildeten sich Grüppchen, deren Getuschel sich in der Hauptsache um Vermutungen über die Anwesenheit der Polizei drehte. Die ratlosen Blicke der Umherstehenden ließ vermuten, dass niemand genau wusste, was passiert war.