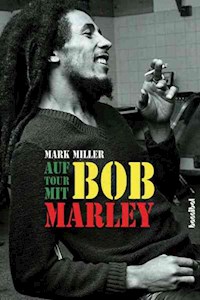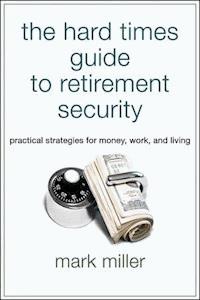9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Kunstsammlerin in Paris, ein Kunstfälscher in New York, eine schicksalshafte Begegnung und eine unsterbliche Liebe Lorraine leitet eine renommierte Pariser Werbeagentur, ihre Leidenschaft aber gehört der Kunst. Als sie zur Versteigerung eines berühmten Gemäldes nach New York reist, wird sie im Central Park von einem Unbekannten überfallen. Nur das mutige Einschreiten des Malers Leo verhindert Schlimmeres. Zwischen den beiden funkt es sofort, doch sie sind in Gefahr: Lorraine wird von einem Stalker verfolgt, der alles über sie weiß und sie in anonymen Nachrichten bedroht. Und Leo, der bis vor Kurzem als Kunstfälscher im Gefängnis saß, wird von seiner Vergangenheit heimgesucht. Schließlich macht er eine schreckliche Entdeckung, die ihre Liebe zerstören könnte. Eine einzigartige Liebe, eine einmalige Story, ein besonderes Debüt – perfekt für alle Leser:innen, die Guillaume Mussos Roman »Nacht im Central Park«, »Das Atelier in Paris« und »Das Mädchen aus Brooklyn« geliebt haben. Wer ist Mark Miller? Die Verlagswelt, die Presse und die Leser:innen rätseln, welcher französischsprachige Autor hinter dem englisch klingenden Pseudonym stecken könnte. Nur eines ist sicher: Alle sind begeistert von dem mysteriösen Autor und seinem mitreißenden Debütroman! »Spannung, Action und Emotionen machen aus diesem Roman das Buch des Sommers!« Gala »Ein echter Favorit! Eine Liebes- und Spannungsgeschichte, die Sie noch lange verfolgen wird.« Nice Matin »Zwischen Abrechnungen, Verdächtigungen und Familiengeheimnissen nimmt Mark Miller uns mit in eine faszinierende Geschichte.« Femme Actuelle »Ein großer Liebes- und Spannungsroman aus der Feder eines mysteriösen Autors.« Ici Paris »Ein origineller Roman mit einem unvorhersehbaren Ende, voller Kunst, Liebe und Spannung.« Version Femina »Dieser Roman hat alle Zutaten, um ein Bestseller zu werden.« Ouest France »Über den Autor, Mark Miller, ist bislang nichts bekannt. Das spielt aber keine Rolle, denn Sie werden von seinem Sinn für Intrigen und seiner Meisterschaft in Sachen Spannung komplett in Atem gehalten.« La Dépêche du midi »Ein Blockbuster!« La Voix du Nord
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Uns bleibt immer New York« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
((bei fremdsprachigem Autor))
Übersetzung aus dem Französischen von Anja Mehrmann
© XO Editions 2021
Titel der französischen Originalausgabe:
»Minuit! New York« bei XO Editions, Paris 2021
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Redaktion: Antje Steinhäuser, Manfred Sommer
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Westend61/Getty Images
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Motto
Vorspann
Prolog
OH!
(Joe Tilson, Öl auf Leinwand)
Mai 2020
Erster Teil
Convergence
(Jackson Pollock, Öl auf Leinwand)
1
Fünf Monate zuvor
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Zweiter Teil
Target
(Jasper Johns, Enkaustik und Zeitungspapier auf Leinwand)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dritter Teil
Kiss II
(Roy Lichtenstein, Öl und Magna)
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Vierter Teil
Den Tod reiten
(Jean-Michel Basquiat, Acryl und Kreide auf Leinwand)
42
43
44
45
46
47
48
Epilog
Playlist
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für Lisa, meinen Fels und Kompass. Sie brachte mich eines schönen Morgens auf die Idee und war meine erste Leserin.
Dieses Etwas nenne ich Liebe. Sie ist das Einzige, was den Menschen in seinem Fall aufhalten kann …
Paul Auster
[Hallo Lorraine. Erinnerst du dich an mich? Wie ich sehe, bist du heute Abend mal wieder allein.]
[Wer sind Sie?]
[Jemand, der sich für dich interessiert.]
[Das reicht. Ich werde Sie blockieren.]
[Ich finde immer Mittel und Wege, an dich heranzukommen. Und außerdem: Willst du nicht wissen, wer ich bin und woher ich all das über dich weiß?]
[Ist mir scheißegal, du armer Irrer! Du interessierst mich nicht. Einfach noch ein Bekloppter in den sozialen Netzwerken.]
[Du willst wirklich nicht wissen, was ich vorhabe? Es geht dich aber etwas an.]
[Bye, du Vollpfosten.]
[Ich habe vor, dich zu töten, Lorraine.]
[Was??]
[So, wie ich deinen Vater getötet habe …]
[Armseliger Schwachkopf, mein Vater ist schon vor achtundzwanzig Jahren gestorben.]
[Und sein Mörder wurde nie identifiziert, stimmt’s?]
[Na und? Diese Information kann jeder im Internet finden.]
[Aber nicht jeder weiß, wo du wohnst: 1, Avenue Barbey d’Aurevilly, dritte Etage links. Und auch nicht, dass du allein lebst. Kein fester Freund. Kein Haustier.]
[WER BIST DU?]
[Das wirst du bald erfahren.]
[Du glaubst, du kannst mir Angst machen? Du solltest mal zum Psychiater gehen. Ich werde die Polizei informieren. Und bis dahin blockiere ich dich. Bye.]
Anfangs glaubte sie, dass alles wieder in Ordnung kommen würde. Sie glaubte es tatsächlich. Er wird aufhören, dachte sie. Er wird der Sache überdrüssig werden. Er wird einfach wieder aus meinem Leben verschwinden.
Anfangs wollte sie daran glauben.
Prolog
OH!
(Joe Tilson, Öl auf Leinwand)
Mai 2020
New York, 28. Mai 2020, gegen 8 Uhr morgens. Sanft streicht die Sonne über die Dächer von Manhattan. Sie spiegelt sich in den Millionen Fenstern der Wolkenkratzer, leuchtet hell in die breiten Straßenschluchten, schleicht sich in das grüne Laub im Central Park, dringt durch die Schiebefenster, die Glaswände der Büros, die Fenster der Hochbahn.
Auf dieselbe Art dringt sie durch die drei Fenster in einen Künstlerloft in SoHo, Midtown Manhattan, ein. Sie beleuchtet den großen Körper, der ausgestreckt vor dem Fußende des zerwühlten Betts auf dem Fußboden aus Eichenholz liegt. Beleuchtet auch die Plakate von Hans Hofmann und Cy Twombly, die an den Wänden hängen, und den Hund, der winselnd die Dielen neben dem Körper zerkratzt.
Lorraine steht in der schweren Brandschutztür.
Von der Schwelle aus betrachtet sie die Szene. Wie betäubt. Angsterfüllt. Im nächsten Moment macht sie drei Schritte auf den Mann zu. Sie hört sich selbst seinen Namen sagen: »Léo!«
Keine Reaktion. Durch das große Loft, das von den fröhlich tanzenden Strahlen der aufgehenden Sonne erfüllt ist, geht sie weiter auf ihn zu. Innerlich ist sie wie erfroren. Er sieht unglaublich schön und ruhig aus in diesem Moment, als er da ausgestreckt auf dem Boden liegt.
»Léo!«
Stille. Bis auf das jämmerliche Winseln des Hundes, eines Cockerspaniels, der seinem Herrchen jetzt mit dem Eifer und der Zärtlichkeit, die typisch für junge Hunde sind, übers Gesicht leckt. Seinem Herrchen, der im Sonnenschein überaus friedlich wirkt und die tierische Zuwendung über sich ergehen lässt, als schliefe er.
»Léo!«
Keine Antwort. Panik überkommt sie. Sie fällt auf die Knie, schüttelt ihn, schlägt ihm ins Gesicht. Schon rollen Lorraine die Tränen über die Wangen; sie glänzen im goldenen Morgenlicht.
»Léo! Bitte! Mach die Augen auf. Sag etwas. Léo!«
Sie beugt sich über ihn, sucht nach seinem Puls, seiner Atmung. Findet beides. Er lebt! Er atmet!
Zwanzig Sekunden später öffnet er seine großen hellgrauen Augen und richtet diesen lichtvollen Blick auf sie, der sie immer dahinschmelzen lässt. Er versucht zu lächeln, sein Gesicht ist kalkweiß.
»Lorraine? Du bist da … Hab keine Angst … Ruf einen Krankenwagen«, sagt er mit schwacher Stimme. »Jetzt, Liebling …«
Erneut schließt er die Augen. Er atmet noch, ist aber offensichtlich wieder ohnmächtig geworden. Mit zitternder Hand holt Lorraine ihr Handy heraus. Die Tränen trüben ihren Blick. Konzentrier dich! Sie braucht zwei Anläufe, um die 911 anzurufen. Eine Stimme am anderen Ende der Leitung. Sie stammelt, bringt alles durcheinander. Die Stimme fragt sie ruhig nach ihrem Namen und ihrer Adresse »für den Fall, dass das Gespräch unterbrochen wird«.
Die Worte sprudeln aus ihr heraus, aber die Frau von der Leitstelle unterbricht sie und fordert sie auf, noch einmal von vorn anzufangen. Das regt sie noch mehr auf. Diese Frau ist dermaßen ruhig, dass Lorraine beinahe die Beherrschung verliert. Sie atmet durch, spricht langsam und deutlich. Die Frau am anderen Ende der Leitung begreift sehr schnell, dass etwas Schlimmes vorgefallen ist, und bittet sie, am Apparat zu bleiben.
In diesem Moment öffnet er die Augen und sagt: »… ist nicht so schlimm …«, um dann ein weiteres Mal das Bewusstsein zu verlieren. Es ist exakt 8:30 Uhr an diesem Morgen des 28. Mai 2020 in New York.
Sie sieht, wie sie ihn auf einer Trage, deren Rollen unangenehm quietschen, abtransportieren. Die untere Hälfte seines Gesichts bedeckt eine Sauerstoffmaske, die Sanitäter tragen Stoffmasken. Seine Haare, die sie bei ihrer ersten Begegnung ein bisschen zu lang fand, umrahmen sein schönes Gesicht mit den geschlossenen Lidern, und erneut spürt sie, wie die Angst von ihr Besitz ergreift. Sie schließt die Tür des Lofts hinter sich, wobei sie den Cockerspaniel entdeckt. Er sitzt allein mitten im Raum und hat den Blick auf Lorraine gerichtet, diesen traurigen, verlorenen und ratlosen Blick eines herrenlosen Hundes, und sie spürt, wie ihr ein weiteres Mal die Tränen in die Augen steigen. Dann begleitet sie die Sanitäter zum Aufzug.
Wooster Street. Die Hecktüren des weißen Rettungswagens vom New York-Presbyterian Hospital mit den orangefarbenen und blauen Streifen sind weit geöffnet. Die Tragbahre wird hochgehievt und gleitet in die Führungsschienen. Sie sieht Léo im Inneren des Wagens verschwinden, das Ding verschlingt ihn förmlich. Dann steigt sie wieder die Treppe hinauf und sucht ein paar Sachen zusammen, die er im Krankenhaus brauchen wird. Und weiß tief in ihrem Inneren und mit schmerzhafter Gewissheit, dass er nicht zurückkommen wird.
Erster Teil
Convergence
(Jackson Pollock, Öl auf Leinwand)
1
If you’ve ever been to New York City,
You know what I’m talking about.
The Yardbirds, New York City Blues
Fünf Monate zuvor
Es regnete wie aus Eimern auf Paris an diesem Montag, dem 9. Dezember 2019. Sie klappte den Koffer, den sie in ihrer großen und ziemlich leeren Wohnung in der Avenue Barbey d’Aurevilly Nr. 1, nur wenige Schritte vom Eiffelturm entfernt, aufs Bett geworfen hatte, wieder zu.
Sie, das war Lorraine Demarsan, Tochter des verstorbenen François-Xavier Demarsan und seiner Frau Françoise Balsan.
Es war kalt in der Hauptstadt in diesem Dezember, und jetzt regnete es, aber Lorraine achtete nicht weiter darauf. In etwas mehr als zwei Stunden würde sie nach New York fliegen, wo es dem Wetterbericht zufolge schneite.
Lorraine mochte Paris, New York hingegen liebte sie.
Diese Stadt besaß eine Energie, eine Schwingung, die sie zu etwas Einzigartigem machte. Und sie hatte etwas Unergründliches, eine Art Rhythmus, den nur New York und die New Yorker besaßen, dieses Völkchen, dass sich so sehr von den Parisern unterschied und ihr dennoch unendlich vertraut war. Sie war zwar Französin, hatte die ersten sieben Jahre ihres Lebens aber im Big Apple verbracht. Bis ihre Mutter beschloss, mit Sack und Pack nach Frankreich zurückzukehren, weit weg von der Megalopolis, in der Lorraine aufgewachsen war. Deshalb wurde sie jedes Mal, wenn sie dorthin zurückkehrte, nicht nur von der atemberaubenden Magie dieser Stadt, sondern auch von dem Gefühl ergriffen, nach Hause gekommen zu sein.
Nachdem sie in Jeans und einen dicken Pulli geschlüpft war und sich ihren grauen Schal um Hals und Kinn gewickelt hatte, begann sie, im Zimmer auf und ab zu gehen. Sie warf einen Blick auf die Uhr: 16:09. In einer Minute würde das Taxi kommen. Sie ging zum Balkon und betrachtete ein letztes Mal den von Windböen gepeitschten Eiffelturm. Draußen tobte der Sturm, doch der eisernen alten Dame schienen die Elemente gleichgültig zu sein. Wie eine Herausforderung für die verstreichende Zeit ragte sie in den dunklen Himmel über Paris hinein und hatte ohne jeden Zwischenfall diverse Epochen, sämtliche Krisen und jedes Unwetter überstanden.
Lorraine wandte sich ab und überprüfte, ob ihr Reisepass sich in der Innentasche ihres Mantels befand. Sie wollte nur noch eins: im Flugzeug sitzen und sich von den Flugbegleitern umsorgen lassen. Sie würde ein oder zwei Gläser Champagner trinken, sich einen Film oder eine Serie anschauen und dann unter der kuscheligen Decke und der Schlafmaske einschlafen, die Air France in der Businessclass zur Verfügung stellte. In diesem Augenblick wünschte sie sich nichts anderes, als weit weg zu sein, so groß war ihre Angst, so deprimiert war sie.
Dabei hatte Lorraine Demarsan mit ihren fünfunddreißig Jahren durchaus Grund, guter Stimmung zu sein. Beruflich befand sie sich auf dem Weg nach oben. Ihre Versetzung auf die andere Seite des Atlantiks bedeutete einen weiteren Schritt in ihrer makellosen Laufbahn. Die Werbeagentur DB&S eröffnete eine Filiale in New York, und sie sollte das Steuer in die Hand nehmen. DB&S wie Demarsan, Bourgine & Salomé. Paul Bourgine und Paul-Henry Salomé, ihre Geschäftspartner. Insgeheim nannte sie die zwei »meine beiden Pole«. Was sie tatsächlich auch waren, und zwar von jeher, obwohl die beiden wesentlich älteren Männer, alte Freunde ihres Vaters, sie manchmal auf eine Art bevormundeten, die ihr auf die Nerven ging.
Nichtsdestotrotz hatten sie beschlossen, Lorraine die Leitung der New Yorker Niederlassung anzuvertrauen, denn sie beherrschte die Sprache, war mit den kulturellen Besonderheiten vertraut und kannte diese Stadt und ihre Bewohner besser als jeder andere. Im Grunde war sie ebenso sehr New Yorkerin wie Pariserin. Sie ging in eines der Badezimmer und holte sich eine Halsschmerztablette aus dem Arzneimittelschrank. Es war immer dasselbe: Sobald sich ein wichtiges Ereignis am Horizont abzeichnete, traten bei ihr irgendwelche körperlichen Beschwerden auf. Als Jugendliche zog sie sich vor einer Verabredung mit einem Jungen oder vor einer Prüfung regelmäßig Lippenherpes zu. Über den endlos langen Flur gelangte sie zu dem Zimmer zurück. Die Wohnung bestand aus zwölf Räumen, von denen sechs Wohnräume und vier Badezimmer waren. Bei einem Quadratmeterpreis von fünfzehntausend Euro konnte sie sich das Leben in dieser sehr begüterten Gegend des VII. Arrondissements, einer der teuersten von Paris, nur deshalb leisten, weil die Wohnung Teil ihres väterlichen Erbes war.
Eine SMS auf ihrem Handy teilte ihr mit, dass ihr Wagen des Pariser Taxiunternehmens G7 eingetroffen war.
Sie beugte sich über das Bett und bewunderte ein letztes Mal das Kunstwerk auf dem Bildschirm ihres MacBooks: La Sentinelle. Ein Bild von Victor Czartoryski. Nein, nicht ein Bild. Das Bild. Das Meisterwerk des amerikanisch-polnischen Malers, das 1970 dessen zweite Schaffensperiode, die des »metaphysischen Realismus«, eingeleitet hatte. Das Gemälde, das neben Pollock, Warhol und anderen einen der bekanntesten amerikanischen Künstler des 20. Jahrhunderts aus ihm gemacht hatte. Eine schemenhafte menschliche Silhouette, mit wütenden schwarzen Pinselstrichen auf grauem Grund gemalt, mit kaum wahrnehmbaren Spuren von Grün und Kadmiumgelb und mit gespachtelten Stellen in einem außergewöhnlichen Rot.
La Sentinelle. Das Lieblingsbild ihres Vaters und auch das von Lorraine … Sie betrachtete es zum hundertsten Mal. In wenigen Stunden würde es vielleicht ihr gehören.
Sie wollte den Laptop gerade herunterfahren und ihn in die Hülle schieben, als eine neue Nachricht in ihrer Mailbox und gleich darauf auch auf dem Display ihres iPhone auftauchte. Sie erstarrte. Absender unbekannt. Kein Betreff … In ihrem Gehirn schrillten die Alarmglocken. Angst überkam sie. Ihre Kehle war wie ausgetrocknet, als sie die Nachricht öffnete.
Du kannst gehen, wohin du willst, Lorraine, du wirst mir nicht entkommen.
Lorraine starrte auf den Bildschirm, ihre Sinne waren wie betäubt.
Sie versuchte ihre Fassung wiederzufinden, schaltete den Apparat aus und klappte ihn zu. Auch löschte sie sämtliche Lampen, sodass nur noch das Licht der Straßenlaternen die leeren Räume erhellte. Die Tasche mit dem Laptop schräg über die Schulter gehängt, den Koffer in der Hand, lief sie zur Tür, schloss die Wohnung ab und eilte zum Fahrstuhl.
Sie rannte den Bürgersteig entlang. Obwohl sie das Gesicht im Schal und im Kragen ihres Mantels vergraben hatte, schlug ihr der kalte Regen ins Gesicht. Sie lief auf das Taxi an der Ecke Avenue Barbey d’Aurevilly und Avenue Émile Deschanel zu und ruinierte sich dabei innerhalb weniger Sekunden die Frisur.
Die Rinnsteine liefen über, der Regen ergoss sich über Fassaden und Asphalt. Kein Mensch war zu sehen. Das Viertel sah aus, als hätten die Bewohner es verlassen. Wie eine unheilvolle Großstadtwüste.
Erst als sie in den Fond des schwarzen Mercedes stieg, bemerkte sie, dass sie heftig zitterte. Mit dem Gefühl, einer Gefahr entronnen zu sein, ließ sie sich auf die Rückbank sinken und sagte sich, dass er sie in New York vielleicht in Ruhe lassen würde. Sie wünschte, ihr Abschied wäre endgültig. Sie wünschte, der große Tag wäre bereits gekommen. Bald. Nächsten Monat. Dieser Aufenthalt war nur ein Vorspiel, der vorbereitende Besuch vor dem großen Sprung. Wenn erst einmal sechstausend Kilometer zwischen ihr und ihm lagen, fehlten ihm hoffentlich die Mittel, ihr weiterhin das Leben zu vergällen.
2
I’m the king of New York.
The Quireboys, King of New York
Er verlässt Rikers Island noch am gleichen Tag. Es schneit. Es ist bitterkalt an diesem frühen Morgen. In New York ist die Temperatur deutlich unter null gefallen. Die ganze Stadt unter dem dunklen Himmel ist von einem reinen, blendenden Weiß. Ein Dezember wie jeder andere im Big Apple.
Er heißt Léo Van Meegeren, ist einunddreißig Jahre alt – und an diesem Punkt der Geschichte endlich frei.
Um den Gefängniskomplex von Rikers Island zu betreten oder zu verlassen – der größte im Staat New York und der zweitgrößte der Vereinigten Staaten, der, wie der Name schon sagt, auf einer Insel mitten im East River erbaut wurde –, muss man eine eintausendzweihundertachtzig Meter lange Brücke überqueren. Genau das tat der Gefangenentransporter, der Léo an diesem Morgen wegbrachte, begleitet von Möwengeschrei und eisigen Windböen.
Léo schwankte auf der Rückbank hin und her, aber er lächelte. Denn nach drei Jahren Haft im Otis Bantum Correctional Center, einem der zehn Gefängnisse des Komplexes, konnte er Rikers Island endlich verlassen. Was er verbrochen hatte? Nun, Léo verstand es, Gemälde von Pissarro, Renoir, van Gogh, Matisse genauso gut, wenn nicht besser als die großen Meister selbst zu malen. Er war ein Fälscher. Oder war jedenfalls einer gewesen. Nach drei Jahren in der Arrestzelle hatte er beschlossen, den Pinsel beiseitezulegen.
Mit seiner verwaschenen Jeans, dem schwarzen Rollkragenpulli, der leichten Wildlederjacke und den etwas zu langen braunen Haaren ähnelte Léo Van Meegeren eher einem Künstler – der er ja wirklich war – als einem Ex-Häftling. Er war eins fünfundachtzig groß und wog achtzig Kilo, sieben mehr als bei seiner Ankunft auf Rikers. Das zusätzliche Gewicht verdankte er sportlichen Übungen im Gefängnis. Aber abgesehen von seinem katzenartigen, leicht nachlässigen Gang, der so langsam war, dass man es für Berechnung halten konnte, fielen an ihm vor allem seine riesigen grauen Augen auf, die aufmerksam und verträumt zugleich wirkten. Sein Blick war der eines Raubtiers oder der eines Malers, je nachdem.
Die raubtierhafte Seite beruhte vermutlich auf den drei Jahren, die er auf Rikers verbracht hatte. Aggressionen, Misshandlungen der Häftlinge durch die Wärter oder durch andere Häftlinge, Sadismus, sexuelle Gewalt, illegale Geschäfte jeder Art, Leibesvisitationen am nackten Körper vor den Mitgefangenen, der Dschungel aus Beton, in dem sich ein Krankenhaus, eine Kapelle, Baseballfelder, ein Elektrizitätswerk, eine Laufbahn und zwei Bäckereien befanden – alldem eilte der Ruf jener Gewalttätigkeit voraus, die aus Rikers eines der schlimmsten Gefängnisse in den USA gemacht hatte. Am 22. Juni 2017 verkündete der Bürgermeister von New York höchstpersönlich, er habe die Absicht, Rikers Island innerhalb der nächsten zehn Jahre zu schließen.
Für Léo war es höchste Zeit. Mit dem Rücken an die vibrierende Seite des Kastenwagens gelehnt, saß er regungslos da, während er hin und wieder einen flüchtigen Blick auf seine Weggenossen warf. Sieben von ihnen wurden an diesem Tag entlassen. Sieben Geschichten, sieben Werdegänge. Sieben nervöse oder erloschene Gesichter. Der Wagen verlangsamte die Fahrt, hielt schließlich an. Die Türen öffneten sich. Der Widerschein des Schnees drängte die Finsternis zurück und ließ die Männer blinzeln.
»Na los, ihr da drin. Alle Mann aussteigen!«
Sie sahen einander an. Léo bemerkte, dass sich einige Männer in einer Art Schockzustand befanden.
»Kommt schon, beeilt euch! Es ist kalt hier!«
»Verdammte Scheiße«, sagte der neben ihm. »Ich kann es einfach nicht fassen.«
Léo sah, dass ein junger Kerl von Mitte zwanzig heiße Tränen vergoss. Der Älteste von ihnen – er ging bereits auf die siebzig zu – saß immer noch auf der Bank und schien unfähig, sich zu erheben. Léo legte ihm eine Hand auf die Schulter.
»Wir sind da, Charlie. Wir müssen jetzt gehen.«
Der Alte hob den Kopf, musterte ihn mit stumpfem Blick, und Léo begriff, dass er Angst hatte. Angst vor der Freiheit. Angst vor den leeren Tagen da draußen. Léo erinnerte sich an einen Song von U2, in dem es hieß: In New York, freedom looks like too many choices.
Beim Aussteigen stellte er fest, dass seine Jacke für die Jahreszeit viel zu dünn war. Es war höllisch kalt, und noch immer fiel hinter den Pfeilern der Hochbahn dicht und schwer der Schnee. Er ließ seinen durchdringenden Blick durch den Transporter wandern, der unter dem hohen Metallgerüst der Station Astoria-Ditmars Boulevard in Queens parkte. Als ihm einfiel, dass sich unter den Sachen, die sie ihm zurückgegeben hatten, auch ein altes Ticket befand, fragte er sich, ob es drei Jahre später immer noch gültig war. Die Art von Fragen, die nur einem Ex-Häftling in den Sinn kommen konnten.
In dem Zug, der sich wenige Minuten später lärmend in Bewegung setzte, um ihn nach Südwesten zur Insel Manhattan zu bringen, verengten sich seine großen grauen Raubtieraugen. Betäubt von der Menschenmenge, stand er inmitten der Passagiere.
Wie ein Kind drückte er die Stirn an die Fensterscheibe und genoss den Anblick der kleinen Flachdachhäuser, die in der aufgehenden Sonne vorbeiflogen. Er betrachtete verschneite Straßen, vereiste Spielplätze und weiße Schnellstraßen, auf denen die Autos nur in Zeitlupe vorankamen. Als handle es sich um sanfte Musik, lauschte er dem Getöse der hin und her schwankenden Hochbahn, die dem auf Rikers üblichen Lärm in nichts nachstand. Bis zu dem Augenblick, in dem sich der Zug in die Eingeweide der Stadt bohrte und in das unterirdische Netz gelangte.
Siebenundzwanzig Minuten nach der Abfahrt kam Léo aus der Station Prince Street an der Ecke zum Broadway wieder zum Vorschein. Er gab acht, auf den glatten Bürgersteigen nicht auszurutschen, stieg über große Schneeverwehungen hinweg und begegnete vereinzelten sich gegen die Kälte zusammenkrümmenden Passanten. Er war auf eine heftige, geradezu unverschämte Art glücklich. Und obwohl der eisige Wind durch seine Jacke drang, hatte er es nicht besonders eilig. Er erkannte jede Straße, jede Kreuzung und jedes Gebäude, auch wenn sich die Geschäfte in den drei Jahren verändert hatten.
Dies war sein Viertel. Ein Viertel mit gepflasterten Straßen, Restaurants, Boutiquen, schicken Galerien und Cast-Iron Buildings, Häusern mit gusseiserner Fassade, die mehr als hundert Jahre zuvor erbaut und längst in sündhaft teure Künstlerlofts umgewandelt worden waren.
Ihm war kalt, seine Hände und Füße fühlten sich wie erfroren an, als er die Wooster Street hinaufging. Er kam an einem großen Umzugswagen vorbei. Junge Leute räumten ihn aus, indem sie die Möbel auf dem Schnee abluden. Vor einem kleinen fünfstöckigen Backsteingebäude blieb er stehen, betrachtete die Außentreppe, an der ein Fahrrad angekettet war, die hohen Fenster und die Feuerleiter aus Metall, die sich im Zickzack an der Fassade emporrankte.
Im Lauf seiner dreijährigen Haft hatte er zweimal geweint. Alle Männer weinen im Gefängnis. Mitten in der Nacht, in der Dunkelheit, lassen sie sich die Tränen lautlos über die Wangen laufen, bis sie das Laken benetzen, um sie dann abzuwischen, unbemerkt von ihrem schlafenden Zellengenossen. Damals war es ihm vorgekommen, als wäre das Gefängnis ein Monster, das ihn verschluckt hatte und nie wieder ausspucken würde.
Mit vom Schneesturm zerzausten Haaren stand er regungslos unter dem dunklen Himmel. An diesem Tag weinte er nicht. Sein Blick wanderte langsam über die Fassade und nahm jedes Detail wahr, als beabsichtigte er, alles so realistisch wie möglich, im Stil eines Charles Sheeler oder Edward Hopper nachzumalen.
Dennoch war er innerlich bewegt. Verdammt bewegt sogar.
Denn er war wieder zu Hause.
Er bemerkte den Mann nicht, der ihm in der Subway gefolgt war und ihn nun aus gut zwanzig Metern Entfernung beobachtete. Er hatte die Augen gegen den Rauch der Zigarette, die in seinem Mundwinkel steckte, zusammengekniffen, und sein Gesicht war so lang und mager, dass es merkwürdig eindimensional wirkte.
3
Take him back to NYCAnd we all go woowoowoo.
Herman Dune, Take Him Back to New York City
Das Loft war noch in dem Zustand, in dem er es verlassen hatte. Dieselben Plakate von Hans Hofmann und Cy Twombly an den Wänden aus Backstein, dieselben ledernen Clubsessel, dieselben Teppiche, Möbel und antiken Nippesstücke waren in dem riesigen offenen Raum verteilt, dasselbe Cannondale-Fahrrad stand in einer Ecke, das alte Bett auf den Dielen aus Eichenholz.
Während er die Brandschutztür hinter sich schloss und den hellen, stillen Raum betrat, begannen seine Augen doch noch verräterisch zu glänzen. Er hatte vergessen, wie viele Quadratmeter seine Wohnung umfasste. Als er sie nun im Geist mit seiner Zelle auf Rikers verglich, kam sie ihm unendlich groß und wunderbar friedlich vor. Auch das Licht, das durch die nach Osten zeigenden Fenster hereinschien, hatte nichts mit dem Unheil verkündenden künstlichen Schimmer zu tun, der nur mit Mühe die Gitter des Gefängnisses zu durchbrechen vermochte.
Er zog seine Jacke aus und ging auf das Sims unterhalb der drei Fenster zu, wo immer Bücher, Kunstzeitschriften und Kataloge lagen, die nun nach drei Jahren im direkten Sonnenlicht leicht vergilbt waren. Ragtime von E. L. Doctorow, Scharfe Zeiten von Richard Price, Der unsichtbare Mann von Ralph Ellison.
Seine Lieblingsromane. In allen ging es um New York. Seine Stadt. Er wollte nirgendwo anders sein.
Dennoch war er gereist, vor allem durch Europa. Nach der Kunstakademie war er ohne einen Cent in der Tasche durch Italien, Spanien, Frankreich, Flandern gereist, hatte Amsterdam, London, Wien und viele andere Städte gesehen. Er hatte Museen besucht, viele Museen. Die Eremitage, die National Gallery, die Vatikanischen Museen, den Louvre, den Prado, die Accademia und die Scuola Grande di San Rocco in Venedig, das Kunsthistorische Museum in Wien. Auf Rikers Island hatte er häufig die Augen geschlossen und die Gemälde seiner Lieblingskünstler vor sich gesehen. Bonnard, Rembrandt, Tizian, Goya, Czartoryski … eine Farborgie in seinem Kopf, ehe der Knast ihn in die Realität zurückholte.
Nicht die geringste Spur von Staub war zu sehen, so, als wäre die Zeit stehen geblieben, sobald er diesen Ort verlassen hatte und ins Gefängnis gegangen war. Er wusste, dass die Putzfrau einmal im Monat vorbeikam, und seine Schwester hatte ihm versichert, dass sie das Loft regelmäßig lüftete.
Er berührte die Heizkörper. Lauwarm. Er drehte die Heizung voll auf, um gegen die Kälte anzukämpfen, die die Stadt einhüllte. Er ging in die Kochecke, in der die italienische Espressomaschine bereitstand, suchte in einem Schrank nach Kaffee, ließ die Bohnen in die Kaffeemühle prasseln, nicht ohne vorher an der Verpackung zu schnuppern. Seit drei Jahren hatte er nichts derart Köstliches mehr gerochen. Er öffnete den Wasserhahn über der Spüle, ließ das Wasser für einen Moment einfach laufen und füllte den Behälter der Espressomaschine. Dann öffnete er den Kühlschrank: Leere.
Léo schaltete die Stereoanlage ein, die auf der Küchentheke stand. Während die Kaffeemaschine sich aufheizte, entledigte er sich seiner Kleidung und ging unter die Dusche, die sich auf der anderen Seite der Wand aus Glasbausteinen, die das Loft vom Badezimmer trennte, befand. Ray Charles stimmte What’d I Say an. Dieser und ein paar andere Songs hatten es ihm ermöglicht, auf Rikers Island durchzuhalten. Die Rohrleitungen vibrierten, warmes Wasser schoss aus dem Duschkopf, und Léo schloss vor Wohlbehagen die Augen. Plötzlich schalteten seine Sinne jedoch auf Alarmbereitschaft, und er warf nervös einen Blick über die Schulter. Natürlich war niemand dort.
Du bist nicht mehr auf Rikers, Mann, mach dich mal locker. Hier bist du nicht in Gefahr …
Said I feel alright now, sang Ray Charles auf der anderen Seite der Glaswand in voller Lautstärke, wie um ihn zu beruhigen.
Als er aus der Dusche kam, fand er in einer Schublade weiche, sorgfältig gefaltete Handtücher vor. Er trocknete sich ab. In dem großen Standspiegel erblickte er den fahlen Teint und die geröteten Augen eines Menschen, der nur selten das Tageslicht sieht. Und ein Gesicht mit einigen zusätzlichen Falten.
Mit nacktem Oberkörper, ein Handtuch um die Hüften geschlungen, genoss Léo den frisch gemahlenen Kaffee, während Elton John verkündete, er sei still standing: Er stehe immer noch aufrecht da. Freut mich für dich, Mann, dachte er, freut mich wirklich. Ich auch. Überwältigt von seinen Gefühlen und voll wilder Begeisterung, verzog Léo das Gesicht zu einem Lächeln. Er deutete sogar einen Tanzschritt an.
Verdammt, frei zu sein ist einfach fantastisch.
Kurze Zeit später stand er regungslos vor den unberührten Leinwänden, den Glasgefäßen voller Pinsel und den Farbtuben, die auf dem Arbeitstisch aus rohem Holz verstreut lagen. Drei Jahre, ohne zu malen … Was für Bilder würden seine Erfahrungen im Gefängnis hervorbringen? Er lechzte danach, sich auf die Malerei zu stürzen, Tag und Nacht zu malen, bis er erschöpft auf seiner Lagerstatt zusammenbrechen würde … aber vorher musste er jemandem einen Besuch abstatten.
Er durchstöberte den Kleiderschrank und fand eine Lederjacke, deren Kragen mit Fell gefüttert und die sehr viel wärmer als sein Wildlederblouson war, außerdem einen dicken Wollpullover, eine Jeans und Unterwäsche. Fünf Minuten später hatte er die Wärme des Lofts gegen die beißende Kälte der Straßen von Manhattan eingetauscht, und sog die klare Luft ein, als handle es sich um berauschenden Äther. Er musste seine finanzielle Situation bei der Bank klären. Bis dahin würde er sich mit den zerknitterten Scheinen behelfen, die er bei seiner Entlassung aus Rikers zurückbekommen hatte. Er schob die Hände in die Taschen und machte sich leichten Herzens auf den Weg zur Subway, wobei er über den schmutzigen Schnee auf der Wooster Street hüpfte.
An der Ecke East 73rd Street und Lexington Avenue befand sich das Kitty Fine Wines, eine schicke Weinhandlung. Das leise Bimmeln des Glöckchens an der Glastür nahm Léo in Empfang, als er über die Schwelle trat. Er wischte sich die Schneeflocken vom Pelz seines Kragens und sah sich um.
Der Laden hatte sich kaum verändert: mit Mahagoni vertäfelte Wände, Fässer, die den Eindruck erwecken sollten, man befände sich in einem Weinkeller in Burgund oder in der Toskana, Spiegel, die die Illusion eines größeren Raums vermittelten. Die Inhaberin hatte sich eine blaue Winzerschürze um die Taille gebunden und unterhielt sich angeregt mit einem Kunden.
Léo schlenderte an den Regalen entlang und gab vor, sich für günstige kalifornische, chilenische oder neuseeländische Weine sowie für unerschwingliche Tropfen aus Frankreich mit dem Prädikat Grand Cru zu interessieren, außerdem für Whiskeys aus Taiwan und für eine Flasche Grey-Goose-Wodka in einem Kasten von Chopard für achthundertfünfzehn Dollar. Offenbar verfügten die Kunden in diesem Viertel nach wie vor über die nötigen finanziellen Mittel.
Er betrachtete gerade mit träumerischer Miene einen in einer Vitrine eingeschlossenen Pétrus 1988 zu dreitausendzweihundert Dollar die Flasche, als die junge rothaarige Frau am anderen Ende des Geschäfts ihr Kundengespräch beendete. Sie kam flotten Schrittes auf ihn zu und griff im Vorbeigehen nach einem kalifornischen Wein.
»Dieser französische Wein ist wegen der Steuern und Abgaben sehr teuer«, verkündete sie, als sie vor ihm stand. »Stattdessen würde ich Ihnen diesen kalifornischen Wein empfehlen, wenn Sie wollen. Der ist günstiger. Und um sich den Pétrus zu leisten, fehlen Ihnen auf jeden Fall die Mittel.«
»Woher wollen Sie das wissen?«, protestierte er mit beleidigter Miene. »Ich ziehe französischen Wein vor, egal zu welchem Preis … Es gibt mindestens zwei Gebiete, auf denen die Franzosen glänzen: beim Wein und in der Malerei.«
»Ach wirklich?«, versetzte die junge Frau. »Sei bloß nicht so ein Snob, Léo Van Meegeren. Und was ist mit Convergence?«
»Einen Renoir würde ich nicht gegen sämtliche Pollocks dieser Welt tauschen.«
»Du lügst, Bruderherz«, sagte sie. »Du hast Pollock und Czartoryski von jeher verehrt wie zwei Halbgötter.«
Und damit warf sich Kitty ihrem Bruder in die Arme und zog ihn an sich. Sie drückte ihren Kopf mit der fließenden roten Haarpracht an seinen Hals und stand für einige Sekunden regungslos da. Er spürte den Herzschlag seiner Schwester an seiner Brust. Als sie sich voneinander lösten, weinte sie.
»O Mann, ist das schön, dich zu sehen«, stammelte sie, während sie sich mit einer Ecke ihrer Schürze die Tränen trocknete. »Du hättest mir ruhig sagen können, dass du rauskommst, du Scheißkerl!«
Er zuckte mit den Schultern. »Du weißt doch, wie so was läuft. Ich habe es selbst erst gestern Abend erfahren.«
»Trotzdem hättest du mich anrufen können.«
»Ich wollte dich überraschen.«
Ein Lächeln erhellte Kittys Gesicht. Sie hob den Kopf und verschlang ihn förmlich mit ihren großen, tränenfeuchten Augen. Sie war rothaarig, er hingegen brünett; Kitty hatte zwar die gleichen grauen Augen, aber ihre Nase, ihre Wangen, ja sogar ihre Lippen waren mit Sommersprossen übersät.
»Wie ist das möglich?«, fragte sie und musterte ihn prüfend. »Du siehst gleichzeitig schlanker und kräftiger aus. Offenbar hast du dich in Form gehalten.«
»Außer Sport kann man im Gefängnis nicht viel machen.«
»Trotzdem, was für Muskeln, hier … und da auch«, sagte sie und betastete durch die Jacke hindurch seinen Bizeps. »Hast du schon im Loft vorbeigeschaut?«
»Ja. Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Dort ist alles beim Alten.«
Sie verzog die Lippen zu einem schelmischen Grinsen. »Vergiss nicht, dass es jetzt auf meinen Namen läuft.«
Léo lächelte. Das war der einzige Kniff, der ihnen eingefallen war, um das Loft dem Zugriff der Justiz zu entziehen. Kitty warf einen Blick auf ihre Uhr, fasste ihn am Ellbogen und machte Anstalten, ihn zur Tür zu führen. »Wollen wir mittagessen gehen? Ich mache den Laden einfach zu. Ich könnte einen Aushang schreiben: ›Wegen Entlassung aus dem Gefängnis ausnahmsweise geschlossen‹, wie findest du das? Schließlich kommt mein kleiner Bruder nicht jeden Tag aus dem Knast …«
»Könnte sich vielleicht mal jemand um mich kümmern?«, fragte ein Kunde in drei Metern Entfernung von ihnen.
»Könnten wir schon, tun wir aber nicht«, versetzte Kitty, während sie direkt auf ihn zuging. »Der Laden ist geschlossen.«
»Wie bitte? Aber an der Tür steht: ›Geöffnet von 9 bis 18 Uhr‹!«
»Es brennt«, sagte seine Schwester. »Wir werden evakuiert.«
Der Kunde riss die Augen auf. »Ein Brand? Wo denn? Wo ist die Feuerwehr?«
»Die kommt gleich.«
»Was reden Sie denn da? Ich sehe nichts.«
»Riechen Sie denn nicht den Rauch?«
»Ich rieche gar nichts.«
»Nun, in dem Fall sollten Sie mal zum HNO-Arzt gehen.«
Und damit setzte sie ihn kurzerhand vor die Tür.
Er lief ziellos umher, ohne auch nur einmal stehen zu bleiben, seit Stunden schon. Alles war ihm Vorwand genug, sich herumzutreiben, die wiedergefundene Freiheit zu kosten wie Wein, die vorweihnachtliche Atmosphäre in sich aufzunehmen. Die Hände tief in die Taschen geschoben und mit aufgestelltem Kragen, schlenderte er ziellos umher, ging hinunter zur Subway und kam wieder heraus, verirrte sich, kehrte um, bis ihn seine Schritte nach Einbruch der Dunkelheit schließlich wieder zum Times Square trugen. Denn hier schlug das Herz der Stadt. Hier befand sich das Zentrum ihrer Lebensenergie, ihrer strahlenden Verrücktheit.
Trotz der Kälte und des Schnees drängten sich wie immer Touristen und Schaulustige vor den riesigen Werbebildschirmen, auf denen die Bilder explodierten, als wollten sie den nächtlichen Himmel erstürmen.
Auf den Gehwegen schwangen dickbäuchige Weihnachtsmänner ihre Glöckchen, Touristen fotografierten sich mithilfe von Selfie-Stäben. Die Menschenmenge strömte an ihm vorbei und bot eine überaus abwechslungsreiche Show, aber allmählich begann ihn die ständige Animation zu langweilen. Dreimal versuchte er, ein Taxi heranzuwinken, ehe endlich ein yellow cab neben ihm hielt. Er nannte dem Fahrer die Adresse. Wenn man dem Schild am Armaturenbrett Glauben schenken durfte, handelte es sich um einen Turban tragenden Sikh namens Jagmeet Singh. Der Mann legte einen Blitzstart hin und fädelte den Nissan mit akrobatischem Geschick in den dichten Verkehr ein.
Eine Viertelstunde später setzte ihn das Taxi vor seinem Wohnhaus in der verlassen wirkenden Wooster Street ab.
»Sie ankommen«, sagte der Fahrer vergnügt.
»Danke, Jagmeet«, sagte Léo beim Bezahlen. »Fahren Sie immer so?«
»Wie fahren?«
»Na ja … so schnell.«
Jagmeet hatte sich zu ihm umgedreht und zwinkerte ihm amüsiert zu. Ein stolzes Lächeln blitzte unter seinem schwarzen Bart hervor.
»Ach, das? Sie noch nicht gesehen … Das war langsam.«
»Langsam?«
Jagmeet nickte energisch. Léo bedankte sich, öffnete die Wagentür, und sofort wirbelten Schneeflocken herein. Er liebte das, die Art, wie diese Stadt Völker, Kulturen, Sprachen, kleine und große Schicksale vermischte. New York war die ganze Welt in einer Stadt. Es war 22 Uhr 03, als er aus dem Taxi stieg, das gleich wieder losfuhr wie ein Formel-1-Auto aus der Startbox. Mit dem Gefühl, endlich nach Hause gekommen zu sein, sah er die roten Rückleuchten rasch in der Dunkelheit verschwinden.
Er bemerkte den Mann mit dem schmalen Gesicht nicht, der ein Stück weiter in der Dunkelheit eines Wagens saß und ihn beobachtete.
4
Another place – another train.
Beastie Boys, No Sleep Till Brooklyn
Um 20 Uhr 53 New Yorker Ortszeit setzte sie das Taxi vor dem Plaza Hotel in der 768 Fifth Avenue an der südöstlichen Ecke des Central Park ab – noch am selben Tag, denn indem sie von einer Zeitzone in die andere gesprungen war, hatte sie sechs Stunden gewonnen.
Während der Fahrt im Fond des Wagens hatte sie durch die beschlagene Scheibe gespäht und die Stadt unter ihrem weißen Mantel wiederentdeckt. Und für einen Augenblick hatte der Anblick sie in die Winter ihrer Kindheit zurückversetzt, zu dem sechsjährigen Mädchen, das in Begleitung ihres Papas und einer ihrer »Mamas« – die zweite oder dritte vielleicht – im Central Park einen Schneemann baut. Oder sich mit nackten Füßen und in einen Baumwollpyjama gehüllt die Nase an dem kalten Fenster ihres Zimmers platt drückt und staunend die großen, flauschigen Flocken betrachtet, die auf die East 73rd Street niedergehen. Eine einsame Kindheit, umsorgt von Nannys, die ihr vertrauter waren als die eigenen Eltern, und in der sie lange, zähe Stunden in den Fluren und leeren Zimmern eines bestimmten Hotels verbrachte, das zu groß und zu still für ein Mädchen ihres Alters war. Nur in Begleitung ihrer Spielzeuge, Kuscheltiere und Bücher. Es war unvermeidlich: Jedes Mal, wenn sie in New York von Bord ging, wurde sie von denselben Erinnerungen heimgesucht. Im Fond des Taxis erdrückte sie für einen Moment das Gefühl der Sehnsucht und Einsamkeit. Eine Einsamkeit, die seitdem Alltag für sie geblieben war, dessen war sie sich bewusst, und sie befürchtete, dass sie neben ihrer Vergangenheit auch ihre Zukunft prägen würde.
Doch als sie aus dem Taxi stieg, empfand sie angesichts der festlichen Atmosphäre, die überall herrschte, dennoch einen Anflug kindlicher Freude. Welche Stadt konnte mit dieser hier konkurrieren? Trotz der späten Stunde kehrten noch Pferdekutschen von ihren Ausfahrten zu dem Luxushotel zurück, die Insassen waren in warme Decken gehüllt. Die weihnachtliche Beleuchtung und die Straßenlaternen tauchten den Schnee auf den Gehwegen in ein gedämpftes Licht. Wie immer um diese Jahreszeit war die Stimmung unbeschreiblich. Aber gleich am nächsten Morgen würde sich der Schnee unter den Reifen der Autos in schmutzigen Matsch verwandeln, Abgase würden die Luft verschmutzen, wütendes Hupen ertönen. Auch das war New York.
Lorraine hob den Kopf und betrachtete die hoch aufragende Fassade des Plaza. Sie wurde von einem Ecktürmchen begrenzt, das einem Film von George Cukor entsprungen zu sein schien. Ein Kofferträger nahm ihr Gepäck und ging ihr in die Lobby voran, wo der traditionelle große Tannenbaum aufragte, dessen Äste unter dem Gewicht der Lichterketten nachzugeben drohten. Genau hier, dachte sie, waren Miles Davis und Francis Scott Fitzgerald mit seiner Zelda abgestiegen, hier hatte man Szenen aus Der unsichtbare Dritte, Folgen der Sopranos und Kevin – Allein zu Haus gedreht. Die beiden Pauls hatten ihr ein schönes Geschenk gemacht und für sie ein Zimmer an diesem mythischen Ort reserviert. Zweifellos wollten sie ihr damit zu verstehen geben, dass nunmehr sie der Boss war, dass sie hier alle Vollmachten hatte – und zugleich eine gewaltige Verantwortung trug. Bei dem Gedanken spürte sie, wie ihr Magensäure in die Kehle stieg. Sie achtete nicht weiter darauf und folgte dem Kofferträger zur Rezeption.
Zehn Minuten später drückte sie ihm eine Banknote in die behandschuhte Hand, schloss die Tür, drehte sich um und ließ den Blick durch das Zimmer schweifen: fünfte Etage mit Blick auf den Park. Cremefarbene Wände, das Kopfende des Betts mit barocken Vergoldungen verziert, ein Obstkorb auf der Marmorplatte der Kommode. Die Dekoration hatte einen antiquierten Charme, der an eine Epoche erinnerte, in der New York noch die größte und berühmteste Metropole der Welt war.
Sie ging zum Fenster und zog die schweren Vorhänge auseinander. Der Central Park schlummerte unter seiner Schneedecke in der Dezembernacht, und sie dachte an all jene, die diese Nacht draußen verbringen mussten. Reiche Menschen haben im Grunde kein Recht, traurig zu sein, dachte sie. Was natürlich ein idiotischer Gedanke war. Während ihrer Kindheit war ihr Vater nicht müde geworden zu erzählen, dass er bei null angefangen hatte und trotzdem niemandem etwas schuldig geblieben war. Dass er mit fünf Brüdern und Schwestern in einer kleinen, feuchten Wohnung in der Passage de la Folie-Regnault im XI. Arrondissement von Paris aufgewachsen war, in unmittelbarer Nähe des Friedhofs Père Lachaise. Und dass er nie glücklicher gewesen war als in jener Zeit. Nicht einmal, als er bereits einer der gefragtesten Galeristen Manhattans war, den die New Yorker Kunstszene nur den »Franzosen« nannte und der Geliebte wie Gemälde sammelte.
Sie legte ihren Koffer auf das Bett, öffnete ihn und holte die drei Bücher heraus, die sie vor der Abfahrt eilig hineingeworfen hatte: Ein Baum wächst in Brooklyn von Betty Smith, Jazz von Toni Morrison und Glamorama von Bret Easton Ellis. In allen ging es um New York. Sie hängte ihre Sachen in den Schrank und ging ins Bad, dessen Armaturen hochkarätig vergoldet waren. Bei ihrem letzten Besuch in New York hatte sie in einem schäbigen Hotel über einem billigen Restaurant in Chinatown übernachtet.
Sie ließ sich ein Bad ein, ging zurück ins Zimmer, holte eine Flasche Wasser aus der Minibar und schluckte eine Tablette. Wie so oft nach einem Flug hatte sie Migräne. Auf dem Bett liegend, fuhr sie ihr MacBook hoch und verband es mit der Steckdose über dem Nachttisch. Sie öffnete ihr Postfach. Eine E-Mail von Laurie’s, dem Auktionshaus. Sie schickten ihr erneut den Katalog für die Versteigerung am nächsten Tag. Mit La Sentinelle als Herzstück. Ein weiteres Mal versank sie in der Betrachtung des Gemäldes. Bei dieser Versteigerung waren zwei weitere Bilder von Czartoryski im Angebot, die aus einer frühen Schaffensperiode des Malers stammten. Einige Sekunden lang ließ sie sich noch von dem Anblick hypnotisieren, dann griff nach ihrem Handy und suchte in ihren Kontakten nach einer Nummer.
»Gut angekommen?«, ertönte die tiefe, ernste Stimme Paul-Henry Salomés – eine Stimme, die sie unter tausend anderen erkannt hätte.
Wie spät war es jetzt in Paris? Sie rechnete schnell nach. Zwischen drei und vier Uhr morgens … Zum Glück war ihr Mentor und Patenonkel ein Nachtmensch. Vor ihrem inneren Auge sah sie ihn in seiner Wohnung im XVI. Arrondissement inmitten seiner Gemälde eine Cohiba und einen feinen alten Napoléon genießen, denn wie Lorraine war auch Paul-Henry an lange, einsame Nächte gewöhnt.
»Ich würde dich gern sehen«, sagte sie.
»Aber immer«, antwortete er.
Sie lächelte und startete den Videoanruf. Eine Sekunde später erschien er auf dem Display. Im Morgenmantel saß er inmitten von Seidenkissen auf einer Ottomane, seine silbergraue Mähne umrahmte ein kraftvolles Gesicht, aus dem vor allem der metallische Blick seiner blauen Augen hervorstach. So intensiv, dass er zu glühen schien. Selbst mit siebzig Jahren hatte Paul-Henry Salomé nichts von seinem Glanz eingebüßt. Dieser Mann, der beste Freund ihres verstorbenen Vaters, der zwanzig Jahre nach dessen Tod die Werbeagentur DB&S aus der Taufe gehoben und sie als Teilhaberin aufgenommen hatte, war für Lorraine auch eine Art Ersatzvater. Er war Mentor und Beichtvater in einem, jemand, an den sie sich wandte, wenn sie einen Rat brauchte.
»Alles in Ordnung?«, fragte er.
Sie schaute auf das Display und sagte: »Ich bin ein bisschen nervös.«
»Das ist doch normal, oder? Du stehst vor einer großen Herausforderung. In Sachen DB&S New York zählen wir ganz auf dich. Sei dir dessen bewusst, aber lass dich davon nicht lähmen.«
»Versetz dich mal in meine Lage. Bis jetzt war ich in der Firma die Nummer drei, und hier stehe ich an vorderster Front.«
»Aber das wolltest du doch. Du darfst dich nicht ständig infrage stellen. Du bist absolut in der Lage, die New Yorker Niederlassung zu führen. Du bist bereit dafür, Lorraine. So bereit, wie man nur sein kann.«
»Ich bin nicht nur deswegen nervös.«
Sein heller Blick brannte unter den schweren Lidern. Ohne jeden Versuch, seine Neugier zu verbergen, starrte er sie an. »La Sentinelle?«
Sie nickte.
»Dein Vater war verrückt nach diesem Bild«, sagte er.
Daran konnte sie sich nicht mehr erinnern. Als ihr Vater La Sentinelle zum ersten Mal in einer Galerie in Midtown Manhattan ausgestellt hatte, war sie erst sieben Jahre alt. Und genauso alt war sie, als er auf dem Gehweg vor der Galerie von einem Unbekannten mit drei Kugeln mitten in die Brust niedergestreckt wurde. Die Polizei hatte den Mann nie gefunden. Lag der geradezu krankhaften Faszination, die dieses Bild auf sie ausübte, unbewusst womöglich die Gleichzeitigkeit der beiden Ereignisse zugrunde?
Unsinn. Seitdem sind achtundzwanzig Jahre vergangen, eine Ewigkeit. Hör auf mit dieser Küchenpsychologie.
»Schade, dass du nicht hier bist, um mich zu unterstützen«, sagte sie und bereute es sofort.
»Hör auf, dich zu unterschätzen«, wies er sie zurecht, wobei er die nackten, rundlichen Fesseln kreuzte, die aus dem Morgenmantel herausragten. »Seit achtundzwanzig Jahren lebst du jetzt schon ohne ihn. Bislang hast du dich ausgezeichnet geschlagen, und das hast du sicherlich nicht deiner Mutter zu verdanken. Du hast dich selbst erschaffen, Lorraine. Wie dein Vater. Du brauchst niemanden, glaub mir.«
»Im Gegensatz zu mir hat mein Vater keine fünfzehn Millionen Dollar geerbt«, versetzte sie. »Es ist spät in Paris, wir sollten jetzt besser Schluss machen.«
Paul-Henry musterte sie mit unergründlichem Blick, der in diesem Moment wie verschleiert wirkte, was ihm ein wenig von seiner gefährlichen Schärfe nahm. Er sagte: »Du weißt genau, dass ich nicht mehr als drei Stunden pro Nacht schlafe. Ich liebe die Nacht. Sie ist eine gute Zeit zum Nachdenken, zur Rückbesinnung auf sich selbst, für Melancholie und zur Beschwörung unserer ureigenen Dämonen. Jenen Schatten, die wir tagsüber unter dem Deckel halten.«
Sie sah, wie er den goldbraunen Cognac in dem Schwenker kreisen ließ und an seiner Zigarre zog. Wie er eine dichte Wolke aus grauem Rauch in den Lichtschein der Lampe blies. Um ihn herum nur Zwielicht, Widerschein, Dunkelheit. Erneut erschauerte sie.
Schließlich sagte er: »Aber du musst morgen in Form sein, darum lasse ich dich jetzt in Ruhe. Also Gute Nacht.«
»Gute Nacht, Onkel.«
Wie immer, wenn sie sich mitten in der Nacht mit ihm unterhielt, überkam sie ein sonderbares Gefühl, eine Mischung aus Ruhe und Unbehagen. Es war ihr nie gelungen, diesen Mann, der sie immerhin seit dem Kleinkindalter begleitete, wirklich einzuschätzen. Als sie zehn war, hatte er sie wie seine eigene Tochter behandelt und mit ihr gespielt. Er verfolgte ihre Fortschritte im Studium, als sie zwanzig war, und bot ihr kurz vor ihrem achtundzwanzigsten Geburtstag den Posten als Teilhaberin an – im Tausch gegen einen substanziellen Teil ihres Erbes, den sie in das Kapital von DB&S einbrachte.
Im Grunde war Paul-Henry Salomé ein Geheimnis, zu dem nur er selbst den Schlüssel besaß.
Sie hatte das Gespräch gerade beendet, als aus ihrem Handy das Signal für eine eingehende SMS erklang. Eine unbekannte Nummer. Lorraine spürte, wie sich ihr Puls beschleunigte. Mit hämmerndem Herzen las sie den Text ein erstes Mal und dann noch einmal, wobei sich jedes Wort in ihren Geist einbrannte.
Du entkommst mir nicht, Lorraine, nicht einmal in New York.
5
Don’t mess with this place,
it will eat you alive.
AC/DC, Safe in New York City
In derselben Nacht wurde er gegen zwei Uhr geweckt. Es gab keinen Alarm, kein warnendes Vorzeichen. Entweder hatte sich Léo in einer Tiefschlafphase befunden, oder sein Gehirn hatte im Schlaf die Geräusche der Tür, die entriegelt wurde, mit Straßenlärm verwechselt.
Sie schüttelten ihn. Er schlug die Augen auf, und eine Sekunde später zerrten sie ihn bereits aus dem Bett.
Danach ging alles entsetzlich schnell. Sie hoben ihn hoch, warfen ihn zu Boden und packten ihn an den Füßen. Er wehrte sich heftig, um ihnen zu entkommen, brüllend wie ein verletzter Löwe. Als sie ihn über den Boden schleiften, rutschte ihm die Pyjamahose bis zu den Knöcheln hinunter und gab in der dumpfen Helligkeit sein Gesäß und seine Geschlechtsteile, gestreift von Licht und Schatten, den Blicken preis. In diesem Augenblick versetzte ihm einer der Angreifer einen Tritt, wie ein Fußballspieler einen Elfmeter schießt. Er raubte ihm buchstäblich den Atem. In seinem Schritt explodierte ein grässlicher Schmerz, während die Männer ihm weitere Tritte in die Rippen, die Arme und auf jeden Teil seines Körpers versetzten.
Berauscht von Wut und Schmerz, packte Léo einen der drei Angreifer reflexhaft beim Fußknöchel und ließ ihn zu Boden gehen. Einem anderen schlug er vom Fußboden aus gegen das Knie, so heftig, dass beinahe die Kniescheibe heraussprang. Der Typ brach heulend zusammen, aber der erste hatte sich bereits wieder aufgerappelt, während der dritte sich damit begnügte, die Szene zu beobachten. Der Gegenschlag kam sofort; Léos Widerstand fachte die Wut der Männer weiter an. Eine massive Faust traf sein Jochbein und zertrümmerte es beinahe, ehe sich Tritte und Faustschläge in entsetzlichem Tempo abzuwechseln begannen. Er rollte sich zur Kugel zusammen, zog die Beine an und legte Arme und Ellbogen um den Kopf, um die Stöße abzufangen. Reglos blieb er liegen, bis der Hagel aus Schlägen plötzlich endete, so abrupt wie ein Sommergewitter.
Einer der Typen, vermutlich der Anführer, beugte sich über ihn. Selbst im Halbdunkel war zu erkennen, dass seine Haut gelblich und blass wie die einer Leiche war. Spitzes Kinn, eine Nase, lang und schmal wie eine Messerklinge, darunter ein winziger Mund voller hässlicher Zähne; große, hervorstehende Augen glitzerten verschlagen unter einer sehr hohen, gewölbten Stirn. Er sah aus wie ein Vampir aus einem Stummfilm oder eine Skulptur von Giacometti, nur deutlich unheimlicher. Léo konnte sein Alter nicht schätzen. Wenn der Typ sprach, senkte er die Stimme zu einem Flüstern, das Léo das Blut in den Adern gefrieren ließ.
»Viele Grüße von Mr Royce Partridge III. Erinnerst du dich? Du hast ihm einen falschen Modigliani angedreht, für eine Million Dollar. Nicht gerade wenig, eine ganze Million … Ich wäre nicht mal in der Lage, den Unterschied zwischen einem echten und einem gefälschten Picasso zu erkennen, und es ist mir auch scheißegal. Aber mein Chef war stinksauer, als er erfahren hat, dass das schönste Gemälde seiner Sammlung bloßer Schwindel war. Jetzt will er seine Kohle zurück, ist doch klar. Natürlich mit Zinsen, also zwei Millionen. Du hast zwei Wochen Zeit. Sonst kommen wir wieder und schneiden dir an der rechten Hand einen Finger nach dem anderen ab. Du bist doch Rechtshänder, oder? Danach wird’s schwierig mit dem Malen. Zwei Wochen, zwei Millionen.« Mit diesen Worten wandte sich der Typ zum Gehen.
Einer der beiden anderen – ein Mann, bei dem das Fett eindeutig die Muskelmasse überwog – versetzte Léo mit gleichgültiger Miene einen letzten Tritt, als erledigte er auf mechanische Art eine sinnlose Aufgabe.
6
And I’m numb to the pain.
Fun Lovin’ Criminals, Ballad of NYC
»Sie sollten zum Arzt gehen«, sagte der Mann in der Apotheke.
»Ja, ich weiß.«
»Sie müssen wirklich zum Arzt.«
»Ich weiß.«
»Zehn Dollar fünfzig.«
Er zahlte. Nachdem er endlich erschöpft eingeschlafen war, hatte ihn das ins Loft flutende Sonnenlicht geweckt. Er hatte nur zwei Stunden geschlafen, und beim Aufwachen war sofort auch der Schmerz wieder da. Bei dem Versuch, sich zu bewegen, hatte er sich gefühlt wie der von Pfeilen durchlöcherte heilige Sebastian auf einem Gemälde von Bellini oder Mantegna. Gelähmt vor Schmerz lag er in seinem Bett, das mit Blutflecken übersät war wie ein Drip Painting von Jackson Pollock. Eine Sekunde lang betrachtete er das zerknitterte, fleckige Laken. Rot auf Weiß. Ein richtiges Kunstwerk …
Als er sich schließlich schwankend erhob, wurde es noch schlimmer. Es war, als wäre ihm die ganze Nacht lang ein Sumoringer auf den Rücken gesprungen. Unter der Dusche verschafften ihm Seife und warmes Wasser Erleichterung, die aber nicht lange anhielt. Er betrachtete sich im Spiegel: Das rechte Jochbein hatte seinen Umfang verdoppelt, das rechte Auge war halb geschlossen, sein ganzer Körper von violettblauen Flecken übersät, und am linken Zeigefinger fehlte der Fingernagel. Léo hatte die erstbesten Klamotten, die er finden konnte, übergestreift. Schmerzen bei jeder Bewegung. So war er zur Apotheke gegangen.
»Haben Sie ein Glas Wasser?«
»Wie bitte?«
»Ein Glas Wasser.«
Der Apotheker seufzte und kam kurz darauf mit einem durchsichtigen Plastikbecher zurück.
»Nicht mehr als sechs Stück pro Tag und immer nur eine auf einmal«, warnte er. »Die sind stark.«
»Mmmh.«
Vor den Augen des entsetzten Apothekers schluckte er zwei Tabletten, bedankte sich und ging hinaus.
Zwei Millionen Dollar, dachte er. Zwei Millionen innerhalb von zwei Wochen. Unmöglich. Die Gerichtskosten, die Kaution, die Pfändung, all das hatte ihn mittellos zurückgelassen. Es war ihm zwar gelungen, hunderttausend Dollar in einem Möbellager in der South Street am Ufer des East River zu verstecken, das er für zweihundertfünfzig Dollar im Monat gemietet hatte, aber zwei Millionen … Nein, es war äußerst unwahrscheinlich, dass er eine solche Summe aufbringen konnte.
Außerdem musste er sich um seine persönliche Sicherheit kümmern. An die Polizei konnte er sich nicht wenden. Er war ein Ex-Häftling, gerade erst aus dem Gefängnis entlassen. Mit anderen Worten: ein Ausgestoßener im Kastensystem der New Yorker Polizei. Royce Partridge III hingegen war ein Brahmane. Léos Wort war nichts wert angesichts des Erben einer der einflussreichsten Familien New Yorks. Und bei seinem Vorstrafenregister konnte sich Léo nicht einmal eine Waffe kaufen.
Mit hochgezogenen Schultern beschleunigte er den Schritt. Er zitterte vor Kälte und bei dem Gedanken, dass die Angreifer wiederkommen und ihn erneut im Schlaf überraschen konnten. Sogar für jemanden, der drei Jahre auf Rikers verbracht hatte, war diese Aussicht erschreckend. Erneut ließ er den nächtlichen Gewaltausbruch vor seinem geistigen Auge ablaufen – und kam zu der Erkenntnis, dass es eine ebenso wirksame wie angenehme Lösung gab.
Der Ort hieß »Die Zuflucht« und befand sich in der Centre Street zwischen Little Italy und Chinatown. Der junge Mann hinter dem Tresen, der Léo begrüßte, hatte selbst das spitze Gesicht eines Windhunds, und der Blick seiner bebrillten Augen wirkte gutherzig und sanft.
»Was genau suchen Sie?«
»Einen Hund.«
»Welche Rasse?«
»Ist mir egal.«
Der junge Mann kratzte sich am Kopf.
»Aber was für ein Hund schwebt Ihnen denn vor?«
»Einer, der bellt.«
Der Mitarbeiter des Tierheims betrachtete Léo über seine Brille hinweg, schwankend zwischen Ratlosigkeit und einem drohenden Lachkrampf.
»Das trifft so ziemlich auf jeden Hund zu.«
»Gibt es keine stummen Hunde?«, fragte Léo lächelnd.
Ende der Leseprobe