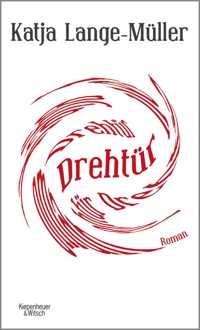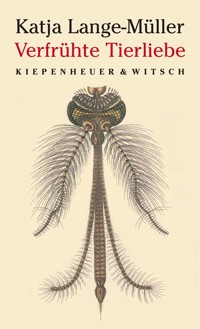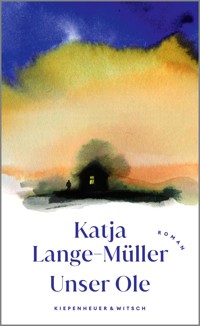
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Frauen, die von ihren Müttern nicht geliebt wurden, ein kognitiv beeinträchtigter Junge, der sie verbindet, und ein unerwarteter Tod. Katja Lange-Müller gelingt mit diesem Kammerspiel ein literarisches Wunderwerk. Die einst bildschöne Ida ist alt und vom Leben, den Männern und sich selbst enttäuscht. Um nicht völlig zu verarmen, arbeitet sie gelegentlich als Model bei Seniorinnenmodenschauen. In einem Kaufhaus begegnet sie Elvira, die ihren Enkel Ole betreut, genauer: ihn abwechselnd schikaniert und verwöhnt. Als Ida ihre Wohnung verliert, lockt Elvira, die den Kontakt zu ihrer Tochter abgebrochen hat und doch nichts mehr fürchtet als die Einsamkeit, die Freundin in ihr Landhaus, denn sie braucht Hilfe mit dem unberechenbaren, spätpubertierenden Hünen Ole. Eines Morgens kommt es zu einem tragischen Ereignis, das Oles Mutter Manuela auf den Plan ruft. Sie hat ihren Sohn seit dessen erstem Lebensjahr nicht mehr gesehen. Während die Frauen einander misstrauisch umkreisen, entblättern sich ihre Familiengeschichten, ihre Biografien, ihre seelischen Verletzungen. Katja Lange-Müller ist einzigartig in der literarischen Kraft und Präzision, mit der sie Figuren vom Rande der Gesellschaft unterschiedliche Stimmen gibt. Dieser Roman schärft aufs Feinste unser Denken und Empfinden. Er erzählt von ablehnenden Müttern, von den Widersprüchen, aus denen sich eine Persönlichkeit zusammensetzt, von der heimlichen Sehnsucht nach Zuneigung und all den Lebenslügen, die so gelogen manchmal gar nicht sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Katja Lange-Müller
Unser Ole
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Katja Lange-Müller
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Katja Lange-Müller
Katja Lange-Müller, geboren 1951 in Ostberlin, lebt als freie Schriftstellerin in Berlin. 1986 erhielt sie den Ingeborg-Bachmann-Preis, 1995 den Alfred-Döblin-Preis für ihre zweiteilige Erzählung »Verfrühte Tierliebe«, 2002 den Preis des ZDF, des Senders 3sat und der Stadt Mainz, 2005 den Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor, 2008 den Preis der LiteraTour Nord, den Gerti-Spies-Preis und den Wilhelm-Raabe-Preis. Im Jahr 2012/2013 war sie Stipendiatin der Villa Massimo, erhielt den Kleist-Preis und war 2013/2014 Stipendiatin der Kulturakademie Tarabaya Istanbul. 2017 erhielt sie den Günter-Grass-Preis.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Drei Frauen, die von ihren Müttern nicht geliebt wurden, ein kognitiv beeinträchtigter Junge, der sie verbindet, und ein unerwarteter Tod. Katja Lange-Müller gelingt mit diesem Kammerspiel ein literarisches Wunderwerk.
Die einst bildschöne Ida ist alt und vom Leben, den Männern und sich selbst enttäuscht. Um nicht völlig zu verarmen, arbeitet sie gelegentlich als Model bei Seniorinnenmodenschauen. In einem Kaufhaus begegnet sie Elvira, die ihren Enkel Ole betreut, genauer ihn abwechselnd schikaniert und verwöhnt. Als Ida ihre Wohnung verliert, lockt Elvira, die den Kontakt zu ihrer Tochter abgebrochen hat und doch nichts mehr fürchtet als die Einsamkeit, die Freundin in ihr Landhaus, denn sie braucht Hilfe mit dem unberechenbaren, spätpubertierenden Hünen Ole.
Eines Morgens kommt es zu einem tragischen Ereignis, das Oles Mutter Manuela auf den Plan ruft. Sie hat ihren Sohn seit dessen erstem Lebensjahr nicht mehr gesehen. Während die Frauen einander misstrauisch umkreisen, entblättern sich ihre Familiengeschichten, ihre Biografien, ihre seelischen Verletzungen.
Katja Lange-Müller ist einzigartig in der literarischen Kraft und Präzision, mit der sie Figuren vom Rande der Gesellschaft unterschiedliche Stimmen gibt. Dieser Roman schärft aufs Feinste unser Denken und Empfinden. Er erzählt von ablehnenden Müttern, von den Widersprüchen, aus denen sich eine Persönlichkeit zusammensetzt, von der heimlichen Sehnsucht nach Zuneigung und all den Lebenslügen, die so gelogen manchmal gar nicht sind.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2024, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung Marion Blomeyer/Lowlypaper
Covermotiv Illustration von Elisabeth Moch
ISBN978-3-462-31657-5
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Förderhinweis
Motti
PROLOG
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
VIII. Kapitel
IX. Kapitel
X. Kapitel
XI. Kapitel
XII. Kapitel
XIII. Kapitel
XIV. Kapitel
XV. Kapitel
XVI. Kapitel
XVII. Kapitel
XVIII. Kapitel
XIX. Kapitel
XX. Kapitel
XXI. Kapitel
XXII. Kapitel
EPILOG
Die Arbeit an diesem Roman wurde mit einem Preis der Stadt Deidesheim gefördert, wofür die Autorin herzlich dankt.
»Sie durchschauen einander, aber sich selbst kennt keine.«
Margit N., Gruppenpsychotherapeutin
»Ja, ja, immer sind die Mütter schuld.«
Anita B., Gruppenpsychotherapieteilnehmerin
PROLOG
Diese Geschichte ist nicht erfunden, schon gar nicht frei. Doch weil daraus ein literarischer Text werden wollte, habe ich die Namen der an den realen Ereignissen beteiligten Menschen geändert, ihnen Gedanken in den Kopf und Wörter in den Mund gelegt und auf die Art ihre Spuren verwischt, obwohl zwei von ihnen bereits verstorben sind, mich also ohnehin nicht mehr verklagen könnten.
I
»Kleines Haus am Wald / Morgen komm ich bald …«, diesen Herbert-Roth-Schlager aus der Zeit ihrer Jugend hatte Ida vor sich hin gesummt, während sie ihren Koffer packte, um am nächsten Tag bei Elvira einzuziehen. Der alte Schrankkoffer vom Flohmarkt war derart geräumig, dass er beinahe ihre gesamte Garderobe fasste, zumindest jene etwa vierzig Kleidungsstücke, die sie noch schön genug fand; und das freute sie, um es mit einem ihrer Wörter zu sagen, diebisch. Denn einerseits konnte sie so den Wunsch ihrer neuen Hausherrin erfüllen und andererseits wurde sie notgedrungen endlich mal ein paar olle Fummel los unddas meiste von dem billigen Glitzerkram, der sich ineinander verheddert auf dem Linoleumboden ihrer Ein-Zimmer-Erdgeschosswohnung häufte. Ihren Notgroschen, drei echtgoldene Schmuckstücke, hatte sie ja eh längst versilbert und in der finsteren Bude, die sie nach dem Ende ihres letzten einigermaßen festen Verhältnisses mieten musste, auch nur eine Notlösung gesehen.
Aber die Tür zur Notlösung, dachte Ida, die werde ich morgen hinter mir zuschlagen, für immer, egal wie es kommt.
»Bring nicht mehr als einen Koffer voll persönlicher Sachen mit«, hatte Elvira am Telefon gesagt. »Ich hasse zu viel Zeug, das bloß rumliegt, Motten anlockt, Staub fängt. Alles, was man wirklich zum Leben braucht, ist ja schon hier, doppelt und dreifach sogar.«
Das war nun etwa zwei Jahre her. Und noch ein Jahr davor waren die beiden Frauen einander zum ersten Mal begegnet, in einem Karstadt-Warenhaus bei einer Modenschau für Seniorinnen. Ida war eins der drei Mannequins gewesen, Elvira eine Kundin, die zufällig unter das nicht eben zahlreich versammelte Publikum geraten war und nichts für sich gesucht hatte, sondern einen Pullover für ihren Enkel Ole, der damals gerade fünfzehn wurde und, wie Elvira klagte, »wuchs, als würde man Dünger an ihn füttern«.
Hatte die ehemalige technische Zeichnerin Elvira, die sich gern ihres »unbestechlichen Blicks« rühmte, Ida tatsächlich auf Anhieb sympathisch gefunden? Oder keimte da bereits ein Plan? Jedenfalls war sie bis zum Ende der Show geblieben und dem Mannequin Ida, das umgezogen, aber nicht abgeschminkt, davoneilen wollte, hinterhergelaufen.
»Dürfte ich Ihnen eventuell noch ein paar Minuten Ihrer kostbaren Zeit stehlen?«, hatte Elvira, Idas Mantelärmel ergreifend, gesäuselt. »Es wäre mir eine Ehre, eine so attraktive, wunderbar selbstbewusste Dame wie Sie zu einem Gläschen Sekt einzuladen.«
Und Ida, wehrlos gegen Komplimente, folgte ihr huldvoll lächelnd in das Kaufhausrestaurant.
Seit jenem Tag trafen sie sich öfter, schlossen so etwas wie Freundschaft; und als Ida, die nur gelegentlich modelt, ansonsten jedoch weder eine auskömmliche Rente bezieht noch über nennenswerte Rücklagen verfügt, ihre Wohnung verlor, weil ihr die, wie sie nicht wahrheitsgemäß erklärte, »wegen Eigenbedarfs« gekündigt worden sei, bot Elvira ihr ein Zimmer in ihrem Haus auf dem Lande an.
»Dies helle, geräumige Zimmer, die Küche, das geflieste Bad und der zauberhafte Obstgarten«, lockte sie, »sind gratis.«
Aber einen kleinen Haken, der erst am Ende des Telefonats zur Sprache kam, hatte Elviras großzügigeGestedann doch.
»Vielleicht hilfst du mir ein bisschen wirtschaften und kümmerst dich mit um Ole«, sagte sie, als sie merkte, dass Ida ein Stein vom Herzen fiel, »auch wenn der Knabe nie einfach war, allmählich wird er echt schwierig.«
»Ach Gottchen«, antwortete Ida, »Jungsin der Pubertät, und erst recht später, sind meine Spezialität, das ist nun wirklich kein Problem und so eine Dreier-WG jetzt sicher genau richtig für mich – oder für uns.«
II
Nein, dachte Ida, als sie, nach einer langen, teuren Fahrt mit einem Kombitaxi, zu der sie sich wegen des schweren Schrankkoffers ebenso schweren Herzens entschlossen hatte, Elviras Anwesen erblickte, Herbert Roths Häuschen am Waldessaum ist das nicht, doch ein Zurück gibt es auch nicht.
In dem Moment erst fiel ihr auf, dass sie einander nie zu Hause besucht haben und dass sie diejenige gewesen war, die solche Intimitäten gescheut hatte.
Meine Notlösung, dachte sie weiter, konnte ich ja niemandem zeigen, nicht mal der flüchtigsten Bekanntschaft, schon gar nicht Elvira. Und die Rechnungen für unsere Treffen in dieser noblen Kaffeerösterei am Ku’damm sind auch immer nur von ihr beglichen worden. Na, warum wohl? Die ist viel reicher als ich – und sie mag mich. Hat sie womöglich eine verborgene lesbische Ader? Egal, damit komme ich klar.
Ida schleifte ihren Schrankkoffer den Gartenweg entlang und drückte den Klingelknopf neben der verwitterten Eingangstür, deren borkig-rostroter Anstrich sie an Schorf erinnerte. Aber noch war sie optimistisch, trotz des ernüchternden Eindrucks, den die neue Bleibe machte. Das mit Elviras womöglich lesbischer Ader fürchtete sie halb, weil ihr für so was die Erfahrung fehlte, und halb hoffte sie es, denn es würde ihr bestätigen, dass sie nach wie vor begehrenswert war, und die Rolle beherrschte sie perfekt.
Wird schon schiefgehen, ermutigte sie sich, ist ja diesmal wenigstens kein Mann, in dessen Hände du dein Schicksal legst.
Elviras »Eigenheim«, ein rauputzgrauer Würfel mit einem schieferfarbenen Eternitdach, befindet sich auf einem Eckgrundstück am Rand eines Dorfes nahe der Hauptstadt, von der aus es per Auto gut, per Regionalbahn und Bus aber nur bis neun Uhr abends zu erreichen ist. Elvira nannte ihre abgelegene Gegend einmal »das letzte Loch im Berliner Speckgürtel«.
Dies unscheinbare, zum Teil hinter bemoosten Apfelbäumen verborgene Umsiedlerhaus wurde zwischen 1946 und 1955 erbaut und ähnelt von vorn einer Kinderzeichnung: Das Dach ein gleichschenkliges Dreieck über einem Quadrat, darin vier kleinere Fensterquadrate, zwei links, zwei rechts, und weiter unten, in der Mitte, ein die Tür darstellendes Rechteck.
Das ist das Haus vom Nikolaus, dachte Ida, als sie am Abend ihrer Ankunft noch einmal hinausging, um es genauer zu betrachten, den Spruch hab ich als kleines Mädchen meinen Buntstiftbildern zugeflüstert, immer wenn ich wieder eins fertig hatte. Und dann nahm ich das Blatt und suchte meine Mutter, dabei wollte sie es gar nicht, keinen müden Blick war’s ihr wert. Es landete ruckzuck bei all den anderen Nikolaushäusern, Strichmännchen und Sonnen in dem Korb neben der Flurgarderobe.
Nachbarn hat das Grundstück nur zur linken Seite, zur rechten grenzt es an eine fast das ganze Jahr über feuchte Wiese, eine Mückenbrutstätte, die deren Pächter, die Ortsgemeinde, selten mähen lässt, weil das Heu, das sie ergibt, eher fault als trocknet. Der Wald, eine Kiefernholzplantage voller viel zu dicht stehender, mickriger Bäumchen, beginnt gleich hinter dieser Ebene fetten Sumpfgrases, das, wie Elvira erzählte, ihre Kaninchen krank gemacht habe:
»Ich war so stolz auf meine prächtigen Erdnuckel. Zuletzt hatte ich Deutsche Riesen, einen silbergrauen Rammler und drei gescheckte Zibben. Blöderweise fing Ole eines Tages an, sie heimlich mit diesem eklig sauren Grünzeug zu füttern. Vielleicht war auch Schierling dabei oder sonst ein giftiges Kraut, jedenfalls bekamen die armen Viecher die Scheißerei davon. Sie wurden derart mager und apathisch, dass ich sie schlachten musste, alle vier am selben Tag. Doch den Braten, den Ole sich womöglich erhofft hatte, er könnte ja sterben für Kaninchenrücken in Senfsoße, den gab es nicht. Nicht mal in der Tiefkühltruhe sind die Kadaver gelandet. Verscharrt hab ich sie, vor seinen Augen, dort, unter den Johannisbeersträuchern, und dazu ›Häschen in der Grube‹ gesungen, das einzige Lied, das er kennt, natürlich von keiner anderen als mir. Der dumme Junge durfte für seine Missetaten nicht noch belohnt werden. Bestrafen konnte ich ihn aber auch nicht, er weiß ja nicht, was er tut. Seinetwegen, nur seinetwegen, halte ich keine Karnickel mehr, gar keine Tiere.«
Außer Ole, dachte Ida – und schwieg, wie meistens, wenn Elvira von ihrem Enkel sprach.
III
Damit die Tür, die sich den verregneten Sommer und Herbst über verzogen hat, nicht ganz so laut knarren möge, legt Ida ihre zarten Hände um deren Klinke und hebt sie an; doch die Tür zu Elviras Nikolaushaus, wie sie ihr wohl letztes Domizil auch nach zwei Jahren noch bei sich nennt, knarrt trotzdem.
Ida, die sich ohne ihre Kontaktlinsen oder wenigstens ihre doofe Brille unsicherer fühlt, als sie es je zugeben würde, gähnt, reibt sich die Lider, blinzelt, bis die Konturen vor ihren kurzsichtigen Augen schärfer werden und sie zumindest den vorderen Bereich des verwilderten Gartens einigermaßen überblicken kann.
In ihrem lindgrünen Morgengewand und den lila Samtpantoffeln, die Elvira »schrecklich kitschig« findet, betritt sie die Schwelle.
Diese Pantöffelchen, denkt Ida auf ihre Füße schauend, waren vielleicht mal kitschig, aber teuer auch, und Ole hat die beiden Plüschbommeln, die ich so mochte, schon am Tag meiner Ankunft unter dem nunmehr gemeinsamen Dach von ihnen abgerissen und sich in die Ohren gesteckt.
Ida streckt und dehnt sich und hält ihren blondierten Lockenkopf hinausins Freie.
Ins Freie, warum sagt man so zum Draußen?, denkt sie und dann: Gott sei Dank muss ich diese grausam schwere Eichenholztür nicht gleich wieder schließen, denn heute ist ein herrlicher Tag, sonnig wie lange nicht und erstaunlich warm für die Jahreszeit. Aber Elvira wird darauf bestehen, dass ich ihn nutze, um endlich mal das abgefallene Laub zusammenzuharken und die Dahlien runterzuschneiden, wegen ihrer schwarz verfärbten Blütenköpfe, die schon im August nicht mehr weiß, gelb oder rosa waren, sondern braun und matschig herabhingen, als schämten sie sich.
»Igitt, nun sind sie vollends vergammelt«, hat Elvira ihr gestern zugerufen. »Machst du sie bitte weg, Ida?! Du weißt doch, ich kann mich nicht bücken. Mit Dahlien, das solltest du dir merken, ist es, wenn Sommer und Herbst derart verregnet waren, wie mit toten Fischen, die stinken auch zuerst am Kopf. Und vergrab die Strünke nicht in der Erde! Alles, was schimmelt, gehört auf den Komposthaufen.«
Das gesteppte lindgrüne Seidennegligé, ein Stück aus besseren Zeiten, unter dem Ida nackt ist, umfließt ihre schlanke Gestalt und glänzt in dem hellen Licht, so verführerisch, dass sie sich selbst umarmt, wie früher, als sie manchmal die ganze Welt umarmen wollte, nein, nicht die ganze, nur ihre.
Ida ist tatsächlich noch sehr gut beieinander; ihr Busen, aus dem nie ein Baby trank, wölbt sich straff über den Silikon-Implantaten, die, da sie nicht allzu mächtig sind, nach wie vor halten, was der Chirurg versprochen hatte; und ihren faltigen Hals kann sie gerade nicht sehen, ebenso wenig wie ihr Gesicht, das sie, sobald ihre in jüngster Zeit allerdings ziemlich spärlich fließenden Modeleinkünfte es erlauben, von Carla, der Dorfkosmetikerin, behandeln lässt. Elvira weiß nichts davon; die, befürchtet Ida, würde sie maßregeln, nach dem Motto: Wenn du dir solchen Luxus leistest, darfst du dich gerne auch an den Ausgaben für unseren Lebensunterhalt beteiligen.
Erst vorigen Montag wieder hat Carla Idas Gesicht »unglaublich frisch für das einer fast Achtzigjährigen« genannt, und als die daraufhin ihre Botox-glatte Stirn zu runzeln versuchte und doch nur weit aufgerissene Augen zustande brachte, fügte Carla, die gelegentlich betont, dass sie, bevor die Mauer fiel, Germanistik studiert habe, lächelnd hinzu, die Schönheit einer Frau mit solch prächtigen Genen sei eben unvergänglich.
Ida, die nicht »fast achtzig«, sondern gerade mal sechsundsiebzig ist, pflegt dieses Gesicht wie ein eigenständiges, kostbares Wesen, dessen Zustand ihr nie gleichgültig war. Aber mittlerweile, etwa wenn sie es morgens und abends im Spiegel betrachtet, sorgsam reinigt, eincremt und massiert, kommt es ihr fremd vor, beinahe ebenso fremdkörperartig wie ihre Brüste mit den beiden gefühlstauben, stark pigmentierten Mamillen, die während der Operation, die nun über dreißig Jahre zurückliegt, unter Vollnarkose abgetrennt und weiter oben wieder angenäht wurden und seitdem auf nichts mehr reagieren, sich nicht einmal mehr zusammenziehen, auch nicht bei Eiseskälte. Diese Nippel, das Wort Brustwarzen ist Ida von jeher zuwider, ähneln in ihren Augen – und andere als ihre schauen da eh nicht mehr hin – braunen Fingerhüten oder gebratenenWurstzipfeln oder den Seepocken auf dem Buckel des gestrandeten Pottwals, den sie in einem Dokumentarfilm gesehen und der ihr wegen seiner hässlichen Parasiten sogar ein kleines bisschen leidgetan hat.
»Kapselfibrose, glücklicherweise nicht stark ausgeprägt«, meinte der Arzt, dem sie ihren Busen vor einiger Zeit präsentierte, weil er ihr manchmal Schmerzen bereitet.
»Bis auf die dunklen Nippel«, sagte sie, »gefällt er mir ja noch, er ist nur so fest geworden, und dann dieses Ziehen, wenn ich im Schlaf die Seite wechsle.«
»Stimmt, Ihre Brüste sind etwas unbeweglich, doch solange sich da nichts verformt, sollten Sie es lassen, wie es ist«, riet der Arzt, »auch wenn Sie diese vorsintflutlichen Silikonkissen schon eine halbe Ewigkeit mit sich herumtragen. Ansonsten gibt es nur zwei Optionen: rausnehmen oder austauschen. Das wäre eigentlich spätestens nach zwanzig Jahren fällig gewesen. Aber Sie sind nicht das einzige wandelnde Museum und neue, vielleicht kleinere Implantate und besonders die Entfernung des Narbengewebes, das sich wahrscheinlich gebildet hat, kosten heutzutage richtig viel Geld, und ich bin mir nicht sicher, ob es nicht wieder zu Verhärtungen käme.«
Gesicht und Busen, denkt Ida, waren mein ganzes Kapital, und dann: Das stimmt ja gar nicht, oder höchstens für mein Gesicht. Den Busen verdanke ich einem verschwindend geringen Teil des Kapitals von Rudolf, der am letzten Abend unseres letzten gemeinsamen Urlaubs am Lago Maggiore zu mir sagte: »Ach, Ida, wenn ich dich umstülpen könnte wie einen deiner kalbsledernen Handschuhe und so dein Inneres nach außen kehren, glaubst du, dass noch irgendjemand auch nur einen Blick an dich verschwenden würde?!«
Ein folgenschwerer Satz, der Ida, sobald ihr Rudolf in den Sinn kommt, jedes Mal zuerst einfällt – und wortwörtlich; als er sie traf wie ein Fausthieb, hatte sie den Zenit ihrer Schönheit noch nicht überschritten und ein paar ehrliche Tränen vergossen, die Rudolf, ihren zweiten Langzeit-Sugardaddy, allerdings kein bisschen gerührt, nur bewirkt hatten, dass er seiner »Süßen« eines der gestärkten und gebügelten schneeweißen Damast-Taschentücher zuwarf, die er, wie er zu sagen pflegte, »stets am Mann« trug.
»Der Mensch, das sozialste derhochentwickelten Säugetiere«, heißt es im »Buch der 100Weisheiten«, das Ida von ihrer Mutter geerbt hat, »erfährt sich grundsätzlich durch die Reaktionen seiner Artgenossen, und wie denen ein Mitmensch gefällt, bestimmt nicht allein dessen Erscheinungsbild.«
Aber meine Artgenossen, denkt sie, können ja nicht in mich hineinschauen, so wenig, wie ich in sie, so wenig, wie Rudolf mich umstülpen konnte. Und überhaupt: »Wie es drinnen aussieht, geht niemanden was an.«
Auch diesen Satz kennt Ida von ihrer die Ordnung und nur die Ordnung liebenden Mutter, die zu ihrem vier Jahre vor Kriegsende geborenen einzigen Kind eine durch nichts überbrückbare Distanz gewahrt hatte.
Vielleicht war sie einfach bloß neidisch. Ich wuchs, nachdem die harte Zeit des Niedergangs und der Bombenangriffe überstanden war, im Wirtschaftswunderland heran, nicht sonderlich behütet, doch immerhin friedlich, und wurde schon als kleines Mädchen viel mehr bewundert als jemals sie selbst. – Eine bessere Erklärung für das abweisende Verhalten ihrer Mutter ist Ida nie eingefallen.
Und ja, es lässt sich nicht bestreiten, Ida war einst bemerkenswert schön. Vor allem darum hatte sie, bis weit über das Klimakterium hinaus, nur auf die Blicke der Männer Wert gelegt, bewundernde, gierige, geile Blicke, die der Frauen, vergleichend prüfende, manchmal empörte, waren an ihr abgeperlt wie Wasser an einem eingeölten Bodybuilder. Und zu der Einsicht, dass es neben den schlichten, einigermaßen harmlosen Männern auch solche gab und gibt, deren Begehren in Zerstörungslust oder gar Zerstörungswut umschlägt, sobald das Objekt oder eben Subjekt ihres Verlangens erobert ist, kam sie erst, als ihr keiner von denen mehr Beachtung schenkte.
Und wenn ich es früher begriffen hätte?, denkt sie. Das hätte mir auch nicht aus der Klemme geholfen. Denn obwohl ich mich optisch nahezu perfekt fand, habe ich Fehler – ein Pickelchen etwa oder einen abgebrochenen Fingernagel oder eine misslungene Hochsteckfrisur – oder kleine Charakterschwächen, von denen ja niemand gänzlich frei ist, immer nur bei mir gesucht. Seltsam, ich war auf Fehler fixiert, auf jeden Fehler, nichts anderes als Fehler. – Ach, meine kleinen weiblichen Schwächen, mein Egoismus, meine Eitelkeiten und mein einziger Makel, die erst zu flachen, dann vielleicht zu üppigen Brüste, die hatten Schuld, die ließen Rudolf derart erkalten! – Oder doch nicht? Vielleicht waren es gar nicht meine Schwächen und Fehler und dieser eine Makel, der Busen, den ich mir womöglich nicht früh genug vergrößern ließ, sondern eher das, was Rudi, bis zum Tag X, an mir begeistert hatte, die »Rehaugen«, die »sinnlichen Lippen«, die »grandiosen Beine«. War er dieser »Reize«, wie er es nannte, überdrüssig geworden, als er plötzlich völlig verrücktspielte? Verrückter denn je, nur leider nicht mehr nach mir. Er begann, mich zu bekämpfen, ganz systematisch und gemein. Und warum? Gingen ihm meine Ansprüche gegen den Strich, meine »Vergnügungssucht«, mein »Diätfimmel«, mein »Luxuswahn«? Oder war ihm tatsächlich gerade meine Schönheit langweilig geworden? Meine legendäre Schönheit, die ihn und manchen von seiner Sorte anfangs magisch angezogen hatte, so sehr, dass sie mich wollten, um nahezu jeden Preis, den am Ende all dieser Geschichten, die keine Lovestorys waren, immer ich bezahlen musste, mit Tränen und Scham und der Angst um meine Zukunft ohne reichen Gönner? – Gott sei Dank kam ja immer bald ein nächster. – Davon, wie es ist, derart attackiert zu werden für etwas, wofür man nichts kann, haben die weniger schönen Frauen, die unsereins beneiden, ja nicht den Hauch einer Ahnung! Die sind nur die Deckel, die auf irgendwelche Töpfe passen oder umgekehrt. Und weil es sich so gehört, gebären sie ihren Töpfen oder Deckeln Topf- oder Deckelkinder, die sie lieben, anders als meine Mutter mich. Aber was heißt anders? Meine Mutter hat mich nicht anders geliebt, sondern gar nicht.
Dass er mich nicht mehr begehrt, vermutete Ida bereits damals, liegt womöglich doch nur an meinem Busen, den der triebgesteuerte Rudolf nicht prall genug findet. Diese Erleuchtung kam ihr, als sie sich einer Bemerkung seines ebenso triebhaften Vorgängers Bernhard erinnerte, einer scheinbar beiläufigen Bemerkung, die sie leichtsinnigerweise kaum beachtet hatte: »Ein bisschen mehr könntest du schon auf den Rippen haben!«
Und jetzt, während sie weiterhin die schwarzverfärbten Dahlienblüten anstarrt, als enthielten die aller Rätsel Lösung, weiß Ida auch wieder, was ihr daraufhin durch den Kopf gegangen war: Mein Berni ist ein bisschen breit geworden, und nun wünscht er sich auch seine Freundin etwas rundlicher.
Trotzdem, denkt sie, wollte ich natürlich nicht zunehmen, bloß ihm zeigen, wie klug ich bin, und dass ich seine feine Ironie und jede noch so leise Kritik verstehe. Deshalb servierte ich von da an abends beim Fernsehen neben der üblichen Flasche Burgunder edle Schweizer Nusspralinen, die dann, Stück für Stück und schwuppdiwupp, in Bernhards farblosem Strichmund verschwanden. Er merkte nicht mal, dass er den ganzen Karton allein leer futterte, weil er ja eh nur auf den Bildschirm glotzte.
Aber als später auch Rudolf die Lust an ihr verlor, deutete Ida Bernhards Bemerkung neu und diesmal richtig, wie sie glaubte: Auf ihren Rippen saß was? Der Busen! Da wurde ihr klar, dass sie Bernhard, ungeachtet der dezent zum Einsatz gebrachten Pralinees, einmal zu oft nicht ernst genug genommen hatte, denn nur wenige Wochen später machte er Schluss. »Es ist aus«, sagte er, »aus und vorbei. Du musst gehen.«
Ach Berni, denkt Ida und hebt ihren jetzt ein wenig feuchten Blick hinauf in die kahlen Kronen der Apfelbäume, der elende Schuft hat sich tatsächlich erdreistet, mich zu verlassen, mir sogar Hausverbot erteilt, mich mittellosan die Luft gesetzt, und das nicht etwa wegen einer Jüngeren, sondern wegen Britta, einer kurvigen, glotzäugigen Brünetten in seinem Alter, die ihre Monstertitten