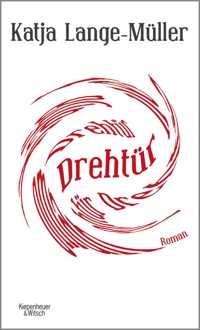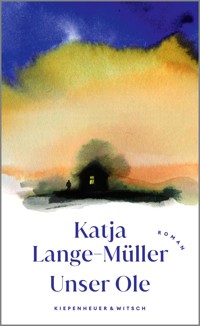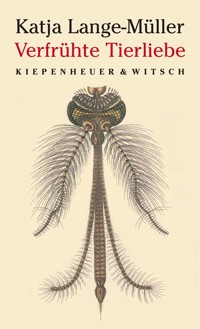9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Der Holzwurm tickt schon lange im Gebälk." Wohl niemand, der diese Geschichte gelesen hat, wird so schnell das Panoptikum von Originalen, das Quartett der umwerfenden Verlierer-Typen vergessen, die in den späten siebziger Jahren die Belegschaft von Udo Posbichs privatem Satz- und Druckereibetrieb in Ostberlin bildeten: Die ewig liebeskranke Püppi, die als linkshändige Setzerin vollständig neben der Spur fährt und ihre Sehnsucht nach Glück schließlich auf eine Topfpflanze projiziert, ein schizophrener Drucker mit reichlich düsterer Vergangenheit, dessen Gesprächspartner Geräte und Maschinen sind, oder ein Kollege, in dessen Lende einst sein parasitärer Zwillingsbruder steckte... In einer virtuosen Sprache und mit einem einzigartigen Humor, durch den sie der Verzweiflung in der Welt Satz für Satz Paroli bietet, erzählt Katja Lange-Müller eine Geschichte vom Ende – vom Ende eines Berufsstandes und einer Technologie, vom Ende der Schrift und einer sozialen Klasse. Und schließlich wird es die Geschichte einer sagenhaften subversiven Aktion, die hier auf keinen Fall verraten werden darf...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Katja Lange-Müller
Die Letzten
Aufzeichnungen aus Udo Posbichs Druckerei
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Katja Lange-Müller
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Katja Lange-Müller
Katja Lange-Müller, geboren 1951 in Ostberlin, lebt als freie Schriftstellerin in Berlin und im Aargau. 1986 erhielt sie den Ingeborg-Bachmann-Preis, 1995 den Alfred-Döblin-Preis für ihre zweiteilige Erzählung »Verfrühte Tierliebe«, 2002 den Preis des ZDF, des Senders 3sat und der Stadt Mainz, 2005 den Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor, 2008 den Preis der LiteraTour Nord, den Gerty-Spies-Preis und den Wilhelm-Raabe-Preis. In den Jahren 2012/2013 war sie Stipendiatin der Villa Massimo, erhielt den Kleist-Preis und war 2013/2014 Stipendiatin der Kulturakademie Tarabya Istanbul. 2017 erhielt sie den Günter-Grass-Preis, 2023 den Turmschreiberpreis der Stadt Deidesheim.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
"Der Holzwurm tickt schon lange im Gebälk." Wohl niemand, der diese Geschichte gelesen hat, wird so schnell das Panoptikum von Originalen, das Quartett der umwerfenden Verlierer-Typen vergessen, die in den späten siebziger Jahren die Belegschaft von Udo Posbichs privatem Satz- und Druckereibetrieb in Ostberlin bildeten: Die ewig liebeskranke Püppi, die als linkshändige Setzerin vollständig neben der Spur fährt und ihre Sehnsucht nach Glück schließlich auf eine Topfpflanze projiziert, ein schizophrener Drucker mit reichlich düsterer Vergangenheit, dessen Gesprächspartner Geräte und Maschinen sind, oder ein Kollege, in dessen Lende einst sein parasitärer Zwillingsbruder steckte...
In einer virtuosen Sprache und mit einem einzigartigen Humor, durch den sie der Verzweiflung in der Welt Satz für Satz Paroli bietet, erzählt Katja Lange-Müller eine Geschichte vom Ende – vom Ende eines Berufsstandes und einer Technologie, vom Ende der Schrift und einer sozialen Klasse. Und schließlich wird es die Geschichte einer sagenhaften subversiven Aktion, die hier auf keinen Fall verraten werden darf...
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2009, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © Rudolf Linn
ISBN978-3-462-30115-1
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Fördernachweis
Motto
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
Die Autorin bedankt sich beim Deutschen Literaturfonds Darmstadt für die Förderung dieses Buches.
Hängen, nicht begnadigen.
Hängen nicht, begnadigen.
(Setzerwitz)
I
Den Himmel, zu dem ich hochsah, wann immer mir das Wort »frei« einfiel, verdunkelten an jenem Augustabend vor zwanzig Jahren riesige, schwer auf fußballfeldgroße Flachdächer herabhängende Wolken, in deren Unterseiten, oder sollte ich »Wampen« sagen, sich Antennen bohrten, Schornsteine stemmten. Nur die fransigen Ränder und ein paar dünnere Segmente der Wolken durchleuchtete krebsrot die sinkende Sonne; mit zusammengekniffenen Augen beobachtete ich das träge, organartige Pulsieren in den glühenden Schwachstellen dieser – vielleicht ja doch an ihren labilen Aggregatzuständen leidenden – Scheinkörper aus nichts als Staubpartikeln und dem ewigen H2O der Pfützen, Bäche, Seen, Meere sämtlicher Länder, der Ozeane aller Kontinente, der Biotope unserer Welt.
Ich stolperte, fing, mit den Armen rudernd, gerade noch den Sturz ab und schaute von nun an wieder auf die Straße, deren Haus Nummer acht zu einem zweihundert Quadratmeter großen Erdgeschoßteil an einen privaten polygrafischen Betrieb vermietet war, der mich seit neunundzwanzig Tagen beschäftigte.
Ja, ich zählte die Zeit damals nach Tagen und die Tage nach Stunden, wie ein Soldat oder ein Inhaftierter, doch mit dem Unterschied, daß ich, wenn ich am Ende der jeweils acht Stunden Arbeit den Kittel auszog, diesen Werktag für Werktag garantierten Glücksmoment namens »Feierabend« hatte, und die Möglichkeit, mir auf dem Heimweg vorzustellen, daß ich am nächsten Morgen hoffentlich krank wäre, also zum Arzt gehen dürfte und dann zurück ins Bett.
Neun Jahre lang hatte ich meinen erlernten Beruf nicht mehr ausgeübt – und ausüben ist schon das richtige Wort für das, was ich in Udo Posbichs Druckerei tat: Ich »übte« das »Aus«, den Tag, an dem man mich wieder einmal fristlos entlassen oder ich, vor Scham über meine linkshändige Stümperei, von alleine aufgeben würde. »Mehr als das Gold hat das Blei die Welt geändert/Und mehr als das in der Flinte jenes im Setzkasten« – außer diesem Georg Christoph Lichtenbergschen Spruch, den ich während meiner Lehrzeit bei Ott, dem Berufsschullehrer im Fach Schriftzeichnen, zur Strafe für eine von eben diesem Ott höhnisch abgewiesene Hausarbeit, eine unleserliche Krakelei mit der rechts(!) angeschrägten, bambushölzernen Ato-Feder, zehnmal an die Tafel schreiben mußte, die quietschende Kreide in der »falschen« Faust, die lachende Klasse im Rücken, hatte ich alles vergessen. Ich konnte nichts mehr, weder den Winkelhaken einstellen noch wie selbstverständlich die richtigen Lettern greifen oder das verschiedene Blindmaterial auseinanderhalten, bloß alle paar Minuten entnervt auf den Schemel niedersinken, Zigaretten rauchen, die schmerzenden Zehen bewegen.
»Nicht rumstehen, setzen!« lautete das lustige alte Typografenwort, das mir nun wieder mindestens stündlich an den Kopf flog und noch nachts schaurig in den Ohren widerhallte. Hätte ich nicht gleich am ersten Tag meinen Facharbeiterbrief vorzeigen müssen, keiner meiner drei Kollegen hätte geglaubt, daß ich tatsächlich Setzer war.
Schon eine Woche später sagte Fritz »Püppi« zu mir, »Püppi, die einarmige blaue Elefantin«. Ein etwas komplizierter Spitzname, sicher, aber selbst ich empfand ihn als ziemlich zutreffend. Ich habe, unter einem Haufen pechschwarzer strähniger Haare, zwei bemerkenswert große Ohren, die, bei meiner hellen, gut durchbluteten Haut, wenn sie rot sind, und wann sind sie das nicht, bläulich oder eigentlich violett leuchten und die ich mit einer Art Kopfhautgymnastik auch zum Wackeln bringen kann, und weit auseinanderstehende kleine braune Knopfaugen im damals noch kindlich, wenn nicht sogar einfältig wirkenden, runden, flachen Gesicht, aus dem traurig eine lange fleischige Nase hängt. Ich bin kräftig gebaut, fast schon ein wenig plump, und gehe, obwohl oder gerade weil ich zudem hoch gewachsen bin, gebeugt, ja gekrümmt und trägen Schrittes auf meinen Plattfüßen. Das Adjektiv »einarmig« – und in einem weiteren, sich nicht allein auf meine Ohren beziehenden Sinn wohl auch das Adjektiv »blau« – sollten, denke ich, meine Schaffensmoral näher bezeichnen. Ich bin, wie ich schon erwähnte, Linkshänderin, setzte jedoch, weil das technisch anders gar nicht möglich ist, mit der Rechten, während mir meine – zumindest solange ich nüchtern war – doch etwas geschicktere Linke immerfort irgendwelche Zigaretten, Klappstullen und Bierflaschen zu Munde führte.
Der andere Akzidenzsetzer in der zweiten Gasse, Willi, ein greiser magerer Mensch, dessen Augen, Wangen, Lippen, Hände so tief grau waren, daß er aussah wie eine fleischgewordene Bleivergiftung oder richtiger wie zu einer Bleivergiftung gewordenes Fleisch, reichte die einfachsten Aufträge an mich weiter: Visitenkarten, Verlobungs-, Hochzeits-, Traueranzeigen, Einladungen, geringfügige Stehsatzkorrekturen. Doch selbst für solche Lappalien brauchte ich eine Ewigkeit.
Willi, der sich nur einmal am Tag die Hände wusch, in einer Steingutschüssel, aus der er morgens das strauchartige, unermüdlich blühende »Fleißige Lieschen« auf seinem Fensterbrett mit dem Waschwasser von gestern begoß, nahm, immer wenn ich ihn bat, mir zu helfen, eine meiner selbstgedrehten Zigaretten, schob mich zur Seite, so, daß ich ihm nicht auf die Finger sehen konnte, und brachte die Sache wortlos zu Ende. Überhaupt redete er nicht, mit niemandem. Tat er aber hin und wieder doch den Mund auf, dann nur, um in stets gleichbleibender Reihenfolge seine zwei kurzen Reime runterzuleiern wie ein batteriebetriebener Bleiblechwilli: »Schön ist ein Zylinderhut / wenn man ihn besitzen tut / Aber zwei Zylinderhüte / sind von ganz besond’rer Güte … Wer Gott vertraut / und Bretter klaut / der hat ’ne bill’j e Laube …«
Ganz anders als Willi war Fritz, Fritz, der »harte, handflinke, vieläugige Maschinensetzer«, der »King of the Linotype«, der »zum Querulanten geläuterte Opportunist«, wie er sich gerne nannte.
Fritz war höchstens vierzig, eher drahtig als stark, nicht sehr groß, ziemlich aknenarbig im Gesicht, aber engelsblond. Mit diesem betlehemischen Strohdach auf dem Kopf, der groben, keksgelben Gesichtshaut, dem kühn gebogenen, meinem aber gar nicht ähnelnden Riechorgan, den flieder farbenen dramatisch über den Rand der Lesebrille blickenden Augen hielt ich ihn für eine erstaunliche Gestalt, eine gelungene und doch irgendwie auch unglücklich geratene Mischung aus Andy Warhol, Klaus Kinski, Hans Albers und Heino.
Jeden Tag, etwa eine Stunde vor Feierabend, straffte Fritz zwischen den vier plexigläsernen Wänden der engen Zeilensetz- und Gießmaschinenkabine seinen Oberkörper, bis er baumgerade vom Hocker ragte, spreizte die Ellenbogen ab, ließ die Fingerspitzen über die Tastatur der Viermagazin-Linotype tanzen und heulte hingebungsvoll. Dann erinnerte er mich an eine Figur aus einem sowjetischen Zeichentrickfilm, einen Albinowolf, der von bösen, westlichen Wissenschaftlern in einem Terrarium gehalten wurde und sich selbst auf dem Klavier begleitete, zu einem wilden Schmachtfetzen von früher, als er noch der Schrecken der Tiere war, und die Tierheit noch unter sich.
»Warum machst du das?« fragte ich Fritz einmal. »Weil ich muß!« war seine Antwort.
Fritz hatte ein gestörtes Verhältnis zur Zukunft. Es war wohl so, daß er nicht weiter denken konnte oder wollte als höchstens bis zum nächsten Morgen. So ging es ihm absolut gegen den Strich, für etwas Geld auszugeben, das jenseits des Augenblicks lag.
Weil man den Mitgliedsbeitrag im voraus entrichten mußte, war Fritz nicht in der Gewerkschaft, weil Willi die zwölf Mark für die warmen Gerichte, die uns jeden Tag in Aluminiumkübelchen von einer Großküche geliefert wurden, regelmäßig schon zum Wochenanfang kassierte, beteiligte sich Fritz nicht an diesem, wie er es nannte, »kulinarischen Spekulationsbetrug«, sondern ging in den Ein-Uhr Pausen zur Würstchenbude neben der Druckerei, wo er seine »Curry mit Salat« grundsätzlich erst bezahlte, wenn er fertig gegessen hatte.
Fritz war kein besonders ängstlicher Mann. Er fuhr Fahrrad und haßte Automobile, damals schon.
»Warum«, so argumentierte er, »soll ich Scheine hinblättern für irgendeinen Mist, den ich möglicherweise gar nicht mehr erlebe? Da braucht doch bloß so ein dämlicher Lastwagen kommen, ein Schädelbruch, ein Herzinfarkt, ein Gehirnschlag, und schon haben diverse Leute Schulden bei einer Leiche.«
Daß es in der Welt, zumindest der europäischen, und so auch bei Posbich, üblich geworden war, den Lohn nur einmal im Monat einzutüten, nachträglich, für längst geleistete Arbeit, das ärgerte Fritz nun wirklich; darüber konnte er sich stundenlang aufregen. Und tatsächlich hatte Fritz, nur für sich allein, das Privileg von Abschlag und Vorschuß bewirkt. »Aus keinem anderen Grund«, sagte Fritz, »bin ich beim Privaten.« Aber das stimmte nicht ganz; zumindest einen weiteren Grund gab es schon noch, Fritz verabscheute nicht bloß Autos, sondern auch Autoritäten.
Bevor es Fritz zu Udo Posbich verschlagen hatte, war ihm von zwei staatlichen Großbetrieben gekündigt worden. Er hatte seine Abteilungsleiter und Meister so lange provoziert, bis sie die Grundfrage stellten: Wir oder der renitente, pessimistische, parteilose, gewerkschaftsfeindliche Maschinensetzer?
Fritz konnte auch Posbich nicht an seinem Plexiglashaus vorbeiziehen lassen, ohne ihn anzupflaumen. Und Posbich beherrschte sich mühsam, denn er zahlte schlecht, weil er, dem Staat und dessen erpresserisch hohen Gewerbesteuern zum Trotze, nun einmal seinen »bescheidenen Makulaturschuppen«, wie kein anderer als Fritz Posbichs Laden nannte, mit den alten Maschinen über Wasser, seine Gattin bei Laune und vor allem die eigene, so hart erkämpfte Kleinunternehmerstellung halten wollte, und dazu brauchte er einen guten Maschinensetzer, und der konnte keinen einfachen Charakter haben, sonst wäre er ja nicht bei Udo Posbich gelandet.
Obwohl er von Geld genausoviel redete wie vom Tod, war Fritz weder geizig noch furchtsam, im Gegenteil, er gab gern, »mit vollem Mund und feuchten Händen«, wie er es ausdrückte: Spott, Ratschläge, saure Drops und, wenn es ihm paßte, auch mal die eine oder andere Runde. »Bestellte Biere werden getrunken und dann – vielleicht – bezahlt«, sagte Fritz; das sei das Schöne an der Gastronomie, da wüßte man noch, wie schutzlos und gefährdet der Sterbliche ist.
Am Morgen meines dritten Montags bei Posbich, nach einem Wochenende, das ich, erschöpft vom fünfmaligen frühen Auf- und stundenlangen, andächtigen Stillstehen vor dem Fragment einer Tabelle, mit zwei Flaschen »Kreuz des Südens« allein im Bett verbracht hatte, lehnte ich wieder am Setzkasten und starrte halbwachen Blicks auf das Blech mit der rätselhaften Unvollendeten.
Ich erwog gerade, erst einmal zum Klo zu gehen und, entspannt hinter der verriegelten Tür sitzend, schön langsam ein Glas eiskalten Leitungswassers zu trinken, da hatte ich plötzlich den Geruch von Seife, Zahnpasta, Knoblauchwurst in meiner Nase, und die eines anderen, den ich so, aus dem Augenwinkel, nicht sehen konnte, berührte, stoßweise Ströme warmer Atemluft absondernd, das Innere meines rechten Ohrs. »Arme Püppi, du arme, einarmige blaue Elefantin, mein armer schwarzer Kater«, flüsterte Fritz.
Im Nacken und auf den bloßen Armen sträubten sich mir die Haare, ein schmerzliches Kribbeln lief meinen Rücken hinab, in die Furche zwischen den Pobacken; aus meinen Achselhöhlen rann Schweiß, mir wurde schwindlig. »Ist ja gut«, sagte ich zu Fritz, der jetzt auch noch anfing, mit der rauhhäutigen Kuppe seines Daumens durch den dünnen Stoff des Kittels hindurch meine Wirbelsäule abzutasten, entzog mich ihm und trabte, so schnell mein melancholisches Temperament es erlaubte, nun doch zu den Toiletten. Glücklicherweise gab es zwei, die eine extra für mich.
Als ich wiederkam, saß Fritz in seinem Kasten, und Willi war gerade dabei, meine von ihm fertig gebaute Tabelle auszubinden.