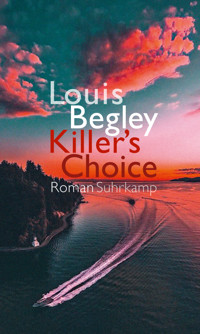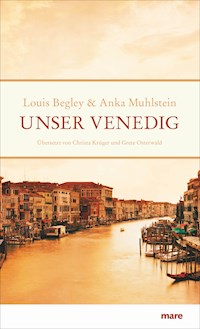
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Meine Insel
- Sprache: Deutsch
Zwei Autoren, wie sie auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein könnten: die französisch schreibende Sachbuchautorin Anka Muhlstein, der englisch schreibende Romancier Louis Begley. Während Begley seine Romanhelden immer wieder nach einem Ausweg aus dem Albtraum Geschichte suchen lässt, muss Muhlstein mit ihren vielfach ausgezeichneten Biographien mitten hinein in die Historie gehen. In "Venedig unter vier Augen" unternimmt Anka Muhlstein einen Streifzug durch die Serenissima, während Louis Begley dem genius loci dieses einzigartigen Orts der Weltliteratur bei Henry James, Marcel Proust und Thomas Mann nachspürt und in einer meisterhaften Erzählung von einer erotischen Initiation und dem einzigen Weg nach Venedig erzählt: "Fährst du nach Venedig, musst du in einer Gondel ankommen, sagte Lilly, das ist das einzig Wahre. Alles andere wäre ein Sakrileg. Eine Gondelfahrt vom Bahnhof zu deinem Hotel, damit tust du der Stadt und dir Genüge, meine ich. Ich sollte dir dazu sagen, dass eine Autorität wie Thomas Mann anderer Meinung ist. Jedenfalls war er anderer Meinung, als er den "Tod in Venedig" schrieb. Dort steht, dass auf dem Bahnhof in Venedig ankommen einen Palast durch die Hintertür betreten hieße."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Für Nicholas, Julia, Isabella, Henri und Jacob
Louis Begley · Anka Muhlstein
Unser Venedig
Aus dem Amerikanischen von Christa Krügerund aus dem Französischen von Grete Osterwald
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikationin der deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliographischeDaten sind im Internet unter http://dnb.ddb.de abrufbar.
Die Proust-Zitate in Romane und Venedig (mit leichten Anpassungen an Louis Begleys Übersetzung ins Englische) stammen aus:
Marcel Proust, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, Bd.6, Die Flüchtige, aus dem Französischen übersetzt von Eva Rechel-Mertens, revidiert von Luzius Keller und Sibylla Laemmel, Frankfurt am Main, 2001.
© 2003 by mareverlag, Hamburg
Covergestaltung Nadja Zobel / Petra Koßmann, mareverlag Hamburg
Abbildung Robert Voit
Lektorat Jana Hensel, Berlin, und Denis Scheck, Köln
Typografie (Hardcover) Farnschläder & Mahlstedt, Hamburg
Datenkonvertierung E-Book Bookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-370-5
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-238-8
www.mare.de
Inhalt
Louis BegleyDer Königsweg nach Venedig
Anka MuhlsteinDie Schlüssel zu Venedig
Louis Begley · Anka MuhlsteinBegleys in Venedig
Louis BegleyRomane und Venedig
Louis Begley
Der Königsweg nach Venedig
Der Königsweg nach Venedig, sagte Lilly, ist in einer Gondel. Alles andere wäre ein Frevel. Eine Gondelfahrt vom Bahnhof zu deinem Hotel, ich finde, damit tust du der Stadt und dir Genüge. Ich sollte dir dazu sagen, dass keine geringere Autorität als Thomas Mann da anderer Meinung ist. Jedenfalls war er anderer Meinung, als er den Tod in Venedig schrieb. Dort steht, dass auf dem Bahnhof in Venedig ankommen einen Palast durch die Hintertür betreten hieße. Er schrieb, man müsse zu Schiff, über das hohe Meer anlangen, sodass der Dogenpalast, die Seufzerbrücke und die Säulen mit dem geflügelten Löwen und St. Theodor wie durch Magie aus dem Wasser auftauchen. Ich frage mich, ob er heute immer noch so denken würde, da man einfach nicht mehr mit dem Schiff nach Venedig fährt, es sei denn, man schätzt Kreuzfahrten und Gruppenreisen.
Zur fraglichen Zeit hatte ich Thomas Manns Novelle noch nicht gelesen, obwohl Der Zauberberg einer meiner Lieblingsromane war. Ich las ihn im Sommer nach meinem Highschool-Abschluss. Ich wollte Geschichte studieren und war fest entschlossen, Militärhistoriker zu werden. Eine Englischlehrerin, die wusste, wie sehr mich der Erste Weltkrieg und sein langes, bis zur Schlacht von Königgrätz zurückreichendes Vorspiel interessierte, sagte mir, Thomas Manns Roman liege ganz auf meiner Linie; und damit hatte sie sehr Recht. Jetzt stand ich kurz vor meinem Abschlussexamen am Harvard College, und meine Passion für Militärgeschichte hatte nicht nachgelassen. Als ich Lilly meine Bildungslücke gestand, lachte sie und sagte, hast du ein Glück. Auf dich warten zwei ganz besondere Genüsse. Die erste Begegnung mit dem Leben in Venedig und dem Tod in Venedig. Über das Wortspiel lachten wir beide. Ich gebe dir das Buch mit, dann kannst du es im Zug lesen, fuhr sie fort. Im Nachtzug von Paris nach Venedig. Einen Liegewagenplatz wirst du dir nicht kaufen, denke ich mir, also wirst du in der Nacht nicht schlafen. Der Bahnhof ist direkt am Canal Grande. Dort warten Gondeln. Du gibst dem Gondoliere deinen Koffer, sagst ihm den Namen deines Hotels oder reichst ihm am besten einen Zettel mit Namen und Adresse und ruhst dann wie ein König in den roten Plüschpolstern. Aber pass auf, dass dir nicht die Augen zufallen. Das herrlichste Schauspiel der Welt, ein Märchenland gotischer Architektur wird an dir vorübergleiten. Wenn dir dann allmählich klar wird, dass du am liebsten für immer so weiterfahren würdest, wird die Gondelpartie leider schon zu Ende sein. Die Gondel wird an ein paar glitschigen, algenüberwachsenen Steinstufen anlegen, die den rio an diesem Abschnitt des Seitenkanals unterbrechen. Bis zu deinem Hotel sind es nur ein paar Meter.
Natürlich dachte Lilly nicht einen Augenblick, sie müsse den berühmten deutschen Schriftsteller in unsere Unterhaltung einflechten, um ihren Worten Autorität zu verleihen. So redete sie eben manchmal, immer dann, wenn sie ihre Rolle spielte, wenn sie auftrat als Tochter des Lehrstuhlinhabers am Englischen Seminar der Universität Harvard, eines mürrischen Menschen, der seinen berühmten Kurs über Chaucer für Studienanfänger seit Menschengedenken unterrichtet hatte – manche behaupteten, schon seit Chaucers Zeit –, als Muse und meist anonyme Schirmherrin des Poets’ Theater und als mein cicerone durch Kultur und Gesellschaft. Ich muss sagen, dass ich die weltgewandten Ratschläge und Rügen, die sie so freigebig spendete, geradezu gierig und blindlings annahm, so bitter sie mir auch manchmal schmeckten. Kein Aspekt meiner Person oder meines Verhaltens war zu trivial für Lillys Aufmerksamkeit und ihre Kommentare, und ich war überzeugt, alles sei nur zu meinem Besten. Ich will nicht behaupten, dass sie meine Mutter in den Schatten stellte – die arme Frau hat sicherlich getan, was sie konnte, und das, obwohl sie sich auch um meine drei jüngeren Schwestern kümmern musste und um meinen Vater, der von einer Depression in die nächste fiel –, aber nie hatte mich jemand so genau geprüft oder mit so vielen Verhaltensregeln bedacht wie Lilly. Diese Regeln zielten abwechselnd auf meine Diktion, meine Tischsitten und Kleider oder die Lücken in meinen Literatur-, Kunst- und Musikkenntnissen. Für mich blieb nur die Frage offen, ob mein Leben sich irgendwann in nebelhafter Zukunft auf einem derart hohen Niveau bewegen würde, dass solche Regeln auch zur Anwendung kommen konnten. Außerdem war ich in Lilly verliebt – und in all die Dinge, die sie hatte und die ich nicht nur nicht besaß, sondern bis vor kurzem auch für vollkommen unerreichbar gehalten hatte.
Auch war ich wie besessen von ihrem Körper, obwohl ich damals noch nicht viel bei ihr erreicht hatte: Ich durfte ihren Mund küssen, wobei unsere Zungen sich in eifriger Kommunikation begegneten, ich durfte an ihren Brüsten saugen – allerdings nicht immer –, Lilly innen an den Oberschenkeln streicheln und bei bestimmten seltenen Gelegenheiten, wenn sie nach dem Dinner mehr Whiskey als normalerweise getrunken hatte, auch von außen durch ihr Höschen hindurch den Venushügel und die Schamlippen kneten. Da sie altmodische Höschen mit angeschnittenem Bein trug, die außer dem üblichen Gebiet auch noch sechs bis acht Zentimeter vom Schenkel umschlossen, führte das Fummeln unter dem Stoff nach innen nicht recht zum Ziel, es sei denn auf dem Weg von der Gürtellinie abwärts, und das war eine Initiative, zu der mich damals nichts ermutigt hatte, die ich also nicht wagte. Ihren Venushügel hatte ich wegen dieser Unterwäsche noch nie gesehen, aber in meiner Phantasie war er blond wie Maisseide und kraus wie Engelshaar auf einem Babykopf. Gerade die Mischung aus Schönheit und kleinen Mängeln bei Lilly machte mich buchstäblich schwach: ihr Mund mit den schön geschwungenen Lippen und den leicht vorstehenden Zähnen, die sich auf meiner Zunge fast schartig und scharf anfühlten, ihre Brüste, über die sich eine ganze Milchstraße aus Sommersprossen zog, und ihre Oberschenkel. Diese Schenkel verdienen besondere Erwähnung: Sie waren plump, was mich überhaupt nicht abstieß; sehr kräftig, weil Lilly eine trainierte Reiterin war, und, gegen Ende der Zeit zwischen zwei Enthaarungsmaßnahmen, stachelig. Ich wusste, dass diese plumpen, stacheligen Schenkel keine Qualifikationsmerkmale eines Pin-up-Girls waren und dass Lilly sich ihrer schämte. Aber für mich bedeuteten die Stoppelhaare Heimlichkeit. Wenn ich mit der Hand darüber strich, war die Rauheit ein weiteres Zeichen dafür, dass ich mich im Vorhof zum Allerheiligsten befand. Die Plumpheit ihrer Oberschenkel und ihres Hinterteils gehörte unbedingt zu meinen Tagträumen von der Besteigung Lillys.
Als ich mein Abschlussexamen am College machte, war ich jung, erst zwanzig. Sie war fünf Jahre älter als ich und hatte am Radcliffe studiert. Danach war sie ein paar Jahre in Europa gewesen und hatte erst bei der Herald Tribune, dann bei Time eine Teilzeitstelle gehabt. Eine üble Brucellose, die sie sich in den Skiferien in Zermatt geholt hatte, zwang sie, nach Cambridge zurückzukehren. Sie wurde wieder ganz gesund, bis auf gelegentliche Anfälle von Erschöpfung, und hatte eine Vormittagsstelle im Büro der Studienförderung; dort hatte ich häufig zu tun, so häufig, dass ich es wagte, sie auf eine Tasse Kaffee einzuladen. Meine Besuche in diesem Büro hingen mit dem Erlass der Studiengebühren am Harvard College zusammen und neuerdings auch mit meinem Stipendium für ein zweijähriges Aufbaustudium an einer europäischen Universität, das ich nach dem Examen erhalten hatte. Mit diesem Stipendium konnte ich einen Sommer lang eine Reise durch Europa finanzieren, wo ich noch nie gewesen war. Venedig wurde mein erstes Reiseziel, als Lilly mir erklärte – mit sinnlich träger Stimme, denn meine Hand befasste sich gerade mit ihren Schamlippen –, sie werde gegen Ende Juni dort sein. Vielleicht könnten wir uns da treffen, murmelte sie. Ich bin eine gute Reiseführerin.
Diese Liebesübungen fanden auf einem Sofa in Lillys Wohnung am Memorial Drive statt, abseits von meinen Zimmern im Collegehaus und dessen Anstandsregeln über Damenbesuche. Lilly hatte Geld aus einem Trust, den ihr Großvater mütterlicherseits, ein erfolgreicher Erfinder, eingerichtet hatte. Das Geld gab ihr eine Art von Freiheit, die ich noch nie aus nächster Nähe gesehen hatte. Sie nahm sich ungefähr so aus: Lilly machte, was sie wollte, ob es nun darum ging, ein Apartment in diesem zitadellenartigen Gebäude zu mieten und zu möblieren oder ein kleines schwarzes Cabrio zu kaufen, weil sie fand, es sehe hübsch aus und passe gut zu ihren Haaren, oder anzukündigen, sie werde Ferien in Europa machen oder dem Poets’ Theater eine Inszenierung von Sechs Personen suchen einen Autor finanzieren. Ungefähr war mir schon klar, dass manche Studenten in meinem College aus sehr reichen Familien kamen; und dass das einen Unterschied machte, konnte ich an ihren Kleidern sehen, die oft maßgeschneidert waren und aus einem Atelier in der Mt.Auburn Street stammten, in dessen Schaufenster ich verstohlene und bewundernde Blicke warf, oder auch an ihren Weihnachtsreisen auf karibische Inseln; aber wirklich verstehen konnte ich diesen Unterschied nicht, dazu stand ich ihnen zu fern und hatte keinen Zutritt zu den College-Clubs, in denen sie, so malte ich mir aus, solche Dinge besprachen. Nun erfuhr ich praktisch aus erster Hand, wie die Reichen ihren Reichtum nutzten. Für einen Stipendiaten aus einer Kleinstadt in New Hampshire waren dies bedeutungsträchtige Lektionen.
Ich besuchte Lilly manchmal nachmittags zur Teezeit nach ihrem Mittagsschlaf, aber meistens zum Abendessen. Sie kochte gern, ihre Spezialitäten waren Lammkoteletts, Kalbsleber, Hühnerleber, Stangenbohnen und Spinat. Wenn ich es mir leisten konnte – gewöhnlich, wenn ich gerade mein Geld von den Eltern eines High-school-Schülers, dem ich Nachhilfestunden gab, bekommen hatte –, brachte ich eine Flasche Wein mit und hoffte, er werde Gnade vor Lillys Augen finden, das heißt weder als untrinkbar noch als absurd teuer getadelt werden. Schien mir die Zeit reif, dirigierte ich uns zum Sofa. Saßen wir dort, lasen wir Gedichte, die sie aussuchte und mich interpretieren ließ. Während wir uns über die Buchseite beugten, fand mein Arm nach und nach den Weg zu ihrer Taille, und meine Hand umschloss ihre Brust. Oder ich fing an, ihr Beine und Knie zu streicheln. Wenn sie meine Hand nicht wegschob, kam ich schnell zur Innenseite ihrer Oberschenkel. Das kupplerische Buch landete mit der aufgeschlagen Seite nach unten auf dem Couchtisch. Dieses Spiel konnte leicht zwei Stunden dauern, mit gelegentlichen Unterbrechungen, wenn neue Drinks geholt – nach dem Abendessen trank sie gern starke Whiskey-Sodas mit Eis bis zum Glasrand – oder Platten auf dem Plattenspieler gewechselt werden mussten, und auch wegen der nach erheblicher Flüssigkeitszufuhr allfälligen Gänge zum Bad. Lilly war gewöhnlich passiv, schloss die Augen und überließ sich meinen Zärtlichkeiten. Ihre einzige Geste für mich bestand darin, dass sie mein Glied mitsamt den Stoffschichten meiner Hose und Shorts ergriff und drückte, als wolle sie seine Härte prüfen. Sie sagte dann, meinem kleinen Mann müsse man zu seiner Geduld gratulieren. Für den kleinen Mann kann ich nicht sprechen; ich ächzte vor Verlangen, dass ihre Hand an meinem Penis bliebe und mir das Zeichen zum Kommen gäbe, aber wann immer ich ihr andeutete, was ich mir wünschte, schüttelte sie immer nur den Kopf und sagte, nein, das habe sie nicht vor. Es war klar, dass ich gut daran tat, mich zu beherrschen. In meiner Hose zu kommen, wie es mir oft mit anderen Mädchen passiert war, hätte nur meinen Status und meine Aussichten verringern können.
Ich dirigierte sie, habe ich gesagt, und so schien es mir damals auch meistens zu sein, aber wenn ich heute darüber nachdenke, bin ich mir gewiss, dass es umgekehrt war. Sie führte bei unseren Spielen Regie. Ihr gefiel Sex ohne die mit Sex verbundenen Unsicherheiten. Ich wusste, einmal pro Woche, manchmal öfter, hatte sie richtigen Sex, ganz ohne unsere Spielchen, mit einem hochangesehenen Fakultätsmitglied, einem Wissenschaftsphilosophen, der mit der besten Freundin ihrer Mutter verheiratet war. Diese Beziehung wolle sie beenden, behauptete Lilly, da der Philosoph – so ihre Worte – sie nur benutze wie eine öffentliche Bedürfnisanstalt. Sie hatte sich auch mit einem hohen französischen Staatsbeamten eingelassen – seinen Namen wollte sie nicht nennen –, der eine große Zukunft vor sich sah. Ich hatte den Eindruck, dass sie ihn liebte und dass ihre Ferien in Europa, von deren Stationen außer Venedig sie mir anscheinend nichts verraten wollte, ihren Kontakt mit diesem Mann wiederherstellen sollten. Als ich fragte, ob sie ihn heiraten wolle, antwortete sie, sie wolle schon, sei aber ganz und gar nicht sicher, ob es auch in seiner Absicht liege. Zum einen sei sie Amerikanerin, was sich für seine Karriere im Staatsdienst vielleicht nicht günstig auswirke; zum anderen sei sie nicht reich genug. Seine Situation und seine Ambitionen verlangten eine außerordentlich glänzende eheliche Verbindung. Diese Information verblüffte mich. Ich war zu der Überzeugung gekommen, dass Lilly den Gipfel des Chic darstellte, und sie schien über reichlich Vermögen zu verfügen. Als Einzelkind würde sie nach dem Tod ihrer Eltern zudem mit hoher Wahrscheinlichkeit an noch mehr Geld kommen.
Meine Affäre mit ihr erreichte im Mai, dem letzten Monat des akademischen Jahres, eine neue Hochebene – in den Ausläufern, kaum oberhalb der Baumgrenze der Sex-Alpen. Wir saßen nach einem verspäteten Start auf dem Sofa. Es war nach elf. Lilly sagte, ich solle nach Hause gehen. Sie sei müde und müsse ins Bett. Ich sagte, nimm mich doch mit, und fingerte an ihren Brustwarzen, so, wie sie es nach meiner Erfahrung gern hatte. Zuerst sagte sie, auf keinen Fall, und dann sagte sie, ja, ich könne mit in ihr Bett kommen und über Nacht bleiben, aber mein kleiner Mann habe keine Chance, er müsse sich aus ihr heraushalten. Ich dürfe sie weiter streicheln, und ich würde ihr ein Märchen erzählen müssen. Damit sie besser einschlafen könne. Das Zubettgehen dauerte eine Weile. Lilly duschte und traf hinter der geschlossenen Tür ihres Badezimmers weitere verborgene Vorkehrungen, um schließlich nach Seife und Zahnpasta duftend, mit feuchtem, sorgfältig gebürstetem Haar wieder zu erscheinen, in einem dunkelroten Seidenpyjama, der grandioser war als alle Kleidungstücke dieser Sorte, die ich je gesehen hatte. Sie sagte, ich solle auch unter die Dusche gehen, und sie habe mir eine neue Zahnbürste auf den Waschbeckenrand gelegt. Ich tat wie geheißen, wagte aber nicht, mich nackt im Schlafzimmer wiedereinzufinden, und kam nicht auf den Gedanken, zu einer Zwischenlösung Zuflucht zu nehmen, zum Beispiel mir ein Handtuch um die Taille zu wickeln. Im technischen Sinn war ich noch jungfräulich und schüchtern. Mein Penis war zwar schon seit dem dritten Highschool-Jahr von verschiedenen Freundinnen mit Händen, Zunge und sogar mit dem Mund bearbeitet worden, aber noch nie jenen Gang hinabgeglitten, dessen Gestalt, Feuchtigkeit und Geruch ich dank der Freundlichkeit von Mädchen, die nicht wie Lilly mit High-Society-Unterwäsche bewehrt waren, streckenweise mit meinem Mittelfinger erkundet hatte. Deshalb finde ich es nicht verwunderlich, dass ich mich auf einen schmählichen Kompromiss einließ. Die Erinnerung daran macht mich heute noch gallebitter. Der Kompromiss bestand darin, dass ich mich in Boxershorts neben Lilly legte. Im abgedunkelten Schlafzimmer hatte ich an ihrem Bett gekniet, meine Hand unter die Bettdecke geschoben und festgestellt, dass Lilly noch ihren Pyjama trug, und mein geflüstertes Flehen, sie möge mir bitte erlauben, ihr das Kleidungsstück auszuziehen, war mit einem strengen «der bleibt an» abgewiesen worden. Das nahm mir den Mut, nackt zu ihr zu kommen und mein entblößtes, pochendes, geschwollenes Glied an die rote Seide zu pressen. Als ich in der Folgezeit schließlich wagte, aus meinen Shorts zu steigen, wurde und blieb genau dieser Kontrast – ihre verschwenderische rote Seidenhülle und ihre Passivität gegen mein drängendes, nacktes Begehren – für mich das Erregendste an den Nächten mit Lilly, bis wir uns am Ende der ersten Juniwoche, unmittelbar nach meinem Abschlussexamen, voneinander verabschiedeten. Lust derselben erotischen Spielart sollte ich erst viele Jahre später wieder erleben, mit einer Frau, die sich mir entblößt auf ihrer Couch sitzend präsentierte, mir ihr Becken entgegendrängte und darauf bestand, dass ich, vor allem wenn ich den kratzigen Tweedanzug trug, den ich damals besonders gern anzog, die Hosen nicht herunterließ, sondern nur so weit öffnete, wie technisch unumgänglich, wollte ich in sie eindringen. Um wieder auf Lilly zurückzukommen: Wir wussten beide, dass dieser Abschied nach meinem Examen nicht endgültig war. Sie sagte, im venezianischen Büro von American Express werde ein Brief von ihr auf mich warten. Darin werde stehen, wann sie in Venedig ankomme und wo sie dort zu finden sei. Abgesehen davon, dass ich mir allmählich unbegrenzte Rechte zur Erkundung ihres Körpers erworben hatte, eingeräumt unter der Bedingung, dass ich keinen Versuch machte, sie auszuziehen oder mit meinem Penis in sie einzudringen, hatten sich unsere Liebesübungen nicht entscheidend verändert. Ich erzählte ihr weiterhin Gutenachtgeschichten – eine Pflicht, die sehr bald verlangte, dass ich mein Repertoire auffrischte, indem ich die Brüder Grimm zu Rate zog, in der Widener Bibliothek, wo ich einen Leseplatz hatte – und schaffte es nach wie vor, während unserer Zärtlichkeiten und wenn wir endlich schliefen, nicht zu ejakulieren. Lilly lobte weiterhin meine Selbstbeherrschung, und ich kann nicht abstreiten, dass ich sie allmählich auch genoss. Trotzdem: Ich hatte mir fest vorgenommen, dass Lilly in Venedig mein gutes Betragen belohnen, das heißt das Opfer meiner Jungfräulichkeit endlich annehmen müsse.
Beim American Express lag der Brief tatsächlich. Sie schrieb, Mittwoch werde sie in Venedig sein. Ich solle sie an diesem Tag um zwölf Uhr mittags im Quadri an der Piazza San Marco erwarten. In welchem Hotel sie absteigen wollte, teilte sie mir nicht mit. Die Bleibe, die ich mir mit Lillys Hilfe ausgesucht hatte, weil man dort erstaunlich niedrige Preise verlangte, war ein winziges Etablissement am Campo S. Angelo. Mein Zimmer lag im vierten Stock und war über ein steiles, enges, sehr sauberes Treppenhaus zu erreichen. Überhaupt schien das Hotel völlig sauber und ohne Anzeichen von Wanzen – die seien in Europa generell zu fürchten, hatte Lilly mir eingeschärft – oder sonstigem Insektenleben außer Mücken zu sein. Die Mücken kamen während meiner ersten Hotelnacht in Schwärmen in mein Zimmer, weil ich versäumt hatte, das Fenster zu schließen, als ich Licht machte. Die Kerze mit Citronella-Öl, die ich am nächsten Tag kaufte, half. In Amerika hatte ich nie eine Wanze gesehen; und wie sich herausstellte, sollte ich erst im August jenes Sommers einer begegnen, in einem Hafenhotel in Alicante. Für mich gab es mit meinem Hotel in Venedig nur ein Problem. Nachdem ich mich angemeldet hatte, sah mir die beleibte, würdevolle Dame, die anscheinend Eigentümerin, Empfangsdame und Kassiererin in einer Person war, streng in die Augen, wackelte mahnend mit dem erhobenen rechten Zeigefinger und sagte niente donne nelle stanze. Dieses Verbot wurde von einem schlecht rasierten Nachtportier wiederholt, dem ich abends, als ich zum Essen aus dem Haus ging, meinen Zimmerschlüssel gab. Es missfiel mir, dass die Möglichkeit, Lilly in mein Zimmer mitzunehmen, damit ausgeschlossen war, aber ein ernsthaftes Hindernis sah ich darin nicht. Mein Zimmer verfügte nur über ein Waschbecken und einen Nachttopf, den ich zufällig im Nachttisch entdeckte. Die Toilette und die Kabine mit der Badewanne lagen am Ende des Flurs. Ich benutzte sie gemeinsam mit anderen Bewohnern des vierten Stocks. Ich ging nicht davon aus, dass Lilly diese Arrangements zusagen könnten. Unsere Liebesnächte würden wir in ihr Hotel verlegen, dessen Ausstattung und Komfort üppiger sein mussten.
Lilly hatte gesagt, mit meinem ersten Gang durch die Accademia und die Scuola S. Rocco müsse ich warten, bis sie komme. Deshalb besichtigte ich den Dogenpalast; aber zuerst kaufte ich mir zum Mittagessen auf ihre Empfehlung hin bei einem Straßenverkäufer auf der Rialtobrücke seppie mit polenta