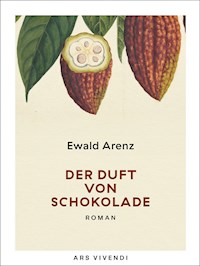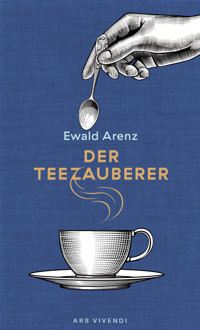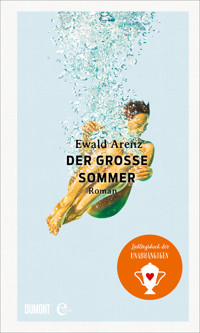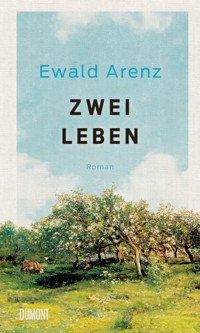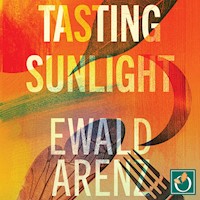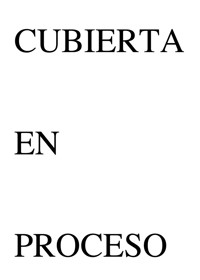Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das ideale Geschenkbuch und der perfekte Begleiter für die Adventszeit: Situationskomik und Sprachwitz der Arenz- Geschwister Ewald, Sigrun und Helwig Mit völlig neuen, exklusiv für dieses Buch geschriebenen Geschichten Die Arenz-Geschwister Sigrun, Helwig und Ewald haben eine ganz besondere Beziehung zur Weihnachtszeit, schließlich wuchsen sie in einem Pfarrhaus auf. Doch nicht nur davon erzählen sie in ihren neuen Familiengeschichten, sondern auch von den ganz normalen Turbulenzen und Missverständnissen rund um Geschenke, Weihnachtsessen, Weihnachtspost und Co. Mit viel Charme und Humor gehen sie unter anderem den Fragen nach, wie man mit dem grellbunten Plastikkram umgeht, den das Kind von den lieben Verwandten bekommen hat, und unter welchen Umständen man(n) seiner Freundin ein Bügeleisen schenken kann …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Liebe Leserin, lieber Leser, sicher ist Ihnen auf dem Einband das Aktions-Logo des Vereins Junge Helden e.V. (www.junge-helden.org/optink) aufgefallen. Man kann sich dieses Signet auch als Tattoo stechen lassen und damit signalisieren, dass man als Organspender zur Verfügung steht. Warum setzt der ars vivendi verlag mit seinen Büchern buchstäblich dieses Zeichen? Hätte ich selbst im Jahr 2006 nicht in allerletzter Sekunde das große Glück gehabt, eine Spenderleber zu erhalten, würden Sie dieses und viele andere Bücher von ars vivendi nicht in den Händen halten. Es ist mir ein Herzensanliegen, mich dafür einzusetzen, dass sich mehr Menschen bereit erklären, Organe zu spenden und damit Leben zu retten. Ihr Norbert Treuheit, Verleger
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (1. Auflage Oktober 2025) © 2025 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg [email protected]
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
www.arsvivendi.com
Umschlaggestaltung: finken & bumiller, Stuttgart, unter Verwendung einer Illustration von © Zamurovic Brothers/Shutterstock
eISBN 978-3-7472-0742-0
Unser verrücktes Weihnachtsfest
Sigrun ArenzAnstelle eines Vorworts oder: Marzipan mit Pommes
Mit Erich Kästner habe ich eigentlich nicht allzu viel gemeinsam. Meine Brüder auch nicht, obwohl die zumindest Männer sind. Sehe ich mir die düstere Zeit an, in der Kästner lebte und arbeitete, die beginnende Barbarei der 1930er-Jahre, bin ich sogar ganz froh darüber, wenn es dabei bleibt.
Als ich aber an einem strahlenden, sommerlich warmen Mainachmittag auf der Terrasse sitze, dem Singen der Vögel, dem Rauschen des Windes in den Blättern des Essigbaums und den Gesangsfetzen der Nachbarn gegenüber lausche, fühle ich mich dem Schriftsteller über den Graben von fast hundert Jahren auf einmal sehr verbunden.
Stille Nacht, denke ich, während die Nachbarn lärmende, leiernde Strandmusik einschalten. Ich versuche mir zwischen den Knospen der frisch auf dem Gartenmarkt erworbenen Rosen Weihnachtskugeln vorzustellen. Wenn ich die Augen zu schmalen Schlitzen verenge, kann ich mir zumindest einreden, das grelle Licht um mich herum stamme von roten Kerzen auf dem Adventskranz. Oh ja, und dieser Duft nach Zimt, Tannennadeln und – Gyros. Kopfschüttelnd stehe ich auf und hole mir ein Glas Eistee mit Minze. Nein, Weihnachtsstimmung will sich an einem Tag wie diesem einfach nicht einstellen. Gut, Schnee und Eis sind ohnehin illusorisch, aber wenn es in den nächsten Tagen einfach mal kühl, windig und regnerisch werden könnte, würde das nicht nur den Pflanzen guttun, sondern auch mir. Ich muss nämlich ganz dringend weihnachtliche Texte verfassen, und da passt mir der blaue Himmel mit den Schäfchenwolken einfach nicht in den Kram. Vielleicht sollte ich es wie Erich Kästner machen. Der schrieb mitten im Sommer Das fliegende Klassenzimmer, eine Geschichte, die im Winter spielt. Vielleicht sollte ich so wie er damals Schreiburlaub in den Bergen machen, wo ich wenigstens den Blick auf schneebedeckten Gipfeln ruhen lassen könnte.
Kurzurlaub in den Bergen, gebe ich in meinen Browser ein und werde mit Angeboten überschüttet, finde aber nirgends eine Möglichkeit, nach einem Zimmer mit Schneeblick zu suchen. Seeblick geht schon eher, nützt mir aber nichts. Obwohl – so ein schöner tiefblauer Alpensee … Herrliche Bilder auf der Website eines Hotels bringen mich zum Träumen. Rauschende Nadelwälder, satte grüne Wiesen, Wanderungen mit dem Hund zur Alm hinauf …
Das Telefon reißt mich aus meinen Fantasien von einer entspannenden Urlaubswoche. Es ist eine Kollegin, die erkrankt ist und glaubt, mir persönlich erzählen zu müssen, was ich in der Vertretungsstunde in ihrer Klasse morgen alles machen könnte. Mein Traum zerplatzt wie eine vom Baum gefegte Weihnachtskugel: Stimmt ja, ich habe gerade gar keine Ferien in Aussicht, die ich in einem idyllischen Bergdorf verbringen könnte. Und hätte ich welche, müsste ich Weihnachtstexte schreiben.
Es ist nämlich mit diesem Buch so, wie es bei uns in der Familie immer ist:
Habt ihr Lust, das zu machen?, schrieb der Lektor, nachdem er den Plan für dieses Büchlein vor uns ausgebreitet hatte. Und könntet ihr die Texte bis September liefern?
Dieser Art von Mail folgt unweigerlich stets die gleiche Art von Gespräch.
»Hast du die Anfrage vom Lektor bekommen, ob wir so ein Weihnachtsbuch machen wollen?«, fragte Jörg, während wir zuschauten, wie sich der Hund auf der Suche nach etwas Essbarem ins Gebüsch am Rand des Cafés stürzte.
»Ja, ja, habe ich gelesen«, antwortete ich.
Pause.
Jemand schlürfte Tee.
Der Hund bellte.
»Und?«, fragte ich.
Jörg verzog das Gesicht. »Ich habe überhaupt keine Zeit.«
»Ja, ich auch nicht«, stimmte ich schnell zu. »Hab eh schon viel zu viel zu tun – und dann wollen die auch noch, dass ich jeden Tag in die Schule gehe.«
»Und das ist ein Riesenaufwand«, fuhr Jörg fort. »Bis September bin ich die ganze Zeit eingespannt …«
»Du hast zugesagt, oder?«, fragte ich.
»Ja, natürlich. Du doch auch, oder?«
»Was ist mit Heinrich, ist der auch mit an Bord?«
Jörg nickte. »Er sagt, ein paar Geschichten kann er auch beisteuern.«
Der Hund schob sich triumphierend rückwärts aus dem Gebüsch zurück, eine halbe Breze im Maul, die er so unauffällig zu kauen versuchte, dass ich es nicht merkte. Ich hatte aber ohnehin andere Sorgen. »Dann müssen wir das halt irgendwie unterbringen«, seufzte ich. »Mit etwas Disziplin wird das ja wohl zu schaffen sein.«
Daran muss ich denken, als ich an diesem herrlichen Mainachmittag vor meinem Bildschirm sitze und versuche, mich auf Weihnachten einzustimmen, während ein milder Wind Rosenduft zu mir trägt und der Hund seinen Tennisball von der Terrasse wirft und dann so laut bellt, bis ich ihm die Wohnungstür öffne, damit er ihn wieder holen kann. Daran und an Erich Kästner, der auf der Bank vor seinem Alpenhotel sitzt und den Blick auf den schneebedeckten Gipfeln ruhen lässt. Die Idee zu dieser Reise kam übrigens von seiner Mutter, zu der Kästner eine enge Verbindung hatte – was dann doch eine Gemeinsamkeit zwischen uns ist. Ich muss mir nicht lange überlegen, wie das Gespräch mit meiner Mutter abgelaufen wäre.
»Mama, ich muss Weihnachtsgeschichten schreiben und komme einfach zu nichts«, hätte ich gejammert. »Mein Hirn ist leer, meine Datei ist leer. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll.«
»Du musst auch mal eine Pause machen«, hätte meine Mutter gesagt.
»Ich habe ja noch nicht einmal angefangen«, hätte ich erwidert.
»Du machst das schon«, hätte sie gesagt und sich wieder ihrem Buch zugewendet.
Wie es mir mit einer Mutter wie dieser jemals gelungen war, irgendetwas fertigzukriegen, weiß ich nicht. Aber irgendwie haben wir es dann doch immer geschafft, den Prüfungsstoff halbwegs zu beherrschen, die Arbeiten zu schreiben und die Texte rechtzeitig abzugeben. »Habe ich doch gesagt«, erklärte sie dann und fühlte sich einmal mehr bestätigt in ihrem irrationalen, aber grenzenlosen Vertrauen in die Fähigkeiten ihrer Kinder.
Während ich noch in Erinnerungen versunken vor meinem leeren Bildschirm sitze und die Sonne genieße, landet mit einem Ping eine Mail von Jörg in meinem Postfach. Lies das mal, schreibt er.
Ich hasse dich so sehr, schreibe ich zurück. Es ist die dritte Weihnachtsgeschichte, die er mir innerhalb von zwei Wochen schickt, und um das Maß vollzumachen, ist sie auch noch sehr witzig.
»Manchmal dauert es eben etwas länger«, höre ich meine Mutter im Geist sagen. »Mach erst mal eine Pause, danach kannst du bestimmt viel besser arbeiten.«
Der Hund ist mit seinem Tennisball zurück und schaut mich erwartungsvoll an.
»Also gut«, sage ich und schließe den Laptop. »Gehen wir erst mal spazieren.«
Schließlich ist bis September noch eine Menge Zeit. Ich schaffe das schon, das weiß ich aus sicherer Quelle. Meine Mutter würde sich bestimmt darüber freuen, dieses Büchlein zu Weihnachten geschenkt zu bekommen, von uns allen dreien, dazu vielleicht noch eine große Schachtel Marzipan.
»Seht ihr?«, würde sie sagen. »Ich hab doch gesagt, ihr kriegt das hin.«
Und deshalb haben wir das auch getan, Heinrich, Jörg und ich.
Helwig ArenzEine Frage der Größe
Es war ein stressiger Morgen. Meine Freundin Elisabeth werkelte in der Küche und probte eine hektische Symphonie mit klappernden Schubladen, klirrendem Besteck und dem frenetischen Kreischen der elektrischen Kaffeemühle. Den Gesangspart übernahm Benjamin Blümchen, der aus dem Kinderzimmer laut »Törööö!« plärrte.
»Gustav, anziehen!«, erinnerte Elisabeth unseren fünfjährigen Sohn zum wiederholten Male.
Auch für mich waren es aufreibende Minuten. Aber das lag nicht daran, dass ich etwa einen Termin gehabt oder rechtzeitig zur Arbeit gemusst hätte. Nein, ich stand halb nackt mit dem Handy in der Hand im Schlafzimmer und wühlte in der Schublade mit der Unterwäsche meiner Freundin.
»Was machst du da, Papa?«, fragte mich Gustav, der eben auf dem Weg ins Bad durchs Zimmer flitzte.
»Äh, nichts«, antwortete ich und versteckte rasch einen BH hinter meinem Rücken.
In der Küche war es plötzlich ruhig geworden. Verstohlen lugte ich durch die Tür und sah Elisabeth im Esszimmer. Sie schlürfte hastig ihren Kaffee und verbrannte sich leise fluchend die Zunge. Ich nutzte die Gelegenheit, huschte zurück ins Dämmerlicht des Schlafzimmers und griff nach dem Spitzen-BH. Rasch machte ich ein Foto. Ich erschrak, weil ich den Auslöser nicht lautlos gestellt hatte.
Ehe Gustav angezogen und mit geputzten Zähnen aus dem Bad kam, hatte ich meine Kollektion fertig – eine Serie mit Schnappschüssen von Büstenhaltern, Strümpfen, einer Feinstrumpfhose und einem Spitzenslip. Mit dem Slip musste ich ein Stück Richtung Tür ins Licht gehen, damit man auf dem Foto etwas erkannte. Da hörte ich Elisabeths Stimme aus dem Flur, fast direkt neben mir. Ich schlüpfte schnell in eine Hose und stopfte den Slip kurzerhand in die Tasche.
»Ach, da bist du, was machst du denn?«, wollte meine Freundin wissen, während sie gestresst durch den Flur humpelte und nach ihrem zweiten Schuh suchte.
»Hab geguckt, dass Gustav die Zähne richtig putzt.«
»Gar nicht wahr!« Gustav war dazugekommen, ließ sich auf den Hintern plumpsen und angelte nach seinen Schuhen.
Aber Elisabeth beachtete ihn gar nicht. »Kannst du Gustav heute in den Kindergarten fahren?«, bat sie.
»Kein Problem«, erklärte ich mich großzügig einverstanden, während ich mein Hemd zuknöpfte. Das passte wunderbar in meine Pläne, denn ich musste schnell in die Stadt. Es war zwei Tage vor Heiligabend, und ich hatte immer noch kein Weihnachtsgeschenk für meine Freundin.
In der Nürnberger Innenstadt schlich ich um einen Laden herum, wagte aber noch nicht, ihn zu betreten. Es handelte sich um ein kleines, geschmackvoll dekoriertes Dessousgeschäft. Im Schaufenster präsentierten unnatürlich lange Beine ein raffiniertes Paar Strümpfe, das Elisabeth gut stehen würde. Die Plastikbeine hatten zwar keinen Rumpf, aber sie standen trotz dieses Makels selbstbewusst herum – ganz anders als ich.
Ich war nämlich vor wenigen Tagen schon einmal in dem Laden gewesen. Mit beschämendem Ergebnis.
Eine Verkäuferin hatte mir ein paar Modelle gezeigt und mich dann gefragt, welche Größe meine Freundin trage. Das brachte mich in Verlegenheit. Ich hatte nur eine vage Ahnung und stammelte ein paar Zahlen. Die junge Frau wollte mir helfen: »Ist Ihre Freundin größer oder kleiner als ich?«
Ich antwortete: »Größer.«
Sie zeigte mir Sachen in M, aber ich hatte das Gefühl, es passte nicht.
»Können Sie ihre Figur etwas näher beschreiben?«, fragte sie weiter.
Ich betrachtete sie genauer und fuhr – wahrscheinlich, weil sie mit dem Vergleichen angefangen hatte – fort: »Also, sie ist etwas schlanker als Sie, würde ich sagen.«
Die Frau lächelte freundlich und meinte: »Dann könnte es auch S sein.«
»Ja, aber sie hat längere Beine als Sie«, wandte ich ein, als ich die Strümpfe in S in den Händen hielt.
»Mit Strumpfhosen ist das auch nicht so einfach«, gab die Verkäuferin zu. »Wollen Sie nicht vielleicht Dessous kaufen, das kommt immer sehr gut an. Hier dieses Set?«
Sie präsentierte mir sehr elegante Spitzenunterwäsche. Aber wieder hatte ich keine Ahnung, ob sie Elisabeth passen würde.
»Es ist schwierig, wenn man das nur so sieht, ohne dass es jemand anhat«, meinte ich.
Die Verkäuferin lachte und machte mir zuliebe einen Scherz: »Ich kann es nun mal leider nicht für Sie anprobieren.«
»Nein, nein«, winkte ich ab. Die Vorstellung war mir etwas peinlich. Und ich sagte, Gott weiß warum: »Nein, nein, das ginge nicht. Meine Freundin hat ganz andere … Also ihre Oberweite …« Ich stockte.
»Wie ist denn ihre Oberweite?«, fragte die Frau mit geschäftsmäßiger Geduld.
Aber für mein Gehirn war dieses Beratungsgespräch zu viel: »Sie hat ganz andere Brüste. Eher normal groß.«
Die Verkäuferin blickte auf, und das erste Mal, seit ich den Laden betreten hatte, schien sie nicht mehr die anonyme Maske der Professionalität zu tragen.
»Äh, Entschuldigung …«, murmelte ich, was es nicht unbedingt besser machte. Nein, ich hatte das Gefühl, dass ich der Bemerkung, die mir herausgerutscht war, damit eher noch mehr Gewicht gab. Vorher hätte die Frau sie noch übergehen können. Jetzt nicht mehr. Sie zeigte mir kühl ein, zwei weitere Modelle, dann ging sie unter dem Vorwand, ich solle mich doch noch ein wenig umsehen, in einen anderen Teil des Ladens.
Voller Unbehagen und ohne viel wahrzunehmen streifte ich die Regale entlang. Schließlich fand ich doch noch etwas, das zumindest ein annehmbares Geschenk wäre: ein Merino-Shirt, das Elisabeth sicher in M passen würde, aber nur in XXL vorrätig war.
Auf der Suche nach einer anderen Verkäuferin kam ich an einem Aufsteller mit Bademode vorbei, hinter dem ich zwei Frauenstimmen ausmachte. Eine gehörte der jungen Frau von gerade eben: »… kann ich ihm auch nicht helfen, wenn er die Größe nicht weiß.«
Die andere schnaubte: »Soll er halt einen Gutschein kaufen. Oder seine Freundin einfach mitbringen!«
»Ja, falls es sie überhaupt gibt. Nach dem, was er beschrieben hat, hat seine Freundin ungefähr die Maße einer Sexpuppe.«
Als ich das hörte, legte ich das Shirt wieder zurück und ging leise und grußlos aus dem Laden.
Verständlicherweise hatte ich wenig Lust, das Geschäft nun erneut zu betreten, solange Gefahr bestand, der besagten Verkäuferin noch mal gegenübertreten zu müssen. Aber Weihnachten kam unerbittlich näher, und woanders war ich nicht fündig geworden. Ich musste es noch einmal hier versuchen. Deswegen stierte ich möglichst unauffällig an der Reizwäsche vorbei durchs Schaufenster, als ich hinter mir Kinderstimmen vernahm. Eine Grundschulklasse auf irgendeinem Ausflug, die in geordneten Zweierreihen an mir vorüberlief. Als ich hörte, wie eines der Kinder seine Lehrerin fragte: »Warum guckt der Mann die Unterhosen an?«, floh ich in das Geschäft.
»Hallo«, begrüßte mich eine gepflegte ältere Dame. Sie war eine Verkäuferin nach meinem Geschmack. Dezent, nicht aufdringlich und sehr hilfsbereit, außerdem war ich diesmal ja leidlich vorbereitet. Ich zeigte ihr die Fotos von den Etiketten in Elisabeths Wäsche, die ich am Morgen geschossen hatte.
»Das ist von einer Strumpfhose meiner Freundin. Man erkennt die Zahlen nicht gut, aber das ist, glaube ich, eine Drei.«
Ich hatte noch mehr Fotos gemacht, die meisten leider unscharf, das Licht war einfach nicht optimal gewesen. Der Frau war es etwas unangenehm, in das Fotoalbum meines Handys zu gucken, aber ihre Hilfsbereitschaft siegte.
»Das ist von einem Slip ...«, erklärte ich. »Das auch, glaube ich.«
Das Problem war, dass Elisabeth offensichtlich keine einheitliche Größe trug. Alles bewegte sich in einem vagen Bereich zwischen S und M und zwischen 36 und 40.
»Das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich«, klärte mich die freundliche Dame auf. »Ist Ihre Freundin größer oder kleiner als ich?«
Auf dieses Glatteis wollte ich mich auf keinen Fall noch einmal begeben.
»Nein, nein! Gleich groß!«, rief ich abwehrend. »Gleich groß.«
Sie guckte etwas irritiert ob meiner heftigen Reaktion. »Nur ungefähr«, ermunterte sie mich.
»Ich kann Ihnen meine Freundin nicht beschreiben«, sagte ich.
Jetzt wirkte die Frau noch irritierter, aber sie ging darüber hinweg. »Kein Problem«, sagte sie scheinbar gut gelaunt. »Wenn Sie sie mir nicht beschreiben können, dann schicke ich Ihnen eine Kollegin.« Und ehe ich sie aufhalten konnte, drehte sie sich um und ging, wobei sie in den hinteren Teil des Ladens rief: »Anna, kommst du mal, da ist ein Kunde, der lieber von dir beraten werden möchte.«
Anna kam, ehe ich es aus dem Laden schaffte. Es war die Verkäuferin von neulich. Als sie mich erkannte, gefror ihr Blick.
»Nein, nein, das ist ein Missverständnis«, sagte ich, »ich wollte gar nicht von Ihnen beraten werden.«
»Nicht?«
»Nein, Ihre Kollegin hat nicht verstanden, was ich wollte.«
»Das ging mir beim letzten Mal auch so. Aber vielleicht kann ich Ihnen jetzt helfen?«, fragte sie kühl.
Inzwischen hatte ein älteres Paar den Laden betreten. Der Mann, Direktor des musischen Gymnasiums in Fürth, grüßte mich, und ich lächelte angespannt zurück. Wir kannten uns flüchtig, weil ich immer wieder Workshops in seinen Klassen hielt.
»Also?«
»Ja, entschuldigen Sie. Es geht immer noch um diese Strümpfe und die Größe, warten Sie.« Ich holte mein Handy aus der Tasche. »Ich zeige Ihnen ein paar Unterwäschebilder.«
»Nein, ich möchte keine Unterwäschebilder von Ihrer Freundin sehen. Kaufen Sie einen Gutschein!«
Der Schuldirektor und seine Frau guckten schon zu uns herüber. Ich begann zu schwitzen. Irgendwie musste ich die Situation wieder auf eine normale Ebene bringen. Die Verkäuferin sah mich fordernd an.
»Das mit Ihrem Busen neulich tut mir furchtbar leid«, stammelte ich.
Ihre Augen verengten sich zu Schlitzen.
»Entschuldigung, es geht wirklich nur um die richtige Größe dieser Strümpfe für meine Freundin«, rief ich verzweifelt.
Wir hatten die volle Aufmerksamkeit aller, als sie laut entgegnete: »Haben Sie Ihre Freundin heute mitgebracht?« Sie deutete auf meinen Rucksack. »Ist sie dadrin? Wollen Sie sie hinten in der Kabine aufblasen, und wir ziehen ihr die Strümpfe gleich über?«
Ich schwieg. Die anderen im Laden schwiegen auch. In manchen der größeren Theater, in denen ich arbeite, gibt es eine Klappe im Bühnenboden, die sich Versenkung nennt. Es ist eine Art Aufzug. Die Darsteller postieren sich auf einem dezent markierten Quadrat und werden auf ein bestimmtes Zeichen hin abwärts gefahren. Oft kommt dabei auch eine Nebelmaschine zum Einsatz. Diesen Abgang hätte ich mir jetzt gewünscht. Aber ich stand nicht auf der Bühne, das hier war das echte Leben.
Der Schuldirektor und seine Frau waren stirnrunzelnd näher zur Kasse gekommen. Der Schweiß lief mir in Bächen von der Stirn.
»Lassen Sie mich das erklären«, sagte ich zur jungen Verkäuferin, aber ich wollte auch, dass die anderen es mitbekamen. Also drehte ich mich halb um. »Das Ganze ist ein Missverständnis«, begann ich so ungezwungen wie möglich, musste mich dabei aber an den Tresen lehnen. Ich zog mein Taschentuch aus der Hosentasche und tupfte mir damit die Stirn ab.
Die Verkäuferin starrte mich entgeistert an, ehe sie sich abwandte und ging. Die Frau des Schuldirektors zischte: »Das ist ja widerlich.« Er selbst zwinkerte mir zu und lachte: »Ach, lassen Sie stecken.«
Verwirrt ließ ich die Arme sinken, und da sah ich, dass das feuchte Taschentuch in meiner Hand in Wahrheit Elisabeths schwarzer Spitzenslip war.
Heiligabend kam und ging. Mein Bruder Heinrich schenkte mir eine Uhr, die irgendwie bei meiner Schwester am Handgelenk landete. Das Buch, das Katharina mir überreichte, wollte sie eines Tages zurückgeliehen haben. Für meine Freundin lag eine Fahrradtasche unter dem Christbaum, in der ich täglich meine Sachen zur Arbeit transportiere. Und ich bekam eine Teekanne, die Elisabeth so schön fand, dass sie sie jetzt immer benutzt.
Viele Geschenke machen wir letztlich doch nur uns selbst. Ich bin froh, dass ich keine Reizwäsche gekauft habe. Sie steht mir einfach nicht.
Sigrun ArenzWeihnachtsgrüße per Eulenpost
Johann Wolfgang von Goethe schrieb im Lauf seines Lebens eine schier unvorstellbare Anzahl Briefe an Freunde, Verwandte und andere Literaten. Um die vierzehntausend sollen es gewesen sein; möglich war ihm das, weil er als hoher Staatsbeamter kein Porto zahlen musste und sich so diese umfangreiche Korrespondenz leisten konnte, ohne zu verarmen.
Im Deutschlehrplan der fünften Klassen steht heute noch das Verfassen von persönlichen Briefen als ein »Kompetenzziel«, und um dem Ganzen im Zeitalter von Instant Messages wenigstens einen Hauch von Realitätsbezug zu verleihen, denken sich wackere Deutschlehrer Projekte aus, bei denen Schüler aus dem Schullandheim an ihre Eltern schreiben – mit Briefumschlag, Adresse, Porto und so weiter – oder eigenhändig gestaltete Weihnachtskarten an Menschen in Seniorenheimen verfassen müssen, die sich oft rührend über die (nicht nur im Bereich der Rechtschreibung) kreativen Grüße freuen. Womöglich bleibt das der einzige echte Brief, den die Kinder in ihrem Leben zu Papier bringen.
Beim Aufräumen stieß ich am ersten Adventswochenende auf einen alten Standordner, der seit Ewigkeiten unbeachtet im Regal gestanden hatte. Ich hockte mich mit gekreuzten Beinen auf den Teppich, neben mir ein Becher mit Tee, der schnell kalt wurde, und erforschte den Inhalt des Ordners. Es wurde eine Reise in eine Vergangenheit, die vielleicht nicht ganz so weit zurücklag wie Goethes Briefwechsel, sich aber doch anfühlte wie eine andere Welt. Zwischen einer Seminararbeit aus der Uni und den noch auf einer Schreibmaschine getippten Seiten eines nie vollendeten Romans befand sich ein Stapel alter, handgeschriebener Briefe aus Studienzeiten. Einige stammten von meiner Familie – sie hatten sie mir während meines Auslandsjahrs in Schottland geschrieben. Die meisten kamen von Freunden aus Großbritannien, mit denen ich nach meiner Rückkehr mehrere Jahre lang einen regen Briefwechsel geführt hatte, um in Kontakt zu bleiben. Wann, wunderte ich mich jetzt, hatten wir die Zeit gefunden, unsere Erlebnisse und Gedanken in dieser Ausführlichkeit niederzuschreiben? Hatten wir vielleicht nichts anderes zu tun gehabt? Die Existenz der Seminararbeit und der Romananfang sprachen dagegen. Die Inhalte der Briefe deuteten ebenfalls darauf hin, dass wir durchaus beschäftigt gewesen waren – nur eben nicht zu beschäftigt, um unseren Freunden zu schreiben. Allein die Adressen auf den Umschlägen weckten Erinnerungen an Jahre, in denen wir alle ziemlich herumgekommen waren, denn die Briefe meiner verschiedenen Kommilitonen aus der Zeit waren in Japan, Island oder Indien aufgegeben worden. Meine Freundin Hermione hatte nacheinander an den drei wichtigsten Universitäten des Vereinigten Königreichs studiert und nebenbei noch ein Auslandsjahr in Freiburg absolviert. Und von überall hatte ich Weihnachtskarten, Geburtstagsgrüße und Briefe erhalten (und selbst welche verschickt), die neben dem neuesten Klatsch auch Literaturkritik, theologische Überlegungen, Backrezepte und Plotentwürfe für den nächsten großen Roman enthielten. Ein paar Jahre lang hatten unsere Briefkästen ein aufregendes Leben geführt. Und dann waren wir alle irgendwann richtig erwachsen geworden, E-Mails hatten die Briefe, Facebook-Posts die E-Mails ersetzt, und heute hatten wir alle nur noch »Kontakte« in unseren Smartphones statt Freunde im Adressbuch stehen. Goethe würde sich im Grabe umdrehen! Seufzend packte ich die Briefe wieder zurück und beschloss, wenigstens die eine gute britische Tradition, die ich von meinem Auslandsjahr mitgebracht und seither gepflegt hatte, weiterzuführen.
»Was machst du da?«, wollte meine Nichte Viola wissen, als sie von der Arbeit heimkam. Statt des versprochenen Abendessens stand ein Karton mit Briefumschlägen und Weihnachtskarten auf dem Esszimmertisch.
»Wonach sieht es denn aus?«, fragte ich lautstark zurück, um den Chorus von Bachs Weihnachtsoratorium zu übertönen. »Ich schreibe Weihnachtspost.«
Sie blickte gleichmütig auf das Chaos. »Dein Adressbuch fängt gleich an zu brennen«, bemerkte sie mit einem Blick auf die Kerzen des Adventskranzes. »Gehört das zu deinem komischen Ritual dazu? Wirst du das Feuer mit Tee löschen?«
Ich war daran gescheitert, Viola die Liebe zum geschriebenen Wort zu vermitteln, aber leider hatte sie die Lektion über Sarkasmus etwas zu gut verinnerlicht.
»Schreiben ist eine uralte Kulturtechnik«, entgegnete ich würdevoll. »Du solltest es mal versuchen.« Ich sagte nichts über die Erinnerungen, die ich mit dem »komischen Ritual« verband, über die Umschläge, die seit meinem Aufenthalt in St. Andrews alle Jahre wieder peu à peu in meinem Briefkasten landeten. Grüße von Freunden, die ich selten sah, die sich aber zumindest in der Adventszeit meldeten. In einer Schuhschachtel bewahrte ich die meisten dieser Karten auf, und die aktuellen hingen stets bis zum 6. Januar in meiner Wohnung. »Außerdem«, fügte ich stattdessen hinzu, »versetzt mich das Schreiben immer in einen Zustand der inneren Ruhe und Gelassenheit.«
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen, intonierte das Münchener Bach-Orchester wie bestellt.
»Verdammte Deutsche Post!«, fluchte ich zwei Tage später so vehement, dass mir der Glühwein aus dem Becher schwappte. »Verdammter Brexit! Vollidioten überall!«
Von den Lautsprechern der Glühweinpyramide schallte Skandal im Sperrbezirk zu uns her, worüber ich mich lautstark aufgeregt hätte, wäre ich nicht gerade dabei gewesen, mich lautstark über die Ereignisse beim Aufgeben meiner Weihnachtspost aufzuregen.
»Erst stand ich in der Post eine halbe Stunde lang an, weil siebenhundert Leute irgendwelche Rücksendungen abgeben mussten. Kauft ja heutzutage keiner mehr im örtlichen Einzelhandel ein«, ereiferte ich mich. »Und als ich dann endlich dran war, fängt die Frau am Schalter an: ›Die Karte kostet mehr, weil die ist quadratisch.‹ – völlig dämliche Regel, finde ich, in England ist das Format vollkommen egal! ›Und diese hier kostet auch mehr, die ist nämlich zwei Millimeter zu lang. Und die auch, weil der Umschlag nicht weiß ist.‹ Wer zum Teufel denkt sich so was aus? Und dann, am Ende, nimmt sie den letzten Umschlag, steckt ihn ganz langsam durch diesen Prüfschlitz und grinst mich hämisch an. ›Und der Brief, der kostet auch mehr.‹ – ›Warum denn jetzt das?‹, frage ich mühsam beherrscht zurück. ›Der ist ja nun wohl wirklich nicht zu groß.‹ – ›Stimmt‹, sagt sie. ›Der entspricht nicht der Norm. Der Umschlag ist zu klein. Das macht dann alles zusammen vierunddreißig Euro zehn.‹ Der Blitz soll sie alle treffen. Es gibt einen speziellen Höllenkreis für Leute, die sich solche Tarife ausdenken!«
Wir hatten uns mehr oder weniger zufällig auf dem Mittelaltermarkt getroffen – Heinrich und Jörg, mein Neffe Theo, Viola und ich –, und meine Familie reagierte mit der Empathie und Feinfühligkeit, für die ich sie liebe.
»Warum schreibst du keine WhatsApps wie jeder normale Mensch?«, fragte Viola. »Selbst schuld, wenn du lebst wie im neunzehnten Jahrhundert.«
»Mir, Schwester, beschert die Post wirkliche Probleme«, erklärte Heinrich mit Nachdruck. »Neulich habe ich wieder einen Brief von einer verrückten Stalkerin bekommen, die auf einer meiner Lesungen war und jetzt der Meinung ist, die drei Sätze, die wir miteinander gewechselt haben, wären Zeichen für ein tiefes spirituelles Band zwischen uns.«
»Du bist Oberstudienrätin«, grummelte Jörg, der momentan wieder einmal ohne Theaterengagement und deshalb gestresst und schlecht gelaunt war. »Da wirst du dir das verdammte Porto ja wohl leisten können. Wer kauft mir noch einen Met? Aber nur den guten mit den echten Gewürzen.«
Theo zog eine Augenbraue hoch. »Tja, geliebte Tante. Arenz verpflichtet. Irgendwer muss schließlich angemessene Standards aufrechterhalten.«
An der Pyramide spielten sie jetzt das berühmte Weihnachtslied Layla. Irgendwo tief in meinem Gedächtnis glaubte ich, meinen Lateinlehrer aus der elften Klasse »Quod erat demonstrandum« sagen zu hören, aber das tröstete mich nur bedingt über den Mangel an Sympathiebekundungen seitens der Familie hinweg.
»Frohe Weihnachten!«, tönte es von allen Seiten, als ich am ersten Feiertag bei Heinrich ins Wohnzimmer trat. Der Stapel bunt verpackter Geschenke unter dem Christbaum weckte nostalgische Erinnerungen an alle Weihnachtsfeste meines Lebens. Das Chaos und das Stimmengewirr im Raum ebenfalls.
Viola drückte mir ein unförmiges Päckchen und ein Glas in die Hand. Das Glas enthielt Gin und Tonic, das Päckchen eine weiße Stoffeule mit Hogwarts-Schal um den Hals und einem Brief in den Klauen. Ich nippte am Gin Tonic und bedankte mich artig, auch wenn ich den Verdacht hegte, dass es sich bei der Eule um dasselbe Exemplar handelte, das ich meiner Schwester vor zwei Jahren von einem London-Besuch mitgebracht hatte.
Im Laufe des Abends wurde mir klar, dass die Familie sich in seltener Einigkeit auf einen roten Faden für meine Geschenke geeinigt hatte. Offensichtlich hatte sie meine Tirade auf dem Weihnachtsmarkt auf eine Idee gebracht.
»Für eine stilvolle Korrespondenz«, lächelte Theo und reichte mir ein flaches Etui aus Holz, das eine Schreibfeder, ein Tintenfass und ein Siegel enthielt.
Jörg hatte selbst geschöpftes Briefpapier mit Monogramm von der Papieroffizin in Fürth für mich, meine Schwester ein neues Adressbuch, und Heinrich überreichte mir ein rechteckiges Paket, das in ein Geschenkpapier mit Schriftrollenmuster eingeschlagen war. Ich vermutete zu Recht ein Buch, war dann aber doch überrascht, als ich Berühmte Briefromane von Goethe bis Glattauer auf dem Cover las.
Später am Abend erhielt ich eine WhatsApp-Nachricht von meiner Freundin Hermione aus Schottland. Frohe Weihnachten, schrieb sie.