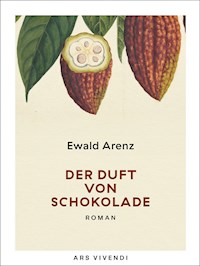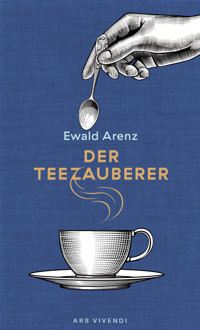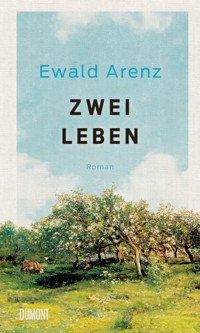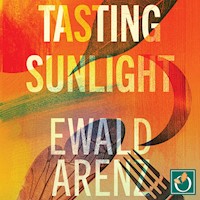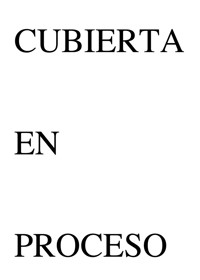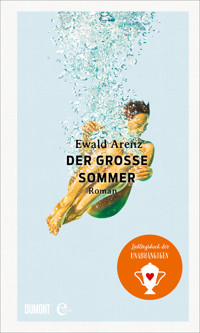
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Zeichen auf einen entspannten Sommer stehen schlecht für Frieder: Nachprüfungen in Mathe und Latein. Damit fällt der Familienurlaub für ihn aus. Ausgerechnet beim gestrengen Großvater muss er lernen. Doch zum Glück gibt es Alma, Johann – und Beate, das Mädchen im flaschengrünen Badeanzug. In diesen Wochen erlebt Frieder alles: Freundschaft und Angst, Respekt und Vertrauen, Liebe und Tod. Ein großer Sommer, der sein ganzes Leben prägen wird. Hellsichtig, klug und stets beglückend erzählt Ewald Arenz von den Momenten, die uns für immer verändern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Als erwachsener Mann läuft Frieder über einen Friedhof. Während er nach einem bestimmten Grab sucht, erinnert er den Sommer, der ihn für immer geprägt hat.
Die Aussicht, sich bei seinem unnahbaren Großvater auf die Nachprüfungen vorbereiten zu müssen, findet Frieder niederschmetternd. Doch dann kommt alles anders als erwartet: Er verbringt die Wochen nicht eingesperrt in einer Lernstube. Vielmehr erlebt Frieder mit Beate die erste große Liebe, mit all den aufregenden und verunsichernden Momenten, die dazugehören. Er erfährt von der komplizierten und dennoch beglückenden Liebe seiner Großeltern. Er genießt unbeschwerte Tage im Schwimmbad, die tiefe Verbundenheit mit seiner Schwester Alma und seinem besten Freund Johann. Zugleich gerät er in Situationen, in denen er lernt, was es heißt, wahrhaftig ein Freund zu sein – und das nicht zuletzt durch den Großvater. Frieder ahnt, dass es ein Sommer ist, wie es vermutlich keinen zweiten mehr für ihn geben wird.
© lowarig
Ewald Arenz, 1965 in Nürnberg geboren, hat englische und amerikanische Literatur und Geschichte studiert. Er arbeitet als Lehrer an einem Gymnasium in Nürnberg. Seine Romane und Theaterstücke sind mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden. Mit seinem Roman ›Alte Sorten‹ (Dumont 2019) stand er auf der Liste »Lieblingsbuch der Unabhängigen« 2019 und sowohl als Hardcover wie als Taschenbuch auf den Spiegel-Bestsellerlisten. Der Autor lebt mit seiner Familie in der Nähe von Fürth.
Ewald Arenz
Der große Sommer
Roman
Von Ewald Arenz ist bei DuMont außerdem erschienen:
Alte Sorten
eBook 2021
© 2021 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Coverabbildung: © Eric Zener
Satz: Angelika Kudella, Köln
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-8321-7077-6
www.dumont-buchverlag.de
1
Wenn es tatsächlich einer von uns vieren nach Rio de Janeiro schaffen sollte, dann war das Johann. Das war irgendwie von Anfang an klar. Johann hatte alles, was man dazu brauchte und außerdem war er der Musiker von uns. Wenn es einer schaffte, dann Johann.
Ich saß neben ihm, damals. Durch die offenen Fenster des Klassenzimmers klang verweht die Glocke vom Friedhof herüber. Über der Linie der Hochhäuser jenseits der Flusswiesen stand ein Flugzeug in der dunstigen Ferne. Das Sri Sri der Mauersegler schnitt das Licht dieses Sommertags in hellgelbe, aufregend saure Zitronenscheiben und ich dachte, man müsste draußen sein und nicht hier drin neben dem Fenster sitzen. Draußen, jenseits des Flusses sein, und dann würde man nach Norden gehen, wo das Meer lag und man sich nach Südamerika einschiffen konnte.
Halb zehn morgens war die schlimmste Zeit. Die ersten beiden Stunden waren gerade vorbei, aber man hatte noch mindestens vier vor sich.
Johann kritzelte sein Heft mit Nullen voll. Das hatte er von Anfang an in Latein gemacht.
»Komm, wir schreiben die längste Zahl der Welt.«
Es war eine unglaublich schwachsinnige Angelegenheit, aber auch irgendwie cool. Jeder von uns schrieb immer zehn Zeilen voll. Immer drei Nullen, kleiner Abstand, wieder drei Nullen. Für unsere Zahl gab es längst keinen Namen mehr. Sie hatte Tausende von Nullen und war fast ein ganzes Schuljahr lang. Manchmal reichten wir das Heft in den Pausen herum und die anderen fanden uns krass, weil sie nicht wussten, ob das gut oder bescheuert war.
Johann stieß mich an und machte eine Kopfbewegung zum Fenster hin. Er hatte die Glocke jetzt erst wahrgenommen. Am Anfang hatte er gar nicht gewusst, dass es eine Totenglocke war, ich hatte es ihm erst erklärt.
»Klingt trotzdem nach Freiheit«, hatte er gesagt.
Ich fand, das stimmte.
Zippos Stimme lag wie ein dunkler Teppich im Klassenzimmer. Ich mochte Zippo und seine Stimme. Ein beruhigender, melancholischer Bass. Eine Stimme, die einen einschläfern konnte, wenn man nicht gerade darauf wartete, die entscheidende Schulaufgabe zurückzubekommen.
»Warum macht er das?«, fragte ich Johann leise. »Warum gibt er das Ding nicht einfach raus? Er ist doch kein Arschloch.«
Johann hob uninteressiert die Schultern.
»Keine Ahnung. Ist vielleicht ein Gesetz oder so. Vielleicht steht in der Schulordnung, dass Schulaufgaben erst besprochen und dann rausgegeben werden.«
Zippo besprach die Fehler. Jeden einzelnen mit richtiger Lösung auf dem Overhead. Dann schrieb er den Fehlersprung an die Tafel. Als er die Noten hinzufügte, zuckte es mir das erste Mal im Magen: einmal sehr gut, viermal gut, sechzehnmal befriedigend, sechsmal ausreichend, zweimal mangelhaft, zweimal ungenügend. Vier von einunddreißig. Ich wusste, wer einer von den letzten vieren war. Johann jedenfalls nicht.
Zippo hieß eigentlich Zigankenberg, aber so nannte ihn nie jemand. Dabei war »Zippo« ein viel zu kurzer Name für diesen Mann. Zwei Meter groß, bestimmt hundert Kilo schwer. Der hätte Boxer werden sollen oder Ringer. Jedenfalls nicht Lateinlehrer.
Johann ließ sich auch nicht Jo nennen.
»Johann. Nicht Jo oder Joe oder so. Johann.«
Das hatte er in der Pause zu Dlouha gesagt, der irgendwann in den ersten Wochen mit »Joe« angekommen war. Er musste es nur einmal sagen. Er hatte manchmal so einen Ernst an sich, der jeden einschüchterte. Ab da nannten ihn alle Johann.
»Ich habe sicher eine Sechs.«
Es war eine Art Beschwörung. Man sagte das Schlimmste und hoffte, dass es dadurch abgewendet würde, dass man auf magische Weise eine Fünf oder sogar eine Vier hätte. Konnte ja sein.
»Quatsch«, sagte Johann.
»Als ob du’s wirklich glauben würdest«, sagte ich. Wieder eine Beschwörung.
Ich sah nach draußen. Die Mauersegler. Das Morgenlicht in den langen Blättern der Weiden am Fluss. Das Blau Blau Blau. Warum hörte die Schönheit der Welt am Fensterbrett auf? Dort draußen war alles. Hier drin war gar nichts.
»Albert.«
Endlich! Zippo gab die Arbeiten zurück. Alphabetisch. Ordnung musste sein. Immerhin hatte er sie nicht nach Noten sortiert. Das hassten alle. Außer den Strebern natürlich.
»Bergmann.«
In der Klasse wurde es laut. War klar. Ey, was hast du? Ich hab ’ne Drei. Boah, ich hab schon gedacht … War gar nicht so schwer, oder? Ich fand schon …
Ich sagte gar nichts mehr und sah aus dem Fenster. Manchmal konnte man das Wasser riechen. Es roch nicht so salzig wie am Meer, aber immerhin.
»Büchner.«
Das war ich. Zippo kam durch den Raum zu uns nach hinten. Sein Gesichtsausdruck war nicht zu deuten. Er reichte mir den Bogen.
»Tut mir leid, Büchner«, sagte er, »ich verstehe das nicht. Deine Übersetzung liest sich sehr elegant. Hat aber leider nichts mit dem lateinischen Ausgangstext zu tun.«
Wenn das witzig sein sollte – das war’s nicht. Sechs. Mit einer Fünf hätte es vielleicht irgendwie noch geklappt, aber mit einer Sechs … Ich war nicht gut in Mathe, aber den Schnitt konnte ich gerade noch ausrechnen. Mathe: Fünf. Latein: Fünf. So viel dazu.
»Passt schon«, sagte ich gleichmütig.
Johann lehnte sich zu mir hin. Seine Schulter berührte meine.
»Sorry.«
»Nee, passt schon. Ich hab’s ja gesagt.«
Ich faltete die Schulaufgabe sorgsam und genau zu einem Flieger. Sogar mit Heckklappen. Die Nase knickte ich um eine Kleinigkeit nach vorne. Das num von numquam hatte auf einmal etwas Witziges. Ich musste lachen, obwohl mir gar nicht danach war.
»Tja«, sagte ich, »durchgefallen.«
Ich kippte den Stuhl nach hinten, bis die Lehne die Wand berührte. Den Flieger drehte ich in der Hand.
»Du kannst doch die Nachprüfung machen.«
Ich zuckte die Schultern.
»Glaubst du, ich kann drei Jahre Latein in sechs Wochen nachlernen? In Mathe gehe ich sowieso unter. Und mit ›unter‹ meine ich ›unter‹. Tausend Meter unter der Oberfläche. Marianengraben.«
Johann musste lachen.
»Ich kann dir helfen.«
»Na klar. Du weißt genau, was dann auf keinen Fall passiert. Lernen nämlich.«
Zippo kam wieder zu uns.
»Lohmann.«
Er reichte Johann die Schulaufgabe und nickte kurz. Johann nahm sie und warf einen schnellen Blick auf die Note. Drei minus. Es war ihm fast ein bisschen peinlich; er legte sie mit dem Kopf nach unten auf den Tisch. Ich sah Zippo an, der den Flieger in meiner Hand erst jetzt bemerkte. Ich kippte nicht mal den Stuhl zurück in die Aufrechte, als ich ihn aus dem Fenster schickte. Mit einer ganz leichten Handbewegung. Er schwebte in einer perfekten Spirale durch die Weiden, streifte einen Zweig, trudelte, richtete sich noch einmal aus und landete im Wasser. Tschüs.
Zippo sah mich an und ich holte tief Luft, aber dann sagte er lediglich: »Als ob du nicht genug Probleme hättest, Büchner.«
Er drehte sich um und ging nach vorne zum Pult. Zwei Meter und hundert Kilo Latein. Ich konnte mir nicht helfen, der Mann hatte recht.
2
Es ist ein stiller Nachmittag. Ich suche das Grab, wie schon so oft. Die Oktobersonne scheint als glutroter, verschwommener Fleck durch den Frühnebel. Es ist kalt. Die Kastanien am Wegrand haben sich noch gar nicht ganz verfärbt, aber der Ahorn beginnt, bunt zu werden. Die Essigsträucher an der Friedhofsmauer leuchten schon so rot, als würden sie auf Schnee warten.
Man sollte doch meinen, dass ein Friedhof immer gleich aussieht. Da geschieht schließlich kaum etwas. Es kommen ein paar Grabsteine hinzu. Vielleicht wird mal ein Weg neu angelegt. Aber so ist es nicht. Oder ich vergesse einfach immer wieder, wo das Grab liegt. Ich komme ja nicht jedes Jahr. Aber oft genug, denke ich. Nur das Grab finde ich nie auf Anhieb. Vielleicht sollte ich diesmal die Nummer fotografieren. Oder im Handy den Standort für das nächste Mal markieren. Andererseits – wozu? Wenn ich keine Zeit habe zu suchen, brauche ich auch nicht hinzugehen.
Der Friedhof ist menschenleer, aber die Eichhörnchen sind überall. Wahrscheinlich gibt es für sie in der Stadt keinen besseren Ort als diesen hier. Keine Autos, keine Leute. Ein ganzer lichter Wald nur für sie allein. Ein Paradies. Ob Eichhörnchen trauern können? Sie sehen nicht so aus.
Und ich? Ich weiß nicht, ob es Trauer ist oder ein anderes Gefühl, das mich ab und zu hierhertreibt. Oft im Herbst, das stimmt schon. Aber ist es Trauer? Manchmal weiß ich nicht, was mir wirklich verloren gegangen ist, worum ich wirklich trauere, wenn ich das Grab suche. Vielleicht ist es dieses eine Jahr, das wir damals hatten. Nein. Es war nicht einmal ein Jahr. Es war dieser eine Sommer, wie es ihn wahrscheinlich nur einmal im Leben gibt. Dieser eine Sommer, den hoffentlich jeder hat; dieser eine Sommer, in dem sich alles ändert. Ja. Vielleicht ist es nicht Trauer allein, sondern vor allem eine Sehnsucht nach diesem Sommer – nach diesem unwiederbringlichen, zitternd schönen Zauber der ersten Male.
Freibad. Zum Glück waren meine Eltern nicht so unentspannt wie Johanns. Und vielleicht hatte sogar mein Vater, der sich wirklich nicht für die Schulkarrieren seiner Kinder interessierte, irgendwann gemerkt, dass ich das Jahr nicht reißen würde.
»Wir überlegen uns was«, hatte er gesagt. Was komplett ungefährlich war. Mein Vater überlegte sich immer was, aber ganz sicher niemals was zu praktischen Dingen. Ich meine, er bekam von meiner Mutter Taschengeld! Wenn er sich was überlegte, dann bedeutete das gar nichts. Wenn Mama sich was überlegen sollte, dann hätte ich ein Problem. Bis jetzt war jedoch noch nichts passiert.
Ich ging manchmal gern ins Freibad, wenn es regnete. Man hatte alles für sich. Das ganze Bad. Der Bademeister ließ einen sogar mit Flossen ins Fünfzigmeterbecken oder machte einem den Sprungturm auf und war überhaupt so entspannt wie sonst nie. Danach grüßte er mich sogar manchmal an den überfüllten Sonnentagen. Ich fand es toll, bei Regen im Bad zu sein, weil das so gut wie keiner machte. Es nieselte gleichmäßig, aber es war nicht kalt. Von den Pappeln, die überall auf den weiten Wiesen standen, tropfte es gleichmäßig. Es roch nach Gras und es war still. Kein Wind. Es war eine ganz besondere Atmosphäre. Ein bisschen so, als wäre man in einer anderen Stadt. Oder eher noch, als hätte so ein öffentlicher Ort auf einmal etwas Geheimes an sich, als könnte er von den anderen Leuten nicht mehr gefunden werden.
Ich lief barfuß über das regennasse Gras zum Sprungbecken. Nebenan im Fünfzigmeterbecken schwammen ein paar Alte ihre Bahnen. Störte keinen. Diese stille, hellgraue Regenluft ließ alle friedlich sein. Ich erkannte ein paar Gesichter. Wahrscheinlich waren die jeden Tag da. Was das dann für ein Leben war? Jeden Tag ins Schwimmbad. Jeden Tag zwanzig Bahnen schwimmen. Jeden Tag wieder nach Hause gehen. Scheiße. Wurde man später so?
Ich legte mein Handtuch an den Fuß des Sprungturms, nickte dem Bademeister zu und stieg hoch. Siebeneinhalb heute. Das war eine Art Wette mit mir selbst. In diesem Sommer wollte ich es bis zum Sprung vom Zehner schaffen. Komischerweise war mir der Dreier am schwersten gefallen. Ich war immer wieder umgekehrt, bis ich irgendwann beim Umdrehen so blöd vom Brett gefallen war, dass ich mit dem Gesicht aufs Wasser geknallt war und einen Tag lang eine rote Stirn hatte. Danach ging es auf einmal. Das war bei mir manchmal so. Ich hatte immer Angst vor großen Hunden gehabt, bis mich beim Zeitungsaustragen einer biss. Von da an war die Angst weg. Vielleicht, weil etwas, wenn es Wirklichkeit wurde, nie so schlimm war, wie man es sich vorgestellt hatte. Ich konnte mir einfach alles vorstellen, und manchmal war das genau das Problem.
Mein erster Sprung vom Fünfer war so glatt gegangen, dass ich von da an immer wieder gesprungen war. Kein Problem. Und jetzt stieg ich zum ersten Mal auf den Siebeneinhalber. Die Stufen der Leiter waren rau, nass und kühl. Ich fröstelte ein bisschen, ging ein Stück vor und stand dort, wo das Geländer aufhörte. Ein Meter vorm Rand. Es war hoch. Es war scheißhoch. Eigentlich hatte ich einen Rückwärtssalto springen wollen. Rückwärtssalto sah geil aus, aber er war der allereinfachste Sprung. Man musste eigentlich gar nichts machen, außer sich trauen. Aber hier … Ich sah nach unten. Wow. Das war ungefähr der dritte Stock. Und es war wie zu Anfang auf dem Dreier: Es ging nicht. Ich konnte mich nicht mal an den Rand stellen. Und rückwärts schon gar nicht. Ich sah zum Bademeister hinüber, ob er mich beobachtete, aber der saß unter seinem Riesenschirm und las Zeitung.
Vielleicht einfach gerade runterspringen?
»Hey, traust du dich nicht?«
Ich fuhr total zusammen, so erschrocken war ich. Man rechnet ja nicht damit, dass da mitten im Regen noch jemand auf den Sprungturm klettert und hinter einem steht. Ich drehte mich um. Ich hatte sie nicht mal kommen gehört. Sie war ungefähr so alt wie ich. Flaschengrüner Badeanzug. Dunkle Haare. Und hübsch. Extrem hübsch.
»Doch, klar.«
Idiot. Idiot. Idiot. Warum sagte ich das?
»Wenn du Angst hast, springen wir zusammen.«
»Bist du schon mal von hier oben gesprungen?«
Ich hatte tatsächlich Angst, aber jetzt mehr, dass sie sich womöglich elegant vom Turm werfen würde, Kopfsprung oder Schraube oder so, und ich immer noch da oben stünde wie … wie irgendwas.
Sie schüttelte den Kopf.
»Nee. Ich hab dich stehen sehen und gewartet. Ich wollte sehen, ob es geht. Aber du bist nicht gesprungen.«
Da war ein Lächeln in der Stimme. Ich konnte nicht sagen, ob es spöttisch war.
»Wir können schon zusammen springen.«
Ich hatte es zu zögernd gesagt. Bestimmt klang ich wie ein Feigling.
»Also«, sagte sie aber nur und trat an den Rand. Okay. Jetzt musste ich auch.
»Eins«, zählte ich.
»Es ist schon hoch«, sagte sie.
Sie sah zu mir herüber. Ich musste lachen. Wir hatten einfach beide eine Scheißangst.
»Okay. Wir springen vom Fünfer.«
Sie lachte jetzt auch. Erleichterung durchströmte mich genauso schnell wie vorher die Angst. Wir drehten uns um und gingen zur Leiter. Dann blieb sie abrupt stehen.
»Okay. Das geht nicht«, sagte sie, »das geht überhaupt nicht. Komm!«
Sie drehte sich wieder um, rannte los und sprang. Scheiße, dachte ich und rannte auch, fiel unkontrolliert durch die leere Luft und knallte mit der Seite so aufs Wasser, dass mir der Atem wegblieb. Ich tauchte tief unter, tiefer, als ich es gut fand, strampelte mich hoch und schnaubte Wasser aus der Nase, als ich oben war. Neben mir schoss sie ebenfalls hoch und schleuderte mit einer Kopfbewegung ihr Haar hinter sich.
»Ich hab mir die Beine geprellt«, lachte sie.
»Ich die Seite«, sagte ich atemlos. »Friedrich. Ich heiße Friedrich.«
»Beate. Cooler Name, den du hast. Aber alt, oder?«
Wir schwammen zum Beckenrand. Der Regen malte tausend Kringel aufs Wasser. Die Stille im Bad schmiegte sich um uns wie ein glattes, durchsichtiges Tuch. Die zusammengeklappten Sonnenschirme auf der Terrasse am Kiosk standen in Reih und Glied schmal und rot im Regengrau wie vergessene, nachdenkliche Soldaten. Der geschlossene Kiosk sah aus, als schliefe er. Für einen Augenblick gehörte das tatsächlich alles uns.
»Ich hab seltsame Eltern«, erklärte ich, als wir aus dem Becken stiegen.
»Aha«, sagte sie.
Sie hatte grüne Augen.
3
Nach Hause zu kommen war manchmal, als wechselte man abrupt von der einen in die andere Welt. Wenn ich die Tür öffnete, war da fast immer ein Grundlärm. Manchmal fröhlich, manchmal wütend. Einer der Hunde bellte oder eine meiner Schwestern spielte Flöte oder Alma hämmerte in der Ecke im Flur, wo sie sich in einem alten Schrank eine Miniwerkstatt eingerichtet hatte. Unsere Wohnung war zu klein. Sechs Kinder. Zwei Hunde. Und zwei Katzen. Als ob meine Eltern die Enge in der Wohnung bewusst großzügig ignorierten. Es war wunderbar, wenn man in dem Moment Teil eines bunten, lauten Ganzen sein wollte. Es war furchtbar, wenn man gerade ein einzelner Mensch sein wollte.
Man wurde sofort hineingesogen. Innen war ich noch im stillen Freibad. Im Regen. Neben einem Mädchen im flaschengrünen Badeanzug. Ich musste schnell innen eine Tür schließen, so wie zu einer Kirche. Lärm gehörte nicht in eine Kirche. Mein kleiner Bruder Kolja kam und nahm mich bei der Hand: Mensch ärgere Dich nicht spielen. Von innen, aus der Kirche, siehst du dir zu, wie du die Kleinen zum Lachen bringst. Wie du sie tröstest, wenn sie schon wieder kurz vor dem Ziel aus dem Feld geschlagen werden. Ob sie Geschwister hatte?
»Du hast verloren!«
Triumphierend. Für Kolja fühlte es sich wie ein echter Sieg an. Der Stolz war echt und die Freude auch. Er wusste nicht, dass ich ihn hatte gewinnen lassen. Glücklich betrogen. Aber es war trotzdem ein Betrug, oder? Ich ging in mein Zimmer.
Ich hatte keine Anlage wie Johann. Ich hatte einen Plattenspieler aus orangefarbenem Plastik mit einer lausigen Box, den meine Mutter mir mal zum Geburtstag geschenkt hatte. Immerhin. Es reichte, um nachts Musik zu hören, für eine Party war niemals genug Druck dahinter. Johann hatte einen Verstärker und irgendwelche Speziallautsprecher. Sein Plattenspieler war schwer und aus silbergrauem Metall und sah richtig teuer aus. Ich dagegen hatte außerdem noch einen Kassettenrekorder, und wenn ich eine Kassette aufnehmen wollte, musste ich den Rekorder auf mein Bett stellen, weil das Überspielkabel nicht lang genug war.
Ich stellte den Plattenspieler an und warf mich aufs Bett. Ich hatte das Zimmer noch nicht lang für mich allein. Das Bett war so aufgestellt, dass ich aus dem Fenster sehen konnte. Draußen stand eine Robinie. Irgendwann hatte ich das in einem der tausend Bücher meines Vaters nachgeschlagen, weil ich wissen wollte, welcher Baum so einen schwerelos süßen Duft verströmte. Ich kannte nichts, was so durchsichtig und trotzdem so allumfassend roch wie die Blüten der Robinie.
Das Fenster stand offen, es regnete immer noch. Und auf einmal stimmte die Musik nicht mehr. Es war eine Platte, die ich eigentlich mochte. Musik, die meine Mutter gehört hatte, als ich klein gewesen war. Alte Schlager, über die ich natürlich lächelte, die mir aber trotzdem immer ein heimeliges Gefühl gegeben hatten. Doch sie hörten sich plötzlich nicht mehr richtig an. Ich versuchte es mit einer anderen Platte. In meinem Regal standen viel weniger als in Johanns, nur keine davon passte mehr. Es war gar nicht so, als ob ich keine Lust mehr auf New Orleans Jazz hätte oder auf die Platte von Jethro Tull, die mein Bruder mir geliehen hatte. Sie stimmten einfach alle nicht mehr. Als ob die Töne etwas erzählten, was mich nichts mehr anging. Alles war … irgendwie nett, aber vollkommen bedeutungslos. Ich nahm die Schlagerplatte und ließ sie wie einen Diskus aus dem Fenster segeln.
Kolja stürmte herein, ohne anzuklopfen.
»Du sollst zum Abendessen kommen.«
»Ich hab keinen Hunger, Kleiner.«
Kolja ließ die Tür offen stehen und rannte ins Esszimmer, nur um zehn Sekunden später wieder um die Ecke zu schießen. Er war ein kleiner Kobold.
»Mama sagt, du musst trotzdem kommen. Sie will was mit dir besprechen.«
Ich stand vom Bett auf. Besprechen war nicht gut.
»Zum Großvater?«
Ich war vollkommen überrumpelt. Es war zwar so wie immer, ich hatte nicht darüber nachgedacht, wie es weitergehen sollte, aber trotzdem war dieser Vorschlag die ultimative Überraschung. Am Tisch wurde es ein bisschen leiser, denn das ging alle an. Zum ersten Mal sollte einer von uns nicht mit in den Familienurlaub fahren. Nämlich ich.
»Das wird ja blöd!«
Lucie, meine kleinste Schwester. Acht Jahre alt und so altklug, dass sie ihren Klassenkameradinnen immer auf die Nerven ging. Ich fand sie meistens witzig. Für meine Freunde waren wir sowieso immer wie ein Zoo. Keine andere Familie hatte so viele Kinder. Ich kannte niemanden mit mehr als zwei Geschwistern.
»Das ist noch gar nicht raus«, sagte ich. Sechs Wochen! Die ganzen Sommerferien bei meinem Großvater. Ausgerechnet. Ich meine, ich liebte meine Großmutter. Nana. Ich fand sie unglaublich. Aber vor meinem Großvater hatte ich, ehrlich gesagt, einfach Angst.
»Doch, das ist raus«, sagte meine Mutter jetzt. Nett im Ton, aber hart in der Sache. »Du kannst die neunte Klasse nicht noch einmal wiederholen. Wenn du die Nachprüfung nicht schaffst, hast du keinen Abschluss.«
»Ich kann auch im Urlaub lernen!«
Okay, das glaubte ich in Wirklichkeit selbst nicht.
»Mama, ehrlich! Beim Großvater! Ich kann … Ich kann hier bleiben und hier lernen. Dann lenkt mich keiner ab. Alma ist doch auch hier. Wir beide können einfach …«
Mama ließ sich auf nichts ein.
»Alma muss während des Praktikums im Schwesternheim wohnen. Und ihr beide sechs Wochen allein in der Wohnung? Nein. Du kriegst sogar ein eigenes Zimmer oben bei Großmutter. Die ist ja auch noch da.«
Großartig. Sechs Wochen bei dem Mann, den ich siezen musste, bis ich zehn war. Herr Professor. Der Stiefvater meiner Mutter, vor dem in der Familie alle Angst hatten. Außer ihr vielleicht. Meine Sommerferien waren gelaufen.
4
»Bist du dumm, oder was?«
Johann amüsierte sich. Morgens, Viertel nach sieben. Es war noch kühl, und wir standen an der Tramwendestation in der Telefonzelle. Ich suchte das Telefonbuch durch. Man sollte nicht glauben, wie viele Endres es in der Stadt gab. Ich antwortete nicht. Johann drehte sich eine Zigarette und schob die Tür ein Stück auf, als er sie anzündete.
»Warum hast du sie nicht gefragt, wo sie wohnt?«
Ja. Warum hatte ich sie nicht gefragt, wo sie wohnte.
»Keine Ahnung.«
Wie konnte man auch erklären, dass ich nicht fragen konnte, weil das ja gezeigt hätte, dass ich mich für sie interessierte. Andererseits war das genau das, was ich tat. Ich interessierte mich für sie. Wieso wollte ich dann nicht, dass sie das wusste? Vielleicht hatte ich auch nicht gefragt, weil sie mich nicht gefragt hatte. Was war das? Man fragte nicht, weil man Angst vor der Enttäuschung hatte? Dass sie sich womöglich nicht für einen interessierte? Super Strategie. Immerhin kannte ich ihren Nachnamen. Das hatte ich hingekriegt, kurz bevor wir uns am Eingang getrennt hatten.
»Braucht ihr noch lange?«
Eine Frau klopfte ungeduldig an die Tür. Als ob wir sie nicht gehört hätten. So eine in einem geblümten Kittelkleid. Ohne Bluse, ohne Strümpfe oder irgendwas. Nur der Kittel. Wenn meine Mutter jemals so etwas anziehen würde, dann würde ich sie umbringen. Oder mich. Ende der Welt.
Johann schob den Kopf hinaus. »Gnädige Frau«, sagte er unglaublich höflich, »nur noch eine Minute, ja?«
Johann konnte so ein unschuldiges Gesicht machen, dass ihm einfach jeder glaubte. Er sah dann aus wie ein Kind. Bloß die Zigarette störte. Die Frau klopfte erneut energisch an die Scheibe.
»Ich bin fertig«, schrie ich und riss einfach alle Seiten mit dem Namen Endres aus dem Buch.
»Wenn das jeder machen würde!«
Der geblümte Kittel rief uns empört hinterher. Wir rannten lachend davon.
Am liebsten wäre ich die letzten zwei Wochen bis zu den Ferien gar nicht mehr in die Schule gegangen. Es war ja sowieso alles klar, und in der Zeit passierte nichts mehr, außer dass man im Biologieraum Filme schaute oder versuchte, den Wandertag zu schwänzen. Nur die eisenharten Lehrer machten noch richtigen Unterricht. Frau Dr. Ott zum Beispiel. Das »Doktor« musste immer mitgesprochen werden. So ein Ding wie mit dem Flieger wäre bei ihr niemals möglich gewesen. Nicht wegen einer möglichen Strafe. Ich glaube nicht, dass Frau Dr. Ott jemals einen Verweis gegeben hat. Es war einfach so, dass so etwas bei ihr nicht vorkam. Genauso wenig wie vergessene Hausaufgaben. Die hatte eine Art, einen anzusehen und dann unglaublich korrekt zu fragen, wie das habe geschehen können.
»Waren Sie krank? Gab es ein Problem bei Ihnen zu Hause?«
Sie siezte uns seit der Neunten. Ich glaube, sie war wirklich jedes Mal aufs Neue überrascht, dass jemand seine Hausaufgaben vergessen konnte, ohne dass es in der Stadt ein Erdbeben gegeben hatte. Es war ein echter Unglauben, eine echte Enttäuschung über ein unmögliches Verhalten, und man fühlte sich dann immer schlecht. In ihrer Welt kam so etwas nicht vor – und in ihren Klassen nach der ersten Unterrichtswoche auch nicht mehr. Immerhin hatte ich es bei ihr in Französisch auf eine Vier geschafft, was mir jetzt allerdings auch nicht mehr half.
In ihren Stunden war es schwer, etwas anderes zu machen, aber ich hatte die Telefonseiten in mein Französischbuch gelegt und ging sie durch.
»Willst du die alle anrufen?«
Selbst Johann flüsterte in Frau Dr. Otts Stunden.
»Ich schau mir an, wer in der Nähe vom Bad wohnt. Sie war zu Fuß.«
Ich war ein bisschen stolz, darauf gekommen zu sein. Vor mir lag ein Stadtplan aus dem Bücherschrank meines Vaters.
»Sie könnte natürlich auch mit der Straßenbahn gekommen sein.«
Johann grinste mich an.
»Lass mir meine Illusionen«, zischte ich, aber tatsächlich hatte ich daran gar nicht gedacht. Scheiße.
»Monsieur Büchner!«
Ich klappte das Französischbuch schnell zu.
»Voulez-vous nous faire part de vos réflexions?«
»Nein, Frau Dr. Ott. Entschuldigung.«
Doch, Frau Dr. Ott, eigentlich schon. Ich falle durch, und es ist im Prinzip völlig egal, ob ich in Ihrem Unterricht rede oder nicht. Ich habe keine Ahnung, warum ich überhaupt noch hier bin. Ich habe ein Mädchen mit einem superhäufigen Familiennamen kennengelernt und war zu doof zu fragen, wo sie wohnt. Und ich habe keine Ahnung, was das hier überhaupt alles soll und warum ich nicht in Brasilien bin. In Rio de Janeiro. An einem grünen Ort am Fuß des Zuckerhuts zwischen Meer und Berg und überall ist Musik in der Luft. Sie kommt nicht von irgendwoher. Es gibt keine Band und kein Radio und keine Lautsprecher. Die Musik ist dort einfach in der Luft und umgibt mich; egal, wohin ich gehe. Und es ist immer die richtige Melodie.
Johann schob mir einen Zettel zu. Krakelig war ein Hut darauf gezeichnet und eine glimmende Zigarette. Johann war ein geiler Musiker, fand ich, aber ein lausiger Zeichner.
›Wir müssen zurück auf die Straße, Sam‹, stand unter dem Hut. ›Freibadrecherche heute Nachmittag?‹
Ich musste lächeln, schob den Zettel zurück: ›Kann nicht. Muss zu meinem Großvater.‹
»Viel Spaß«, hauchte Johann, ohne die Lippen zu bewegen.
Vorne erklärte Frau Dr. Ott das Futur II.
J’aurai aimé. Ich werde geliebt haben.
Super Aussichten.
5
Wir standen im unteren Pausenhof am Zaun. Johann rauchte. Es gab zwei Pausenhöfe. Der Neubau hatte einen großen, weitläufigen Hof mit Klettergerüst und vielen Metallgitterbänken. Das war der Hof für die Kleinen. Wir anderen waren im unteren Hof. Er gehörte zum Altbau und grenzte direkt an den Fluss. Er war kopfsteingepflastert, und in der Mitte stand eine Linde, die sie wohl gepflanzt hatten, als die Schule gebaut wurde. 1894. Humanistisch-neusprachliches Lessing-Gymnasium. Das tollste Gymnasium der Stadt. Und Friedrich Büchner hat es nicht geschafft. Zu viele andere Interessen, hatte Zippo gesagt, das ist dein Problem, Büchner. Ja. Danke. War mir schon vorher klar gewesen.
Dass es eine Linde war, wusste ich aus dem Biologieunterricht in der siebten Klasse. Wir hatten sogar einen Brunnen hier unten, der aber kein Wasser mehr gab. Ich mochte den Hof. Irgendwie gefiel mir die Vorstellung, dass hier schon vor achtzig Jahren Schüler am Zaun gestanden und über den Fluss geschaut hatten. Und dass es damals genauso ausgesehen hatte wie heute.
»Ich kann mir einfach nicht vorstellen, nicht mehr hier zu sein«, sagte ich.
»Du wolltest doch sowieso nach Brasilien«, antwortete Johann.
»Irgendwann fahre ich wirklich, aber im Augenblick reicht das Geld noch nicht ganz. Kannst du mir was leihen?«
»Würde ich wirklich total gerne, aber so viel bist du mir dann doch nicht wert.«
Ich boxte ihn in die Seite.
»Bist du weg in den Ferien? Ich halte das niemals aus. Sechs Wochen bei meinem Großvater! Du hast keine Ahnung, was das bedeutet.«
»Doch«, sagte Johann trocken, »ich war mal dabei, weißt du noch? ›Verwechseln Sie Ihren Alltagsatheismus nicht mit der Fähigkeit, logisch zu denken. Da werden Sie noch üben müssen!‹«
Wir mussten beide lachen. Der Satz war zu einem geflügelten Wort zwischen uns geworden.
Der Großvater hatte Johann examiniert, wie er alle examinierte. Ich hatte meinen Freund zur Großmutter mitgenommen. Nana hatte ich immer gut gefunden. Nein, das traf es nicht wirklich. Ich … irgendwie verehrte ich sie. Und ich würde nie verstehen, was sie an diesem harten Mann gefunden hatte; dass sie sich mal in ihn verliebt haben konnte. Großvater war aus irgendeinem Grund früher aus der Klinik nach Hause gekommen, noch im weißen Kittel, und wir waren ihm im Garten über den Weg gelaufen. Mir blieb nichts anderes übrig, als ihm Johann vorzustellen.
»Johann also. Wissen Sie, woher der Name stammt?«
Er siezte Johann. Nicht aus Höflichkeit, vielmehr um ihn auf Distanz zu halten. So wie wir ihn früher hatten siezen müssen, wie Mama ihn lange gesiezt hatte.
Ich hatte Johann nicht vorgewarnt, weil ich nicht damit gerechnet hatte, Großvater zu begegnen. Aber Johann tat sein Bestes.
»Aus der Bibel. Leider«, sagte er noch. Kirche war nicht so seins.
Großvater sagte, ohne stehen zu bleiben, diesen Satz über Johanns Atheismus und seine Fähigkeit zu logischem Denken. Dann standen wir im Garten, und die Haustür wäre hinter dem Herrn Professor zugefallen, wenn ich sie nicht schnell gestoppt hätte.
»Viel Spaß im Sanatorium zum logischen Großvater«, sagte Johann. »Ich bin zwei Wochen weg, aber ich werde dich aus dem bürgerlichen Sumpf retten, wenn es darauf ankommt. Und wenn dein Großvater nicht zu Hause ist.«
»Danke für gar nichts«, sagte ich. Am Zaun lehnend, sahen wir über den Fluss in die Ferne. Um uns herum summte der Hof von Gesprächen und Lachen und tatsächlich auch von ein paar Bienen. Der Hausmeister hatte in seinem kleinen Privatgarten neben dem Pausenhof Bienenstöcke.
»Und wenn gar nichts kommt?«, fragte Johann nach einer Weile nachdenklich.
Ich verstand ihn.
»Du meinst dieses Gefühl, dass man immer wartet? Dass wir denken, dass alles noch vor uns liegt? Dass wir jetzt noch gar nicht richtig leben, weil wir noch in der Schule sind und noch daheim wohnen und so?«
Er antwortete nicht gleich, aber ich konnte sehen, dass es das ungefähr war.
»Vielleicht lohnt es sich gar nicht. Das Warten, meine ich.«
Es klang so leichthin gesagt. War es aber nicht.
»Vielleicht«, sagte ich. Dann dachte ich an Rio de Janeiro. An den Duft von Robinien im Frühsommer. An das Mädchen mit den grünen Augen. »Vielleicht aber doch.«
Alma stand plötzlich neben uns. Sie hatte ein selbstgebatiktes T-Shirt an, das eines meiner weißen Hemden für immer lila gefärbt hatte, weil unsere Mutter es in der Waschmaschine vergessen hatte. Alma war ein Jahr jünger als ich und eine Klasse über mir. In der fünften Klasse hatte ich schon einmal wiederholt und wir beide waren bis letztes Jahr zusammen gewesen. Ich vermisste sie in den Stunden. Nicht nur, weil sie so viel schlauer war. Alma war cool. Altmodischer Name, hätte Beate wohl gesagt. Ja, hätte ich wieder geantwortet, wir haben seltsame Eltern.
»Hauen wir ab?«, fragte sie, als sie uns so am Zaun sah, und drängte sich zwischen uns. »Goldküste?«
Wir ließen sie in die Mitte. So war es immer gewesen. So würde es immer sein. Wir gehörten zusammen.
»Klingt sehr verlockend«, sagte Johann ausgesucht höflich, »aber ich würde aus Gründen der moralischen Hygiene vorher gerne noch zwei Stunden sinnlosen Matheunterricht hinter mich bringen.«
Alma lachte.
»Spießer!«
Sie nahm Johann die Zigarette weg und zog daran.
»Eine Woche noch, Jungs!«, sagte sie fröhlich.
»Danke, dass du mich erinnerst«, erwiderte ich.
Es klingelte. Die Pause war vorbei. Alma hakte sich bei uns beiden unter, und wir gingen zurück in unsere Klassenzimmer.
6
Wahrscheinlich wäre es klug gewesen, schon in den letzten Tagen vor den Sommerferien mit dem Lernen anzufangen. Dann würde ich vielleicht in den sechs Wochen nicht so viel tun müssen und eine echte Chance haben, die Nachprüfung zu schaffen. Aber ich konnte nicht. Irgendwie hatte ich das Gefühl, als wären diese letzten Schultage auf einmal die eigentlichen Ferien geworden. Die letzten Tage, bevor ich für anderthalb Monate einrücken musste. Ich schob den Gedanken immer wieder beiseite. Und versuchte, möglichst viel in diese Tage zu pressen.
In der letzten Woche vor den Zeugnissen fand das Sportfest statt. Alma und ich hatten ein Transparent gebastelt und nun standen wir vor unserem Haus und warteten auf Johann. Alma saß freihändig auf dem Sattel, einen Fuß auf der Stange, lehnte mit dem Rücken an einem Laternenpfahl und hielt das Rad in der Balance, während sie sich eine Zigarette drehte. Über der Silhouette der Stadt stand die Sonne. Die Antennen waren wie aus Licht in den Himmel über den Dächern geschnitten. Über Alma wölbte sich die Krone der Kastanie im Vorgarten.
»Manchmal würde ich gerne malen können«, sagte ich.
»Wieso?«
Alma waren die Zigarettenpapierchen heruntergefallen und sie versuchte, das Heftchen wieder aufzuheben, ohne vom Rad steigen zu müssen. Es sah deutlich weniger elegant aus, als wenn sie einfach abgestiegen wäre.
»Weil ich dann malen könnte, was ich sehe.«
Alma kippte und fing sich hastig. Dann stieg sie doch ab und hob die Papierchen auf.
»Aber es ist doch sowieso da«, sagte sie einfach. »Du musst es nicht malen.«
Das stimmte. Aber das, was man sah, war nicht alles. Ich wusste nicht, wie ich es ausdrücken sollte.
»Dann müsste man allerdings auch keine Bücher schreiben und überhaupt keine Bilder malen und keine Musik machen. Es ist doch …«
Ich überlegte kurz. Alma hatte sich wieder auf ihr Fahrrad gesetzt und zündete die Zigarette an. Der Rauch zog zu mir herüber. Ich rauchte nicht, aber dieser verwehte Duft war für einen Augenblick wie eine sehnsüchtige Einladung in eine wunderbare Ferne und ich wusste auf einmal, was ich sagen wollte.
»Es ist alles da. Aber das alles hier, dieser Sommermorgen und die Blätter über dir und wie du lässig auf dem Rad sitzt und rauchst und cool aussiehst, das ist … das ist, als ob man das alles erst malen muss, damit man es in einem Moment aufnehmen kann. Damit man fühlen kann, was diesen einen besonderen Augenblick ausmacht.«
»Du musst nicht malen«, sagte Alma wieder. »Du kannst es sagen. Da kommt Johann.«
Sie deutete den Berg hinauf. An der aufgegebenen Tankstelle vorbei kam er mit fliegenden Haaren und flatternder Jacke auf uns zugerast. Er bremste ganz knapp vor uns.
»Moin, folks«, grüßte er. »Was ist das für ein Banner?«
Er deutete auf unser Transparent.
»Das wirst du sehen, wenn wir damit auf der Aschenbahn sind. Du musst die eine Stange tragen.«
Johann zupfte am Stoff. Alma hob die Stangen. Er grinste.
»So was wie: ›Dieser Sportplatz wird instand gesetzt‹?«
Alma seufzte.
»Die Ungeduld der stürmischen Jugend. Du wirst es früh genug erfahren.«
Sie stieß sich von der Laterne ab und kam langsam ins Rollen, weiter den Gehsteig hinab. Johann und ich folgten.
Auf dem Sportplatz war es schon heiß. Wir schlossen die Räder zusammen und schlenderten zur Tribüne zum Fritsch, der dort mit einem Klemmbrett stand und das Ganze überwachte. Einmal im Jahr waren die Sportlehrer die Könige. Sonst nahm sie nie jemand ernst, an unserer Schule schon gar nicht. Latein- und Griechischlehrer waren bei uns die Herrscher, dann kam erst mal lange nichts. Moderne Fremdsprachen, Mathe, Chemie, Bio … das war der Mittelbau. Die brauchte man ja und manche hatten sogar was zu sagen. Schließlich kamen Kunst und Ethik und Sozialkunde und Wirtschaft und Sport … die brauchte keiner.
»Rotfront, Herr Fritsch«, sagte ich und hob die linke Faust. »Wir sind da.«
Fritsch sah kaum auf, als er unsere Namen abhakte.
»Lass mich in Ruhe mit deinen Parolen, Büchner. Start um zehn fünfundvierzig zum Hundertmeterlauf.«
»Jawohl, Herr Kaleu«, antwortete Alma zackig.
Fritsch fuhr unvermutet hoch.
»Ihr denkt alle, die Ferien haben schon angefangen, was? Respekt kriegt man von euch nur, wenn es um Noten geht, ist doch so. Wenn es euch hier nicht passt, dann geht doch rüber!«
»Machen wir«, antwortete Alma schlagfertig und deutete lässig zu den Linden, die auf der Gegenseite der Aschenbahn standen und den Sportplatz zum Park abgrenzten. »Da ist es auch viel schattiger.«
Johann nickte mitleidig.
»Ja. Muss die Hölle sein auf dieser Tribüne mitten in der Sonne.«
Aber Fritsch hatte schon keine Lust mehr, sich mit uns abzugeben.
»Verschwindet. Zehn fünfundvierzig, Büchner. Zehn fünfundvierzig.«
Es hieß, dass Fritsch ein verklemmter Nazi sei. Bestimmt bei der HJ gewesen oder so. Wer wurde schon Sportlehrer? Ich glaubte das irgendwie nicht. Der versuchte nur immer, zackig zu sein, und konnte es eigentlich gar nicht. Den brachte ja Alma schon ins Schwitzen. Obwohl – Alma konnte so was gut. Manchmal dachte ich, dass sie viel mutiger war als ich. Alma wäre sicher ohne Zögern vom Siebeneinhalber gesprungen. Oder erst gar nicht hochgeklettert. Sie hatte oft so etwas Sicheres in dem, was sie tat. Solange wir in einer Klasse gewesen waren, hatte ich mir nie die Hausaufgaben aufschreiben müssen. Alma war da absolut zuverlässig gewesen, sie hatte das immer gemacht. Obwohl sie kein Streber war. Nur kriegte sie das mit der Balance zwischen Arbeit und Spaß irgendwie besser hin als ich. Ich rannte immer voll gegen die Wand.
Meine alte Klasse hatte sich unter die Linden in den Schatten verzogen. Alma und ich setzten uns neben sie ins Gras. Johann blieb stehen und rauchte nachdenklich. Über uns siebten die Blätter das Licht. Alma hatte sonnige Flecken auf dem Rücken. Wind wäre schön gewesen. Ich mochte, was der Wind mit den Blättern tun konnte. Aber das war eigentlich ein Herbstbild und der Sommer begann doch gerade erst.
»Ey, Büchner, was ist das für ein Transparent?«
Max hatte das gerufen. Der Kleinste in meiner ehemaligen Klasse. Er war ein lebendes Klischee. Klein. Frech. Schlagfertig. Ob ich auch so einem Klischee entsprach? Alle dachten immer, ich würde Drogen nehmen, nur weil ich lange Haare hatte. Oder dass ich irgendwie freaky wäre, bloß weil ich gerne Schwarz trug. Ich wusste ja auch nicht, warum. War eben so. Vielleicht gerade deshalb. Damit die anderen etwas in mir sahen, was ich nicht war. Tarnen und täuschen.
»Ein Spendenaufruf für die RAF.«
Max war im Grunde ein Spießer. Der wäre nie auf eine Demo gegangen, vielleicht weil sein Vater ein Mietshaus besaß. Er war immer auf der Seite der Kapitalisten, wenn wir über Politik diskutierten.
»Wirklich witzig, Büchner. Was haben wir gelacht.«
»Dann frag doch nicht, wenn du’s nicht wissen willst.«
Über den Platz hallten unverständliche Lautsprecherdurchsagen. Die Siebtklässler hüpften in die Sandgrube. Ein paar aus der Oberstufe trainierten Hochsprung. Die allermeisten hingen auf den Bänken herum, die man aus den Umkleideräumen ins Freie getragen hatte. Die Lehrer klumpten sich in dem schmalen Schatten unter dem Sprecherhäuschen auf der Tribüne zusammen. Fast alle rauchten. Alles in allem war es ein sehr nachlässig geführtes Sportfest. Ich fand, dass ich recht hatte: Fritsch war kein Nazi. Der konnte gar nichts.
»Sag mal, Frieder, wofür hast du all die Groschen dabei?«
Alma hatte in meiner Sporttasche nach ihrem Feuerzeug gekramt und die Zehnpfennigstücke gefunden, die ich mir gestern in der ganzen Wohnung zusammengeklaut hatte. Sie hielt eine Handvoll hoch. Ich zuckte nur die Achseln. Es war mir unangenehm. Ich wollte Alma nicht sagen, dass ich mich … Ach, keine Ahnung, ob das überhaupt Verlieben war. Wie konnte man sich denn überhaupt in jemanden verlieben, den man gerade mal eine halbe Stunde gesehen hatte? Aber andererseits … vielleicht war es ja Schicksal oder so. Vielleicht musste es genau so sein. Ich hatte dieses Gefühl manchmal: dass die Dinge einfach richtig geschahen, wenn man es ihnen erlaubte. Wenn man wartete, nichts tat. Aber dann wieder … hätte ich wohl die Groschen nicht gesammelt.
»Erzähl ich dir später. Ich glaube, wir sind jetzt dran, oder?«
Johann nickte und drückte seine Zigarette im Gras aus.
»Wie du so schnell rennen kannst, obwohl du rauchst, wird mir auf ewig ein kosmisches Rätsel bleiben«, sagte ich, während Johann sein Hemd auszog und nur in den kurzen Sporthosen dastand; schlank, fast mager. Er nahm das zusammengerollte Transparent auf.
»Morituri te salutant, Alma!«, deklamierte er in komischer Pose. »Fliege ich von der Schule, wenn ich das Ding entrolle?«
»Schieb es auf Frieder«, sagte Alma spöttisch, »der hat ja sowieso nichts mehr zu verlieren.«
»Es ist wunderbar, liebende Freunde um sich zu haben«, sagte ich. Das war das Schöne zwischen uns. So konnten nur wir reden. Das war wie mit den Nullen. Etwas, das die anderen nicht verstanden.
Der Lautsprecher hustete irgendetwas von Hundertmeterlauf. Johann und ich schlenderten quer über den Rasen zur Aschenbahn. Die Betontribüne war jetzt voller als vorhin. Nach der Leichtathletik kam das traditionelle Fußballspiel zwischen der Lehrermannschaft und der Oberstufe. Da würden dann alle zusehen, und wir konnten unbemerkt abhauen. Es war jetzt noch heißer, aber der Schwarz stand in einem seiner beiden Anzüge ungerührt inmitten der ganzen Fünftklässler und schrieb ihre Ergebnisse beim Werfen auf. Vor dem Schwarz hatte ich echten Respekt. Keine Angst, obwohl ich in Mathe so schlecht war, aber Respekt. Vielleicht deshalb, weil er sich nicht mögen ließ. Keiner von denen, die uns mit schwachen Witzen auf ihre Seite ziehen wollten. Man wusste oft nicht, was er dachte, aber dass er sich Gedanken machte, war klar. Er hatte nur zwei Anzüge. Montag bis Mittwoch dunkelblau. Donnerstag und Freitag dunkelgrau. Im Knopfloch eine dünne, goldene Kette, an der die runde Uhr in die Tasche hing, in der eigentlich das Einstecktuch sein sollte. Nicht an der Weste, nicht in der Hosentasche. Er brauchte die Uhr aber nie. Er kam exakt zu Beginn der Stunde und hörte zehn Sekunden vor dem Klingeln auf. Keiner wusste, wie er das machte. Vielleicht sah er manchmal auf die Rathausuhr, aber er konnte das auch in Klassenzimmern, von denen aus man keine Uhr sah.
»Wollen Sie mir erklären, wie Sie auf diese Lösung gekommen sind, Herr Büchner?«
Ich hatte an der Tafel gestanden und eine Hausaufgabe gerechnet, die wir Matheidioten zur Verbesserung unserer Note bekommen hatten. Ich sah die Zahlen an und den Rechenweg, hatte keine Ahnung, stotterte herum und wollte mich eigentlich nur noch setzen. Der Schwarz hatte mich lange angesehen.
»Herr Büchner, die Aufgabe hat Alma gerechnet, richtig?«
Junge! Alma und ich hatten ihn in der sechsten Klasse gehabt. Ich wäre im Leben nicht darauf gekommen, dass er ihren Namen noch kannte. Ganz abgesehen davon, dass er wusste, wie gut sie in Mathe war! Ich konnte nicht anders als mit den Schultern zucken. Man konnte den Schwarz nicht belügen.
»Sie wissen, wie gut ich in Mathe bin«, hatte ich gesagt. »Ja.«
»Danke für Ihre Ehrlichkeit«, hatte er unbewegt geantwortet. »Dafür gebe ich Ihnen das Dreifache der Note, die eigentlich Ihrer Schwester zusteht. Können Sie wenigstens das eigenständig errechnen? Sie dürfen jetzt wieder Platz nehmen.« Dann hatte er den Rechenweg erklärt und ich kapierte ihn auf einmal auch.
Eine Drei. Damit war ich von der Sechs auf eine Fünf gerutscht und konnte zur Nachprüfung zugelassen werden. Und damit hatte ich jetzt das Glück, sechs Wochen lang bei meinem Großvater eingesperrt zu sein, um Latein und Mathe zu lernen. Aber dafür konnte der Schwarz ja nichts.
»Ich sehe, wir dürfen auf das Rennen gespannt sein, Herr Büchner.«
Der Schwarz wies mit einer kleinen Kopfbewegung auf das immer noch zusammengerollte Transparent. Ich musste lächeln, als mir die richtige Antwort einfiel.
»Ich denke, das Motto wird Ihnen entgegenkommen, Herr Schwarz.«
Er nickte nur gemessen und ohne ein Anzeichen von Lächeln, bückte sich dann nach dem Metermaß und notierte ein weiteres Wurfergebnis. Der Schwarz lächelte nie. Trotzdem war ich mir sicher, dass er Humor hatte. Ich meine, der Mann stand in seinem dunklen Anzug mit zugeknöpfter Weste, einer kleinen goldenen Uhrkette im Knopfloch und mit einem etwas zu kleinen Hütchen mitten in der Julisonne auf einem Sportplatz. Ich war mir sicher, dass er wusste, wie das aussah. Und dass ihm das irgendwo ganz innen Freude bereitete.
»Büchner! Lohmann!«
Das galt uns. Fritsch brüllte über den Platz. Die drei anderen Läufer standen schon an den Startblöcken. Johann und ich liefen in lockerem Dauerlauf zu ihnen. Da war Laser aus der Elf. Der war noch schneller als ich, aber darum ging es ja heute sowieso nicht. Obwohl ich ihn heute vielleicht hätte schlagen können.
»Was ist das denn? Tut den Scheiß weg!«
Fritsch deutete auf unser Transparent, das wir zwischen unsere Blöcke auf die Aschenbahn gelegt hatten.
»Wir laufen heute Staffel, Herr Fritsch«, sagte Johann höflich und sprintete auf der Stelle, um sich warm zu machen. Fritsch sah für einen Moment aus, als wollte er sich auf ihn stürzen. Er hatte so lange in der Sonne gestanden, dass man nicht mehr wusste, ob er davon oder vor Wut so rot war.
»Wir brauchen das später«, beruhigte ich ihn. Ich sagte nicht, wann später, aber er war jetzt sowieso viel zu hektisch, um sich auf uns einzulassen.
»Auf die Plätze!«
Ich ging auf die Hände nieder, setzte die Füße in den Startblock. Ich mochte dieses Gefühl. Ich rannte gerne. Ich war schnell. Sonst konnte ich nicht so viel, aber laufen konnte ich gut. Johann und ich griffen jeder eine Stange. Fritsch merkte nichts, der sah nur auf seine Stoppuhr.
»Fertig!«
Ich sah Alma aus den Augenwinkeln. Sie stand mit ihrer Kamera ungefähr fünfzig Meter vor uns an der Bahn. Plötzlich wünschte ich mir, dass Musik um mich wäre. Musik, die all das hier sagen konnte. Den Sommermorgen. Die vielen Stimmen der Kleinen, die sich fast wie im Bad anhörten, die Lautsprecher, den Geruch der aufgeheizten Aschenbahn, Alma am Rand stehend und Johann neben mir. Diesen einen Augenblick vor dem Start. Eine leichte Musik müsste das sein. Eine, die man von innen hören könnte.
Der Schuss knallte und wir rannten los. Im Laufen entrollte sich das Banner, spannte sich wie ein Segel zwischen uns und bremste unglaublich, aber wir gaben trotzdem alles.
»Sport ist Mord.«
Alma und ich hatten uns große Mühe gegeben. In Fraktur stand es da. In fettem Schwarz.
Laser war längst an mir vorbeigezogen. Johann und ich rannten trotzdem, so schnell wir konnten, und ich kam mir für einen Augenblick vor wie einer dieser antiken Olympioniken, von denen Zippo immer so farbig erzählte. Als wir an Alma vorbeiflogen, nahm ich das Klicken der Kamera wahr, wir rannten weiter und hörten das Lachen auf dem Sportplatz aufbrausen, hielten an der Ziellinie nicht an, sondern liefen die volle Bahn, vierhundert Meter, immer noch voll Stoff. Auf der Gegenseite an Schwarz vorbei. Der schob seinen Hut hoch, und es sah aus wie ein Gruß. An meiner Klasse vorbei, die johlte und Beifall klatschte, an den Kleinen vorbei, die sich einen Ast freuten und auf und ab hüpften. Und dann, völlig außer Atem, mit brennenden Oberschenkeln, wieder zum Start.
Fritsch stand mit seinem Klemmbrett da, ein paar andere Lehrer um ihn.
»Büchner! Lohmann! Verweis!«, bellte er.
Klar. War zu erwarten gewesen. Aber für mich kam es ja auch wirklich nicht mehr darauf an und für Johann war es der erste im Jahr. Trotzdem fragte ich atemlos: »Wofür? Das ist ein Zitat von Winston Churchill. Haben Sie ein Problem mit dem?«
Fritsch wusste keine Antwort darauf. Der Schwarz war auch hinzugekommen, reichte Fritsch das Klemmbrett mit den Wurfergebnissen und knarrte: »Geben Sie ihm den Verweis dafür, dass Herr Büchner die Prioritäten zwischen Humor und schulischen Ansprüchen noch nicht richtig setzen kann, Herr Kollege.«
Johann musste grinsen, drehte sich aber schnell weg.
»Wie soll ich denn das in den Verweis schreiben?«
Fritsch war immer noch hilflos.
»›Störung einer schulischen Veranstaltung‹ wird es auch tun«, antwortete der Schwarz, und diesmal hatte ich das Gefühl, als müsste er gleich lächeln. Tat er aber dann doch nicht. Er gab uns ein Zeichen, dass wir gehen durften. Als wir das Transparent einrollen wollten, sagte er knapp: »Das nehme ich an mich, meine Herren.«
War ja egal. Wir brauchten es sowieso nicht mehr. Es hatte getan, was es sollte. Also zogen wir ab, um unsere Taschen zu holen und unauffällig zu verschwinden. Alma stieß zu uns.
»Ich hab so geile Bilder von euch gemacht!«
Johann war gut gelaunt, trotz des Verweises. Vielleicht aber gerade deswegen. Irgendwie kriegte er es nie ab, wenn wir was zusammen anstellten. Es traf immer mich. Manchmal nervte ihn das. Er wollte nicht, dass die Lehrer ihn für einen Spießer hielten.
»Können wir morgen noch entwickeln, oder?«
Alma nickte.
»Wenn der Film voll ist.«
Wir schlossen die Fahrräder auf. Vom Friedhof klangen die Glocken herüber. Die Sonne stand über den Linden, die den Weg zu den Flusswiesen säumten. Für einen Augenblick war es, als wäre alles aus Licht gemacht. Die Kronen der Bäume eine Wolke von grün flirrendem Licht. Der Fahrradweg aus betonhellem, gleißendem Licht. Almas Haare eine wild gesponnene Krone aus widerspenstigen Goldfäden. In diesem Moment hätte man nicht sagen können, welche Farbe ihr Haar hatte, so war es von der Sonne umleuchtet.
»Alma ist soeben heilig geworden«, sagte ich zu Johann und deutete auf ihren Kopf.
»Es wurde auch Zeit«, antwortete Johann. »Das gute Kind.«
Alma saß schon auf ihrem Rad.
»Und jetzt?«
»Wird telefoniert«, sagte Johann.
Alma sah mich bedeutungsvoll an.
»Daher die Groschen.«
Wir fuhren den Bogen am Fluss entlang zurück in die Stadt. Es war noch nicht elf Uhr. Die Stadt war noch frisch. Es waren nur zwei Stunden, die wir uns gestohlen hatten. Trotzdem fühlte sich der Vormittag für einen Moment wie Freiheit an – was dann wohl ab übermorgen vorbei sein würde.
7
Es gibt Tage, da wache ich viel zu früh auf, sehe in das Dunkel vor den Fenstern und zähle mein Leben. Und die Entscheidungen, die ich getroffen oder nicht getroffen habe. Aber es gibt ja im Leben keine Möglichkeit, an einer Weggabelung stehen zu bleiben, wenn die Straße selbst sich unter einem weiterbewegt. Nach links womöglich. Nach rechts – man hat keinen Einfluss darauf. Pech gehabt. Oder Glück.