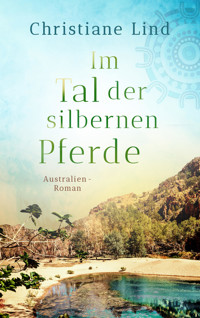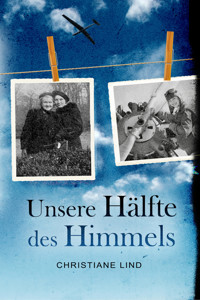
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Nichts kommt dem Fliegen gleich. Aber wie sollte ihre Mutter das verstehen, die bisher noch nie den Himmel erobert hatte?« 1935 träumen die Freundinnen Amelie und Johanna davon, ihr Leben nach ihren Vorstellungen zu führen. Und zwar als Fliegerinnen - ein verwegener Wunsch in einer Zeit, in der Frauen an Heim und Herd gedrängt werden. Doch gemeinsam sind die Freundinnen stark, bis sich eine von ihnen verliebt, was die andere ihr nicht verzeihen kann ... 1971 fällt Amelie nach einem Autounfall ins Koma. Lieselotte, ihre Tochter, reist sofort zu ihr nach Frankfurt am Main. Aus der Sorge um die Mutter entwickelt sich eine Reise in deren Vergangenheit und die Suche nach einer selbstbestimmten Zukunft. Ein großer Schicksals-Roman über ungelebte Träume, Frauen-Freundschaften und die Faszination des Segelfliegens. Neuveröffentlichung des unter dem Pseudonym Clarissa Linden veröffentlichten Romans. Leserinnenstimmen ..., dass mir dieses Buch nachhaltig im Gedächtnis bleiben wird und ab sofort zu meinen Lieblingsbüchern gehört. Das war mal wieder ein Roman, der mich richtig beeindruckt hat. Dies ist eines der schönsten Bücher, die ich je gelesen habe. Mich konnte das Buch vollends überzeugen, ich fand es unglaublich gut erzählt, spannend und interessant. Romantisch, wehmütig und ehrlich. Ich habe das Buch innerhalb kürzester Zeit gelesen, es hat mich emotional sehr stark berührt. Ein tolles Buch, das beide Zeiten detailreich beschreibt und in die man sich mühelos hineinversetzen kann. Für mich ein Lesehighlight, mit dem ich abenteurliche, unterhaltsame und spannende Lesestunden verbracht habe. Ein Roman, der mich berührt und auch stellenweise sehr traurig gemacht hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Unsere Hälfte des Himmels
Christiane Lind
Unsere Hälfte des Himmels
Roman
ImpressumÜberarbeitete Neuveröffentlichung
September 2021
Copyright © 2021, AIKA Consulting GmbH, alle Rechte vorbehalten
Berliner Straße 52, 34292 Ahnatal
www.christianelind.de
Erstveröffentlichung unter dem Titel »Unsere Hälfte des Himmels« und dem Pseudonym Clarissa Linden
© Droemer Knaur 2017
Umschlaggestaltung: Desiree Riechert, https://www.kiwibytesdesign.com
Bildnachweise: © Oleksandr Rozhkov, #108138842 © kuco, #57851746, © Aleksandar Todorovic, #45181997© 1xpert, #238170341
Lektorat: Silvia Kuttny-Walser
Satz: Desiree Riechert, https://www.kiwibytesdesign.com
ISBN: 978-3-98595-014-0
Herstellung und Druck:
Mazowieckie Centrum Poligrafii
Mikołaja Ciurlionisa Strasse 4
05-270 Marki, Polen
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Epilog
Nachwort und Hintergrund
Weitere Literaturhinweise:
Danksagung
Das Buch
Frankfurt in den 30er Jahren: Johanna und Amelie sind Freundinnen, die eine gemeinsame Sehnsucht verbindet: Sie wollen Pilotinnen werden und den Himmel erobern. Doch dieser Traum scheint im Deutschland der Nazi-Zeit unmöglich zu sein. Trotzdem halten beide an ihm fest – bis Amelie sich in Johannas Fluglehrer verliebt. Ein folgenschwerer Verrat zieht furchtbare Folgen nach sich.
Kassel in den 70er Jahren: Amelies Tochter Lieselotte wird plötzlich mit der aufregenden Vergangenheit ihrer Mutter konfrontiert. Nach und nach lernt sie eine Amelie kennen, die sie hinter der distanzierten Fassade niemals vermutet hätte – und kommt dem großen Geheimnis ihrer Mutter auf die Spur. Bald wird ihr klar, dass diese Erkenntnisse ihr eigenes Leben verändern werden.
Historisch fundiert, dramatisch und mitreißend: Ein großer Schicksals-Roman über ungelebte Träume, Frauen-Freundschaften und den Traum vom Fliegen.
Die Autorin
Christiane Lind hat sich immer schon Geschichten ausgedacht, die sie ihren Freundinnen erzählte. Erst zur Jahrtausendwende brachte sie ihre Ideen zu Papier und ist seitdem dem Schreibvirus verfallen. In ihren Romanen begibt sich Christiane am liebsten auf die Spur von Familien und deren Geheimnissen. Sie lebt in Ahnatal bei Kassel mit unzähligen und ungezählten Büchern, einem Ehemann, vier Katern und einer schüchternen Katze.
»Frauen tragen die Hälfte des Himmels.«
Chinesisches Sprichwort und Slogan der internationalen Frauenbewegung
»Den Frauen steht das Recht zu, ihr Leben zu leben, ob sie nun das Tuch mögen, das sie weben, oder das Tiefblau des Himmels lieben, den sie durchfliegen. Ich habe mich auf das Spiel der Männer nicht eingelassen, um sie zu imitieren, ich bin Fliegerin geworden, um zu fliegen.«
Danielle Décuré, erste Flugkapitänin der Air France
Die Personen
1935
Amelie (Melli) Reichard, Fliegerin
Luise Reichard, Amelies Mutter
Benno Reichard, Amelies Vater
Martha Puschke, Amelies Tante, lebt in Hannover
Horst Puschke, Amelies Onkel, lebt in Hannover
Johanna (Hanni) Beese, Fliegerin
Harri Beese, Johannas Bruder
Christel-Marie Beese, Johannas Mutter
Theodor Beese, Johannas Vater
Johannas und Amelies Segelfluggruppe
Therese
Gudrun
Vera
Helma
Hertha
Irma
Felix von Bissing, Flieger
Wolf von Bissing, Felix’ Vater
Charlotta von Bissing, Felix’ Mutter
Jonni Möhring, Fluglehrer in Rangsdorf
1971
Lieselotte Frank, Amelies Tochter
Eduard Frank, Lieselottes Ehemann
Frau Schiller, Lieselottes Nachbarin in Kassel
Marga Paulus, Lieselottes Nachbarin in Frankfurt
Cat Ballou, Margas Kater
Uwe, Margas Chef
Georgia, Historikerin und Margas Freundin
Alix, Krankenschwester
Dr. von Dewitz, Ärztin
Gudrun Görgen, Fliegerin, lebt in Göttingen
Therese Pogge, Fliegerin, lebt in Marburg
Prolog
»Der Flug ist das Leben wert.«Margret Fusbahn
Frankfurt am Main, 1922
»Johanna, wo bleibst du denn? Johanna!« Die Stimme ihrer Mutter klang wieder einmal verärgert. Auf den Holzdielen des Flurs klapperten ihre schnellen, energischen Schritte, als sie sich Johannas Zimmer näherte. Das Mädchen drückte sich tiefer in die Kissen und setzte eine leidende Miene auf. Monatelang hatte Johanna den heutigen Tag vorbereitet. Hatte heimlich geplant, mit Engelsgeduld Holzstücke und Stofffetzen gesammelt, so dass deren Fehlen niemandem auffiel. Hatte Holz und Stoff miteinander verbunden, immer in Sorge, dass jemand sie entdeckte, bevor sie ihren Plan in die Tat umsetzen könnte. Doch keiner schien auf die Idee zu kommen, dass eine Neunjährige so geschickt vorgehen würde.
Heute nun galt es, die Vorbereitungen in die Tat umzusetzen. Zuerst musste sie jedoch ihre Mutter überzeugen. Als die Tür zu ihrem Zimmer sich öffnete, täuschte Johanna einen Hustenanfall vor, der ihren Körper schüttelte.
»Kind. Wir wollen in die Frühmesse«, begann die Mutter, um dann besorgt zu fragen. »Ist dir nicht gut?«
»Mir ist heute gar nicht wohl«, log Johanna. Mit schlechtem Gewissen, weil man nicht lügen sollte, aber sie wollte keinen Tag länger warten. »Ich hab mich bestimmt in der Schule angesteckt.«
»Fieber hast du keines.« Kühl lag die Hand der Mutter auf Johannas Stirn. So durchdringend sah ihre Mutter sie an, dass Johanna beinahe ihren Plan verraten hätte. »Aber wir wollen lieber nichts riskieren.«
»Ich schlaf noch ein bisschen.« Johanna wandte ihrer Mutter den Rücken zu und biss sich auf die Lippe, damit ihr kein weiteres Wort entweichen konnte.
»Ich sehe nach dir, wenn wir aus der Kirche zurück sind.«
Endlich schloss sich die Tür hinter der Mutter, und Johanna drehte sich erleichtert um. Sie horchte auf die vertrauten Geräusche im Haus. die ungeduldigen Rufe ihres Vaters, der sicher bereits ausgehfertig an der Haustür stand. Die Schritte ihres Bruders, die eilig die Treppe herunterpolterten, weil Harri wieder einmal zu spät dran war. Endlich, endlich erklang das Klappen der Holztür.
Mit angehaltenem Atem lauschte Johanna weiter, ängstlich, dass ihre Mutter es sich anders überlegt hätte und ihrer kranken Tochter Gesellschaft leisten wollte. Doch alles blieb ruhig. Langsam zählte Johanna bis einhundert. Dann sprang sie aus dem Bett. Mit fliegenden Fingern zerrte sie sich einen Rock aus dem Schrank, griff nach ihrem blauen Lieblingspullover. Beim Anziehen der wollenen Strumpfhose verhedderte sie sich, weil sie vor Aufregung ins falsche Bein gestiegen war. Als hätte sich alles gegen sie verschworen, riss auch noch der Schnürsenkel ihres linken Stiefels. Sie zog ein Ende durch die Ösen, verknotete es mit dem anderen und band eine Schleife, so gut es eben ging. Endlich, endlich war sie angekleidet für ihr großes Abenteuer. Bevor sie die Tür zu ihrem Zimmer öffnete, verharrte Johanna einen Moment, sammelte allen Mut zusammen, den sie besaß. Heute würde es sich entscheiden, ob sich ihr großer Traum erfüllen ließ.
Auf Zehenspitzen, obwohl niemand im Haus war, der sie hören könnte, schlich Johanna den Flur entlang, bis sie am Aufgang zum Dachboden angekommen war. Vorsichtig drehte sie den Schlüssel, der quietschte, als wollte er sie warnen.
Sonnenlicht schien durch das hohe Fenster und überhauchte den Staub, den Johannas Schritte aufwirbelten, mit goldenem Schimmer, so schön, dass Johanna einen Moment innehielt. Ihr Blick wanderte prüfend zum Fenster. Nur wenige Wölkchen standen am blauen Himmel. Heute war ein perfekter Tag zum Fliegen.
Sie konnte es kaum erwarten, zu der Holztruhe zu gelangen, in der ihre Eltern alte Kleidungsstücke aufbewahrten, die irgendwann einmal zu Putzlappen zerschnitten werden sollten. Niemand ahnte, dass seit einigen Tagen neben den Lumpen Johannas größter Schatz lagerte. Mit angehaltenem Atem öffnete sie den schweren Deckel.
Das Mädchen lächelte, als es sie sah - ihre Flügel. Beinahe so lang wie Johanna selbst. Eine Sperrholzkonstruktion, mit bunten Stoffresten bespannt, die Johanna heimlich in ihrer Kammer zusammengenäht hatte. In der Bibliothek ihres Vaters war sie fündig geworden. In einem Buch mit Zeichnungen von Leonardo da Vinci hatte sie das Modell der Flügel entdeckt und sofort gewusst, dass es ihr Schicksal war, deren Flugtüchtigkeit zu erproben. Heimlich hatte sie das Buch in ihr Zimmer gebracht und die Abbildungen mit Butterbrotpapier abgepaust, bevor sie den Band wieder in die Bibliothek zurückgestellt hatte. Tag um Tag, Abend um Abend hatte sie daran gearbeitet, ihre Flügel zu vollenden. Vor drei Tagen hatte sie letzte Hand an die Lederriemen gelegt, mit denen sie die Flügel an ihren Armen befestigen wollte. Dann hatte sie geduldig abgewartet bis zum heutigen Sonntag. Bis zu dem Tag, an dem sie allein zu Hause blieb.
»Ikarus«, flüsterte Johanna. »Ich werde fliegen wie Ikarus. Der Sonne entgegen. Aber abstürzen werde ich nicht. Ich nicht!«
Warum nur pochte ihr Herz so laut, dass sie ihre gewisperten Worte kaum verstehen konnte? Wenn sie es heute nicht wagte, müsste sie lange warten, bis sie eine erneute Gelegenheit erhielte. Noch einmal würde die Mutter Johanna nicht glauben, dass diese zu krank für die Frühmesse wäre.
Vorsichtig, als wäre er aus feinstem, zerbrechlichem Porzellan, hob Johanna den ersten Flügel heraus. Mit den Fingern strich sie über den hölzernen Rahmen, tastete nach Fehlern oder Bruchstellen, aber er war perfekt. So wie er sein sollte. Auch sein Zwilling wies keinerlei Fehler auf. Nun gab es keine Ausrede mehr. Jetzt oder nie.
Johanna nahm die Flügel in die Arme und ging zum Fenster, das auf die Remise zeigte. In den letzten Wochen hatte sie alle Möglichkeiten des Absprungs geprüft und war doch immer wieder zum Schuppen zurückgekehrt.
Sein Dach war weniger steil als das des Hauses. Außerdem war er nicht so hoch. Nach einem letzten Zögern öffnete Johanna das halbhohe Fenster. Vorsichtig, damit sie keinen Flügel beschädigte, schob sie das Paar auf das braune Dach der Remise. Geschickt kletterte sie hinterher und hob ihre Flügel auf. Erst steckte sie den rechten Arm in die Lederriemen, dann den linken. Probeweise schlug sie mit den Flügeln. Ja, es fühlte sich richtig an.
Zaghaft trat sie einen Schritt nach vorn, so dass sie über die Dachkante und die Regenrinne blicken konnte. Von unten war ihr der Schuppen gar nicht so hoch erschienen. Von hier oben jedoch wirkte die Erde furchtbar weit entfernt. Johanna schloss die Augen, trat noch einen Schritt nach vorn und noch einen, bis sie keinen Boden mehr unter den Füßen spürte. Hektisch schlug sie mit den Flügeln, fühlte den Wind in ihrem Gesicht und lachte. Laut und glücklich.
»Ich fliege. Ich fliege. Endlich.«
In dem Augenblick flaute der Wind ab, als hätte es ihn nie gegeben.
Johanna trudelte der Erde entgegen, schneller und schneller, so verzweifelt sie auch mit ihren Flügeln schlug. Mit der Schulter voran prallte sie auf dem Rasen auf.
»Der Flug war es wert«, war ihr letzter Gedanke.
Kapitel 1
Kassel, 1971
»Bringst mir ein Bier?«
Am liebsten möchte Lieselotte ihm sagen, dass er sich sein Getränk gefälligst selbst holen kann. Schließlich hat Eduard nichts anderes zu tun, als vor dem Fernseher zu sitzen und darauf zu warten, dass die Tagesschau beginnt. Aber in seiner Welt ist es unvorstellbar, dass ein Mann sich sein Bier holt, wenn er eine Ehefrau hat, die ihn bedienen kann. Vielleicht haben die Frauen ja Recht, die fordern, dass ihnen die Hälfte der Welt gehören soll. Die Frauen, die auf die Straße gehen, um Rechte einzufordern. »Emanzenpack«, nennt Eduard die Demonstrantinnen und gerät in Wut, wenn die Tagesschau mal wieder über sie berichtet.
»Gleich«, antwortet Lieselotte, während sie die Teller zusammenstellt. Sie wirft die Pelle der »Ahle Worschd« in den Mülleimer. Die luftgetrocknete Mettwurst gehört für Eduard zu einem Abendessen einfach dazu. Wehe, wenn Lieselotte vergisst, Bauernbrot oder saure Gurken zu kaufen, die unverzichtbaren Beilagen zur »Ahle Worschd« sind. Als Lokalpatriot trinkt Eduard auch nur Martini-Bier der Brauerei Kropf in der Kölnischen Straße oder der Herkules-Brauerei in der Hafenstraße.
Andere Ehemänner helfen zumindest bei der Hausarbeit mit. Eduard hingegen meint, dass er genug leistet, wenn er das Geld nach Hause bringt. Früher hat er wenigstens ab und zu gesagt, dass ihm das Essen geschmeckt hat. Jetzt essen sie schweigend. Eduard schaufelt alles in sich hinein, als würde er gar nichts schmecken. Zu Beginn ihrer Ehe hat sich Lieselotte noch bemüht, ihn mit neuen Gerichten zu überraschen – Liebe geht schließlich durch den Magen. Aber da ihm nie etwas so gut mundete wie bei seiner Mutter, hat sie es aufgegeben, ihn zu verwöhnen. Wie sie auch vieles andere aufgegeben hat. Nur weil sie eine falsche Entscheidung getroffen hat.
Soll das alles gewesen sein?, fragt sich Lieselotte, während sie noch etwas »Pril« ins Spülwasser gibt. Mechanisch säubert sie die Teller, spült nach und stapelt das Geschirr auf der Spüle. Soll ihr Alltag immer und ewig so weitergehen? Kochen, putzen, fernsehen, kochen, putzen, fernsehen – während draußen das Leben tobt. Erst gestern stand wieder etwas in der Zeitung über die frechen Frauen, die mit wilden Aktionen ihr Recht einfordern. In Frankfurt haben sie ein Go-in im Dom veranstaltet – ein Riesenskandal. In ihrer Heimatstadt, die sie für Eduard und Kassel aufgegeben hatte.
Ob sie sich an den Aktionen der Frauen beteiligt hätte, wenn sie noch in Frankfurt lebte, hat Lieselotte sich gefragt. Wohl nicht, muss sie sich eingestehen. Den Mut hat sie nicht, das weiß sie nur zu gut. Sie ist einfach zu brav, um sich mehr als das zu wünschen, was sie hat. Nein, das stimmt nicht. Wünschen tut sie sich mehr, aber sie wagt es nicht, die Wünsche in die Tat umzusetzen.
»Lieselotte, der Tatort fängt gleich an. Wo bleibt mein Bier?«
Der Tatort. Viel lieber würde Lieselotte den Film im Zweiten sehen, aber bei ihnen zu Hause entscheidet Eduard, welche Sendung im Fernsehen eingeschaltet wird. Eduards Stimme klingt vorwurfsvoll, weil er auf sein Bier warten muss. Wenn er so gelaunt bleibt, wird es ein langer Sonntagabend. Lieselotte trocknet ihre Hände am Geschirrtuch, öffnet den Kühlschrank und holt eine Flasche Bier heraus. Sie sucht ein Glas und den Flaschenöffner, arrangiert alles auf einem Tablett. Dann öffnet sie eine Tüte mit Salzbrezeln, die sie auf einer Schale anrichtet. Ihre Hand greift nach der sonnengelben Verpackung der »Treets«, die sie so gerne nascht. Dann aber hält Lieselotte inne. Erst gestern hat Eduard zu ihr gesagt, dass sie mehr auf sich achten solle. »Twiggy bist du auf keinen Fall.«
Als ob er ein Adonis wäre. Früher sah Eduard gut aus – das haben Lieselottes Kolleginnen jedenfalls gesagt. Ihr ist das nicht so wichtig gewesen, aber nachdem Erika damals gemeint hat, dass Eduard sie an Hellmut Lange erinnere, einen Kommissar der Stahlnetz-Reihe, hat Lieselotte sich die Serie einmal angesehen. Wie der Schauspieler hat auch kantige Gesichtszüge, ein eckiges Kinn und dunkle Haare und Augen. Eduard versucht alles, diese Ähnlichkeit zu betonen, indem er seine Haare so frisiert wie der Schauspieler. Außerdem schaut er jede Serie und jeden Film, in denen Hellmut Lange mitspielt. Inzwischen allerdings machen sich Bier und »Ahle Worschd« bemerkbar und schlagen sich auf seinen Hüften nieder. Rund ist er geworden in den sechs Jahren ihrer Ehe. Rund, aber nicht gemütlich, sondern kühl und lieblos.
Warum nur findet sie nicht die Kraft, ihn zu verlassen? Stattdessen bringt sie ihm das Tablett und bemüht sich um ein Lächeln. Die Mühe hätte sie sich sparen können, weil ihr Ehemann nur Blicke für das Bier und den Fernseher hat.
»Hier, dein Bier. Und ein bisschen was zu knabbern.«
Eduard brummt nur etwas als Antwort. Er schaut Lieselotte gar nicht an, sondern greift nach dem Bier, öffnet die Flasche und gießt die Flüssigkeit in das geschwungene Glas. Der bittere Geruch lässt Lieselotte die Nase rümpfen. Hoffentlich kommt er heute nicht auf die Idee, mit ihr schlafen zu wollen. Seinen Bieratem könnte sie nicht ertragen. Aber sie würde es überstehen, so wie jedes Mal.
Ein Bericht der Tagesschau weckt ihre Aufmerksamkeit. In ganz Deutschland demonstrieren Frauen gegen den Paragraphen 218.
»Wir haben abgetrieben.« Erst hat Lieselotte die ganze Aufregung um das Stern-Titelbild nicht verstanden, aber neugierig war sie doch und hat sich die Zeitschrift gekauft. Die 374 Frauen, die sich dort zu einem Schwangerschaftsabbruch bekannten, gaben damit zu, gegen ein Gesetz verstoßen zu haben. Nun müssen sie mit Konsequenzen rechnen. Ob sie so mutig gewesen wäre?, überlegt Lieselotte. Sie kann nicht einmal sagen, ob sie es falsch oder richtig findet, was diese Frauen gemacht haben. Beide Seiten in dieser Debatte bringen gute Argumente ins Spiel. Schade, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihren früheren Kolleginnen gehalten hat, mit denen hätte sie gerne über die Aktion geredet. Was Eduard davon hält, das hat er deutlich gesagt.
»In den Knast gehören die alle.« Zweifel scheint Eduard nicht zu kennen. Auch jetzt schimpft er wieder.
Als die unverwechselbare Titelmelodie des Tatort beginnt, holt Lieselotte sich den Nähkorb. Sie sucht sich die Socken heraus, die sie während des Krimis stopfen will. So haben ihre Hände etwas zu tun, während ihre Gedanken wandern. Was ist nur los mit ihr? Warum ist sie so unzufrieden? Eduard ist zwar nicht mehr so liebevoll wie vor sieben Jahren, als er um sie geworben hat, aber er ist ein guter Mann. Verdient ordentlich Geld, geht nicht fremd und beschwert sich nicht, dass sie keine Kinder haben. Obwohl er nicht ahnt, dass es Lieselottes Entscheidung war. Vielleicht würde ein Kind ihnen ja helfen. Jemand, den Lieselotte umsorgen, dem sie ihre Liebe schenken kann. Ein Haustier hat Eduard abgelehnt, weil es zu viel Schmutz macht und er keine Lust hat, sich darum zu kümmern. Das hat er jedenfalls gesagt. Lieselotte jedoch hegt den Verdacht, dass Eduard nicht bereit ist, ihre Aufmerksamkeit zu teilen, auch wenn er sie nicht mehr liebt. Falls er sie überhaupt je geliebt hat. Während auf dem Schwarzweißfernseher der Krimi seinen Lauf nimmt, kämpft Lieselotte gegen Tränen an. Sie blinzelt und kann die Socke durch den Tränenschleier kaum noch erkennen. Reiß dich zusammen. Wenn Eduard mitbekommt, wie nah du am Wasser gebaut hast, dann …
»Hol mir noch ein Bier.« Nicht einmal das Wörtchen »bitte« kann er sich noch abringen. Wie konnte sie nur auf die Idee kommen, dass ihr Ehemann erkennen würde, wie unglücklich sie ist.
Ohne etwas zu sagen, steht Lieselotte auf, geht in die Küche und kehrt mit eine Flasche Bier zurück. Kein Wort des Dankes bekommt sie von ihrem Mann zu hören, viel zu sehr ist Eduard auf den Tatort konzentriert. Gerade als Kommissar Finke aus Kiel und sein Assistent Jessner einen Verdächtigen befragen, klingelt das Telefon.
»Eine Unverschämtheit«, grummelt Eduard, während er sich aus dem ledernen Fernsehsessel hievt. »Wer ruft nur mitten im Tatort an?«
Ich könnte an den Apparat gehen, denkt Lieselotte, weil ihr der Krimi egal ist, aber das würde Eduard niemals zulassen.
»Du kannst es klingeln lassen. Wenn es wichtig ist, rufen sie noch einmal an«, schlägt sie stattdessen vor.
»Das Geräusch raubt einem die Ruhe.« Eduard erhebt sich. Nach einem vorwurfsvollen Blick auf Lieselotte, als könnte die etwas für den vorwitzigen Anrufer, geht er ans Telefon.
»Frank!«, blafft er in den Hörer, damit sein Gegenüber zu spüren bekommt, wie unverschämt es ist, sonntagabends um diese Uhrzeit zu stören.
Dann schweigt er.
»Ja, das ist die Mutter meiner Frau.«
Etwas in seinem Tonfall lässt Lieselotte aufhorchen. Sie legt die Socke aus der Hand, streicht sie glatt und steht dann auf. Ihr Herz schlägt schneller. Ihre Mutter ruft nie an. Außerdem haben sie doch erst heute Nachmittag miteinander telefoniert. So wie jeden Sonntag.
»Ja, gut. Auf Wiederhören.« Eduard legt den Hörer vorsichtig auf, als könnte jede hastige Bewegung das Telefon zerbrechen. Er ist blass geworden. So kennt Lieselotte ihn nicht. Angst greift nach ihr. Ihre Kehle fühlt sich trocken an. Sie räuspert sich.
»Ist etwas mit Mutter?« Eduard weicht ihrem fragenden Blick aus. Lieselotte stolpert und greift sich mit der Hand ans Herz. »Sag doch etwas, Eduard. Bitte.«
»Lieselotte.« Noch immer schaut Eduard zu Boden, als könnte er dort Hilfe finden. »Lieselotte.«
Die kalten Finger der Angst halten Lieselotte fest im Griff. »Eduard, bitte sag mir, was geschehen ist.«
Hinter sich hört sie dramatische Musik, ein Zeichen, dass der Tatort sich seinem Höhepunkt nähert. Wieso schweifen ihre Gedanken nur dorthin ab? Noch immer schweigt Eduard. Lieselotte möchte ihn packen, möchte die Informationen aus ihm herausschütteln. Gleichzeitig fürchtet sie sich vor dem, was er sagen wird. Aber lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, wie ihre Großmutter immer sagte. Die Ungewissheit erscheint Lieselotte unerträglich.
»Es gab einen Unfall«, sagt Eduard schließlich. Nicht mehr.
»Was heißt das?« Um Himmels Willen, kann ihr Mann nicht ein einziges Mal etwas konkret und klar sagen? »Was für einen Unfall?«
»Mit dem Auto.« Eduard lässt sich jedes Wort aus der Nase ziehen. »Deine Mutter ist bei jemandem mitgefahren, der mit einem anderen zusammengestoßen ist.«
»Und?« Wieder muss Lieselotte an sich halten, um ihren Ehemann nicht zu schütteln. Wie kann er nur so ruhig über etwas derart Furchtbares reden? »Wie geht es ihr? Hast du mit ihr gesprochen?«
»Amelie liegt im Krankenhaus. Im Markus-Krankenhaus.«
»Ist es schlimm?« Lieselottes Stimme überschlägt sich. Warum nur ist sie nicht ans Telefon gegangen? Dann müsste sie nicht darauf hoffen, dass Eduard endlich zur Sache kommt. Weil immer ihr Ehemann an den Apparat geht. So ist das nun einmal geregelt. »Eduard, bitte.«
»Im Koma. Deine Mutter liegt im Koma.«
Lieselotte taumelt. Suchend tastet ihre Hand nach der Sesselkante. Sie muss sich hinsetzen, weil ihre Beine unter ihr wegzuklappen drohen. Ihr Magen fühlt sich flau an, als müsste sie sich gleich übergeben. Warm wird ihr und kurz darauf eiskalt. Während ihre Hand noch immer nach dem Sessel sucht, verlassen sie ihre Kräfte. Lieselotte rutscht auf den Teppich, ringt nach Luft.
Benommen sieht sie zu Eduard auf, der wiederum auf sie herabsieht, ohne einen Finger zu rühren. Beinahe anrührend wirkt er in seiner offensichtlichen Hilflosigkeit.
»Wasser. Bitte. Ein Glas Wasser«, flüstert Lieselotte mit einer Stimme, die ihr selbst fremd erscheint.
Eduard dreht sich um und marschiert in die Küche, ohne sie auch nur zu fragen, wie es ihr geht.
Obwohl sich in ihrem Kopf alles dreht und sie sich immer noch fühlt, als ob sie gleich das Abendbrot herauswürgen müsste, zieht Lieselotte sich am Sessel hoch. Schwer lässt sie sich in das graue Polster fallen. Sie schließt die Augen.
Mutter. Im Koma. Wie kann das sein? Nicht meine Mutter. Nicht Amelie. Sie ist … sie war doch immer so stark.
»Hier.« Eduard drückt ihr ein halbes Glas Wasser in die Hand.
Beinahe kann er Lieselotte leidtun, wie er so vor ihr steht, ungelenk und hilflos, der Situation nicht gewachsen. Aber dann erwacht der Zorn in ihr. Wenn es andersherum wäre, wenn Eduards Mutter etwas Schlimmes zugestoßen wäre, dann hätte ihr Ehemann erwartet, dass Lieselotte weiß, was zu tun ist. Dass Lieselotte die richtigen Worte findet. Worte des Trosts und des Mitgefühls.
Warum kann ich das nicht von ihm verlangen? Warum habe ich geheiratet, wenn ich in meiner Not dann doch allein bin?
Aber sie schluckt ihren Zorn hinunter, wie schon so oft, und spült mit dem lauwarmen Wasser nach. Langsam fühlt sie sich besser, obwohl ihr der Schreck immer noch in den Gliedern sitzt. Nachdem Lieselotte zweimal tief durchgeatmet hat, steht sie auf. Ein wenig taumelig noch, aber es muss gehen. Mit vorsichtigen kleinen Schritten geht sie auf die Tür zu.
»Wo willst du hin?«
»Nach Frankfurt.«
»Frankfurt ist nicht sicher«, murmelt Eduard. »Erinnerst du dich nicht, dass es im Februar diese Schießerei zwischen Terroristen und der Polizei gegeben hat?«
»Ach ja.« Lieselotte kann sich nicht zurückhalten. Als ob das jetzt wichtig wäre. »Und die beiden Banküberfälle hier in Kassel hast du wohl vergessen?«
»Ich sorg mich ja nur um dich.«
»Wir müssen zu Mutter. Ich packe unsere Koffer.« Ja, so ist es gut. Lieselotte benötigt eine Aufgabe, ein Ziel, damit sie nicht weiter darüber nachdenken muss, was Eduards Worte bedeuten. Damit sie nicht grübelt, was alles mit dem winzigen Wort »Koma« einhergeht. »In einer halben Stunde können wir losfahren.«
»Was denkst du denn? Ich kann nicht mir nichts, dir nichts morgen von der Arbeit wegbleiben.« Lieselotte dreht sich zu ihrem Ehemann um, der den Kopf schüttelt und sie ansieht, als sei sie ein unverständiges Kind. »Du weißt doch, wie ungern ich nachts fahre.«
»Ich muss nach Frankfurt. Es geht um meine Mutter.« Lieselottes Stimme droht sie zu verlassen. Nein, nur nicht weinen. Wenn sie den Tränen erst einmal nachgibt, wird sie nicht mehr aufhören können zu weinen. Das spürt sie. »Ich muss bei ihr sein, wenn sie aufwacht.«
»Du verstehst dich doch gar nicht mit ihr.«
»Das ist jetzt nicht wichtig.« Wie kann er nur so … so stumpf sein? Ihre Mutter liegt im Krankenhaus. Allein. Das muss selbst jemand wie Eduard kapieren. Nun ist unwichtig, ob sie sich mit Amelie versteht oder nicht. Eine Familie steht einander bei, wenn es schlimm wird. »Mutter braucht mich.«
»Sie liegt im Koma, hat der Arzt gesagt.« Eduards Stimme klingt kalt und geschäftsmäßig, als spräche er von jemandem aus dem Fernsehen oder von seiner Arbeitsstelle und nicht von seiner Schwiegermutter. »Da kann man ohnehin nicht viel machen. Es genügt, wenn du morgen früh fährst.«
Ungläubig schaut Lieselotte ihren Ehemann an. Das kann er nicht ernst meinen. Haben sie nicht vor Gott und der Welt geschworen, einander in guten wie in schlechten Tagen zur Seite zu stehen? Sein demonstratives Desinteresse, seine Unfähigkeit, ihr zu helfen, lässt Lieselotte verstummen. Sie verspürt nicht einmal mehr Zorn, nur Müdigkeit und den Wunsch, allein zu sein. Nun endlich kann sie ihre Augen nicht mehr vor der Wahrheit verschließen. Ihre Ehe ist nur eine Fassade, die vom kleinsten Windstoß umgeweht werden kann. Einen Sturm, wie den Unfall ihrer Mutter, verträgt diese Ehe erst recht nicht. Aber was das für sie bedeutet, darüber kann und will Lieselotte jetzt nicht nachdenken.
»Ja«, hört sie sich sagen, tonlos, als brächte selbst ihre Stimme keine Kraft mehr auf. »Ja, du hast wohl recht. Ich gehe ins Bett und werde morgen früh mit dem Zug fahren.«
»Dann ist es ja gut.« Eduard bemüht sich um ein Lächeln und tätschelt ihr die Schulter. Trotzdem kann Lieselotte nicht umhin zu bemerken, dass er an ihr vorbei auf den Fernsehschirm starrt. Wenn sie jetzt geht, kann er noch in Ruhe den Tatort zu Ende schauen. »Soll ich dich zur Bahn bringen?«
»Lass gut sein.« Lieselotte geht zur Tür, setzt einen Fuß vor den anderen. Nur nicht nachdenken, nicht zweifeln, einfach weiter funktionieren. »Du musst ja zur Arbeit.«
Nachdem sie sich gewaschen und sich die Zähne geputzt hat, schlüpft Lieselotte in ihr Flanellnachthemd. Sie legt sich auf die Bettdecke und starrt nach oben an die holzgetäfelte Decke. Ihr Kopf fühlt sich leer an, ihr Herz noch leerer.
Ich muss den Nähkasten noch wegräumen, denkt sie. Ich kann nicht nach Frankfurt fahren und die Wohnung unordentlich zurücklassen. Wer weiß, wann ich wieder zurückkomme.
Kapitel 2
Kassel, 1971
»Grüß Amelie von mir, wenn sie wach ist«, hat Eduard heute Morgen gesagt, bevor er zur Arbeit gegangen ist. Das Frühstück haben Lieselotte und er schweigend hinter sich gebracht. So wie jeden Morgen. Als wäre nichts Besonderes geschehen. »Alles Gute für sie. Das wird schon wieder.«
»Danke.« Mehr hat Lieselotte nicht sagen können. Ihre Enttäuschung hat sie heruntergeschluckt wie eine bittere Medizin. »Ich rufe an, wenn ich weiß, wie lange ich in Frankfurt bleibe.«
Nun steht sie im Schlafzimmer, hat den hellbraunen Koffer geöffnet auf die Tagesdecke gelegt und sucht sich die Kleidung für ihre Reise zusammen. Erst einmal hat sie den Koffer abstauben müssen. Viel zu lange hat er ungenutzt auf dem Dachboden gestanden. Wie lange will sie bleiben? Wie viel soll sie einpacken? Vielleicht ist es doch klüger, erst einmal mit dem Krankenhaus zu telefonieren, um herauszufinden, wie es um Amelie steht. Nachher ist alles nicht so schlimm, und Lieselotte macht sich lächerlich, weil sie Hals über Kopf nach Frankfurt gefahren ist. Und das alles für Amelie, die sich wahrscheinlich nicht einmal darüber freuen wird, dass Lieselotte extra aus Kassel angereist ist. Sie ist meine Mutter, sagt Lieselotte sich. Es gehört sich einfach, dass ich zu ihr fahre, wenn sie im Krankenhaus liegt.
Wie lange steht sie nun schon vor der geöffneten Schranktür und starrt auf ihre Blusen und Röcke, die ordentlich aufgereiht dort hängen? Wann hat sie das letzte Mal einen Koffer gepackt, fragt sich Lieselotte, die sich immer noch nicht aufraffen kann, sich für die Kleidungsstücke zu entscheiden, die sie mitnehmen will. Braucht sie eine Strickjacke für abends? Soll sie für ein paar Tage packen oder für länger?
Vor drei Jahren sind Eduard und sie eine Woche in den Harz gefahren. Da hat Lieselotte den Koffer gebraucht. Allein verreist ist sie noch nie. Vielleicht haben die jungen Frauen doch recht, die fordern, dass jede Frau ein eigenständiges Leben führen sollte. Immerhin hat Lieselotte ein wenig eigenes Geld. Auf einem Postsparbuch, von dem Eduard nichts weiß. Eines ihrer kleinen Geheimnisse, mit denen sie ihn für seine Lieblosigkeit bestraft. Endlich kann sie sich bewegen, greift wahllos einen Arm voll Blusen heraus. Sorgfältig legt sie die Oberteile zusammen, bevor sie sie übereinander neben den Koffer stapelt. Unten gehören die schweren Stücke hinein. Die Röcke und Hosen. Drei dunkelblaue Hosen mit scharfen Bügelfalten und zwei Röcke, einen grauen und einen braunen, packt Lieselotte in den Koffer. Nun die Unterwäsche, Strümpfe, Perlonstrumpfhosen und die Kulturtasche, und sie ist beinahe reisefertig.
Jetzt fehlt nur noch eines. Lieselotte öffnet die Schmuckschatulle, nimmt die Packung »Anovlar« aus ihrem Versteck. Noch vier Tabletten muss sie nehmen. Das darf sie auf keinen Fall vergessen. Nachdem alles verstaut ist, setzt sich Lieselotte neben den Koffer auf ihr Bett. En wenig mulmig ist ihr zumute. Allein mit dem Zug zu fahren und mit den Ärzten zu sprechen, erscheint ihr auf einmal als unlösbare Aufgabe. Vielleicht sollte sie heute Abend mit ihrem Mann reden und Eduard bitten, dass er am Wochenende mit ihr zusammen nach Frankfurt fährt. Ihr Blick fällt auf das Hochzeitsfoto, das auf dem Nachttischchen steht. Eduard in dunklem Anzug, sie in einem hellen Kostüm. Beide schauen sie ernst und auch etwas verwundert in die Kamera, als könnten sie es nicht fassen, dass sie einander gerade geheiratet haben.
»Wir haben abgetrieben« – das haben letzte Woche Frauen im Stern bekannt, und Lieselotte bringt nicht einmal den Mut auf, ohne ihren Ehemann nach Frankfurt zu fahren. Warum kann sie ihre Reise nicht als Abenteuer begreifen, sondern ängstigt sich davor? Mutter wäre sofort angereist, wenn mir etwas Schlimmes passiert wäre. Außerdem kann ich so endlich wieder einmal ein paar Tage zu Hause verbringen. Zu Hause – das ist für sie immer noch Frankfurt. Der Gedanke gibt Lieselotte die Kraft, aufzustehen, den Koffer zu nehmen, ihren Sommermantel anzuziehen und die Haustür hinter sich abzuschließen.
Die vier Kinder der Familie, die erst vor kurzem nebenan eingezogen ist, spielen vor dem Mietshaus, in dem Eduard und Lieselotte wohnen. Wild laufen sie durcheinander und schreien. Erst als ein Mädchen mit roten Haaren sie beinahe umrennt, versteht Lieselotte die Worte. Sie schüttelt den Kopf. Die Kinder spielen Baader-Meinhof und Polizei, so wie Lieselotte früher Räuber und Gendarm gespielt hat. Ist kein Wunder, dass die Kinder sich so etwas ausdenken, meint sie, als sie an der Litfaßsäule vorbeikommt, an der das Fahndungsplakat der Baader-Meinhof-Bande klebt. Die linke Ecke hat sich gelöst und verdeckt das Gesicht von Ulrike Meinhof. Auch der Text ist nur halb zu sehen, aber Lieselotte hat das Plakat so oft gesehen, dass sie den Text beinahe auswendig kann: Anarchistische Gewalttäter – Baader-Meinhof-Bande – Wegen Beteiligung an Morden, Sprengstoffverbrechen, Banküberfällen und anderen Straftaten werden steckbrieflich gesucht …
Noch vor einem halben Jahr hat sie gedacht, dass sie in Kassel sicher ist, dass die Terroristen nur in den großen Städten ihre Verbrechen begehen. Doch im Januar hat die Bande hier eine Bank überfallen. Auf einmal war die Gefahr nah. Etwas, was man sonst nur in der Tagesschau sieht, hat sich vor der eigenen Haustür ereignet.
»An die Wand stellen sollte man die«, hat Eduard gesagt, der zu allem stets eine eindeutige Meinung vertritt. »Eine Schande, dass die Polizei die immer noch nicht erwischt hat.«
Lieselotte hat geschwiegen. So wie sie immer den Mund hält, wenn Eduard sich über Politik auslässt. Selbst wenn er Willy Brandt beschimpft, den Lieselotte eigentlich ganz gern mag. Eduard meint, dass sie sich nicht für Politik interessiert. Niemals käme er auf die Idee, dass seine Frau nur nicht mitihm über das Tagesgeschehen reden will. Weil er sowieso keine Meinung außer seiner eigenen gelten lässt.
»Halt die Augen offen«, hat Eduard abschließend gesagt. »Die hunderttausend Mark Belohnung kämen mir gerade recht.«
Ob Zugfahren noch sicher ist?, fragt sich Lieselotte, während sie ihren Koffer einen Augenblick abstellt. Ihr Blick sucht nach Anzeichen in den jungen Gesichtern auf den Plakaten, dass die Frauen und Männer wirklich gefährliche Anarchisten sind. Aber sie sehen aus wie viele andere auch. Ich würde sie wahrscheinlich nicht einmal erkennen, wenn ich sie sehe. Belohnung hin oder her.
Ein Blick auf die Uhr zeigt Lieselotte, dass noch Zeit bleibt, bis ihr Zug fährt. Daher steigt sie am Königsplatz aus der Straßenbahn, um einen Blick in die Schaukästen des Kaskade-Kinos zu werfen. Vielleicht kann sie Eduard ja überreden, gemeinsam dorthin zu gehen, wenn Lieselotte aus Frankfurt wieder zurück ist. Eduard mag das Fernsehen, das »Heimkino« lieber, weil ihn da keine Fremden stören. Lieselotte hingegen liebt die Wasserspiele, die im »Kaskade« vor Beginn des Films stattfinden.
Ein Mädchen, wohl zwölf Jahre alt, kommt ihr entgegen. In der Hand hält es eine Glasflasche mit »Kwatsch«. Lieselotte erkennt die typische rote Farbe des Getränks und die Glaskugel, die den Flaschenhals verschließt. Auf einmal bekommt sie Durst auf die Limonade, obwohl sie weiß, wie süß sie schmeckt. Aber sie entscheidet sich dagegen und macht sich auf den Weg zum Bahnhof.
Obwohl sie getrödelt hat, ist Lieselotte zu früh am Bahnhof angekommen. Sie kauft sich eine Fahrkarte und geht zum Gleis, damit sie ihren Zug nicht verpasst. Noch kann ich umkehren. Ist zwar schade um das Geld, aber davon muss ich Eduard ja nichts erzählen. Schließlich ist es mein Geld.
»Bin ich hier richtig für den Zug nach Frankfurt?«, fragt sie eine junge Frau, deren gelangweilter Gesichtsausdruck Lieselotte den Eindruck vermittelt, dass sie eine erfahrene Reisende ist. Hot Pants trägt sie, wie es die Mode vorschreibt, so kurz, dass Lieselotte aufpassen muss, dem Mädchen nicht auf die Beine zu starren. »Kennen Sie sich aus?«
»Ja. Und ja.« Der Blick, mit dem die junge Frau sie mustert, ist wenig freundlich. »Frankfurt stimmt.«
»Danke«, sagt Lieselotte und tritt zur Seite, weil ihr das Mädchen eindeutig signalisiert, dass es kein Interesse an einem weiteren Gespräch hat. Sie setzt sich auf eine Bank, den Koffer neben ihren Knien, und wartet auf den Zug. Endlich fährt er ein. Erstaunlich wenig Menschen steigen ein, so dass Lieselotte ein Abteil für sich allein hat.
Zwei Stunden hat sie nun Zeit, bis sie in Frankfurt eintreffen wird. Zwei Stunden, in denen sie ihre Gedanken sortieren kann. Zwei Stunden, in denen sie ihren Zorn bändigen kann. Nachdem Lieselotte vorhin die Haustür hinter sich abgeschlossen hat, hat sie sich einen Augenblick lang gefragt, wie es wohl wäre, wenn sie nicht nur für ein paar Tage ginge, sondern für immer. Einfach die Tür hinter sich schließen und niemals zurückkehren. Eduard verlassen und ein neues Leben beginnen. Ob er überhaupt bemerken würde, dass sie nicht mehr da ist? Spätestens dann, wenn der Kühlschrank leer ist, hat sie gedacht und sich über die Bitterkeit ihrer Gedanken erschreckt.
Nachdem sie ihren Koffer verstaut hat, setzt Lieselotte sich auf die unbequeme Bank des Zugabteils. Die dunkelroten Polster sind durchgesessen und schmuddelig. Um sich abzulenken, blättert sie in der Brigitte, die sie in der Bahnhofsbuchhandlung gekauft hat. Aber ihre innere Unruhe ist so groß, dass sie sich nicht auf die Bilder schlanker, modisch gekleideter Frauen konzentrieren kann. Noch immer meint sie zu träumen. Amelie im Krankenhaus. Ein Autounfall. Ihre Mutter ohne Bewusstsein, hat der Arzt gesagt. Mehr hat Eduard Lieselotte nicht berichten können, weil er nicht nachgefragt hat.
Lieselotte hätte selbst im Krankenhaus anrufen können, aber sie telefoniert nicht gern. Außerdem hat sie befürchtet, dass sie in Tränen ausbrechen wird, sollte der Arzt eine schlimme Prognose abgeben. Sie ist sich sicher, dass sie schlechte Nachrichten besser ertragen kann, wenn sie dem Doktor direkt gegenübersteht. Nervös knetet sie ihre Finger. Sie schaut aus dem Fenster des Zuges, ohne die Landschaft wirklich wahrzunehmen. Zu groß ist ihre Sorge, wie schlimm es um ihre Mutter wohl steht. Amelie, die immer so stark und unverwundbar wirkte. Lieselotte kann sich ihre Mutter nicht schwach und hilflos vorstellen.
Ich muss träumen. Gleich wird der Wecker klingeln, und ich werde erwachen. Mutter kann nicht krank sein. Nicht Mutter. Nicht jetzt. Nicht bevor ich sie fragen kann, was es mit meinem Vater auf sich hat. Ob sie wirklich nichts gewusst hat. Von damals. Wenn sie nicht wieder aufwacht, kann ich Mutter nie sagen, wie unglücklich ich bin. Wie unglücklich ich immer war. Ob ich aber den Mut aufbringe, ihr das zu beichten, wenn sie erwacht?
Wie lange kann ich in Frankfurt bleiben, bis Eduard sich aufregt?
Das kann mir jetzt auch egal sein. Wenn es ihn nicht einmal interessiert, dass Mutter ohne Bewusstsein ist. Warum soll ich mit ihm verheiratet bleiben, wenn ich mich in der Not nicht auf ihn verlassen kann?
Der Zug fährt in einen Bahnhof ein und hält an. Lieselotte sieht Menschen ein- und aussteigen und beneidet die Fremden darum, dass sie angekommen sind. Immer wieder ertappt sie sich bei der Frage, ob sie ihre Ehe wirklich weiterführen will. Wie von selbst legt sich ihre Hand an die Kehle, es fühlt sich an, als würde jemand sie ersticken. Wenn meine Mutter stirbt, bleibt mir nur Eduard. Besser eine lieblose Ehe als die Einsamkeit.
Endlich fährt der Zug in Frankfurt ein. Obwohl sie seit sechs Jahren mit Eduard in Kassel lebt, fühlt Lieselotte sich hier zu Hause, auch wenn die Stadt sich in den letzten Jahren sehr verändert hat. Lieselotte staunt über die vielen Baustellen, an denen die Straßenbahn vorüberfährt. Nach kurzer Fahrt hat sie das Markus-Krankenhaus in der Wilhelm-Epstein-Straße erreicht. Vor der Eingangstür bleibt Lieselotte stehen, um Atem zu holen. Während der Zugfahrt hat sie viele Möglichkeiten im Kopf durchgespielt, aber noch immer fühlt sie sich für schlechte Nachrichten nicht ausreichend gewappnet.
Aber es muss sein. Vom Pförtner erfährt Lieselotte die Station, auf der ihre Mutter liegt. Mit müden Schritten geht sie die hellgrün gestrichenen Gänge entlang, bis sie ihr Ziel erreicht hat.
»Es tut mir leid.« Das junge Mädchen im weißen Kittel einer Krankenschwester schaut Lieselotte voller Mitgefühl an, als meine sie jedes Wort ernst. »Aber die Besuchszeiten sind vorbei.«
»Kann ich dann wenigstens mit dem Arzt sprechen, bitte?« Lieselotte kommt sich dumm vor, wie sie hier auf dem Flur steht. In ihrem besten Mantel, denn schließlich hat sie eine Reise in die große Stadt angetreten, neben sich den hellbraunen Koffer. Vernünftig wäre es gewesen, das Gepäck irgendwo abzustellen. Oder wenigstens vorher im Krankenhaus anzurufen und sich zu erkundigen, wann Besuchszeiten sind. Wie ein kopfloses Huhn ist Lieselotte losgeflitzt, aufgeschreckt von der Nachricht, dass ihre Mutter den Unfall hatte. Eduard hat wohl recht damit, dass Lieselotte jemanden braucht, der sich um sie kümmert. Ohne ihn fühlt sie sich verloren, steht der Krankenschwester hilflos gegenüber.
»Tut mir leid«, sagt das Mädchen wieder. »Da müssen Sie morgen früh zur Besuchszeit kommen. Dann hat der Doktor bestimmt Zeit für Sie.«
Lieselotte spürt, dass ihre Unterlippe zittert. Ihre Augen füllen sich mit Tränen, so sehr sie dagegen auch ankämpft. Es kann nicht sein, dass sie ihre Mutter heute nicht mehr sieht. Ausgerechnet jetzt, wo sie sich das erste Mal in ihrer Ehe gegen Eduard aufgelehnt hat. Wenn sie jetzt scheitert, dann …
»Bitte, wie geht es meiner Mutter?« Lieselottes Nase ist verstopft, und sie schnieft. Was für ein Bild sie wohl abgibt? Was soll die Krankenschwester nur von ihr denken? »Kann ich sie wenigstens kurz sehen?«
Die junge Frau, auf deren Namensschild Alix steht, schüttelt den Kopf. Bedauernd.
»Alix.« Lieselotte versucht zu lächeln. Sie möchte sich mit der jungen Krankenschwester gut stellen, damit diese sich gern um Amelie kümmert. »Ein ungewöhnlicher Name.«
»Ja, da leide ich auch darunter.« Das hübsche blonde Mädchen, dessen Haut vor Jugend und Gesundheit strahlt, hebt die Hände. »Meine Oma hieß so. Mama hat sie sehr bewundert.«
»Und Sie?« Das Gespräch mit der Krankenschwester lenkt Lieselotte von ihren Sorgen ab. »Mögen Sie Ihre Großmutter?«
»Gehen Sie rein. Eigentlich darf ich das nicht.« Sanft fasst Schwester Alix Lieselotte am Arm und dirigiert sie vor sich her zum letzten Zimmer im Flur. »Schauen Sie kurz hinein und sagen Ihrer Mutter guten Tag, aber bitte beeilen Sie sich.«
Lieselotte bewegt sich nicht, weil sie nicht glauben kann, dass die junge Frau gegen die Regeln verstößt.
Ängstlich blickt Schwester Alix über ihre Schulter. »Wenn die Oberschwester zurückkommt, bekomme ich Ärger.«
»Danke«, flüstert Lieselotte. Die Freundlichkeit tut ihr gut. Verstohlen öffnet sie die Tür und späht ins Krankenzimmer. Zwei Betten stehen dort. Das vorn an der Tür ist leer. Im zweiten, dicht am Fenster, liegt eine schmale Gestalt, in der Lieselotte erst auf den zweiten Blick ihre Mutter erkennt. Amelies Kopf ist mit weißen Bandagen umwickelt, die ihr Haar bedecken und bis unters Kinn reichen. Wie eine Mumie sieht sie aus, schießt es Lieselotte durch den Kopf. Sofort schämt sie sich für diesen Gedanken. Im Zimmer hängt der typische Krankenhausgeruch nach Desinfektionsmitteln und Bohnerwachs, der Lieselotte zum Würgen reizt, als sie langsam auf das Bett zugeht. Einen Fuß setzt sie bedächtig vor den anderen, als müsste sie eine Eisenkugel hinter sich her schleifen.
Ich muss mich sputen, damit Schwester Alix nicht meinetwegen Ärger bekommt.
Obwohl sie dieser Gedanke nicht loslässt, bleibt Lieselotte erst einmal stehen. Sie streckt die linke Hand aus, aber noch ist sie nicht nah genug am Bett, um ihre Mutter berühren zu können. In Amelies Arm steckt ein Schlauch, der zu einem Tropf mit einer hellen Flüssigkeit führt. Das rechte Bein der Mutter ist eingegipst und hängt in einem Streckverband. Hinter dem Bett stehen mehrere Kästen und Geräte, von denen Drähte zum Körper ihrer Mutter führen. Lieselotte starrt auf die Kurven und das helle Flackern auf den Bildschirmen - nur um Amelie nicht ansehen zu müssen.
»Frau Reichard«, hört sie Schwester Alix’ Stimme. Sie klingt drängend. »Bitte. Kommen Sie.«
»Ich heiße Frank«, erwidert Lieselotte automatisch. »Reichard ist der Name meiner Mutter. Einen Moment noch, bitte.«
Durch Schwester Alix’ Drängen ist Lieselotte aus der Starre erwacht. Mit zwei Schritten tritt sie ans Bett und streicht über die Hand ihrer Mutter. Entsetzlich bleich sieht sie aus, so als hätte Amelie bei dem Unfall viel zu viel Blut verloren. Und kalt fühlt die Hand sich an, wie die Hand einer Toten.
»Mama«, flüstert Lieselotte. »Mama, ich bin da.«
Wie lange ist es her, dass sie ihre Mutter »Mama« genannt hat? Schon als kleines Kind hat Lieselotte erkannt, wie wenig dieses Kosewort zu der starken Frau passte, die sie großgezogen hat. Alles, was in Lieselottes Leben weich und liebevoll war, hat sie ihrer Großmutter zu verdanken – Oma Luise. Ohne die wäre Lieselottes Kindheit freudlos und einsam gewesen. Nach Oma Luises Tod hatten sich Amelie und Lieselotte eher noch weiter voneinander entfernt, beide gefangen in der Trauer. Unfähig, eine Brücke über die Traurigkeit zu bauen, die sie einander hätte näher bringen können. Jetzt wünscht Lieselotte sich, sie hätte es gewagt, einen Schritt auf ihre Mutter zuzugehen, aber zu stark war die Angst vor Ablehnung gewesen.
Kurz streicht Lieselotte noch einmal über die leblose Hand ihrer Mutter. Dann dreht sie sich um, streckt den Rücken und rafft alle Kraft zusammen, die sie in sich finden kann. Amelie würde es nicht gutheißen, wenn ihre Tochter sich schwach zeigte. Schwäche war und ist ihrer Mutter verhasst.
»Es war Krieg. Wer nicht kämpfen konnte, hatte schon verloren«, hat ihre Mutter einmal gesagt, nachdem Lieselotte weinend und auf Trost hoffend früher aus der Schule nach Hause gekommen war, weil eines der anderen Mädchen gemein zu ihr gewesen war. »Wenn du jetzt wegläufst, wirst du dein Leben lang weglaufen. So eine Tochter will ich nicht.«
Also biss Lieselotte die Zähne zusammen und ging zurück zur Schule. Von diesem Tag an versuchte sie niemals wieder, die Unterstützung ihrer Mutter zu erlangen, sondern focht jeden Kampf allein aus, egal, wie schmerzhaft es sein mochte. Eigentlich sollte ich gut auf die Einsamkeit vorbereitet sein. Warum also fürchte ich mich so davor, dass meine Mutter stirbt?, denkt Lieselotte und wendet sich um. An der Tür bleibt sie kurz stehen und wirft noch einen Blick über ihre Schulter. Noch immer fällt es ihr schwer, in der zarten, bewegungslosen Gestalt ihre starke Mutter zu erkennen.
»Vielen Dank.« Lieselotte nickt Schwester Alix zu. Morgen muss sie der jungen Frau Blumen mitbringen oder Pralinen – zum Dank. »Auf Wiedersehen.«
»Bis morgen.« Schwester Alix erwidert Lieselottes Gruß. Ihr Gesicht wirkt so ernst, dass sich der Schrecken erneut auf Lieselotte senkt. »Seien Sie gegen neun hier. Da hat der Doktor bestimmt Zeit für Sie.«
»Vielen Dank.« Lieselotte leckt sich die trockenen Lippen. Es fühlt sich wie ein Aufschub an, dass sie erst morgen die Wahrheit erfahren wird.
Kapitel 3
Frankfurt am Main, 1971
Vom Krankenhaus aus fährt sie mit der Straßenbahn nach Bockenheim. Die Nähe fremder Menschen hilft Lieselotte, ihre Tränen zurückzudrängen. Niemand soll erfahren, wie schlecht es ihr geht. Niemals die Gefühle nach außen tragen – das ist das Credo ihrer Mutter. Obwohl Lieselotte unter der Härte und der Kälte ihrer Mutter gelitten hat, trägt sie wohl mehr von Amelie in sich, als sie je zugeben möchte. In der Öffentlichkeit kann sie ihre Empfindungen so gut verbergen, dass sie selbst manchmal nicht mehr weiß, was sie fühlt. So auch jetzt nicht. Nach dem ersten Schrecken über die Leblosigkeit der Mutter spürt Lieselotte … gar nichts mehr. So sehr sie auch in sich hineinlauscht, es ist, als wäre sie taub und kalt. Als wäre etwas in ihr gestorben. Wenn nur Luise noch lebte, dann könnte Lieselotte mit ihr reden, könnte sich vergewissern, dass ihre Gefühle zurückkehren werden.
Klick. Klack. Lieselotte zuckt zusammen, als der Lärm von »Prallis« sie aus ihren Gedanken reißt. Ein dicker Junge schlägt die Kugeln zusammen, als bekäme er Geld dafür. Den Menschen, der die Klicker-Kugeln erfunden hat, sollte man dazu zwingen, einen Tag lang Straßenbahn zu fahren, damit er am eigenen Leib erfährt, was für einen infernalischen Lärm diese Dinger machen. Immerhin konzentriert sie sich jetzt auf etwas anderes.
Nachher werde ich Eduard anrufen.
Als ob ich mit ihm darüber sprechen könnte.
Als ob er mich verstehen könnte.
Sie stößt ein bitteres Lachen aus, das ihr einen erstaunten Blick der Frau auf dem Sitzplatz gegenüber einbringt. Als Lieselotte entschuldigend lächelt, löst dies bei ihrem Gegenüber nur ein Schulterzucken aus. Dann wendet die Frau den Blick ab, als wäre Lieselottes Benehmen ihr peinlich.
Dann eben nicht, liebe Tante. Dann nehmen wir den Onkel. Das ist auch ein schöner Mann.
Nun lächelt Lieselotte, in Erinnerung an Luise, die diesen Spruch so oft zum Besten gab. Auch weil ihre Großmutter wusste, wie sehr Amelie sich jedes Mal über diese Lebensweisheit ärgerte. Als Kind hat Lieselotte ihrer Oma diesen Spruch nachgeplappert, obwohl sie nicht begriffen hat, was er eigentlich bedeutet. Großmutter und Enkelin haben sich dann angegrinst, während Amelie nur den Kopf schüttelte: »Mama, du sollst der Kleinen nicht so einen Blödsinn beibringen.«
Lieselotte ist so tief in ihren Erinnerungen versunken, dass sie beinahe die Haltstelle verpasst. Eilig springt sie auf, greift nach dem Koffer und rempelt aus Versehen die Frau ihr gegenüber an, die empört den Kopf schüttelt.
»Entschuldigung«, stammelt Lieselotte und stolpert erneut.
»Ja ja, aber passen Sie wenigstens jetzt auf«, lautet die patzige Antwort.
Lieselotte lächelt noch einmal schuldbewusst und steigt aus. Die wenigen Schritte bis zum Haus, in dem ihre Mutter wohnt, kommen ihr viel zu kurz vor. Gerne würde sie es hinauszögern, die leere Wohnung zu betreten. In dem Beet vor dem Achtparteienhaus blühen Studentenblumen, gelb-orangefarbene Farbtupfer vor dem Grau der Fassade und dem anthrazitfarbenen Gehweg. Lieselotte bleibt vor der Haustür stehen. In ihrer Handtasche sucht sie nach dem Schlüssel, den ihr die Mutter vor Jahren für Notfälle gegeben hat.
»Was für ein Quatsch!«, hat Eduard damals gesagt. »Sollen wir etwa für jeden Kieks und Kaks extra aus Kassel anreisen? Es muss ja wohl in Frankfurt jemanden geben, dem deine Mutter ihren Schlüssel geben kann.«
»Es gehört sich so.« Nur dieses eine Mal hat Lieselotte sich gegen ihren Ehemann aufgelehnt. »Mutter wird uns bestimmt nicht wegen Kleinigkeiten stören.«
Ein Schauder läuft über ihren Rücken, als sie sich an den Streit erinnert. Hier und jetzt kommt es Lieselotte so vor, als habe sie damals bereits geahnt, dass sie den Schlüssel einmal benötigen wird. Um sich abzulenken, studiert sie die Klingelschilder, während ihre Finger sich um den kalten Stahl des Schlüssels legen. Ein paar neue Namen entdeckt sie, nur Frau Schiller wohnt immer noch in der Wohnung im Erdgeschoss rechts. Wie alt ist die wohl inzwischen? Schon als sie noch ein Kind war, kam es Lieselotte vor, als wäre Frau Schiller bereits hundert Jahre alt. Mit den vielen Falten, dem grauen Haar, das sie zu einem festen Dutt aufgesteckt trug, und der großen Warze am Kinn war Frau Schiller ihr immer wie die böse Hexe aus Grimms Märchen erschienen.
Dass Frau Schiller das Geschehen im Mietshaus mit Argusaugen beobachtete und jede noch so kleine Verfehlung Lieselottes sofort an deren Mutter weitergab, trug nicht dazu bei, dass das Mädchen die Alte besser leiden konnte. Wahrscheinlich war Frau Schiller nur einsam, erklärt sich Lieselotte das Verhalten der Mieterin heute, aber selbst bei allem Verständnis geht sie der Frau lieber aus dem Weg.
Automatisch tritt Lieselotte sich die Schuhe an der Fußmatte ab, als sie das Miethaus betritt. Die grauen Steinfliesen des kleinen Flurs wirken sauber, als hätte sie vor wenigen Minuten jemand feucht gewischt. Wie schon in ihrer Kindheit rümpft Lieselotte die Nase über den Geruch nach Reiniger und Erbsensuppe, der so intensiv ist, als wäre er zusammen mit der Farbe auf die Wände aufgetragen. Im letzten Jahr ist die Holztreppe gestrichen worden. Statt des dunklen Brauns, das Lieselotte ihr Leben lang kannte, ist sie jetzt von einem tiefen Jägergrün, was nicht so recht zu den hellgrauen Stufen passen will. Lieselotte atmet tief durch, bevor sie ihren Koffer anhebt und die Treppe bis zum zweiten Stock hinaufsteigt. An der Wohnungstür hängt ein ebenfalls hellgraues Schild an einem Nagel. Kleine Kehrwoche steht darauf.
Nicht das auch noch, denkt Lieselotte. Dafür habe ich jetzt gar keinen Kopf!
Aber sie wird ihrer Pflicht nachkommen müssen, sonst gibt es bestimmt Ärger mit Frau Schiller. Manche Dinge ändern sich nie – darauf würde Lieselotte wetten.
Die Wohnung wirkt leer und unbewohnt. Nein, das muss sie sich wohl einbilden. Schließlich liegt ihre Mutter erst seit gestern im Krankenhaus. In der kurzen Zeit vereinsamt ein Zuhause noch nicht. Lieselotte bleibt im Türrahmen stehen, weil sie sich wie ein Eindringling fühlt. Ob ihre Mutter damit einverstanden wäre, dass sie mir nichts, dir nichts hier ihr Quartier aufschlägt?
Doch was denkt sie da nur? Schließlich haben sie beide hier lange gemeinsam gewohnt. Zwanzig Jahre lang haben Lieselotte und ihre Mutter die Wohnung geteilt, sieben Jahre davon hat auch noch die Großmutter bei ihnen gewohnt. An ihre erste gemeinsame Wohnung in Frankfurt erinnert Lieselotte sich nur dunkel, überwiegend aus den Erzählungen ihrer Mutter. Ausgebombt worden sind sie, so dass sie nach Kriegsende hier einzogen sind. Drei Frauengenerationen.
Nach Luises viel zu frühem Tod hat Lieselotte sich in der kleinen Dreizimmerwohnung einsam gefühlt. Einsam und voller Sorge, dass sie bis an ihr Lebensende in diesem Achtparteienhaus wohnen müsste. In dem Haus, das immer nach scharfem Reiniger stinkt, als habe jemand gerade erst vor fünf Minuten die große Hauswoche erledigt. Diese Angst hat Lieselotte dazu gebracht, mit Eduard auszugehen, den ihr eine Arbeitskollegin vorgestellt hat.
Schön war es damals. Im Büro. Mit den anderen Frauen. Auch wenn die Arbeit selbst weder anspruchsvoll noch interessant war. Auch wenn Karl, der einzige Mann im Büro der Baufirma, am wenigsten arbeitete und beinahe doppelt so viel Geld bekam wie Lieselotte und deren Kolleginnen Ilse und Erika. Trotzdem hat es Spaß gemacht. Mit Ilse und Erika hat Lieselotte sich wohl gefühlt. Gemeinsam haben sie sich hinter Karls Rücken über ihn lustig gemacht, wenn er sich wieder als kleiner Chef aufgespielt hat. Gemeinsam haben sie bei der Postfiliale angerufen, wo der Mann gearbeitet hat, den sie nur vom Telefon kannten. Seine Stimme, schmelzender als die eines Schlagersängers, hat sie alle drei verzaubert. An einem Freitagnachmittag sind sie zu dritt in die Postfiliale gefahren, um sich den Mann anzuschauen.
Klein war er, mit Bauchansatz und beginnender Glatze.
»Wir hätten uns den Traum bewahren sollen«, hat Erika gesagt, nachdem sie das herausgefunden hatten. »Vielleicht ist träumen besser, als die Wahrheit zu suchen.«
»Was ist denn mit dir los?«, hat Ilse gesagt und ihrer Freundin einen Vogel gezeigt. »Hast du wieder einen Roman gelesen?«
Viel zu schnell war die schöne Zeit vorüber gewesen. Erst hat Erika geheiratet, dann Ilse, so dass Lieselotte allein zurück geblieben war. Sicher, es haben neue Sekretärinnen angefangen, aber die waren jünger, viel jünger. Lieselotte war es immer so vorgekommen, als schauten die jungen Dinger sie mit einer Mischung aus Mitgefühl und Arroganz an, weil Lieselotte Ende Zwanzig war, bei ihrer Mutter lebte und keinen Freund hatte.
Torschlusspanik – so nennt man das wohl, was Lieselotte dazu bewogen hat, mit Eduard auszugehen, sich von ihm küssen zu lassen, obwohl sie sich vor seiner breiten, feuchten Zunge geekelt hat. Die Angst, übrig zu bleiben, hat Lieselotte dazu veranlasst, Eduards Antrag anzunehmen, auch wenn sie ihm so gar nichts zu sagen hatte. Obwohl sie sich weder für Motorräder noch für Fußball interessierte. Für die beiden Themen also, über die Eduard stundenlang reden konnte. Als Lieselotte ihn gefragt hat, welches Buch er zuletzt gelesen hat, hat er sie angesehen, als wäre sie nicht ganz klar im Kopf. Da fragte sie sich zum ersten Mal, ob es wirklich die richtige Entscheidung war, weiterhin mit ihm auszugehen. Verzweifelt klammerte sich Lieselotte an die Hoffnung, dass es besser würde, wenn Eduard und sie erst verheiratet wären.
Wenn sie ehrlich ist, hat sie sich damals nur davor gefürchtet, den Rest ihres Lebens mit ihrer Mutter teilen zu müssen. In der Dreizimmerwohnung in Bockenheim, in der sie fast ihr ganzes Leben verbracht hatte. Selbst heute, nach sechs Jahren Ehe ohne Liebe, erscheint Lieselotte ihre Entscheidung immer noch als vernünftig. Sie musste hier raus, um jeden Preis.
Inzwischen ist sie ins Wohnzimmer getreten, das immer noch so aussieht wie vor zehn Jahren, als Lieselotte ausgezogen ist. Ihre Mutter verdient gut und könnte es sich bestimmt leisten, die alte Polstergarnitur zu ersetzen, aber das ist Amelie nicht wichtig. Ich weiß allerdings nicht, was ihr wirklich wichtig ist.
Lieselotte seufzt. Sie nimmt den Koffer, um damit in das Zimmer zu gehen, das einmal ihres war. Erst hat sie es mit Oma Luise teilen müssen, nach Luises Tod gehörte es ihr allein. Nach Lieselottes Heirat hat ihre Mutter nur wenig in dem Zimmer verändert, so als hätte sie erwartet, dass ihre Tochter bald zurückkehren würde. In den Jahren ihrer Ehe hat sie nicht einmal bei ihrer Mutter übernachtet, weil Eduard das nicht wollte. Zu Amelies Geburtstag und an jedem zweiten Weihnachtstag sind sie zum Kaffee aus Kassel angereist und nach dem Abendessen wieder zurückgefahren. Für Lieselotte fühlt es sich an wie eine Zeitreise in ihre Vergangenheit, als sie die Tür zu ihrem Zimmer öffnet. Das schmale Bett, ein Schreibtisch aus hellem Holz, die weiß angestrichene Kommode, ein Erbstück von Oma Luise. Auf den zwei Regalbrettern an der Wand stehen immer noch einige der Bücher, die sie als Kind gelesen hat. Heidi, Der Trotzkopf, Peterchens Mondfahrt.
Tränen verschleiern Lieselottes Blick. So wenig ist von ihrem Leben übrig.
So ein Blödsinn. Natürlich ist mehr geblieben – alles, was ich nach Kassel mitgenommen habe. Wenn ich anfange, sentimental zu werden, bin ich Mutter keine Hilfe.
Lieselotte stellt den Koffer ab, packt ihre Sachen aus und hängt sie in den dunkelgrün gestrichenen Schrank, der dort seit ihrer Kindheit steht. Als sie die Türen öffnet, weht ihr der Geruch von Mottenkugeln entgegen. Ordentlich zusammengefaltet liegen Handtücher und Waschlappen auf den Regalböden. Vorsichtig schiebt Lieselotte sie zur Seite, damit ihre Wäsche Platz findet. An der Kleiderstange aus Holz hängen zwei schwere Wintermäntel in Plastiküberzügen. Lieselotte bringt ihre Hosen und Röcke daneben unter.
Als nächstes geht sie in jedes Zimmer, um die Fenster zu öffnen, damit der Geruch nach Einsamkeit und Traurigkeit entweichen kann. Lieselotte schaut in den Kühlschrank. Nein, einkaufen muss sie heute nicht. Weil ihr die Decke auf den Kopf zu fallen droht, nimmt sie sich Besen, Handfeger und Kehrblech, um die kleine Hauswoche zu erledigen.
»Aber hallo, wer bist du denn?« Vor der Wohnungstür sitzt eine große schwarze Katze und blinzelt Lieselotte aus grünen Augen an. »Wie elegant du bist mit deinem weißen Brustfleck. Als ob du ein Smokinghemd trägst.«
Vorsichtig hält sie der Katze ihre Hand hin, unsicher, wie sie mit dem Tier umgehen soll. Ihre Mutter hat sich stets gegen Haustiere ausgesprochen, weil die Arbeit nur an ihr hängen bleiben würde. Und Eduard mag nichts, was schmutzt, wie er sagt. Also hat Lieselotte sich damit abgefunden, ihre Tage allein zu verbringen. Aber wenn es nach ihr ginge, dann lebte sie mit einer Katze. Sie mag die Stubentiger, die so unabhängig und freiheitsliebend sind.
Die Katze streckt sich, dehnt ihren Rücken und gähnt. Dabei zeigt sie so spitze Zähne, dass Lieselotte ihre Hand sicherheitshalber wieder zurückzieht. Das sieht das Tier als Gelegenheit an, sich rasch an Lieselottes Waden zu schmiegen, bevor es an ihr vorbei in die Wohnung schlüpft. Einen Moment steht Lieselotte wie erstarrt, dann ruft sie: »Halt! Nein, das darfst du nicht. Raus mit dir!«
In diesem Augenblick geht die Tür zur Wohnung gegenüber auf. Dort, wo kein Namensschild hängt und wo früher Frau Rasche gewohnt hat. Eine junge Frau schaut auf den Flur heraus, die dunklen, kurzen Haare verwuschelt, als wäre sie gerade erst aufgestanden. Auch den Kissenabdruck auf ihrer linken Wange und das Gähnen mit offenem Mund, ohne sich die Hand vorzuhalten, wertet Lieselotte als Indizien, dass sie mit ihrer Vermutung richtig liegt. Schlaftrunken blinzelt die junge Frau sie aus erstaunlich hellen grauen Augen an. Sie trägt ein übergroßes gestreiftes Männerhemd, mehr nicht. Keinen Rock, keine Hose, keine Schuhe.
»Hallo. Entschuldigen Sie bitte. Cat Ballou weiß genau, dass er nicht in die Wohnung darf.« Mit fragendem Blick kratzt sie sich am Kopf. »Sind Sie neu?«
»Cat Ballou? « Lieselotte ist etwas irritiert. »Das war doch eine Frau … und das ist ein Kater, oder?«
Den Western kennt sie, weil Eduard gern Western ansieht, aber der Film Cat Ballou - Hängen sollst du in Wyoming hat ihm nicht gefallen, weil eine Frau die Hauptrolle spielt. Außerdem mag er die Schauspielerin Jane Fonda nicht, Lieselotte hingegen gefielen beide, was sie jedoch – wie so oft – für sich behalten hat.
»Ja, Cat Ballou war eine Frau, aber das weiß der Kater ja nicht.« Die junge Frau zuckt mit den Schultern. »Er guckt nicht gern Western. Da kommen ihm zu wenig Tiere drin vor, glaube ich.