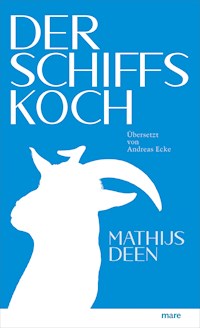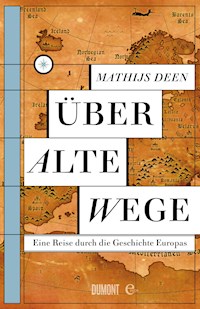Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Seit dem Unfalltod seiner Eltern wohnt Jan allein auf dem Hof am Rande der Nordsee, das Leben geht seinen Gang, aber die Einsamkeit nagt an ihm. Ein bisschen Gesellschaft wäre schön, eine Frau, Gespräche, Sex, vielleicht sogar eine eigene Familie? Jan gibt eine Anzeige auf und erhält Antwort von Wil. Wil jedoch, so stellt sich heraus, verfolgt einen ganz eigenen Plan – sie sucht keine Liebe, sondern Ruhe vom Stadtleben und von den Enttäuschungen der Vergangenheit. Ihre einzige Bedingung lautet: Von dem Haus, in dem sie künftig leben wird, muss sie das Meer sehen können. Literarisch, atmosphärisch und mit einem feinen Gespür für das Skurrile beschreibt Mathijs Deen den Prozess einer ungewöhnlichen Paarwerdung. Zwei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, versuchen zusammenzufinden. Kann das gut gehen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mathijs Deen
UNTERDENMENSCHEN
Roman
Aus demNiederländischenvon Andreas Ecke
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.ddb.de abrufbar.
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel Onder de mensen bei Uitgeverij Thomas Rap, ein Imprint von De Bezige Bij, Amsterdam.
Copyright © 2016 Mathijs Deen
Der Verlag dankt der Niederländischen Literaturstiftung für die Förderung der Übersetzung.
© 2019 by mareverlag, Hamburg
Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann, mareverlagAbbildung © plainpicture / Ableimages / David HarriganLektorat Ilka Heinemann, Köln
Typografie (Hardcover) mareverlagDatenkonvertierung E-Book Bookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-352-1
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-280-7
www.mare.de
INHALT
IDie Vereinbarung
IIWils Art
IIIDer Unterschied
IVUnter den Menschen
VFrühstücken
VINichts sagen
VIIGlas
VIIIZu Mutter
IXVergebliche Mühe
XWarten
XISchnee
I
DIE VEREINBARUNG
Irgendwo weit im Norden steht am Seedeich ein Bauernhof, der wie ein wartendes Arbeitspferd sein Hinterteil dem Meer zuwendet. Es ist ein ausladendes braunes Hinterteil aus Reet, ohne Tür und Fenster. Von der Traufe auf Augenhöhe erhebt sich das Dach steil bis zum First, der nicht mehr im Lee des Deichs liegt, sondern ungeschützt dem Seewind ausgesetzt ist. Das nächste Haus steht fünf Kilometer landeinwärts, und jenseits des Deichs wohnen in einer verschlickten Gezeitenrinne nur Krabben und Plattfische. Es ist Winter und kalt.
Unter dem riesigen Dach steht Jan in der Küche, die Hände in den Hosentaschen, und wartet darauf, dass die Suppe warm wird. Jan ist Bauer. Er wohnt allein und hat nichts zu tun. Die Rüben sind abgeholt, das Getreide ist im Speicher, die Kartoffeläcker hat er im letzten Jahr kurzzeitig verpachtet, sodass in diesem Winter nichts sortiert werden muss, der Kleiboden ist gepflügt und harrt der nächsten Aussaat, die Maschinen sind gewartet und in gutem Zustand, die Buchhaltung in Ordnung. Wenn Jan gleich seinen Teller Suppe gegessen und das Geschirr gespült hat, gibt es beim besten Willen nichts mehr zu tun. Dann ist das Leben geschafft.
Doch Jan ist nicht zufrieden. Es ist der erste Winter, in dem er auf dem Hof das Sagen hat, und sein erster Winter allein. Ein ganzes Arbeitsleben liegt noch vor ihm. Trotzdem ist alles geschafft. Diese Erkenntnis verleiht all seinem Tun eine Sinnlosigkeit, mit der er schlecht umgehen kann.
Jan löffelt seine Suppe, spült das Geschirr und steht danach einen Moment unschlüssig in der Küche. Dann geht er langsam durchs Haus, landet vor dem Fernseher und starrt eine Weile auf den Bildschirm. Der Hof hat keinen Kabelanschluss, das Bild ist ein wenig verschneit. Er hatte geplant, sich eine Satellitenschüssel anzuschaffen, um mehr Auswahl als nur zwischen zwei niederländischen und einem deutschen Sender zu haben. Da aber die Einkünfte niedriger als erwartet ausfielen, hat er sich vorerst dagegen entschieden. »Viel Zeit fürs Fernsehen habe ich sowieso nicht«, dachte er. Ein Irrtum.
Er schaltet den Fernseher wieder aus, legt sich aufs Sofa und versucht sich zu erinnern, wann er zum letzten Mal mit jemandem gesprochen hat, und über was. Ihm fällt nur der Fahrer ein, der die Rüben abgeholt hat, und das war im November, vor gut einem Monat. Danach ist er noch ein paarmal zum Einkaufen ins Dorf gefahren, aber ob er da etwas gesagt hat? Er ist sich nicht sicher. Der Postbote fährt seit dem Herbst aus Gründen der Zeitersparnis nur noch bis zu Jans grünem Briefkasten an der Gemeindestraße, für Jan bedeutet das einen Weg von einem Kilometer über den holprigen Streifen Betonplatten, der schnurgerade landeinwärts führt. Die Zeitung kommt mit der Post, jeden Tag die Zeitung von gestern. Gas und Strom werden erst im Februar abgelesen.
Nachdem Jan sich bereit erklärt hatte, den Betrieb zu übernehmen, waren seine Eltern ins Dorf gezogen, damit er, wie sie sagten, auf dem Hof freie Bahn habe. Da ihr Arbeitsleben nun hinter ihnen lag, wollten sie reisen, nach Österreich, in die Berge. Vor der Abfahrt hatte Jans Mutter auf dem Hof sieben Tage lang ununterbrochen gekocht: Suppen und Eintöpfe, aber auch Frikadellen mit Kartoffeln und Gemüse, Spaghetti, Makkaroni und Gerichte aus großen Fleischstücken, Sirup und braunen Bohnen. All das verteilte sie in beachtlichen Portionen auf blaue Gefrierbeutel, die in langen Reihen bereitlagen, und fror es ein. Sie kochte wie besessen, bevor sie Jan allein im Haus am Deich zurückließ, als könne sie den Gedanken nicht ertragen, dass in naher Zukunft Jan, oder schlimmer noch: jemand anders in ihrer Küche den Kochlöffel schwingen würde. So traf Jan in jenen Tagen seine Mutter schon Kartoffeln schälend an, wenn er morgens die Küche betrat, und abends war sie noch mit Spülen beschäftigt, wenn er zum Schlafen nach oben ging. Das Ergebnis war eine totalitäre Menge von fertigen Mahlzeiten, die beide Gefriertruhen im Scheunentrakt bis zum Rand füllten und ihn von der Notwendigkeit, selbst zu kochen, für ein bis anderthalb Jahre entbanden.
Am Tag vor der Abreise bekam Jan von seinem Vater ein Mikrowellengerät geschenkt. Sie aßen zu dritt (Mutter kochte ein letztes Mal). Und dann ging es los, seine Eltern fuhren in ihrem Auto weg, auf Nimmerwiedersehen. In Österreich kamen sie mit dem Wagen von der Straße ab, rollten in einen See und verließen das Wasser nicht mehr lebend.
Das liegt nun vier Monate zurück, und Jan hat noch nicht einmal eine halbe Gefriertruhe geleert.
Jan gibt eine Kontaktanzeige auf. »Bauernsohn sucht Frau. Wohnt allein. 80 ha.« Als er seinen Text in der Samstagszeitung liest, findet er es seltsam, dass er »Bauernsohn« geschrieben hat und nicht einfach Mann oder Bauer oder Landwirt. Aber nun steht es einmal da. Und er erhält sogar Zuschriften, nach einer Woche werden vier Briefe an ihn weitergeleitet. Er liest sie, während er langsam gegen den Wind zum Hof zurückgeht, und schon bevor er angekommen ist, hat er drei davon abgehakt. Was er von dem vierten halten soll (»Ich weiß, wie das ist. Ruf mich an. Wil«), ist ihm nicht ganz klar. Er überlegt, was sie wohl mit »das« meint. Sie kann unmöglich wissen, wie es ist, Bauernsohn zu sein. »Das« kann sich also nur aufs Alleinwohnen oder die achtzig Hektar beziehen.
Jan ruft an. Am Telefon ist sie ebenso kurz angebunden wie in ihrem Brief. Und energisch. Er hat sie fragen wollen, was sie mit »das« meint, doch ehe er sich’s versieht, ist das Gespräch vorbei. Und als sie sich am nächsten Tag im Bahnhofsrestaurant gegenübersitzen, schenkt er dem Kellner, der sein Winken hartnäckig übersieht, mehr Aufmerksamkeit als der Frau vor ihm, die er kaum richtig anzuschauen wagt.
»Ich glaube, wir fühlen uns hier beide nicht wohl«, sagt sie nach einer Weile. »Nimm mich doch mit zu dir nach Hause. Du wohnst doch am Meer?«
Über diese Frage muss Jan tatsächlich kurz nachdenken.
Sie will nicht gleich ins Haus, sondern erst auf den Deich. Eine Zeit lang stehen sie dort oben nebeneinander und starren aufs Wasser. Dann sagt sie: »Weißt du, was das Komische ist mit diesem Land? Überall Meer, aber es gibt kaum Häuser, von denen aus man es sehen kann. Entweder liegt ein Deich davor oder Dünen. Von deinem Haus aus sieht man das Meer wohl auch nicht, oder?« Jan dreht sich zu dem riesigen, blinden Dach des Bauernhofs um. »Nein«, antwortet er. »Ich glaube nicht.«
»Liebst du das Meer?«
Jan schiebt die Hände in die Taschen, plötzlich verärgert. »Ich weiß nicht so genau, was ich dir sagen soll«, sagt er. »Komm mit ins Haus, dann können wir was trinken. Oder willst du was essen? Es ist jede Menge da.«
Im Haus kann er seine wachsende Übellaunigkeit kaum noch unterdrücken. Wil will gern etwas Warmes trinken, und das dürfe ruhig auch eine Tasse Suppe sein, sagt sie. Also verlässt Jan die Küche, um zu den Gefriertruhen in der Scheune zu gehen. Doch auf halbem Wege bleibt er wie ein bockiger Bock stehen. Nach kurzer Beratung mit sich selbst kehrt er in die Küche zurück. »Suppe ist alle«, sagt er.
Es dauert lange, bis das Eis bricht. Sie sitzen eine Weile in dem kahlen Wohnzimmer mit dem Sofa, dem Sessel, dem niedrigen Tisch und dem Fernseher. An den leeren Wänden sieht man, wo früher der Kalender, die Uhr, das Gemälde mit dem blühenden Kartoffelacker und die Fotos von Vorfahren gehangen haben, bis seine Eltern sie in ihr neues Zuhause mitnahmen. Jetzt warten sie, in Kartons verpackt und zurückgebracht, in der Scheune, bis Jan weiß, was er mit all den Sachen anfangen soll.
»Sieh mal, Jan«, sagt Wil, »es ist wichtig, dass du weißt, was ich will.« Ihr Blick schweift kurz durchs Zimmer, sie holt tief Luft. »Ich habe bisher in der Liebe kein Glück gehabt. Ich bin oft enttäuscht worden. Ich will nicht, dass mir das noch einmal passiert. Verstehst du?«
Jan versucht nicht, es zu verstehen. Die Bockigkeit hat seine anfängliche Verlegenheit vertrieben, und jetzt sitzt er sehr gerade auf dem Sofa, blickt ohne zu blinzeln die junge Frau an und fragt sich, ob er sie begehren könnte. Er sucht in ihrem Gesicht nach irgendetwas, das er streicheln, küssen oder zur Not wenigstens schlagen möchte. Doch Wil hat ein Gesicht wie ein Festungswall, mit straff aufgestecktem Haar, einem Mund voll unverständlicher Wörter, zusammengekniffenen Augen und einer scharfen, vorspringenden Nase. Jan schaut und schaut und denkt: Verflixt, wie sieht sie aus.
»Was meintest du mit ›das‹?«, fragt er.
»Was meinst du mit ›was meintest du mit das‹?«
»In deinem Brief. ›Ich weiß, wie das ist‹, hast du geschrieben.«
Wil denkt einen Moment nach. »Kann ich das Haus sehen?«, fragt sie.
»Das Haus?«
Jan führt Wil durch das Bauernhaus. Sie trödelt lange im Gewölbekeller, in dem auf Regalen Gläser mit eingemachtem Gemüse stehen. Sie fragt, wie die Gemüse eingemacht worden sind und wann, wie alt die Bodenfliesen sind, und noch einiges andere, das Jan nicht auf Anhieb weiß. Die leer geräumten Zimmer im ersten Stock interessieren sie nicht, die große Diele und der Dachboden dagegen schon. Sie sorgt dafür, dass Jan keinen Winkel des riesigen Bauernhauses auslässt, weshalb er mit ihr auch an Stellen kommt, die er zuletzt als Kind gesehen hat. Auf morschen Treppchen und in schmalen Durchgängen, in denen sie sich zwangsläufig fast berühren, erwartet er, ihre Körperwärme zu spüren und ihren Geruch einzuatmen. Doch da ist nichts als der kühle Hauch und das Wirbeln geruchloser Luft, als würde nicht eine Frau an ihm vorbeigehen, sondern als wäre nur ein Fenster geöffnet. Jan tastet mit dem Blick ihre Kleidung ab, die alles Interessante verhüllt. Sie trägt einen Schal, eine lange, fast neue Wolljacke, die bis auf die Oberschenkel fällt, eine dicke Hose und Schnürschuhe. Bei seiner stillen Suche nach Sinnenkitzel findet er nur Nähte, Falten und Säume.
Es dämmert schon, als sie schließlich die Scheune betreten. Während Jan knappe Erklärungen zu den Sortiermaschinen und dem Traktor gibt, legt sie den Kopf in den Nacken und blickt nach oben.
»Ein riesiges Dach, und so hoch«, unterbricht sie ihn. »Kann man vom Dach aus das Meer sehen?«
Jan denkt nach. Er versucht, sich an die letzte Erneuerung des Reetdachs zu erinnern. Damals hat er auf dem First gesessen. »Ich glaube, ja«, antwortet er. »Aber sicher bin ich mir nicht. Was hast du bloß immer mit dem Meer?«
»Du wohnst am Meer, und es lässt dich kalt?«
»Wasser und Schlick.«
»Dann entgeht dir aber die Hälfte der Welt«, sagt Wil. »Ein ganzer Horizont, die endlose Weite gleich hinter deinem Haus. Du brauchst nur auf den Deich zu steigen, und schon wird deine Welt doppelt so groß.«
Anscheinend bekommt Jan doch noch etwas von Wil zu sehen. Irgendetwas in ihr ist aufgesprungen, und sie blickt ihn jetzt offen an. Sag noch was übers Meer, denkt er. »Achtzig Hektar sind schon groß genug. Weißt du, wie das ist, mit achtzig Hektar?«
»Ach, und warum hast du dann die Anzeige aufgegeben? Etwa weil du so viel zu tun hast?«
Zum ersten Mal hätte Jan Lust, etwas mit Wil zu machen, zum Beispiel, ihr diesen verdammten Schal abzunehmen, oder, oder, oder …
Wenig später stehen sie wieder auf dem Deich (Wils Idee) und sehen in der hereinbrechenden Dunkelheit einen Leuchtturm am Horizont.
»Welche Insel ist das?«, fragt Wil.
Jan nennt den Namen einer Insel und fügt hinzu, dass er sich nicht sicher ist. Wil dreht sich um. Sie stößt ihn an. »Sieh mal.« Sie zeigt auf das senkrechte, dreieckige Windbrett unterhalb des Firsts. »Siehst du, wie der Lichtstrahl vom Leuchtturm oben das Dach streift? Wenn man da oben ein Fenster hätte, könnte man von innen aufs Meer schauen, siehst du? Dann würde jede Nacht das Licht vom Leuchtturm durch die Vorhänge scheinen.«
»Da schläft schon jemand«, erwidert Jan. »Das Brett da nennt man Eulenbrett, dahinter wär Platz für eine Eule.«
»Eulen schlafen tagsüber, wir nachts«, sagt Wil.
Jan und Wil fahren in die Stadt. Bevor der letzte Zug fährt, essen sie im Bahnhofsrestaurant eine Kleinigkeit. »Das war’s dann«, sagt Jan. »Abfahrt in einer Viertelstunde.« Er streckt unterm Tisch ein Bein aus und berührt ihr Knie. Er schaut ihr ins Gesicht.
»Ich hätte einen Vorschlag«, sagt sie.
»Und der wäre?«
Wil schaut auf die Armbanduhr, holt einen Taschenkalender aus dem Rucksack, dann einen Kugelschreiber und sagt: »Ich schlage vor, dass wir es drei Mal machen …« Sie blättert in ihrem Kalender.
»Was?«, fragt Jan. Doch sie blättert weiter. »Was machen?«
»Das«, antwortet sie, »du weißt schon. Gibt es Tage, an denen du gar nicht kannst?«
Jan schweigt und schaut sie finster an.
»Jan, ich bin oft enttäuscht worden, und die Liebe hat mir nie das gebracht, was ich wollte. Vielleicht wollte ich also das Falsche. Und jetzt habe ich keine Lust mehr, mit irgendwelchem Quatsch Zeit zu verschwenden. Drei Mal, zuerst auf meine Art, beim zweiten Mal auf deine Art, und dann sehen wir weiter. Okay?«
Jan schaut und schweigt.
»Verstehst du, wie ich es meine? Drei Mal heißt drei Verabredungen, an drei verschiedenen Tagen. Nur damit du mich nicht falsch verstehst … na komm, gleich fährt der Zug.«
Jan schaut Wil reglos an und sagt dann: »Lös dein Haar.«
Sie zuckt leicht zusammen, wie vor Schreck. Aber sie fasst sich schnell und zeigt auf ihre Uhr.
»Erst das Haar lösen.«
»Na gut«, sagt sie und seufzt. Sie fummelt kurz an ihrem Hinterkopf herum, dann fällt das aufgesteckte Haar zögernd auf ihre Schultern. Jan schaut.
»In Ordnung«, sagt er.
II
WILS ART
Wils Vorschlag, es drei Mal zu machen – zuerst auf ihre, dann auf seine und schließlich auf eine noch näher zu bestimmende Art –, kam nicht aus dem Nichts. Sie hat lange darüber nachgedacht. Über alles denkt sie in den letzten Monaten gründlich nach, im Gegensatz zu früher, als sie allen schwierigen Gedanken aus dem Weg ging. So vieles hat sich verändert, schon so vieles ist Gott sei Dank vorbei.
Wil hat eine überdurchschnittliche Portion Pech abbekommen. Wenn sie an ihre Kindheit zurückdenkt, sieht sie sich in ihrem Zimmer, wie sie vom Bett aus auf die Vorhänge schaut. Es ist spät am Abend, sie ist sieben, sie hat Angst. Sie flüstert sich zu, sie sei unsichtbar, und als sie aufgestanden ist, auf Zehenspitzen durch den oberen Flur zur Treppe schleicht und dann sehr langsam hinuntergeht, sieben Stufen, versucht sie jedes Geräusch zu vermeiden, damit niemand hören kann, wo sie ist oder was sie tut. Auf jeder Stufe hält sie inne und zählt mit langen Pausen bis sieben oder nennt möglichst langsam die Namen aller Mädchen in ihrer Klasse, oder aller Tiere, die sie kennt. Nach sieben Stufen setzt sie sich hin und horcht auf den Streit, der unten tobt. Sie weiß ungefähr, was sie im nächsten Moment sagen werden oder schreien werden. Sie flüstert es mit, bis sie hört, wie ihre Mutter aus dem Wohnzimmer stiefelt, die Tür ihres eigenen Zimmers zuzieht und den Schlüssel herumdreht. Dann wartet sie auf das Knallen der Haustür, das Motorgeräusch, wenn ihr Vater den Wagen startet, die Stille, die herabsinkt, und die kalte Luft, die von oben über die Stufen abwärtsströmt, ihren Rücken und ihre Beine entlang. Denn die Kälte wohnt oben, wo ihr Zimmer ist, und sie ist die Königin der Kälte, ihr Bett ist aus Schnee. Unten ist der Streit verstummt, alles ist still geworden, niemand ist mehr da, es ist dunkel. Und sie sitzt und wartet.
Wenn ihre Erinnerung endlich von Tageslicht erhellt wird, sieht sie die leere Küche am frühen Morgen, das Butterbrot für die Schule, das sie sich selbst schmiert, die Tür, die sie leise zuzieht, um niemanden zu beunruhigen.
Oder den Erker, in dem sie sich mit hochgezogenen Knien hinterm Vorhang versteckt hat und gegen die Scheibe zu atmen versucht, ohne dass sie beschlägt. Sie sieht auch den Garten während der endlosen Sommerferien und darin sich, wie sie die Stängel geknickter Blumen mit Satéspießen schient oder Hummeln fängt und in einem Marmeladenglas in ihr Zimmer mitnimmt, um mit ihnen zu sprechen und sie mit den Fingerspitzen zu streicheln.
Natürlich gab es auch die Momente, jetzt so unwiderruflich vorbei, in denen sie zu dritt zusammen waren, Vater, Mutter und sie, und in denen sie sich mit ausweichender, aber lächelnder Beflissenheit durchs Zimmer bewegte, still den Tisch deckte, die Gabeln und Messer lautlos auf die Tischplatte legte und aus der Distanz beobachtete, wie nichts geschah, wie die beiden lasen und glücklicherweise keiner etwas sagte. Langeweile ist gut, dachte sie. Langeweile ist still.
In ihrem Zimmer hing ein Poster von einem Berg auf einer Landspitze, der Gipfel von ewigem Schnee bedeckt. Es war ein Foto von einem schlafenden Vulkan weit im Norden, auf Island. Sehr tief darunter, wusste sie, gab es eine feurige Masse in der Erde, wie eine nie verlöschende Zündflamme. Aber der Berg schlief, der Berg rührte sich nicht, alles war unter Kontrolle, alles war still. Das Wasser des Meeres ringsum war klar und sehr, sehr kalt.
Ihr Umgang mit Freundinnen, Lehrerinnen und Lehrern, Verkaufspersonal in Läden und später mit den wenigen Jungen, zu denen sie außerhalb der Schule Kontakt hatte, war von der gleichen distanzierten, stillen Freundlichkeit bestimmt. Allmählich wendete sich das gegen sie, denn es zeigte sich, dass Freundinnen und Freunde ihre Neigung, Probleme zu vermeiden und Konflikten aus dem Weg zu gehen, einfach missbrauchten. Während ihrer Ausbildung zur Dokumentarin schrieb sie nicht nur ihre eigenen Hausarbeiten, sondern mindestens ebenso viele für diese Freunde und Freundinnen, die plötzlich allerlei andere Dinge zu tun hatten oder ungeniert zugaben, zu faul zu sein. Und immer wieder wurden die für andere geschriebenen Arbeiten von den Dozenten besser beurteilt als die unter ihrem eigenen Namen abgegebenen.
Wenn eine Fete zu organisieren war, übernahm sie mehr Aufgaben als andere, doch wenn sie selbst Leute einlud, war das Interesse mäßig. Als sie eine Stelle fand, begnügte sie sich mit einem zu kleinen Schreibtisch in einem zu lauten und vollen Büro und mit Arbeit, die unter ihrem Niveau, aber von der Menge her kaum zu bewältigen war. Es gab ein paar junge Männer, die sie verließen.
Sie erledigte, was man ihr auftrug, mit einem Lächeln, aber Tippfehlern. Auch als der Hausarzt sie vor anderthalb Jahren, nach ihrer Entlassung, wegen ihrer hartnäckigen Hautprobleme nicht an einen Dermatologen, sondern an einen Psychologen überwies, tat sie, was ihr aufgetragen wurde. Sie fand eine neue Stelle, in der Kleinanzeigen-Abteilung einer Zeitung. Einmal in der Woche, an ihrem freien Nachmittag, fuhr sie zu dem Therapeuten, um herauszufinden, warum ihr alles misslang und sie nicht glücklich war.
Das lag, so lernte sie, an einem Muster.
Der Therapeut hielt ihre Probleme für nicht allzu schwerwiegend. Er rieb sich sogar die Hände, als er sagte, sie würden daran arbeiten. »Ich werde Ihnen klare Aufgaben stellen«, erklärte er, »Woche für Woche. Und bei jeder Sitzung schauen wir, was daraus geworden ist. Ob Sie Erfolg hatten.«
»Soll ich aufschreiben, was Sie sagen?«, fragte sie.
»Sehr gut«, lobte er. »Sagen Sie es einfach, wenn Sie etwas aufschreiben wollen.« Er lehnte sich zurück und dachte nach. »Tun Sie nie etwas, nur weil jemand anders es will«, begann er. »Tun Sie, was Sie selbst wollen. Und wenn Sie nicht wissen, was Sie wollen, warten Sie, bis Sie es wissen. Fragen Sie sich, was Ihre Wünsche und Sehnsüchte sind, und dann, ob es auch wirklich Ihre eigenen sind. Lassen Sie sich nicht beirren. Lassen Sie sich nie zu einer Entscheidung drängen, bevor Sie sich Ihrer Sache sicher sind. Solange Sie sich von anderen abhängig machen, werden andere das ausnutzen. Wenn Sie nicht wissen, was Sie wollen oder wie Sie etwas tun wollen, dann nehmen Sie sich Zeit. Vermeiden Sie Situationen, in denen Sie verwundbar oder manipulierbar sind.«
Er machte eine Pause und schaute ihr beim Schreiben zu. »Haben Sie das?«, fragte er.
Ein Jahr lang radelte sie an jedem Freitagnachmittag in Richtung Stadtrand, durch die Stille der Außenbezirke, an Wassergräben entlang, an denen Kopfweiden und Landhäuser standen, zu einem Bauernhaus, in dem sie, mal mit dem Therapeuten allein, mal mit Leidensgenossen, über ihr Leben sprach. Sie grub den Gemüsegarten um, fütterte die drei Hobby-Kühe, machte das Hühnerhaus sauber und wehrte an stillen Tagen gelegentliche Annäherungsversuche des Therapeuten mit einem Lächeln ab.
»Ich bin um meinetwillen und nur um meinetwillen hier«, sagte sie.
»Sehr gut«, lobte er.
Allmählich lernte sie, auf eine andere Art zu leben; sicher nicht glücklich, aber wenigstens, nun ja, weiser, oder wie sie selbst es ausdrückte: »mit Selbsterkenntnis und erreichbaren Zielen«. Die Langeweile, die sie im Laufe der Therapie als Sammelbecken für alte Einsamkeit, Enttäuschung und Trauer erkannt hatte, verhärtete sich zu einer zähen Wut.
»Diese Wut, das ist dein Hund«, sagte der Therapeut. »Du hältst ihn an der kurzen Leine, das spürt jeder. Ich auch.« Er lachte. »Das ist deine Kraft.«
Vor allem auf dem Rückweg, wenn sie durch die Kulissen aus Wiesen, Wassergräben und beschnittenen Weiden zu ihrer kleinen Wohnung in der Stadt zurückradelte, festigte sich in ihr die Erkenntnis, dass sie, wenn sie nicht wollte, nie wieder die Betrogene zu sein brauchte. Der Kälte ihrer Jugend stellte sie eine Vision von einem Haus am Meer gegenüber, wie der schlafende Vulkan auf dem Poster weit entfernt von allen, die sie ausnutzen wollten; dazu ein leerer Horizont, ein unkomplizierter Mann, den sie zu nehmen wusste, viel freie Zeit zum Lesen und zum Arbeiten im Garten und ausreichend Gelegenheit, erst gründlich nachzudenken und dann zu handeln.
Als sie Jans Kontaktanzeige eintippte und seine Adresse las, suchte sie den Ort auf der Karte der Niederlande, meldete sich krank und fuhr am nächsten Tag mit Zug und Bus in den Norden. Von der letzten Haltestelle an war es noch eine gute Stunde zu Fuß. Sie ging, bis sie von der Straße aus in der Ferne unterhalb des Deichs den Bauernhof sah. Um sie herum tiefe, schnurgerade Wassergräben und gepflügte Äcker bis zum Horizont. Hoffnung und Erwartung loderten in ihr auf. Sie ging an der Zufahrt vorbei und steuerte nach einem Kilometer über die Äcker den Deich an. Auf dem Deich ging sie hinter dem Hof her. Es war fürchterlich kalt, und das Bauernhaus unten sah warm, aber ungastlich aus. Ein Hagelschauer, der über den Deich hinweg auf das hohe Dach niedergegangen war, hatte auf dem First eine dünne Eisschicht hinterlassen. Ihr traten tatsächlich Tränen in die Augen. »Das ist es, hier ist es«, sagte sie zu sich. Sie versuchte es zuerst noch zurückzuhalten, doch bald fing sie an zu rennen. »Wehr dich nicht«, sagte sie, und dann schrie sie ihr aufflammendes Glück aus sich heraus. Sie hatte ihre Bestimmung gefunden. Sie wusste es genau.
Und heute ist der Tag, an dem sie mit Jan verabredet ist, um es zu machen, und zwar auf Wils Art. Schon seit dem Aufwachen ist sie nervös. Obwohl sie wusste, dass es ein Fehler war, hat sie das genauere Nachdenken über Wils Art aufgeschoben und wieder aufgeschoben. Und nun muss sie im allerletzten Moment herausfinden, was das eigentlich ist: Wils Art. Schon öfter ist ihr aufgefallen, dass es gar nicht so einfach ist, erst gründlich nachzudenken und dann zu handeln. Denn trotz aller Übungen und aller Vorsätze fällt die Wirklichkeit oft ein kleines bisschen anders aus, als sie sich vorgestellt hat. Was theoretisch ein großartiger Plan zu sein schien, erweist sich, wenn es darauf ankommt, ärgerlich oft als nicht umsetzbar.
»Stopp!«, sagt sie. »Los jetzt! Bisher ist alles gut gelaufen.«
Sie hat recht. Bisher ist alles sehr gut gelaufen. Als in der Kleinanzeigen-Abteilung Briefe für Jan eintrafen, behielt sie die zurück und schrieb selbst vier, wobei sie vier verschiedene Telefonnummern angab. Sie brachte ihre Zuschriften zur Post und stellte am nächsten Tag das Telefon ihrer (inzwischen nach einem Schlaganfall verwirrten und übersensiblen) Mutter, den kaum noch gebrauchten Apparat eines entlassenen Kollegen in der Kunstredaktion und den ihrer drei Wochen abwesenden Nachbarn so ein, dass alle Anrufe zu ihrem eigenen Telefon zu Hause umgeleitet wurden. Dann begann das Warten, vor ihr auf dem Tisch lagen die Kopien ihrer Briefe. Sie musste sich unbedingt mit »Hallo« melden. Wenn er anrief, kam es darauf an, möglichst schnell herauszufinden, auf welchen Brief er reagierte, und den entsprechenden Telefonstil zu wählen. Von Ank, der Plaudertasche: albern, durstig, indirekt. Von Wil, der Entscheiderin, dem General. Von Marie, der Reservierten: bissig penibel, Meinungen, Hund. Und natürlich von Irene. Keine der vier durfte die Initiative aus der Hand geben, nicht einmal Ank.
Das Telefon klingelte, und zwar ziemlich oft. Anrufe für ihre Mutter, sogar mehrmals hintereinander, eindeutig von demselben Mann, der Obszönitäten von sich gab, dann auf legte und erneut anrief, bis er merkte, dass am anderen Ende der Leitung keine verwirrte, ältere Frau, sondern jemand anders war. Der Versuchung, Mitleid mit ihrer Mutter zu empfinden, gab sie nicht nach. »Heute ist mein Tag«, sagte sie und schüttelte den Gedanken ab.
Es bestand auch die Gefahr, dass jemand den leeren Schreibtisch in der Kunstredaktion anrief. Einmal kam wirklich ein Anruf für die Zeitung, dringend, wie es schien, den sie mit den Worten »Hier geht es gerade drunter und drüber, könnten Sie die Zentrale anrufen?« abwimmelte.
Dann rief Jan an. Er antwortete auf den kürzesten Brief, den, in dem sie Wil hieß, in dem stand: »Ich weiß, wie das ist.« Jetzt wusste sie, dass er den energischen Typ suchte. Kurz und knapp verständigte sie sich mit ihm und legte auf. Leicht benommen blieb sie sitzen. »Also Wil«, sagte sie und trommelte mit den Fäusten auf den Tisch. Dann nahm sie die drei verworfenen Briefe und zerriss zwei von ihnen. Bei Irene zögerte sie. Ihre Augen brannten.
»Wil«, sagte sie, »das ist gut, das ist wenigstens klar.«
Und sie zerriss auch Irenes Brief, warf die Schnipsel in den Papierkorb, stand auf, ging ins Schlafzimmer und stellte sich vor den Spiegel, in dem sie sich von Kopf bis Fuß betrachten konnte. Was sie sah, gefiel ihr nicht. Ihre Arme, ihre Schultern, ihr Haar, alles hing. »So geht es nicht«, sagte sie. »So ist Wil nicht.«
Sie ging ins Badezimmer, suchte eine Weile, bis sie eine solide Haarklammer fand, und kehrte zum Spiegel zurück. Sie fasste das Haar dicht am Hinterkopf zusammen, drehte es dreimal, rollte es hoch und befestigte es mit der Klammer. Sie betrachtete das Ergebnis. »Das ist besser«, sagte sie. Sie wandte sich ein paarmal nach links und rechts und stellte sich wieder gerade vor den Spiegel, die Füße fest auf dem Boden.
»Wil«, sagte sie.
Sie sah wahrhaftig einen Anflug von trübem Bedauern, doch dann wurde ihr Blick kalt. Sie hob die Nase ein kleines Stück und schaute sich hart und scharf an.