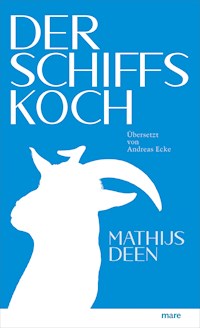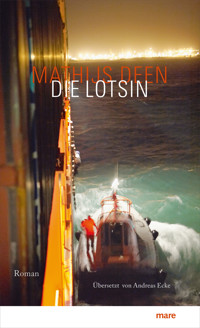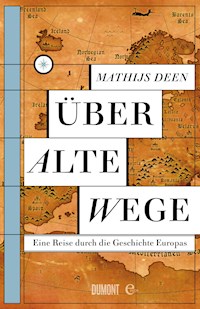Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Liewe Cupido
- Sprache: Deutsch
In der deutschen Bucht stößt das niederländische Bergungsschiff Freyja auf der Suche nach einem Container überraschend auf ein seit 1950 verschollenes Wrack. Leider hat dies nicht nur Kupfer im Wert von einer Million Euro an Bord, an dem sich die Besatzung der Freyja gern diskret bereichert hätte, sondern auch eine Leiche: Ein toter Taucher ist mit Handschellen an das Wrack gekettet, knapp außer Reich-, doch nicht außer Sichtweite vor ihm die Schlüssel. Die Ermittlungen von Kommissar Liewe Cupido, gebürtiger Deutscher, aber auf Texel aufgewachsen und darum »der Holländer« genannt, führen von einem Tauchclub auf Terschelling über einen Wohnungseinbruch auf Föhr bis zu einem Familiendrama in Wilhelmshaven. Je näher Cupido dem Täter kommt, desto mehr wird er in einen Fall verwickelt, in dem Väter und Söhne versuchen, einander zu beschützen, bis zum Äußersten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mathijs Deen
DER TAUCHER
Roman
Aus dem Niederländischen
von Andreas Ecke
mare
Originaltitel: De Duiker
Copyright © Mathijs Deen, 2023
© 2023 by mareverlag, Hamburg
Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann / mareverlag
Coverabbildung plainpicture/NaturePL/Alex Mustard
Datenkonvertierung E-Book Bookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-821-2
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-7017
www.mare.de
Für Joris
Rache hinkt,
sie kommt langsam, aber sie kommt.
Victor Hugo, Hernani
PROLOG
Es ist noch dunkel, als Jan Matz mit seinem Sportangelboot Skua den Hafen von Wyk auf Föhr verlässt und Kurs auf die offene See nimmt. Er will seinen Sohn Johnny zwischen zehn und halb elf im Nassauhafen von Wilhelmshaven an Bord nehmen, und auch mit seinem schnellen Boot dauert die Fahrt mindestens vier Stunden, selbst bei völlig glatter See wie jetzt. Es ist sechs Uhr, ein Dienstagmorgen Anfang November, und bis es hell wird, vergehen noch Stunden. Aber es ist so gut wie windstill und klar. Ein fast voller Mond steht tief im Westen, und das Licht der Leuchttürme reicht weit. Jan Matz hat die Heizung eingeschaltet und sich einen Becher heißen Kaffee eingegossen. Der Duft erfüllt das Ruderhaus, das den größten Teil des Vorschiffs einnimmt, die Scheiben beschlagen ein bisschen. Achtern auf dem Angeldeck stehen ein paar volle Kanister. Wenn er vier Stunden mit Vollgas fährt, muss er in Wilhelmshaven nachtanken, damit es für den Rückweg reicht. Würde er im Nordhafen tanken, müsste er erst durch die Seeschleuse, aber damit will er keine Zeit verlieren. Bevor sein Sohn im Nassauhafen an Bord kommt, wird er selbst den Tank auffüllen. Dann kann Johnny, sobald sie das Seegatt hinter sich und den Leuchtturm Alte Weser an Steuerbord haben, für die erste Stunde der schnurgeraden Fahrt zur Südspitze von Amrum das Steuer übernehmen.
13 Grad, Junge, du weißt ja.
Es ist schon das sechste Mal, dass er ihn so mit dem Boot von Wilhelmshaven abholt, und im Lauf der Zeit hat sich ein Ritual entwickelt, auf das Jan sich freut, während er im Dunkeln aufs Meer hinausfährt. Wenn Johnny das Steuer übernimmt und die Gashebel nach vorn drückt, holt er die Brötchen mit Rührei und Speck aus der Tasche, öffnet die zweite Thermosflasche mit Kaffee, füllt zuerst Johnnys Becher, dann seinen eigenen. Anschließend macht er es sich auf dem Sitz neben der Tür bequem und lässt sich in dem gleichmäßig stampfenden Boot zum nordfriesischen Wattenmeer zurückfahren, weg von Wilhelmshaven, weg von dem Haus seines früheren Lebens mit seiner Ex-Frau und dem anderen Sohn, den sie von ihm fernhält wie den Alkohol, weg von all dem Theater. Er sitzt schräg hinter Johnny, betrachtet seinen Hinterkopf, seine Schultern, seinen Rücken und versucht den Mann zu sehen, zu dem er werden wird. Schließlich dreht er den Kopf zur Seite, und sein Blick schweift über die Baken und Tonnen, die vorbeiziehen, die Schiffe in der Außenweser. So wird es wieder sein, dahin ist er unterwegs.
Aber jetzt ist er noch allein in der Dunkelheit. Das Feuer des Leuchtturms Amrum taucht sein Boot immer wieder kurz in ein gespenstisches Licht. Er fährt an der Tonne in der Norderaue vorbei und dreht den Bug in Richtung Wilhelmshaven. Die einsame, dunkle Überfahrt macht ihm Angst. Schon mehrmals ist es vorgekommen, dass er allein auf See Dinge gesehen oder gehört hat, die es nicht geben konnte: Geräusche, als würde jemand an Bord klettern, einen dumpfen Schlag gegen die Unterseite des Bootes, das Knarren der Tür des Ruderhauses, als würde sie langsam geöffnet. Jedes Mal, wenn er in die Dunkelheit hinausfährt, muss er irgendetwas überwinden. Zum Glück scheint der Mond, in gut anderthalb Stunden beginnt es zu dämmern, und man wird das Licht des Leuchtturms Alte Weser sehen.
1Mittwoch
Der Rudergänger des Küstenmotorschiffs Julie Ottersen, das mit einer Ladung Rapsöl auf der Fahrt von Thyborøn nach Sandefjord ist, hat nicht gemerkt, dass er ein Boot gerammt hat. Es ist noch früh an einem regnerischen Mittwochabend, aber über der Nordsee ist es schon dunkel. Das Boot, das von der Julie Ottersen gerammt wurde, führte keine Positionslichter, und der Rudergänger war durch die Begleiterscheinungen seiner Verdauung in Anspruch genommen. Der Koch hatte Fischklöße mit Püree zubereitet, das einzige Gericht, dem er nicht widerstehen kann. Und so hatte er, nachdem er seine Portion vertilgt hatte, eine zweite erbeten und bekommen. Seit der Mahlzeit ist eine gute Stunde vergangen, und jetzt, allein auf der Brücke – der Hafen von Thyborøn hinter ihnen, der Lotse von Bord –, kämpft er einen stillen Kampf gegen die Nachwirkungen seiner Gier. Er atmet möglichst ruhig ein und aus und beobachtet an Steuerbord voraus das Lichtbündel des Leuchtturms von Hanstholm, das sich in der Ferne wie ein Scheibenwischer über den nächtlichen Himmel bewegt.
Die Kollision war nur als dumpfes Wummern wahrnehmbar, ein Geräusch, das nicht bis in sein Bewusstsein vorgedrungen ist. Auch sonst hat fast niemand an Bord etwas gemerkt. Der Kapitän hat sich mit seiner Frau, die mit an Bord gekommen ist, in seine Kajüte zurückgezogen, die Matrosen sitzen in der Messe vor dem Fernseher. Nur der Koch, der in der frisch gewienerten Kombüse das Schneidebrett scheuert, blickt kurz auf und horcht. Es war ein leises Geräusch wie von einer Stalltür, die an einem windstillen Abend irgendwo weit weg hinter einer Wiese zugeworfen wird. Der Koch lauscht, hört aber nichts Besonderes mehr. Er spürt auch keine Veränderung in der Bewegung des Schiffs und konzentriert sich wieder auf das Schneidebrett.
Doch die Julie Ottersen hat tatsächlich etwas gerammt; ein nicht bemanntes Sportangelboot, das langsam im Flutstrom entlang der Küste Jütlands nach Norden treibt. Es ist ein stabiles Boot, nur knapp zehn Meter lang, aber mit hohem Freibord und komfortablem Ruderhaus auf dem Vordeck. Es schlägt nicht leck, sondern beginnt stark zu krängen, schleift kurz an der Bordwand der Julie Ottersen nach achtern und kentert dann im wirbelnden Schraubenwasser allmählich durch, bis es kieloben zur Ruhe kommt. So treibt es weiter durch die Nacht.
2Donnerstag
Christine hat jemand anderen erwartet. Als sie die Haustür öffnet und die Polizisten sieht, trübt sich ihre Miene deshalb rasch ein, von freudiger Erwartung zu Unverständnis und gleich darauf Mutlosigkeit.
»Doch nicht wieder«, sagt sie.
»Frau Matz?« Der Ältere der beiden ergreift das Wort. Seine Kollegin, eine kräftige Frau, die breitbeinig hinter ihm steht, macht sich noch breiter, indem sie die Hände in die Hüften stemmt. Vor der tief stehenden Sonne verdunkeln die beiden den Hauseingang.
»Was hat er denn jetzt wieder angestellt?« Christine sucht Halt am Türrahmen und blickt die Polizeibeamten fast flehend an.
»Sie sind die Mutter von Johannes Matz?«
Eine eigentlich überflüssige, nur der Form halber gestellte Frage. Die beiden kommen nicht zum ersten Mal. Christines Sohn Johannes, von seinen Eltern seit jeher Johnny genannt, ist Ende vergangenen Jahres von denselben Beamten abgeholt und in die Polizeiinspektion gebracht worden. Damals war sogar eine Kriminalbeamtin dabei, Schulze hieß sie. Fast eine Woche war Johnny in Untersuchungshaft. Jetzt wartet er zu Hause auf seinen Prozess. Er wird beschuldigt, Hauke Mauer, einen Jungen aus demselben Viertel, ein Jahr jünger als er, vorsätzlich so schwer verletzt zu haben, dass er wohl nie wieder ganz gesund werden wird.
»Ich heiße nicht mehr Matz, das habe ich Ihnen doch beim letzten Mal schon gesagt«, erwidert Christine und streicht sich mit der Hand über die Stirn. »Und mein Sohn ist bei seinem Vater, auf Föhr.«
Das bringt die Beamten aus dem Konzept. Christine späht an ihnen vorbei in beiden Richtungen die Straße hinunter.
»Ich erwarte jemanden«, erklärt sie, »und es ist mir unangenehm, wenn Sie dann hier vor der Tür stehen.«
»Wann ist Ihr Sohn nach Föhr gefahren?«, fragt die Beamtin, die ihre Hände jetzt nicht mehr in die Hüften stemmt.
Christine schüttelt den Kopf, als wollte sie einen Gedanken vertreiben. »Gestern«, antwortet sie. »Nein, am Tag davor«, korrigiert sie sich dann, »vorgestern. Was haben wir heute? Donnerstag? Am Dienstagvormittag hat mein Ex-Mann ihn abgeholt, mit dem Boot. Sie waren im Nassauhafen verabredet.«
»Ihr Sohn war also in der vergangenen Nacht nicht in Wilhelmshaven?«
»Er ist auf Föhr, bei seinem Vater …« Sie seufzt, löst sich vom Türrahmen und tritt einen Schritt zurück. »Kommen Sie doch herein, wenn Sie mir nicht glauben. Sehen Sie in seinem Zimmer nach. Sie kennen ja den Weg.« Sie deutet mit dem Kopf auf eine Tür, die von der Diele in ein Zimmer führt. Johnnys Zimmer.
Doch das ist gar nicht nötig. Die Tür wird geöffnet, und Johnny selbst erscheint, im grauen Jogginganzug, Telefon in der Hand, Ringe unter den Augen. Flaum auf der Oberlippe macht die Mundwinkel ein wenig dunkler.
»Wieso bist du hier?!«, bringt Christine mühsam hervor. »Du solltest doch bei deinem Vater sein!«
»Johnny, du kommst mit«, sagt der Polizeibeamte.
Johnny zuckt mit den Schultern. »Warum?«
»Du stehst im Verdacht, an dem Anschlag mit der Benzinbombe vergangene Nacht beteiligt gewesen zu sein.«
»Was für ’ne Benzinbombe?« Johnny starrt auf sein Telefon und tippt darauf herum. »Wer hat das gesagt?«, fragt er, ohne aufzublicken.
»Ich hab dich was gefragt!«, sagt Christine nun laut und energisch. »Wieso bist du hier?!«
»Bin zurückgefahren«, antwortet Johnny. »Hab die Schnauze voll von fucking Föhr.«
»Du kommst mit auf die Inspektion«, wiederholt der Beamte. Er betritt die Diele. Johnny blickt von seinem Smartphone auf. »Ich geh nirgendwo hin«, erklärt er. »Und schon gar nicht mit Ihnen. Wie kommen Sie dazu, mir hier zu Hause Stress zu machen? Lasst mich in Ruhe, ihr Loser.« Christine stellt sich zwischen den Polizisten und ihren Sohn.
»Sei nicht so unhöflich und geh in dein Zimmer«, sagt sie über die Schulter, schiebt Johnny rückwärts ins Zimmer und zieht die Tür zu.
»Es gibt Videoaufnahmen von dem Anschlag, Frau Matz«, sagt der Beamte, der jetzt mitten in der Diele steht. Auch seine Kollegin kommt herein.
»Was genau ist denn nun wieder passiert?«, fragt Christine.
»Vergangene Nacht ist vor dem Haus der Familie Mauer ein Molotowcocktail explodiert. Unter dem Auto der Familie. Das hat gebrannt und konnte gerade noch rechtzeitig gelöscht werden, sonst wäre noch viel Schlimmeres passiert. Auf den Aufnahmen ist ein Motorroller mit zwei jungen Männern zu sehen. Der hintere hat die Benzinbombe geworfen, und den Fahrer hat der Sohn der Mauers als Ihren Sohn identifiziert.«
»Der Sohn der Mauers? Der ist doch im Rehazentrum!?«
»Nein, nicht der Sohn, den Johannes zusammengeschlagen hat, sondern sein älterer Bruder.«
Die Zimmertür wird geöffnet, und Johnny erscheint.
»Hat Peter das gesagt, der Flachwichser?«
»Bleib in deinem Zimmer!«, schreit Christine. Sie schiebt ihn zurück und schließt die Tür mit einem Knall.
»Mein Sohn war auf Föhr«, sagt sie mit Nachdruck. »Er hat ausnahmsweise einmal nichts angestellt.« Sie dreht sich um und brüllt in Richtung Tür: »Ausnahmsweise!« Nach kurzem Nachdenken wendet sie sich wieder langsam den Beamten zu und sagt: »Mein Mann kann das bestätigen.«
»Ihr Ex-Mann.«
»Mein Ex-Mann, ja.«
Sie schaut dem Beamten einen Moment in die Augen, sucht dann Blickkontakt mit seiner Kollegin hinter ihm, doch Anzeichen von Verständnis findet sie auch bei ihr nicht. »Ich rufe ihn jetzt an«, sagt sie und öffnet Johnnys Tür. Ihr Sohn steht mitten im Zimmer, das Smartphone in der Hand. Es ist dunkel, die Vorhänge sind zugezogen.
»Gib mir dein Telefon«, sagt Christine.
»Warum«, erwidert er, »was willst du damit?«
»Ich rufe deinen Vater an.« Sie nimmt das Telefon, probiert irgendetwas aus, das nicht klappt, gibt es zurück. »Ruf du ihn an«, sagt sie, »schalte den Lautsprecher ein, gib es dann mir. Das heißt, wenn der Mistkerl sein Telefon eingeschaltet hat.«
Johnny tippt etwas ein, das Telefon bleibt erst einmal stumm.
»Er ist oft mit dem Boot auf See und taucht«, sagt Christine, während sie das Smartphone anstarrt. »Es ist übrigens mein Boot.« Dann ertönt doch das Freizeichen. »Gib her.« Sie reißt Johnny das Smartphone aus der Hand. Zu viert horchen sie auf den Freiton. Viermal … fünfmal … Als sich die Mobilbox einschaltet, nimmt Johnny ihr das Telefon ab und wählt erneut. Wieder ertönt das Freizeichen, doch niemand meldet sich. Johnny grinst die Polizisten an.
»Wir verfolgen das auf der Inspektion weiter«, erklärt der Beamte. »Entweder du kommst friedlich mit, oder die Sache wird unangenehm. Mitkommen wirst du so oder so.«
»Ihr haltet euch für schlau, was«, sagt Johnny und macht einen Schritt rückwärts, aus dem Telefon erklingt weiterhin das Freizeichen. »Aber ich bin viel schlauer als ihr beide zusammen, ihr Nullchecker.«
Bevor der Beamte etwas erwidern kann, wird der Anruf entgegengenommen.
»Hallo …?«
Es ist eine Männerstimme. Im Hintergrund ist ein Rauschen zu hören, wie von einer Brandung.
»Jan?«, fragt Christine.
»Hvem taler jeg med? Hallo?«
»Wer ist da? Jan Matz?«
»Jeg ved ikke …«
»Ist das Friesisch?«, fragt der Polizeibeamte.
»… telefonen lå her på stranden … jeg tog den op …«
Der Beamte beugt sich zum Telefon hinunter und sagt: »Hello, sir, where are you? Are you on Föhr?«
Am anderen Ende werden ein paar Worte gewechselt, jemand anders übernimmt das Telefon.
»Hallo?«
»Wer sind Sie?«, fragt Christine.
»The phone was on the beach, in a plastic bag«, sagt eine Frauenstimme mit dänischem Akzent.
»Where are you?«, fragt der Polizeibeamte noch einmal.
»Bulbjerg«, antwortet die Frau nach kurzem Zögern. »Close to Hanstholm.«
»This is the Police of Wilhelmshaven. Please, bring the phone to the police of Hanstholm«, sagt der Beamte. »Thank you … äh … tak.«
Es wird aufgelegt. Christine schüttelt den Kopf und schaut Johnny an, der sie mit seinen siebzehn Jahren schon ein gutes Stück überragt. Doch er erwidert den Blick nicht. Er starrt aufs Smartphone, kehrt in sein Zimmer zurück.
»Es tut mir leid, Frau, äh …«
»Pumper.«
»Es tut mir leid, Frau Pumper, aber Ihr Sohn muss mitkommen.«
3
Die Freyja, ein zum Bergeschiff umgebauter Kutter von der Insel Terschelling, ist zehn Seemeilen westlich von Amrum vor Anker gegangen. Sie ist anderthalb Tage lang im Gebiet zwischen dem Windpark und den Untiefen vor Sylt und Amrum gekreuzt und hat den Meeresboden mit dem Multibeam-Fächerecholot abgesucht. Auf der Brücke behielt Kapitän Sil van Hee, ein kräftiger Mann in den Vierzigern, hellblaue Augen und blonde Locken, Mehrtagebart, T-Shirt und Jeans, nebenbei den Bildschirm mit dem sich ständig verändernden Profil des Meeresbodens im Auge, einen Beutel Shag und eine große Flasche Cola in Reichweite.
Die Freyja fuhr gerade einmal drei Knoten, leicht rollend. Weil es bewölkt war und regnete, wurde es auch tagsüber nicht richtig hell auf See, der Horizont war nicht zu erkennen. Auf der Brücke herrschte eine fast feierliche Stille, nur unterbrochen von seltenen Funkmeldungen und hin und wieder einem leisen Signal des Echolots, wenn es eine größere Unebenheit entdeckte. Sil, der das Gerät und seine Eigenheiten genau kennt, ignorierte die meisten dieser Signale. Er war ganz auf seine Suche eingestellt. Stunden vergingen, und von Zeit zu Zeit reckte er sich, rutschte auf seinem Sitz nach vorn oder drehte sich eine Zigarette. Matrose Ties Boom brachte ihm eine Thermoskanne mit Kaffee und verschwand wieder nach unten.
Es war kurz nach zehn am Morgen, als ein Kontaktsignal des Echolots Sils Aufmerksamkeit erweckte. Er stellte den Fahrstufenregler auf langsame Fahrt zurück und wartete, bis die Freyja zum Stillstand kam; dabei schaute er auf den Bildschirm. Der Meeresboden stieg zum westlichen Ausläufer der Amrumbank hin an. Es war eine Stunde nach Niedrigwasser, weshalb die Wassertiefe dort kaum zehn Meter betrug. Auf dem Bildschirm war das Profil des Meeresbodens detailreich abgebildet, und man sah, dass etwas aus dem Sand herausragte. Es war kein Container, der da lag, das sah Sil sofort. Trotzdem schaute er genauer hin, etwas aufrechter jetzt, wie ein Jagdhund, der etwas gehört hat und horcht. Auf dem bläulichen Bild waren die Umrisse eines kleinen Schiffs zu erkennen, nicht länger als etwa dreißig Meter.
Eigentlich hätte Sil weiterfahren müssen. Die deutschen Behörden hatten ihm die Erlaubnis erteilt, einen Container aufzuspüren, und nicht, nach Wracks zu suchen. Die Versicherungsgesellschaft, bei der die Ladung des Containerschiffs Medea versichert war, hatte ihn beauftragt, einen Container zu bergen, den das Schiff vor zwei Wochen in einem Sturm aus Südwest beim Verlassen der Außenweser verloren hatte. Und weil ein Wartungstechniker auf HelWin beta, einer Umspannplattform des Offshore-Windparks Amrumbank West, angegeben hatte, er habe den Container zwischen den Windkraftanlagen nach Nordosten treiben sehen, suchte Sil van Hee das Gebiet zwischen dem Windpark und den Inseln ab. Dass der Container nach der Meldung durch den Techniker leckgeschlagen und gesunken war, stand inzwischen fest, allein schon, weil Hunderte von Schuhen und Quietscheenten an den Stränden von Rømø, Sylt, Amrum und Sankt Peter-Ording angespült worden waren.
Ties Boom, angelockt vom Leerlaufgeräusch des Motors, kam polternd den Niedergang zur Brücke hinauf.
»Gefunden?«, fragte er beim Hereinkommen.
Sil deutete mit dem Kopf auf den Bildschirm. Ties stellte sich neben ihn, und zusammen betrachteten sie das Geländemodell des Echolots.
»Das ist auf keiner Karte«, sagte Ties.
Sil schüttelte den Kopf. »Nein.«
Bevor Ties als Matrose bei Sil anheuerte, kannten sich die beiden Insulaner schon vom Verein »Costa Rica«, dem Tauchclub von Terschelling. Beide haben die Wrackkarten der Gebiete nördlich der Westfriesischen Inseln praktisch auswendig gelernt. Und sogar den Meeresboden hier, westlich der Nordfriesischen Inseln, haben sie bei den abendlichen Treffen im Club oder zu Hause im stillen Kämmerlein gründlich studiert und besprochen. Auch wenn er weit außerhalb der Jagdgründe niederländischer Taucher liegt und sie entsprechend selten hier getaucht sind. Sie wissen, dass die deutsche Küstenwache nicht viel für Wrackräuber übrighat, wie man sie zu nennen pflegt.
»Ich seh trotzdem mal nach«, sagte Sil, »nur zur Sicherheit.« Er schaltete einen Computer etwas weiter seitlich auf der Brücke an. Auf dem Monitor erschien eine Karte des gesamten Nordseebodens: von der mit Wracks übersäten Straße von Dover am östlichen Ende des Ärmelkanals bis zur norwegischen Küste, vor der ebenfalls zahlreiche torpedierte, an Felsen zerschellte oder einfach in Stürmen untergegangene Schiffe liegen.
Sil vergrößerte den Norden der Deutschen Bucht. Nördlich und westlich der Amrumbank zählte er elf Wracks. Doch die Freyja, deren Position auf der Karte mit angezeigt wurde, lag zwei Seemeilen vom nächsten eingezeichneten Wrack entfernt.
»Nein«, bestätigte Sil, »dies ist nicht drauf.«
»Was machen wir?«, fragte Ties.
Sil stand auf und suchte mit dem Fernglas das Meer ab. Weit und breit keine Küstenwache. »Wir sehen es uns kurz an.«
»Melden?«, fragte Ties.
»Wir werfen nur einen Blick drauf.«
So kommt es, dass die Freyja den Anker hat fallen lassen. Nicht, wie Kutter das normalerweise tun, von der Ankerklüse am Bug, sondern an einem der beiden Ausleger, an denen früher, als der Kutter noch fischte, die Baumkurren seitlich ins Wasser gelassen wurden.
Die Freyja liegt nun quer zum Flutstrom, und Sil lässt von einem Block am zweiten Ausleger, gegenüber dem mit dem Anker, einen Greifer ins Wasser, an dem eine Kamera und eine Lampe befestigt sind, die Leine kann er von der Brücke aus fieren und anholen. Er verdunkelt die Fenster der Brücke; im Dämmerlicht erscheinen auf dem Schirm neben dem Monitor mit der Wrackkarte die trüben Bilder der Kamera auf dem Weg nach unten.
Langsam wird das Wasser rings um den Lichtkegel der Lampe dunkler, hin und wieder huscht ein Fisch vorbei, und dann, erst noch verschwommen, aber bald deutlicher, wird wie durch eine beschlagene Scheibe ein Schiffsbug sichtbar. Vorsichtig lässt Sil die Kamera weiter hinunter. Inzwischen schaut ihm außer Ties Boom auch der Maschinist Piet Bonga über die Schulter. Sie schweigen. Diese Arbeit erfordert hohe Konzentration, und Sil wird dabei nicht gern durch Gerede gestört.
Der Bug ist teilweise im Sand begraben, aber etwa die Hälfte ragt noch hervor. Anscheinend ist das Schiff über das Heck gesunken. Ein wenig Sand wird aufgewirbelt, die letzten drei Buchstaben des Schiffsnamens werden lesbar. NNE.
Ties kann sich nicht mehr zurückhalten. »Ob das die Hanne ist?«, flüstert er.
»Langsam voraus«, sagt Sil, ohne das Kamerabild aus den Augen zu lassen. Dann blickt er auf. »Du, Ties.«
Ties springt ans Steuer, kuppelt den Motor kurz wieder ein, schaut dann erneut über Sils Schulter. Ganz allmählich beginnt sich das Bild zu bewegen. Die Bugspitze verschwindet, die Kamera schwebt über das Wrack, das mittschiffs fast vollständig im Sand begraben ist.
»Die Hanne hatte tausend Platten Anodenkupfer an Bord«, sagt Ties. »Im Vor- und Achterschiff. Wenn die das ist …«
Jetzt sieht man, dass das Wrack einen Knick hat, es ist mittschiffs durchgebrochen. Aber der Brückenaufbau ragt erstaunlich unversehrt aus dem Sand. Nur schief, das ja. Das Bild trübt sich ein, Sil holt die Leine ein wenig an, und es wird wieder schärfer.
»Was war das?«, fragt Piet.
»Stopp, Ties«, sagt Sil.
»War das ein Mann?«
Doch sie sind schon über das Wrack hinaus. Die Kamera, die durch die Vorwärtsbewegung der Freyja langsam über das Wrack gezogen wurde, hat Brückenaufbau und Achterschiff hinter sich gelassen und zeigt nur noch Sand.
Sil steht auf, schiebt Ties zur Seite und fährt nun, sehr vorsichtig, langsam achteraus, wobei er den Monitor mit dem Kamerabild im Auge behält. Leicht verzögert kommt die Kamera zum Stillstand und bewegt sich dann allmählich von achtern über das Wrack. Sil kuppelt den Motor aus und beobachtet gespannt, wie das Achterschiff erneut ins Bild kommt. Für einen kurzen Moment stellt er den Fahrstufenregler auf langsame Fahrt voraus, kuppelt wieder aus. Aufreizend langsam erfasst die Kamera den Brückenaufbau und schwebt dann auf der Stelle. Rechts unten im Bild ist tatsächlich ein Mann zu erkennen. Er trägt einen Tauchanzug, seine Druckluftlaschen hängen ein bisschen schief, er hat die Tauchmaske noch auf. Am rechten Unterschenkel ist ein Messer befestigt.
Sil, Ties und Piet starren schweigend auf die Gestalt.
»Der lebt nicht mehr«, sagt Ties schließlich.
»Da knacken wir den Jackpot, und dann das, verflucht noch mal«, sagt Piet. »Typisch. Da drin liegt eine Million in Kupfer …«
Sil schüttelt den Kopf. »Diese Hände …« Sehr vorsichtig lässt er die Kamera etwas weiter hinunter. Weil sie nicht genau über dem Taucher zum Stillstand gekommen war, verschwindet dessen Körper bei der Annäherung langsam aus dem Bild. Aber die Hände sind noch zu sehen. Und dass die Handflächen aneinandergelegt und die Handgelenke am Geländer des Niedergangs zur Brücke festgemacht sind. Mit Handschellen.
Sil richtet sich auf, kratzt sich kurz den Rücken. »Wie’s aussieht, haben wir die Hanne gefunden«, sagt er, »aber jemand ist uns zuvorgekommen.«
4
Dineke Hooimaker von der Inselpolizei Terschelling ist auf dem Weg von Formerum zur Dienststelle in West, als ihr Mobiltelefon klingelt. Auf der Rückbank sitzt schweigend eine alte Frau. Sie heißt Jeltje Schol und ist vom Seniorenheim in West, in dem sie wohnt, zu einem Haus am Rand von Formerum gegangen, dem Haus, in dem sie 1931 geboren wurde. Es ist ihr Geburtstag, und sie hat sich einen dünnen Zopf geflochten und sich früh auf den Weg gemacht. Sie hat schöne Sachen angezogen, ein geblümtes Kleid und darüber, wegen des unfreundlichen Herbstwetters, einen warmen Mantel. Wenn niemand sie mitnahm, war es ein mehrstündiger Fußmarsch, und der Tag hatte schon begonnen, deshalb durfte sie keine Zeit verlieren. Sie wusste, dass ihre Eltern sie erwarteten, weil sie Geburtstag hatte.
»Ich gehe nach Hause«, sagte sie zu den Fischen in dem großen Aquarium in der Eingangshalle des Altenheims. »Mama backt Pfannkuchen. Und am Tisch liest Papa Psalm 103 vor, nur für mich.«
Sie ging, sie sang, sie hatte Rückenwind. Ab und zu drehte sie sich um, weil sie sehen wollte, ob aus dem Dorf vielleicht jemand mit einem Pferdefuhrwerk kam. Doch es kam kein Fuhrwerk, also ging sie weiter.
Dass sie nicht neun, sondern vierundachtzig geworden war, entging ihr. Und auch, dass ihre Eltern schon seit fast vierzig Jahren tot waren und folglich nicht mehr im Elternhaus wohnten.
Dass die neuen Bewohner sie nicht ins Haus ließen, verwirrte sie. Sie erklärte, sie habe Geburtstag, und spähte in den Flur. Erst rief sie ihre Mutter. Als Mutter nicht kam, rief sie nach ihrem Vater.
Und als der fremde junge Mann die Haustür vor ihrer Nase schloss, um die Polizei anzurufen, hat sie angefangen zu schreien und sogar eine Handvoll Muschelgrieß vom Gartenweg an die Fenster geworfen.
Dineke Hooimaker und ihr Kollege Joost Fons waren ohnehin gerade auf Streife und deshalb schnell zur Stelle. Dineke sagte Jeltje, sie sei gekommen, um sie mit dem Taxi abzuholen. »Steig ein, Jeltje, du hast die Rückbank ganz für dich allein.«
Im Streifenwagen beruhigte sich Jeltje. Durchs Seitenfenster betrachtete sie die Häuser, die Dünen und die Wiesen, die vorbeiglitten. Ein paarmal beugte sie sich vor. »Ich habe heute Geburtstag«, sagte sie dann. Plötzlich klingelt Dinekes Mobiltelefon. Nicht das Diensttelefon, sondern ihr privates. Sie nimmt ab. »Dineke?« Es klingt fast wie eine Frage.
»Ja, Sil van Hee«, hört man aus den Autolautsprechern. Und dann, nach einem Moment Stille: »Von der Freyja.«
»Ich weiß, wer du bist«, sagt Dineke. »Muss ja dringend sein, wenn du meine Privatnummer anrufst.« Für Dineke Hooimaker, als Tochter von Einzelhändlern aus Laren im Achterhoek ein Import vom Festland, war es sehr gewöhnungsbedürftig, dass auf der Insel nichts völlig privat bleibt, obwohl sie Polizeibeamtin ist. Sie fragt gar nicht erst, woher der Kapitän ihre Nummer hat.
»Ich hab hier einen Fall«, erklärt Sil.
»Du bist über Lautsprecher zu hören, und ich habe Jeltje Schol hinten im Wagen«, sagt Dineke mit einem Blick in den Rückspiegel.
»Hallo, Jeltje«, sagt Sil.
»Ich habe Geburtstag«, sagt Jeltje.
»Soll ich dich an Joost weitergeben?«, fragt Dineke.
Ihr Kollege auf dem Beifahrersitz hebt die Augenbrauen. »Sonst bist du nicht so scharf drauf, mit uns zu reden, Sil«, sagt er.
»Ich will es mit dir besprechen, Dineke.«
»Ist es so ernst?« Dineke bremst ab und lenkt den Wagen auf den Seitenstreifen. »Ich fahre erst mal rechts ran.«
»Ich habe hier einen Toten«, sagt Sil, als Dineke endlich mit dem Mobiltelefon am Ohr neben dem Wagen steht.
Dineke erwidert nichts, klopft an die Windschutzscheibe und gibt Joost mit einer Geste zu verstehen, dass er aussteigen soll. »Moment«, sagt sie, »ich stehe hier ungünstig.« Während ein Auto vorbeifährt, schaltet sie den Lautsprecher des Telefons ein und geht zu Joost, der ausgestiegen ist.
»Was hast du gesagt, Sil?«, fragt sie. »Ich will nur sicher sein, dass ich dich richtig verstanden habe.«
»Ich habe hier einen ertrunkenen Taucher.«
»Wo bist du?«
»In der Deutschen Bucht, vor Amrum.«
»Auf See«, vergewissert sich Dineke.
»Auf See, ja«, bestätigt Sil. »Bei Amrum.«
»Was ist passiert? Ist es einer von deinen Leuten?«
»Nein, nein«, antwortet Sil. »Keine Ahnung, wer das ist. Er ist unten, in einem Wrack, über dem wir liegen. Ich sehe ihn durch die Kamera.«
Dineke schickt Joost mit einer Handbewegung weg, und er steigt schulterzuckend wieder ein.
»Was wolltest du fragen, Sil?«, fragt Dineke und legt das Telefon wieder ans Ohr.
»Ich hab gedacht, weil wir sowieso auf See sind … Kann ich diesen Toten auf die Insel mitnehmen, ihn einfach zu Hause an Land bringen und dann euch überlassen, so als ob wir ihn beim Bergen mit hochgeholt hätten? Oder müssen wir was anderes unternehmen, hier …« Er ist einen Moment still. »Das würd ich nämlich lieber nicht«, sagt er dann.
»Was glaubst du, Sil? Überleg mal.«
Sil schweigt. Dann seufzt er. »Hatte ich schon befürchtet.«
»Deutsche Küstenwache verständigen«, sagt Dineke.
»Wenn’s denn sein muss … Ich dachte nur, ich frag erst mal …«
»Tja, dann halt die Ohren steif«, sagt Dineke, und sie fügt hinzu: »Und tu mir einen Gefallen, Sil: nicht mehr diese Nummer, hörst du?«
Sie legt auf.
5
Am liebsten hätte Sil die Hanne sich selbst überlassen und weiter nach dem Container gesucht. Aber das Bild des Tauchers, gefesselt ans Geländer des Niedergangs, verfolgt ihn.
»Wir können das Schiff doch ausräumen und dann weiter«, meint Piet Bonga. »Der Mann ist doch sowieso tot.«
»Du bist kein Taucher«, sagt Sil.
»Um torpedierte Seeleute machst du dir sonst weniger Gedanken«, erwidert Piet. »Als ob das so ’n großer Unterschied wär.«
Sil starrt schweigend den Taucher auf dem Monitor an. Wenn man lange genug hinsieht, ist es ein stilles, beinahe friedliches Bild. Wegen der Flut hängt die Kamera jetzt ein wenig höher, sodass der Taucher wieder ganz zu sehen ist, als hätte Sil weggezoomt. »Da«, sagt er zu Piet, »sieh ihn dir genau an, und dann sag das noch mal.«
Piet zieht die Schultern hoch. »Eine Million, Sil. Da liegt eine Million. Ich seh vor allem mein leeres Bankkonto.«
»Ich habe Hooimaker angerufen«, sagt Sil. »Wir haben keine Wahl mehr.«
»Ich kapiere einfach nicht, wieso du das gemacht hast.«
»Um zu verhindern, dass ich doch noch auf dich höre.«
»Bin mal mit Sil getaucht, zu dem englischen U-Boot nördlich der Noordergronden«, wirft Ties ein. »Wir waren nur zu zweit, Anker fallen lassen, saß fest drin, dachten wir. Wir runter, aber ab zehn Metern trübe Suppe, jede Menge Zeugs, Pflanzen, Plastik, wir sahen nichts. Und von einem Moment zum andern hatte ich ihn verloren. Und der Anker hatte sich losgerissen. Wir waren fast zwanzig Meter tief, also schön langsam rauf, und wenn man dann oben ist, kann man nicht mehr runter. Bestimmt ’ne halbe Stunde hab ich im Boot so vor mich hin gebibbert. Und immer wieder gekuckt, Lampe ins Wasser, runtergeleuchtet. Man ist einfach hilflos. Und dann kommt der Kerl rauf, als wär nix gewesen.«
»Ich mach manche Dinge gern allein«, sagt Sil.
Alle drei schauen wieder auf den Schirm. Der Taucher wird vom Flutstrom ein kleines bisschen zur Seite gezogen. Sein linker Fuß ist unter einer der Stufen eingeklemmt, als hätte er seine ganze Körperkraft einzusetzen versucht, um seine Hände aus den Handschellen herauszuwinden.
»Na, dann setzen wir mal eine Meldung auf Kanal 16 ab«, sagt Sil und steht auf. »Mal sehn, ob die Küstenwache wach ist.«
»Was sagst du, wenn sie dich fragen, wieso wir uns überhaupt dieses Wrack ansehen?«, fragt Piet.
»Dass wir dachten, es wär der Container.«
Eine Stunde später ist die Bad Bramstedt, ein Patrouillenschiff der Bundespolizei See, in einigem Abstand längsseits gekommen. Drei Beamte mit Schwimmwesten fahren in einem RIB zur Freyja. Ties lässt eine Lotsenleiter hinunter, und die Männer klettern routiniert aus dem Festrumpfschlauchboot an Bord. Sie stellen sich nicht vor, geben niemandem die Hand, fragen nur nach den Ausweisen. Auf ihre deutschen Fragen gibt Sil kurze englische Antworten. »No German«, sagt er. »Sorry.«
Zwei der Beamten verschwinden mit Ties und Piet in der Messe, der dritte steigt mit Sil zur Brücke hinauf. Kurz danach schauen sie zusammen auf den Bildschirm. Der Beamte entfernt sich ein paar Schritte, gibt über sein Funkgerät etwas an die Bad Bramstedt durch und kommt zu Sil zurück, um wieder den reglosen Taucher zu betrachten.
»Mein Gott«, entfährt es ihm.
»A diver yourself?«, fragt Sil.
Der Beamte bewegt die Schultern, wie um die Frage abzuschütteln, und fragt dann: »Sprechen Sie kein Wort Deutsch?«
Sil schüttelt den Kopf. »Nein.«
»Why are you here?«
»Salvage a container, lost by the Medea«, antwortet Sil.
Der Bundespolizist blickt auf den Bildschirm. »That is not a container«, sagt er.
»No«, sagt Sil, »that is not a container.«
Der Beamte denkt nach. Dann trifft er eine Entscheidung. »You have to stay here. Don’t move your ship, don’t lift anchor. Just … stay.«
Er geht zum Fenster, blickt zur Bad Bramstedt hinüber und spricht leise in sein Funkgerät. Sils Blick schweift durch den Raum, er sieht, dass auf dem anderen Monitor noch die Wrackkarte zu sehen ist, schaut zu dem Beamten hin, der ihm den Rücken zugewandt hat, und schließt das Programm.
Als der Beamte sich wieder umdreht, hat Sil sich gerade einen Kaffee eingegossen und hingesetzt.
»You have to stay and wait for our detective«, sagt der Bundespolizist. »He speaks Dutch. He is from your island of Texel. But it will take a while.«
»I am not from Texel«, sagt Sil unwirsch. »I have to move on. I can’t afford to wait.«
»You have to wait.«
Sil stellt seinen Kaffeebecher ab. »Texel«, sagt er und schüttelt den Kopf.
»His name is Cupido«, sagt der Beamte.
Sil blickt auf. »Cupido?«
»You know him?«, fragt der Beamte.
»No«, antwortet Sil. »No. But this ship used to belong to a fisherman Cupido from Texel, the TX 9. He drowned, the ship was sold. We bought it.«
»His father was a fisher«, sagt der Bundespolizist. »That is all I know.«
»Well, well«, sagt Sil. »And he has to come from Texel now?«
»No, from Cuxhaven. But it will take a while. You have to stay here till he arrives.«
6
Hauptkommissar Liewe Cupido steht vor einem kleinen Haus am Rand von Nordholz, eine halbe Autostunde von der Inspektion am Hafengelände Cuxhavens entfernt. Das Haus steht leer, es ist zu verkaufen. Er ist einmal um das Gebäude herumgegangen und betrachtet nun prüfend die Dachrinne und die Fensterrahmen. Neben ihm sitzt sein Hund und blickt zu ihm auf.
Während der gewohnten Runde mit dem Hund auf dem unbebauten Land am Hafen ist er plötzlich umgekehrt und über den Deich zum Parkplatz hinter der Inspektion zurückgegangen, hat den Hund auf die Rückbank seines Wagens springen lassen, ist selbst eingestiegen und losgefahren.
Vom Hafen fuhr er nach Südwesten, wo die immer spärlichere Bebauung durch Wiesen und schließlich eine leicht hügelige Landschaft mit Sandböden und Wäldchen abgelöst wurde. Er fuhr bis zum Heidegebiet bei Altenwalde, parkte neben einem Sandweg und ging in den Wald. Die Hündin, von der Leine gelassen, rannte vor ihm her. Sie hatte in Aurich ein Dasein als Streunerin gefristet, war vor ein paar Wochen unbemerkt in Liewes Auto gesprungen und beanspruchte seitdem einen Platz in seinem Leben, was dieses Leben nicht unerheblich verkompliziert hatte. Nicht nur, weil sie ausgeführt und gefüttert werden musste, sondern auch, weil sie ihr Herrchen am liebsten keinen Moment aus den Augen verlor. In Liewes Leben gibt es wenig Regelmäßigkeit, und ihm bleibt nichts anderes übrig, als sie mitzunehmen, wann immer es möglich ist: nicht nur ins Büro, sondern auch, wenn er zu Ermittlungen unterwegs ist. Sein Vorgesetzter Hermann Rademacher hatte zunächst protestiert, doch das kümmerte Liewe einfach nicht. Außerdem bleibt die Hündin in fast jeder Situation ruhig, rollt sich bei Besprechungen unterm Tisch zusammen und schläft, bis Liewe fertig ist. Nach einiger Zeit bemerkte niemand mehr ihre Anwesenheit. Wenn Liewe unterwegs übernachten muss, ist es fast immer das Hotel, das Schwierigkeiten macht, nie der Hund.
Er hat ihr den Namen Vos gegeben, das niederländische Wort für Fuchs. Ein Kollege hatte sie in Aurich bei einer nächtlichen Überwachungsaktion für einen Fuchs gehalten. Vielleicht ist Liewe deshalb auf diesen Namen gekommen.
Der Spaziergang ist vorbei, aber Liewe hat es nicht eilig, zur Inspektion zurückzukehren. Er hat einen Umweg über Nordholz gemacht, wo dieses kleine, aber freistehende Haus zu verkaufen ist. Es steht in der Nähe des Flugplatzes Nordholz-Spieka und somit auch des Fliegerhorstes Nordholz, was Vorstellungen von Unruhe erweckt, aber eigentlich hält sich der Flugverkehr in Grenzen. Das Häuschen ist von Birken- und Nadelwäldchen und sanft gewelltem Weideland umgeben. Wer nicht wüsste, dass in drei Himmelsrichtungen nur eine halbe Stunde entfernt die Nordsee und die Mündungen von Weser und Elbe liegen, könnte ohne Weiteres glauben, irgendwo im Osten des Landes zu sein, weit weg von der Küste.
Das Haus hat vorn einen spitzen Giebel, auf der weißen Farbe sieht man hier und da anthrazitgraue Regenspuren, als hätte der Himmel Mascaratränen geweint.
»Was hältst du davon, Vos?«, fragt Liewe. Er blickt sich um. Dann klingelt sein Telefon. Es ist Lothar Henry, der stellvertretende Leiter der Bundespolizei See in Cuxhaven.
»Wo bist du?«
»Unterwegs«, sagt Liewe.
»Ich wusste nicht, wo du geblieben warst.«
Liewe wartet ab.
»Du musst raus auf die Nordsee, wir haben einen Toten. Die Bad Bramstedt ist da, aber auch ein Niederländer, Freyja, ein Bergeschiff, das über einem Wrack geankert hat. Auf dem Wrack ist ein Taucher, und der ist tot, angekettet.«
»Verstehe«, sagt Liewe.
»Dieser niederländische Kapitän, der spricht kein Deutsch.«
»Wracktaucher?«
»Bergungsunternehmer, von Terschelling. Mit einem umgebauten Fischkutter.«
»Verstehe«, sagt Liewe.
»Kennst du ihn?«
Liewe antwortet nicht, er klopft ein paarmal seitlich auf sein Bein. Vos kommt zu ihm. Er streicht ihr über den Kopf. »Und jetzt?«, fragt er dann.
»Du musst hin.«
»Können die sich nicht auf Englisch verständigen?«
»Es geht um einen Mord, Liewe«, sagt Lothar verblüfft. »Jedenfalls sieht es ganz danach aus. Da müssen wir schon möglichst präzise ermitteln.«
Liewe antwortet nicht, aber jetzt wartet auch Lothar ab.
»Hab gerade wenig Zeit«, sagt Liewe schließlich.
»Aha, und deshalb verkrümelst du dich während der Dienstzeit … Ich versteh dich nicht, Liewe. Das hier ist wirklich mal was Besonderes, und ein Niederländer hat was damit zu tun. Wie gemacht für dich. Oder hast du einen bestimmten Grund, nicht hinzuwollen?«
»Dem Mann bin ich nie begegnet …«
»Sie warten auf dich, Liewe. Wir fliegen dich nach Amrum, von da nimmt dich ein RIB mit.«
»… aber ich kenne das Schiff«, sagt Liewe.
»Wieso kennst du das Schiff?«
»Es war das Schiff von meinem Vater.«
Lothar weiß erst einmal nicht, was er sagen soll. Liewe und er kennen sich jetzt gut zehn Jahre, und es gab eigentlich nie Reibereien zwischen ihnen, aber ein vertrauliches Verhältnis ist es auch nie geworden. Niemand hat ein vertrauliches Verhältnis zu Liewe Cupido. Dass sein Vater Fischer war und auf See ertrunken ist, ist allerdings nichts Neues für Lothar.
»Du weißt, dass das keine Rolle spielt, Liewe«, sagt er.
»Ich bin hier in der Nähe der Flugplätze, aber Vos ist bei mir.«
»Und? Was willst du damit sagen?«
»Dass sie dann mitmuss«, sagt Liewe und legt auf.
7
Der Seenotrettungskreuzer Margrethe Gaardbo läuft mit kaum drei Knoten Fahrt in den Hafen von Hirtshals ein. Er schleppt ein gekentertes Sportangelboot, das die Fähre nach Island beim Auslaufen sechs Seemeilen vor dem Hafen gesichtet hat.
Kaum war die Meldung eingegangen, hatte die Margrethe Gaardbo mit Höchstgeschwindigkeit die angegebenen Koordinaten angesteuert, doch dort angekommen, ahnten die Retter gleich, dass es nichts mehr zu retten gab. Still wie ein sterbender Wal schaukelte das Boot kieloben in der Dünung. Zwei Seenotretter sprangen im Tauchanzug ins kalte Wasser, klopften mehrmals auf den Rumpf, horchten, tauchten unters Boot, um hineinsehen zu können. Es war niemand darin zurückgeblieben.
So schnell sie ausgelaufen waren, so langsam laufen sie wieder ein, hinter ihnen das Boot, die hellblaue Unterseite des Rumpfs immer noch oben.
Auf dem Anleger werden sie von Andrea Jenssen von der Hafenpolizei erwartet. Sie hat sich tief in ihre Jacke verkrochen, ein kalter auflandiger Wind weht, und es nieselt. Sie fängt die Festmacherleine, die ihr zugeworfen wird, und legt sie um einen Poller, ohne den Blick von dem gekenterten Boot abzuwenden.
»Also niemand an Bord?«
»Nein«, sagt einer der Seenotretter, als er auf den Anleger steigt. »Niemand aus Fleisch und Blut jedenfalls.«
»Deutsches Boot?«
»Heimathafen ist Wyk auf Föhr. Steht auf dem Heck.«
»Offensichtlich gerammt«, sagt Andrea. Sie deutet mit dem Kopf auf eine Beule an Backbord. »Die Besatzung wird wohl über Bord gegangen sein. Vielleicht war es nur einer.«
»Von jetzt an bist du zuständig«, sagt der Seenotretter. »Du sagst ja Bescheid, wenn du noch was von uns willst.«
»Schleppt es bitte noch zum Bootskran, okay?«, sagt Andrea. »Umdrehen müssen wir es so oder so.«
Eine Stunde später hängt das Boot tropfend über dem Wasser. Andrea und ihr Kollege Liam Berg stehen Schulter an Schulter vor dem Kran auf dem Kai und betrachten es. Seitlich am Bug ist der Name Skua aufgemalt. Am Heck nicht weit über der Wasserlinie ist eine Plattform angebracht, groß genug, um darauf stehen oder sitzen zu können. Das etwa zehn Meter lange Boot hat auf dem Angeldeck eine Winsch und am Heck zwei Davits.
»Ich vermute, der Bootsbesitzer hat gern Sachen an Bord gehievt«, sagt Andrea. »Wracktaucher, würde ich wetten.«
Plötzlich stößt Liam seine Kollegin an und sagt: »Ich glaube, der Anker ist weg, siehst du? Halt mich kurz fest …« Er reicht ihr seine linke Hand, die sie mit beiden Händen packt, beugt sich dann seitlich über den Rand des Kais und streckt seine Rechte nach der ins Wasser baumelnden Ankerkette aus. Andrea verlagert ihr Gewicht nach hinten, um ihn halten zu können. Er erwischt die Kette, Andrea zieht ihn wieder zurück. Als Liam die Kette ganz aus dem Wasser geholt hat, sehen sie, dass der Anker tatsächlich fehlt. Der Schäkel, an dem er befestigt war, ist aufgeschraubt.
»Wir sollten mal Föhr anrufen«, sagt Andrea.
8
Es kommt selten vor, dass Liewe im Hubschrauber übers Wattenmeer fliegt. Weil es etwas umständlich ist, so zu einem Einsatzort auf See zu kommen, muss die Sache schon dringend sein. Der Bundespolizei See sind zwar gerade drei große Einsatzschiffe mit Hubschrauberlandedeck bewilligt worden, aber bis zu deren Stapellauf werden noch ein paar Jahre vergehen.
Dass Liewe jetzt nach Amrum geflogen wird, von wo ihn ein Festrumpfschlauchboot zur Bad Bramstedt bringen wird, liegt daran, dass es immer noch um einiges schneller geht, als mit dem Schiff von Cuxhaven zur Amrumbank zu fahren.
Liewe hat sich angeschnallt und hält Vos auf dem Schoß in den Armen. Sobald der Hubschrauber in der Luft ist, beugt er sich ein wenig zum Fenster, um hinunterzuspähen.
Es ist mitten am Nachmittag, Wind aus Nord bringt Regenschauer, und wo die Wolkendecke zwischendurch aufreißt, fallen Bündel Sonnenlicht, die Liewe an Jakobsleitern erinnern, schräg auf Land und Meer. Weil sich das Wasser vom Watt zurückzieht, wird das bizarre Muster der Priele in der Schlickfläche sichtbar, ein Wirrwarr mäandrierender Adern, die im Licht der tief stehenden Sonne silbern glänzen. Die schmalen Strände der kleinen unbewohnten Inseln leuchten wie bronzene Sicheln auf, und die Salzwiesen, die sich hinter diesen Stränden verbergen, glühen in ihren Herbstfarben – ein Patchwork aus Blutrot, Violett, grellem Grün und Gelb. Vögel fliegen in großen Schwärmen auf, die plötzlich die Richtung ändern. Liewe schaut hinunter und krault Vos beruhigend hinter den Ohren.
Der Himmel zieht sich wieder zu, neue Schauer kommen, und als unten gerade die Halligen Hooge, Langeneß und Gröde vorbeikommen, verschwindet die Sonne ganz hinter Wolken, das Watt wird zu einer weiten Fläche ohne Farbe und Perspektive.
Solange die Sonne schien, hat Liewe nicht nach Westen geschaut, doch jetzt sucht er den Horizont ab. In der Ferne entdeckt er die Bad Bramstedt, und daneben liegt sie: die Anna, die TX 9, auf die er als Kind so viele schlaflose Nächte lang gewartet hat. Von seinem Zimmer aus, unterm Dach in dem Haus am Deich auf Texel, hörte er sie auslaufen und zurückkommen. Er erkannte ihr Motorgeräusch, anders als das der anderen Kutter, ein wenig heiser. Sein Vater, auf der Brücke seines Schiffs, verschwand durchs Marsdiep ins schwarze Loch der Nacht, und man wusste nie, wann er wieder daraus zurückkehren würde. Liewe lag wach und horchte.
Doch jetzt ist sie wieder da, die Anna seines Vaters, um vieles älter und mit einem anderen Namen, den Lothar auch erwähnt, Liewe aber schon wieder vergessen hat.
Der Hubschrauber beginnt den Landeanflug nach Amrum, und kurz vor der Landung dreht er, sodass die Schiffe nicht mehr zu sehen sind. Stattdessen Dünen und vom Abwind des Rotors gebeutelte Bäumchen. Kurz danach ist die Maschine gelandet. Liewe löst seine Gurte, steigt aus und hebt dann Vos hinunter. Ein Polizeiwagen steht bereit.
Die Fahrt zur Bad Bramstedt und zu dem Kutter ist unruhig. Windstöße, die weiteren Schauern vorangehen, packen das RIB, das auf den Wellen tanzt. Liewe hat auch Vos so gut es ging eine Schwimmweste um den Leib gezurrt. Sie liegt vor seinen Füßen im Windschatten des halboffenen Steuerstands, während auf beiden Seiten Bugwellen vorbeisausen.
Zwanzig Minuten später schaukeln sie neben der Freyja. Liewe klettert über eine Lotsenleiter an Bord, beugt sich über die Reling und ruft hinunter, dass die Bad Bramstedt das RIB mit Vos darin aufnehmen soll. Dann zieht er seine Schwimmweste aus und wendet sich Sil van Hee zu, der von der Brücke heruntergekommen ist.
»De schipper?«, fragt er auf Niederländisch.
Sil nickt. »Willst du oben reden oder dich erst noch umsehen?«
Liewe schaut zur Brücke hinauf, dann zu den ausgeklappten Auslegern mit Stahlseilen, die straff gespannt ins Wasser hängen.
»Den Anker gegen den Strom, damit sie schön still liegt«, erklärt Sil. »Dann den Greifer mit der Kamera auf der anderen Seite runter. Die Tide ist inzwischen gekentert, aber deine Kollegen haben mich angewiesen, alles so zu lassen, wie es war. Der Ebbstrom zieht uns also bald vom Wrack weg. Wenn du den Taucher noch sehen willst, müssen wir uns beeilen.«
»Dann geh mal vor«, sagt Liewe und folgt Sil den Niedergang zur Brücke hinauf. Auch der Beamte von der Bad Bramstedt, der schon mit Sil auf der Brücke war, kommt mit.
Gleich darauf stehen Sil und Liewe vor dem Bildschirm. Der Taucher ist gerade noch zu sehen. Liewe betrachtet das Bild ohne erkennbare Regung und schaut sich dann auf der Brücke um. Er schlägt vor, sich zu setzen.
»Ich führe dieses Gespräch auf Niederländisch«, sagt er zu seinem Kollegen. »Aber bleib ruhig da, wenn du willst.« Und dann zu Sil: »Du hast nach einem Container gesucht.«
»Von der Medea. Ein Techniker vom Windpark hat ihn hierhin treiben sehen. Deshalb haben wir hier gesucht.«
»Du liegst über einem Wrack.«
»Ja«, sagt Sil. »Wir bekamen ein Kontaktsignal vom Echolot. Ich dachte, es könnte der Container sein.«
Liewe schaut Sil eine Weile schweigend an. »Terschelling, was?«, sagt er dann.
Sil lächelt.
»Und wen haben wir da?« Liewe deutet mit dem Kopf auf den Bildschirm.
»Der Taucher? Keine Ahnung.«
»Das Schiff.«
Sil streckt den Rücken durch, kratzt sich kurz an der Stirn. »Die Hanne«, sagt er. »1950 gesunken. Seitdem verschollen. Hatte den Sturm noch bei Terschelling abwettern wollen.«
»Ladung?«
»Tausend Platten Anodenkupfer, für Hamburg.«
»Tausend Platten Kupfer, aber auch ein toter Taucher«, sagt Liewe. »Wenn das kein Pech ist.«
Sil zuckt mit den Schultern. »Wir waren auf der Suche nach dem Container«, sagt er. »Hätte gern auf das hier verzichtet.«
»War nichts Großartiges, dieses Schiff«, sagt Liewe.
»Kam von Duisburg den Rhein runter und wollte dann durch die Deutsche Bucht nach Hamburg. Aber es war Südwest 9. Ein Fischer aus Bremerhaven will sie noch gesehen haben, nordwestlich von Helgoland. Wenn das stimmt, muss sie manövrierunfähig gewesen sein. Ich hab mal den Logbucheintrag von diesem Fischer gelesen, von der Rotersand, er hätte noch gerufen, ob sie Hilfe bräuchten, aber der Schiffer hätte abgewinkt.«
»Abgewinkt«, sagt Liewe.
»Bei Windstärke 9 rufen, und dann wird abgewinkt, ich finde die Geschichte unwahrscheinlich.«
Liewe zieht die Schultern hoch, als wäre ihm kalt. »Bist du unten gewesen?«, fragt er dann.
»Beim Wrack? Nein.«
»Ich kann dein Schiff durchsuchen lassen …«