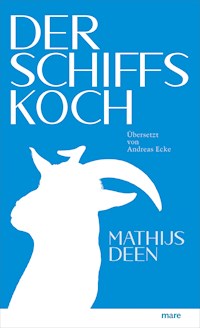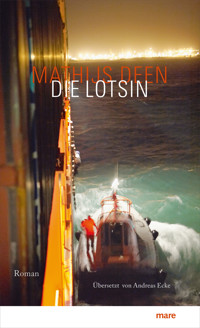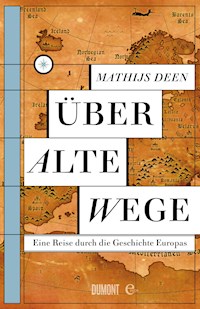9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knesebeck Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Eine kulturhistorische Reise von der Quelle bis zur Mündung des Rheins Über 1200 Kilometer fließt der Rhein durch sechs Staaten – und durch das Herz Europas. Mathijs Deen erzählt so virtuos wie persönlich, so fesselnd wie kenntnisreich die Geschichte des Flusses und die Geschichten, die sich an und in ihm zugetragen haben (könnten). Über Zeiten und Grenzen hinweg sind wir mit den Flusspferden, die einst am Rheinufer grasten, unterwegs und mit den Lachsen auf dem Weg zu ihren Laichplätzen, mit Julius Caesar und dem jungen Goethe. Eine lebendige und humorvolle kulturhistorische Betrachtung des bedeutendsten Stroms Deutschlands. Spannenden Erzählungen erwecken den Rhein zum Leben In Fluss ohne Grenzen nimmt Mathijs Deen Sie mit in die Grauzone zwischen Fakt und Fiktion, Wissen und Fantasie. Angefangen bei den Flusspferden, die vor Millionen von Jahren an den Ufern des Flusses weideten, bis zu den erschöpften Lachsen, die ihren Lebensraum langsam verändern mussten, vom Mädchen aus dem antiken Steinheim bis zu den römischen Feldherrn Corbulo und Julius Caesar, der den Rhein als Grenze seines Reiches sah, vom jungen Goethe bis zu den Nordseefischern und Geologen. Und Deen erzählt nicht nur die Geschichte des Flusses, sondern die Geschichten, die sich an und in ihm zugetragen haben, in denen der Rhein immer präsent ist, manchmal als Hauptfigur, manchmal auch als Statist. Der Rhein ist, neben der Donau und der Elbe, vielleicht der europäische Fluss. Er entspringt nicht einfach nur in den Alpen, sondern seine Zuflüsse kommen aus allen Teilen Europas. In Fluss ohne Grenzen geht Mathijs Deen der Seele des Rheins auf den Grund und schafft in unerwarteten Geschichten eine natur-, literatur- und kulturhistorische Biografie des Rheins.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Die Übersetzung dieses Buches wurde von derniederländischen Stiftung für Literatur gefördert.
Titel der Originalausgabe:
De grenzeloze rivier. Verhalen uit het rijk van de Rijn
Erschienen bei Thomas Rap, Amsterdam
Copyright © 2021 Mathijs Deen
Deutsche Erstausgabe
Copyright © 2023 von dem Knesebeck GmbH & Co. Verlag KG, München
Ein Unternehmen der Média-Participations
Projektleitung: Dr. Hans Peter Buohler, Knesebeck Verlag
Übersetzung: Andreas Ecke, Bonn
Lektorat: Ingrid Exo, Leipzig
Grafikelemente: Umschlagmotiv © Bridgeman Images,
Buchrücken © Shutterstock / Andriy Solovyov
Karte: Angelika Solibieda, Karlsruhe
Umschlaggestaltung: Favoritbüro, München
Satz und Herstellung: Arnold & Domnick, Leipzig
ISBN 978-3-95728-682-6
Elektronisch ist folgende Ausgabe erhältlich:
eBook (epub): ISBN 978-3-95728-748-9
Alle Rechte vorbehalten, auch auszugsweise.
www.knesebeck-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Es wäre zu wünschen, dass ein kluger oderkunstverständiger Geologe einmal einunterhaltsames und verständliches Buch über dieGeschichte des Rheins schreibt.Darin würde viel Staunenswertes vorkommen.
Jac. P. Thijsse, Onze groote rivieren [Unsere großen Flüsse]
Den Rhein hat es immer gegeben.
Kim Cohen, Paläogeograf
Inhalt
Geburt
Flussbetten
Flusspferd
Zuhause
Der eislaufende Bär
Rubikon
Kanäle
Inseln
Bad
Einfallstor
Loreley
Basel
Beten und Arbeiten
Weg
Zum Schluss
Dank
Es war Donnerstag, der 13. September 2018, und auf einer Landspitze der Mittelmeerinsel Vis waren lange Tische gedeckt. Girlanden mit Lämpchen hingen zwischen den Nadelbäumen. Die Sonne war untergegangen, der Westen glühte noch ein wenig nach.
Meine Tochter feierte ihre Hochzeit, und ich saß ihr gegenüber. Der Mann links neben mir, der Ed heißt, hatte wieder Platz genommen, nachdem er eine Rede an das Brautpaar gehalten hatte. Er ist nicht nur der englische Stiefvater meiner Tochter, er ist auch Geologe. Seine Ansprache hatte er, das Glas in der Hand, mit der Feststellung eingeleitet, dass wir uns auf einer Insel im Adriatischen Meer aufhielten, über die sich in geologischer Hinsicht viel Interessantes sagen lasse, dass er aber davon absehe, weil wir ja nicht deswegen gekommen seien. »Heute Abend geht es um die Braut und den Bräutigam«, sagte er zur Beruhigung der Gäste.
Es folgte ein mit passenden Neckereien gespickter Vortrag, der schließlich auf das Bekenntnis zusteuerte, dass Ed, auch wenn er das nie ausdrücklich gesagt hatte, meine Tochter liebte und ihr alles Glück der Welt wünschte. »Das war nicht übel«, sagte ich, als er wieder saß, in halbherzigem Bemühen um britisches Understatement. Er grinste. Vor zwanzig Jahren hatte er die Frau geheiratet, von der ich geschieden worden war. Meine Ex-Frau und meine Tochter hatte er übers Meer nach Schottland mitgenommen, wohin er aus beruflichen Gründen zog, und nun saßen wir hier zusammen. Ich hatte meine Hochzeitsansprache vor ihm gehalten, und dabei waren bei manchen Zuhörern Tränen geflossen. Als er sprach, wurde gelacht.
»Was ich dich fragen wollte: Ich schreibe ein Buch über den Rhein«, sagte ich, um ein Gespräch in Gang zu bringen, »und da wir ohnehin gerade über die Dinge des Lebens sprechen «, ich nickte in Richtung des Brautpaars, »angenommen, der Fluss wäre eine Person, mit einem Leben und einem Tod …«
Ich wurde von meiner Tochter abgelenkt, die mein Nicken als Gruß gedeutet hatte und ihn mit erhobenem Glas erwiderte. Genau gleichzeitig griffen Ed und ich nach unseren Gläsern und prosteten ihr zu. Sie lachte, auch wir lachten.
»Angenommen, der Fluss wäre eine Person«, wiederholte ich, als meine Tochter ihre Aufmerksamkeit wieder anderen zuwandte, »dann hat er doch eine Geburt und einen Tod.« Ed nickte, stellte sein Glas hin und schaute auf seinen Teller.
»Wenn man sich den Rhein als Kind vorstellt, dann ist er ein Kind der Alpen, weil er in den Alpen entspringt. Aber die Alpen sind nicht immer da gewesen. Beschreib mir, wie sie entstanden sind. Du weißt so etwas. Stell dir vor, wir hätten das miterleben können.«
Er blickte auf und runzelte die Stirn. Ich sah, dass sein Haar grau geworden war, ich wusste, dass auch ich sichtbar alterte, und mir kam der Gedanke, dass wir beide bei der nächsten Generation zu Gast waren, dass Dinge kommen und gehen, ohne dass man sie aufhalten kann.
»Angenommen, Zeit spielt einmal keine Rolle«, fuhr ich fort, »es gibt die Alpen noch nicht, wir stehen an der Südküste Europas, wir schubsen die Zeit ein bisschen an, jede Minute eine Million Jahre, und wir beobachten, was passiert. Was sehen wir dann? Sehen wir Italien auf uns zu treiben, bis es gegen die Küste donnert, und erheben sich dann plötzlich unter unseren Füßen die Berge?«
Ed schüttelte den Kopf, schob seinen Teller zur Seite, nahm eine Serviette und strich sie auf dem Tisch glatt. »Wenn die Schwerkraft das Einzige wäre, dann würden wir alle zusammen auf einer Billardkugel wohnen.«
Ich nickte, er sah, dass ich ihn nicht verstand.
»Dann würde die Erde jedes Relief zu sich hinziehen, bis alles flach wäre«, verdeutlichte er.
Ich stellte mir Land vor, das überall so flach ist wie das Meer, Wasser, das von kniehohen Küsten abläuft wie von einem Teller im Regen.
Ed hatte inzwischen die Hände links und rechts auf die Serviette gelegt. »Die Schwerkraft ist nicht das Einzige, es gibt eine weitere Kraft«, sagte er, »die der Kontinentaldrift. Im Eozän war es nun so, dass Afrika auf Rammkurs in Richtung Europa war. Und das ist noch nicht vorbei. Afrika ist immer noch unterwegs und wird am Ende das Mittelmeer völlig zusammenschieben. Aber damals gingen kleine Minikontinente der großen Landmasse voraus. Italien ist so ein Stückchen Afrika, das die Vorhut bildete.«
Ich schaute auf seine Hände, die sich jetzt langsam aufeinander zu bewegten. Weil sie die beiden Ränder der Serviette niederhielten, faltete sich der Stoff in der Mitte allmählich auf.
»Hier«, sagte er und deutete mit dem Kopf auf seine Rechte, »das ist Italien, und das …«, er deutete nach links, »… ist Europa. So haben sie sich aufeinander zu geschoben. Der Meeresboden ist schwer und tauchte ab, der eine Kontinent schob sich allmählich über den anderen. So haben sich die Alpen aufgefaltet, siehst du?«
Er starrte angespannt auf die Serviette, auf den Gebirgskamm, der sich in der Mitte Zentimeter um Zentimeter hob. Eine Weile ging es gut, doch bald begann sich der Stoffwulst zu neigen. Ed bemühte sich ohne Erfolg, den einstürzenden Bergrücken aufzurichten, überlegte, ob er noch etwas dazu sagen könnte, und gab auf, ohne es versucht zu haben.
»Es ist schon ein bisschen komplizierter«, erklärte er zum Abschluss.
Er strich die Serviette glatt und breitete sie auf dem Schoß aus. Ich blickte am Brautpaar vorbei aufs Meer.
»Aber das Allererste, was man merkte, als noch nichts passiert war«, sagte ich, »als Italien noch nicht am Horizont erschienen war, was war das Erste, was hier vom Bevorstehenden zu spüren war?«
Ed zuckte mit den Schultern. »Erdbeben, nehme ich an.«
»Tsunamis?«, fragte ich.
»Sehr gut möglich.«
Und dann wurde das Essen aufgetragen.
Zwei Tage nach der Hochzeitsfeier fuhr ich sehr früh am Morgen zum kroatischen Festland zurück. Ungefähr nach der Hälfte der Überfahrt wurde es hell. Der Himmel färbte sich orangerot über dem Karstgebirge, das sich am Horizont wie eine Tausende Meter hohe, unendlich langsam anrollende Brandungswelle aus Felsen erhob.
Ich blickte übers Meer, sah Fischerboote schaukeln, hier und da durchschnitten die Rückenflossen von Delfinen die Oberfläche. Es war windstill, das Wasser ein Spiegel. Mit Ausnahme einer einzelnen kleinen Welle über die gesamte Breite der Wasserfläche, nicht einmal kniehoch. Erst nach einiger Zeit konnte ich erkennen, dass sie sich langsam von Nordosten nach Südwesten bewegte.
Ich zog meine Erdbeben-App zurate und sah, dass sich ein leichtes Beben ereignet hatte, dessen Epizentrum in der Nähe der Küstenstadt Šibenik lag, nicht weit nordöstlich von Vis. Dort ist das Meer mit kleinen Inseln übersät, die wie Berggipfel aus dem Wasser ragen. Das Beben hatte nur eine Stärke von 4,2 auf der Richterskala, gerade genug für eine kleine Welle im Meer und ein paar verstreute Meldungen von knarrenden Böden und einem vom Tisch gefallenen Glas.
GEBURT
Ich träumte, dass ich langsam lebte …Langsamer als der älteste Stein.Es war schrecklich: Ringsum brach ein,schoss empor, stieß oder bebte,was still erscheint.
M. Vasalis, »Zeit«
Natürlich gab es einen letzten Tag, an dem noch nichts geschehen war. An dem der Süden Europas dicht bewaldet war und das Land unter einem geschlossenen Blätterdach hügelig zu einem ruhigen Meer ohne Namen abfiel. Es gab keine Sprache, es gab niemanden, der Namen gab. Das begann erst zig Millionen Jahre später, als sich entfernte Nachfahren des eichhörnchenähnlichen Baumkletterers Plesiadapis, der zu Anfang dieser Geschichte auch in den europäischen Wäldern lebte, zu Geologen entwickelt hatten. Sie fanden heraus, dass die scheinbar unverrückbaren Kontinente eigentlich Schollen sind, die träge, langsamer noch, als Nägel wachsen, auf tiefen Strudeln geschmolzenen Gesteins treiben.
Das verschwundene Meer, das Europa im Süden begrenzte, nannten sie rückblickend den Valais-Ozean oder Walliser Ozean. Es war ein bananenförmiges Meer, das im Westen über eine Meerenge mit der späteren Biskaya verbunden war. Nach Osten hin stieg der Boden des Valais-Ozeans zu einem Paradies aus verstreuten Koralleninseln in klarem, flachem Wasser an. Östlich davon lag das Tethysmeer, das sich trichterförmig zur Panthalassa hin erweiterte, dem melancholisch-verlassenen, endlosen, alle Kontinente umspülenden Ozean.
Anders als sein Name vermuten lässt, war der Valais-Ozean ein Binnenmeer, wovon natürlich an der Südküste Europas nichts zu merken war, es sei denn, dass wochenalte Stürme, von fernen umliegenden Küsten zurückgeworfen, bei ruhigem Wetter geisterhaft wiederkehrten wie plötzlich aus dem Nichts anrollende Wellen. Doch meistens war diese Küste eine ganz gewöhnliche, mit Meer bis zum Horizont und stetiger Brandung. Die schwachen Gezeiten erneuerten das Wasser in den Felstümpeln, in denen Vögel und kleine landlebende Fleischfresser scheue Sandgrundeln, Seeigel, Krabben und Garnelen jagten.
Fielen große Mengen Regen auf die Wälder und füllten sich die Flussbetten, spien die Mündungsdeltas Sand aus, der sich Hunderte Kilometer weit als trüber Fächer im Meer ausbreitete. Und manchmal, wenn das Wasser mit solcher Gewalt vom Himmel stürzte, dass die Flüsse über die Ufer traten und Waldboden abtrugen, beförderten sie nicht nur Sand, sondern auch Kiesel und entwurzelte Bäume in Richtung Meer. Nach Tagen lagen die Stämme an weit entfernten Stränden. Hin und wieder wurden ganze Schwärme von kleinen Fischen unter Lawinen aus Flusssand begraben, starben und wurden von immer mehr Ablagerungen aus dem Fluss bedeckt.
Bei ruhigem Wetter war das Meer glasklar und warm, und in Strandnähe wogten große Schwärme kleiner Fische mit dem Kommen und Gehen der Wellen unbekümmert hin und her. Ein Meer, so weit das Auge reichte, allerdings kam es vor, dass sich an sehr klaren Tagen über dem Horizont Wolken ballten, als läge irgendwo dort erwärmtes Land, das am Ende eines heißen Tages feuchte Meeresluft so weit in die Höhe steigen ließ, dass sie zu Gewitterwolken kondensierte. In den stockdunklen Nächten konnte es dann wetterleuchten, aber so weit weg, dass kein Donner zu hören war.
Es war mitten im Eozän, vor gut vierzig Millionen Jahren, und der Sommer nahm kein Ende. Wo heute Stuttgart liegt, rauschten Baumwipfel und Brandung, wo heute die Schweiz liegt, war nichts als die See.
Dinosaurier gab es schon seit mehr als zwanzig Millionen Jahren nicht mehr, abgesehen von den Vögeln, die sämtliche Auswirkungen des Asteroideneinschlags überstanden hatten. Sie streiften im anbrechenden Abend in Schwärmen über die Baumwipfel oder suchten am Spülsaum nach Nahrung. Den jagenden Säugetieren, vor denen sie aufflogen, war noch nicht deutlich anzusehen, ob sie sich zu Katzen, Wölfen, Mardern oder Bären entwickeln würden.
~
Man kann die Ansicht vertreten, dass sie die ersten Vorzeichen waren, die Wolken am Horizont, die als blitzende Herolde das Kommen von etwas Größerem ankündigten. Doch wahrscheinlicher ist, dass eines Tages ein tiefes, langgezogenes Ächzen aus dem Untergrund aufstieg. Dass die Erde bebte, die Wipfel des Waldes rauschten und peitschten und das Meer sich plötzlich zurückzog. Vögel landeten auf der Ebene aus Schlick, wo schlagend und schnappend überraschte Fische lagen. Es war nur ein kurzes Festmahl, denn am Horizont kehrte das Meer wieder, türmte sich über dem schnell ansteigenden Boden auf und stürzte sich auf das Land. Es entwurzelte büschelweise Bäume, drückte das Wasser in den Flussbetten zurück, warf Schwärme von Fischen auf den Waldboden, verteilte sich und floss erst nach Tagen wieder ab. Die Flutwelle richtete große Verwüstungen an; der Wald brauchte Jahre, um sich zu erholen. Doch das war kein Problem, Jahre gab es im Überfluss.
Die Überlebenden, die wegen ihrer Erinnerung an dieses Ereignis den Strand eine Zeitlang mieden, bekamen Junge, die ihre Angst nicht verstanden. Bald war alles wieder wie vorher. Bis zum nächsten Erdbeben.
Auf dem Meer war etwas im Gange, oder vielleicht besser: unter dem Meer. Aber ein achtloser Küstenbewohner spürte nichts davon. Für einen Vogel ist eine kleine Insel vor der Küste ein Ort zum Landen und Brüten, für einen Baumsamen ein Ort zum Keimen und Wurzelschlagen. Die Entstehung dieser kleinen Insel, die es vor ein paar tausend Jahren noch nicht gab, und ihr Anwachsen um einige Hektar innerhalb eines Jahrtausends waren so langsame Veränderungen, dass sie auf das Leben sterblicher Wesen keinen Einfluss hatten. Wenn Erdbeben ausblieben, merkten die Tiere des Eozäns überhaupt nicht, dass sie in einer Epoche gewaltsamer Umbrüche lebten. Denn die Erde hat einen unendlich langsameren Herzschlag als die Kostgänger, die sie bewohnen.
Das Mittelmeer ist ein Saustall.
Douwe van Hinsbergen
Berge sind wie Wellen, die Zeit im Überfluss haben. Sie kommen aus der Erde an die Oberfläche, erheben sich, erreichen ihre größte Höhe und sinken wieder zusammen, zurück in Richtung ihres Ursprungs. Ihre rollenden Steine sind wie Tropfen, ihre Lawinen wie Gischt.
Stellen wir uns vor, dass wir an der Küste stehen und die Zeit sich beschleunigt. Die Sonne zieht ihre Bahn wie eine Socke in einer schleudernden Wäschetrommel, schneller und schneller, bis keine Socke mehr zu sehen ist, sondern nur noch ein Strich, Tag und Nacht fließen zum Dämmer eines bewölkten Nachmittags zusammen, die Winde aus allen Richtungen gleichen sich gegenseitig aus, alle Wechsel von Wetter und Jahreszeit, Ereignisse, vor denen wir uns normalerweise zu schützen versuchen, fallen weg, und wir stehen in einer windstillen, lautlosen Welt, in der nicht das Meer, sondern die Erde selbst flüssig geworden zu sein scheint.
Wir blicken übers Meer, ein trüber Spiegel, der gedämpftes Licht zurückwirft. Woher dieses Licht kommt, ist nicht zu erkennen.
Ein Mann ist neben mir stehen geblieben. Er heißt Douwe van Hinsbergen und stammt wie ich aus dem Osten der Niederlande, genauer gesagt aus Eibergen, wo es, anders als der Ortsname vermuten lässt, gar keine Berge gibt. Er hat den Achterhoek verlassen, um wirkliche Berge zu finden, und ist schließlich Professor für Geologie an der Universität Utrecht geworden. Nun steht er neben mir, und wir blicken nach Süden. Jahrzehntausende fliegen vorüber, aber immer noch ist nichts zu erkennen.
»Das Mittelmeer ist ein Saustall«, erklärt er. »Man sieht es nur nicht, weil das Wasser es verdeckt. Aber unter dem Wasser ist alles krumm und schief und in Bewegung. Ein einziges Chaos.«
Für van Hinsbergen ist ein Meer nicht das Wasser, sondern die Erdkruste darunter. Europa hört nicht an einem Strand auf, sondern erstreckt sich als Meeresboden weit nach Süden, wohin ein losgelöster Brocken afrikanischer Kontinent wie ein vorauseilender Bote unterwegs ist. Es ist ein solides Stück kontinentale Kruste, das schließlich als Italien hartnäckig gegen Europa drücken wird. Doch jetzt ist es noch auf dem Weg, und Europa beugt sich hinab, um es zu empfangen. Sein steinerner Untergrund senkt sich, und so lässt es sich von dem Brocken langsam, Zentimeter für Zentimeter, besteigen. Unter seinem Gewicht sinkt es weiter ab, in die heiße Tiefe, die zähflüssigen Schichten des Erdmantels, wo es weich wird, sich biegt und dreht und windet. Und Italien drängt weiter, schiebt sich scheuernd voran und schabt von Europas gekrümmtem Rücken das Gestein der Haut, befördert es aufwärts und drückt es vor sich her.
Italien selbst bleibt vorerst noch unter Wasser, aber die abgeschabten Teile von Europas Haut, die es vor sich herschiebt, erheben sich aus dem Meer, erst als Inseln, dann allmählich als langgezogener Streifen Land, der zur Küste hingedrückt wird.
Douwe zeigt in Richtung Horizont, und tatsächlich ist an etlichen Stellen, sehr weit weg, etwas Dunkles über dem Wasser zu sehen, wie Anzeichen eines bevorstehenden Wetterumschwungs. »Das sind die Alpen«, sagt er, »sie sind noch niedrig, aber sie kommen.«
Der Boden unter unseren Füßen ist unruhig geworden, er schlägt langsam Wellen, und hier und da pflanzen sich in der Oberfläche Risse fort. Der Unterleib ganz Europas vibriert und öffnet sich für das Kommende.
Rechts von uns, am Horizont kaum noch erkennbar, werden die Gebirgszüge der Vogesen und des Schwarzwalds auseinandergerissen, und dazwischen öffnet sich ein Graben, der tiefer und tiefer wird, bis von den entblößten Bergwänden Lawinen von Staub und Gestein abgehen. An den Rändern des Grabenbruchs schießen Flammen aus der Erde, Vulkane erheben sich wie Maulwurfshügel, speien Feuer und erlöschen und sinken wieder in sich zusammen.
Unruhestifter sind sie, mit kurzer Lebensspanne.
»Aufpassen«, sagt van Hinsbergen. Ich blicke wieder nach Süden. Die dunklen Pünktchen über dem Wasser sind in den wenigen Minuten, in denen ich abgelenkt war, zu einer steinernen Flutwelle von über tausend Metern Höhe angewachsen, die von West bis Ost die Sicht auf den Horizont versperrt. Der Boden unter unseren Füßen wird zur Seite geschoben, mal nach links, mal nach rechts, und wo sich Risse gebildet hatten, steigen Felsen empor.
Es ist seltsam, dass alles still vor sich geht, abgesehen von einem tiefen Brummen aus dem Inneren der Erde, einem Tremor, den wir eher fühlen als hören. Das Meer zwischen uns und den vorrückenden Bergen ist schmal geworden, eine gewaltige Spannung baut sich im Untergrund auf, als hätte Italien es plötzlich eilig, während Europa sich ihm entgegenstemmt. Die Erde bebt, Gesteinslawinen stürzen ins Meer, steigen als kleine Inseln an die Oberfläche, und dann, als käme etwas zur Vollendung, ertönt ein Laut wie ein langer Seufzer aus den Tiefen der Erde. Danach tritt Entspannung ein.
»Europa hat sich losgerissen«, sagt van Hinsbergen. »Italien hat es so weit in die Tiefe gedrückt, dass dort der südlichste Teil der Platte abgebrochen ist. Jetzt kann es sich aufrichten, pass auf …«
Wir werden langsam angehoben, es ist, als würde Europa sich seufzend von der Last Italiens befreien und Zentimeter für Zentimeter hochstemmen. Was noch von dem Meer zu unseren Füßen übrig war, verschwindet, der Meeresboden steigt auf, langsam, wie ein Korken aus Sirup. Das Wasser läuft ab oder verdampft. Wir stehen nicht mehr an einer Küste, sondern am Fuß eines Gebirges.
Wir schauen daran hinauf, sehen die Felsen, die in der Tiefe gekocht, gequetscht, gefaltet anschließend nach oben gedrückt wurden, schief und krumm in den Himmel ragen.
»Ich hab’s ja gesagt«, brummt van Hinsbergen, »es ist ein Saustall.«
Über uns haben sich Wolken zusammengeballt, die auf dem Weg nach Süden von der neuen Barriere aus Stein aufgehalten werden. Die Welt ringsum ist kälter geworden, die Gipfel der Berge färben sich weiß, der Boden unter uns wird aufgeweicht. All das Wasser, das hier immer schon vom Himmel fiel, aber nach Süden ins Meer abfließen konnte, muss nun nach Norden ausweichen, sammelt sich erst in einem austrocknenden Binnenmeer, sucht dann einen Weg durch die Ebene zu einem Mündungsdelta.
~
Als die Alpen gegen Europa geschoben wurden, stürzten das Wasser und der Schutt von den nördlichen Hängen noch Millionen von Jahren in einen Meeresarm. Dessen Verbindung mit dem Ozean im Westen schloss sich, der Boden stieg langsam, aber sicher an, das Wasser wurde brackig, Inseln bildeten sich, schließlich blieben von dem Meeresarm am nördlichen Fuß der Alpen nur einige verstreute Seen übrig, verbunden von einem Fluss, der Donau.
Während der folgenden dreißig Millionen Jahre landete das Wasser des Alpenrheins in diesem Fluss, der es zum Schwarzen Meer mitnahm. Doch das Land blieb in Bewegung, und als neue Barrieren entstanden, trennte sich der Alpenrhein von der Donau und wandte sich nach einigem Suchen in westlicher Richtung der Rhone und dem Mittelmeer zu. Erst vor etwa drei bis zweieinhalb Millionen Jahren fand er seinen heutigen Weg nach Norden, wo zwischen dem Rheinischen Schiefergebirge und der Nordsee bereits ein Fluss verlief, der mehr oder weniger dem heutigen Mittel- und Unterlauf des Rheins entspricht: der Proto- oder Ur-Rhein. Dieser nur von Niederschlägen und Grundwasser gespeiste Fluss, begierig nach immer mehr Wasser, war schon seit einiger Zeit dabei, sein Einzugsgebiet nach Süden zu erweitern.
Niemand weiß, wann genau der Alpenrhein sich von der Rhone trennte und sein Wasser dem Ur-Rhein anvertraute. Eines Tages fand das Wasser aus den Alpen jedenfalls zum ersten Mal einen Weg nach Norden, mischte sich in das des Ur-Rheins und ließ ihn so anschwellen, dass er nicht wusste, wohin mit all dem Nass. Der Wasserstand unterhalb der Loreley nahm stetig zu, ebenso die Strömung; Sträucher wurden mitgerissen, von Kieseln bedeckte Inseln überflutet, Bäume, die schon seit Jahrhunderten auf Sandbänken wuchsen, entwurzelt und nach Norden getragen, wo der Rhein in den Niederungen zwischen den Bergen und dem Meer über die Ufer trat, Abkürzungen nahm, den Rurgraben durchströmte und sich, immer weiter von seinem zu eng gewordenen Bett entfernt, einen Weg zur Nordsee bahnte.
Mit doppelter Kraft drang das Wasser bis ins Delta vor. Hatte der milde Ur-Rhein so weit stromabwärts nur Tonpartikel mitgeführt und an seinen Ufern abgelegt, so transportierte der angeschwollene Rhein in den folgenden Jahrhunderten Millionen Kubikmeter gröberen Sand und Kiesel. In den tiefsten Schichten der Sand- und Tongruben des Rurgrabens, wo der Rhein früher verlief, sind die Spuren des plötzlichen Wechsels von Ton zu Sand noch deutlich zu erkennen. Auch die durch Bohrungen ermittelte Zusammensetzung der Mineralien in den alten Flusstälern lässt darauf schließen, dass Sand und Bruchstein aus den Alpen fast von einem auf den anderen Tag das Gebiet im Westen Nordrhein-Westfalens, im Südosten der Niederlande und im Nordosten Belgiens erreichten.
Als das geschah, stand Europa an der Schwelle zu einem Zeitalter, in dem sich Kaltzeiten mit wärmeren Phasen abwechseln sollten. In den Warmzeiten gediehen die Wälder; die Baumwurzeln festigten den Boden, häufiger Regen füllte den Rhein mit klarem Wasser, und weil der Meeresspiegel stieg und die Küste sich landeinwärts verschob, vertiefte der Fluss bis weit ins Landesinnere sein Bett. Das Wasser führte nur wenig Material mit, der Fluss versandete kaum. In den Alpen lösten die Niederschläge Mineralien wie Hornblende und Epidot aus dem Gestein, die sich stromabwärts feinkörnig an den Ufern ablagerten.
Schlugen aber die Kaltzeiten zu, lichteten sich die Wälder, Bäume starben ab und wichen einer Steppenlandschaft. Gletscher sprengten die höchsten Felsen der Alpen, der südlichen Vogesen und des Südschwarzwalds. Täler wurden ausgehoben, Felsen abgeschliffen, und das Wasser, milchweiß von Sand und Ton, erhöhte die Ufer. In seinem Delta schuf der Fluss durch Ablagerungen weite Ebenen. Der Meeresspiegel sank, und der Rhein irrte durch seine eigenen Sedimente und über den trockengefallenen Meeresboden weiter und weiter nach Norden.
FLUSSBETTEN
Die Natur hat für unsere Lage gut gesorgt,als sie den Schutz der Alpenzwischen uns und die deutsche Wut gestellt hat.
Francesco Petrarca, Italia mia, benché ’l parlar sia indarno(Kanzone 128)
Unser Klassenlehrer im fünften Schuljahr an der Grundschule in Boekelo sagte einmal im Erdkundeunterricht, während er vor einer großen Europakarte stand, wer dem Rhein lange genug stromaufwärts folge, werde schließlich zu einer Stelle kommen, wo der Fluss so schmal sei, dass man hinüberspringen könne.
Ich habe diese Vorstellung nie vergessen können. Nicht, weil der Rhein in meinem Leben eine wichtige Rolle gespielt hätte, im Gegenteil. Ich bin in Twente aufgewachsen, einem Land der kleinen Bäche und Waldseen. Den Rhein habe ich nur von der Rückbank unseres Autos aus gesehen, wenn es meine Eltern und mich in die Gegend des Deltarheins verschlug, was selten vorkam.
Die Vorstellung des Sprungs über den Rhein, die dieser Lehrer in uns wachrief, blieb vor allem deshalb hängen, weil er ein Sadist war, der großes Vergnügen daran fand, seine kleinen Schüler auf dem sandigen Spielplatz neben der Schule zum Weitsprung ins Dornengestrüpp zu zwingen, vor den Augen des Direktors, als wäre das eine normale Form von Sportunterricht. Er legte das Brett, von dem wir uns abstoßen sollten, anderthalb Meter vor den Sträuchern auf den Boden und feuerte uns an. Weigerte sich jemand, nahm er dessen Wange oder Ohr zwischen Daumen und Zeigefinger, kniff und drehte. Es kam vor, dass er einen Schüler unter den Achseln und Kniekehlen packte, zusammenklappte und in einen Mülleimer steckte.
Ich denke daran, während ich sechsundvierzig Jahre später auf der Rheinquellstraße das Tal betrete, in das der Hinterrhein senkrecht hinunterstürzt. Es ist der 18. November, es hat geschneit, aber der Himmel ist strahlend blau. Der Wind, der mir durchs Tal entgegenweht, kommt vom Gletscher und ist eiskalt. Stromaufwärts, vor den beschneiten Gipfeln, die das Tal in der Ferne abschließen, gerät der Bergfluss hinter einer sanften Biegung nach rechts außer Sicht. Ich bin hier zwar nur noch wenige Kilometer von der Quelle entfernt, doch sogar hier hat sich der Mensch den Rhein schon vorgeknöpft und ihn gezähmt; die Ufer sind begradigt und mit großen rechteckigen Felsblöcken befestigt.
Der Hinterrhein ist einer der beiden Bergflüsse im Kanton Graubünden, die für sich beanspruchen dürfen, stromaufwärts zu den Quellen des Rheins zu führen. Der Hinterrhein vereinigt sich bei Tamins-Reichenau mit dem Vorderrhein, der weiter westlich nahe dem Oberalppass aus mehreren Bergseen entspringt. Am Tomasee – nach der Länge der Wasserläufe berechnet, der am weitesten von der Mündung des Rheins in die Nordsee entfernte See – verkündet ein an einer Felswand angebrachtes Schild, dies sei der Ort der Rheinquelle, 1320 Kilometer von der Mündung entfernt.
Der Tomasee mag am weitesten von Hoek van Holland entfernt sein, doch der Hinterrhein ist mit seinen Nebenflüssen der am weitesten südlich gelegene Teil des ganzen Flusssystems. Ein kleiner Teil der Niederschläge, die ihn speisen, fällt sogar auf italienische Berge in der Provinz Sondrio und fließt mit dem Reno di Lei und dem Averser Rhein in den Hinterrhein.
Ich bin auf dem Weg zu der Stelle, an der dieser Fluss so schmal wird, dass ich hinüberspringen kann. Am Eingang des Tals gibt es eine Tafel mit allen möglichen Informationen, aber der Wind ist so kalt, dass ich es vorziehe, nicht stehen zu bleiben. Im Vorbeigehen sehe ich eine Landkarte, unter der ein beruhigendes grünes Lämpchen leuchtet, woraus ich einerseits schließe, dass ich weitergehen kann, und andererseits, dass das anscheinend nicht immer möglich ist. Ich komme auch an Schlagbäumen vorbei, die aber geöffnet sind. Ein ungefähr fünfzig Meter langes, schmales Betongebäude, wahrscheinlich eine Halle für schweres militärisches Gerät, flankiert den Eingang in das V-förmige Tal. Auf dem flachen Dach weht eine Schweizer Fahne.
Bei einer kleinen Brücke, die das Wasser hier überspannt, folge ich dem Impuls, mich von dem Gebäude und der Fahne fernzuhalten, und begebe mich ans südliche Ufer.
Bald wird mir klar, dass ich mich auf militärischem Übungsgelände bewege, auf dem regelmäßig geschossen wird, als wollten die Schweizer dem Rhein schon in der Wiege mit aller Gewalt einschärfen, dass er es nur ja nicht zu bunt treiben soll.
Nach einem Kilometer enden die künstlichen Ufer, und das Bett des Hinterrheins verbreitert sich zu einer Fläche aus rundgeschliffenen Steinen, die ungefähr die halbe Talsohle einnimmt. Auf die Militärstraße aus festgestampftem Schutt, die auf dem ersten Kilometer wie ein Deich hoch über dem Ufer verlief, folgen Befestigungen aus aufgeschüttetem und geebnetem Schutt, in denen schwere Tore angebracht sind, vielleicht, weil auch darin militärisches Gerät bereitsteht. Außerdem sehe ich Gestelle auf Schienen, vermutlich als Träger von Zielscheiben für Panzer oder Geschütze.
Wo die Kettenspuren aufhören, das Tal sich allmählich verengt und die künstlichen Ufer dem natürlichen Wirrwarr aus abgestürzten Felsbrocken und vom Wasser rundgeschliffenen Steinen Platz machen, kommt man schwieriger von der Stelle. Ich springe von Stein zu Stein und steige über die Reste von Schneelawinen aus jüngster Zeit. Immer noch ist der Rhein zu breit zum Überspringen. Die Steine im Wasser und unmittelbar am Rand sind von glänzenden Eiskappen bedeckt. Auf beiden Seiten ragen Bergwände steil auf. Die kleinen Wasserfälle sind zu himmelhohen Kronleuchtern aus Eis erstarrt.
Je weiter ich ins Tal vordringe, desto mehr Blindgänger liegen zwischen den Felsen. Offenbar zünden längst nicht alle Granaten. Ich muss aufpassen, wohin ich trete. Aber der Nachmittag schreitet voran, mir bleibt nicht mehr viel Zeit, bevor es dämmert, und ich müsste noch einige Stunden klettern, bis der Hinterrhein nur noch aus Rinnsalen besteht, die unter Eis verschwinden. Mit ungeübtem Tieflandbewohnerblick suche ich den Flusslauf nach der ersten Stelle ab, an der ich springen kann. Wo er schmaler wird, strömt das Wasser schneller. Wo er sich verbreitert und ruhiger fließt, sind die aus dem Wasser ragenden Steine zu weit voneinander entfernt, außerdem spiegelglatt. Blindgänger sehe ich nach einem Kilometer nicht mehr, nur noch auf Steinen hinterlassenen Fuchskot und Klauenspuren von Gämsen im Schnee.
Als der Fluss dann endlich so schmal ist, dass man den Sprung wagen könnte, ich aber nach eher unheroischen Überlegungen beschließe, doch lieber zu krabbeln, als zu springen, und den Rhein in drei schlüpfrigen Schritten auf Händen und Füßen überquere, wird mir anschließend bewusst, dass mein Gekrabbel kein besonders schöner Anblick gewesen sein dürfte, was aber auch wieder nicht schlimm ist, weil mich niemand gesehen hat. Ich knie mich in den Schnee und trinke aus dem Rhein, er schmeckt nach Stein.
Beim Verlassen des Tals, jetzt mit dem Wind im Rücken und erwärmten Gliedmaßen, lese ich auf der Informationstafel, dass ich mich auf Sperrgebiet begeben habe, dass die Blindgänger lebensgefährlich sind und dass ich, hätte ich dort Schaden genommen, dafür ganz allein verantwortlich gewesen wäre.
Wieso die Rheinquelle in den Alpen?
Kim Cohen, Paläogeograf
Von einem Moment auf den anderen scheint Kim Cohen von Ärger überwältigt zu werden. Wir haben uns eine Weile über die Entstehung der europäischen Landschaften unterhalten, über Flüsse, die ihren Weg suchen, über sich vertiefende Grabenbrüche und aufgefaltete Gebirge. Doch auf einmal, als ich ihm erzähle, dass ich in die Alpen gereist bin, um die Rheinquelle zu sehen, funkeln seine Augen vor Zorn.
»Wieso die Rheinquelle in den Alpen?«, fragte er. »Was ist das für Unsinn aus dem 19. Jahrhundert?«
»Na ja, ohne Alpen kein Rhein, oder?«, erwidere ich unsicher.
Das macht es nicht besser. Cohen streckt sich. »Das kann mich richtig wütend machen«, sagt er.
Wir sitzen in einem fensterlosen Zimmer, das sich plötzlich zu klein und eng anfühlt. Es ist ein Besprechungsraum im Gebäude der Geowissenschaften der Universität Utrecht. Cohen, Paläogeograf, starrt an die Decke, als suche er dort nach Worten, mit denen er mir begreiflich machen kann, dass mein Bild des Rheins grundfalsch ist, ohne mich allzu sehr zu erschrecken. Dann, wie nach einer Eingebung, schaut er wieder mich an und sagt deutlich und energisch: »Den Rhein hat es immer gegeben.«
Er steht auf und zeichnet etwas auf ein Whiteboard. »Auch ohne Alpen fließt Wasser in den Rhein«, erklärt er. »Ein Fluss ist nicht identisch mit seinem Bett. Viele glauben das, aber es ist ein Missverständnis. Ein Fluss ist Wasser, eine Wurst aus Wasser, ja … eine Wurst aus Wasser.« Er wiederholt es für sich selbst, nicht unzufrieden mit seiner Metapher. »Und dieses Wasser fließt aus dem gesamten Einzugsgebiet zum Flussbett. Aus dem Schwarzwald, aus den Vogesen, aus der Eifel, aus dem Hunsrück.«
Er wendet sich wieder mir zu.
»Wenn man dem Rhein in die Alpen folgt, bis man ein Flüsschen im Schnee findet, hat man diesen Fluss noch nicht verstanden. Es war eine völlig willkürliche Entscheidung, sich da umzusehen und nicht stromaufwärts an der Mosel, am Neckar, an der Lahn, am Main. Es ist eine Zwangsvorstellung aus dem 19. Jahrhundert, dass man einen Fluss erst erkundet hat, wenn man den am weitesten entfernten Punkt erreicht.«
Ich schweige, höre zu, und sein Zorn legt sich.
»Ein Fluss ist nämlich auch das Wasser, das man nicht sieht«, sagt er und setzt sich wieder hin. »Er ist das Grundwasser zwischen den Flussbetten, das Wasser im ganzen Bereich des Unterlaufs. Ein Fluss endet nicht an seinen Ufern.«
»Ist es nicht einfach eine Sache der Benennung?«, frage ich. »Der Fluss, dem man bis in die Alpen folgen kann, heißt nun mal Rhein, und die Mosel Mosel. Und die Quelle der Mosel …«
»… ist auch eine Quelle des Rheins«, ergänzt Cohen. »Und das Regenwasser in den Niederlanden auch.« Er schüttelt den Kopf. »Wasser kennt keine Grenzen und keinen festen Ort. Neulich war hier ein Journalist, der sagte, dass der Rhein, wenn er unser Land erreicht, in der Waal, der IJssel, dem Lek verschwindet.« Er blickt mich durchdringend an. »Aber wo ist der Rhein denn dann plötzlich geblieben?«
~
Später habe ich Cohens Ärger, der mich in dem zu engen Zimmer noch überrumpelte, besser nachvollziehen können. Als die Alpen im Miozän ihre heutige Höhe erreichten, war der Ur-Rhein, der im Nordwesten in die Nordsee mündete, schon viele Millionen Jahre alt. Zwischen dem Einzugsgebiet dieses Ur-Rheins und dem Wasser aus den Alpen lagen Hunderte von Kilometern unruhiges Land, wo Gebirge entstanden und wo in den Grabenbrüchen der Boden immer weiter absank. Die Bruchstücke des Urkontinents Pangaea waren noch dabei, sich voneinander zu lösen, das Land war in Bewegung. Auf der Linie Roermond-Köln entstand ein Grabenbruch, den der Ur-Rhein als Bett nutzte. Die Ardennen, die Eifel und weitere deutsche Mittelgebirge, unter anderem Taunus, Hunsrück und Sauerland, die zusammen als Rheinisches Schiefergebirge bezeichnet werden, wurden durch das kontinentale Geschiebe und Gezerre angehoben. Um ihrem bisherigen Lauf folgen zu können, mussten die Flüsse ihre Betten Zentimeter für Zentimeter in den Untergrund graben. Die mäandernden Flussläufe von Mosel, Lahn und Sieg, Nebenflüssen des Rheins, die das Schiefergebirge entwässern, lassen bis heute erahnen, dass diese Flüsse in flacherem Land entstanden sind. Als der Boden um sie herum und unter ihren Betten ganz allmählich gehoben wurde, vielleicht nur um wenige Zentimeter in einem Jahrhundert, haben sie ihren gewundenen Lauf in ihn eingegraben. Aus den wachsenden Bergen flossen ihnen neue Nebenflüsschen zu.
Jeder Lauf eines Flusses ist vorläufig. Wie eine unmerklich langsam sich windende Schlange sucht er nach dem Weg des geringsten Widerstandes und des größten Gefälles. Das Klima verändert sich, die Landschaft verändert sich, der Fluss passt sich an. Das Wasser transportiert Material, das es unterwegs in stillen Momenten ablagert. Manchmal versandet ein Bett, und der Fluss ist sich sozusagen selbst im Weg. Dann zögert das Wasser und sucht andere Wege.
Außerdem kann es vorkommen, dass die Außenseiten von Schleifen und Flussknien dem Wasserdruck nicht mehr standhalten, dass Ufer abbröckeln und Mäander sich Abkürzungen brechen. Und wenn ein Fluss bei seiner Suche einem anderen begegnet, wird derjenige, der den geringeren Widerstand zu überwinden hat, dem anderen buchstäblich das Wasser abgraben. Flussanzapfung nennt man das. Die Folge ist dann zum Beispiel, dass ein Fluss, der zunächst ins Mittelmeer mündete, Kurs auf die Nordsee nimmt, nur weil er auf der Suche nach dem stärksten Gefälle auf einen nordwärts strömenden Fluss gestoßen ist und sein Wasser darin leichter abfließen konnte.
So hat der Ur-Rhein der Maas die Mosel weggenommen und der Rhone den Main. Schon bevor das Wasser der Alpen den Weg zum Ur-Rhein fand, haben ihn all die von Niederschlägen und Grundwasser gespeisten Flüsse, die er an sich band, anschwellen lassen. Er streckte seine Arme immer weiter nach Süden aus, bis zu den wachsenden deutschen Mittelgebirgen, und schuf dort das malerische Mittelrheintal.
Schon bevor das Gletscherschmelzwasser aus den Alpen den Weg nach Norden gefunden hatte, hat die enge Windung am Fuß der Loreley, des hohen Schieferfelsens im Oberen Mittelrheintal, ungefähr ihre heutige Gestalt gehabt. Nur mit weniger Wasser.
Den Rhein hat es immer gegeben.
FLUSSPFERD
Vor drei Millionen Jahren schwamm ein Atlantischer Lachs von den Jagdgründen im Norden des Ozeans nach Süden, zurück zu dem Fluss seiner Jugend, um zu laichen. Es war ein Weibchen. Unsere Heldin war allein, groß genug, um dem Fluss gewachsen zu sein, und kannte den richtigen Kurs genau. Die Erde zog an ihr, ganz leicht, sie schwamm dagegen an.
Das war es, was sie wollte: gegen alles an.
Solange sie nach Süden unterwegs war, das vibrierende Tageslicht über und das Schwarz der Tiefsee unter sich, ging alles mühelos. Als sie in die Nordsee schwamm, nahm sie die ersten Spuren von Flüssen wahr; dünne Gespinste von Geschmäckern und Gerüchen aus fernen Mündungen. Nichts kam ihr bekannt vor, sie schwamm weiter.
Bis sie zum ersten Mal etwas erkannte, den Geruch und Geschmack ihres eigenen Flusses; ein paar winzige, schwebende Sedimentkörnchen, einen Hauch von Huminsäure, irgendwo in dem trüben Fächer, der sich von Osten her ins Meerwasser öffnete. Sie verlor das Interesse an dem schwachen Ziehen der Erde und konzentrierte sich auf die unverwechselbaren Spuren ihres Flusses, noch ganz vage in der sanften, lauen, sich im Meer auffächernden Strömung.
Sie schlug mit dem Schwanz, änderte den Kurs, gegen die Strömung, auf das trübe Wasser zu; immer schlechtere Sicht, immer stärkere Strömung, das Wasser erst brackig, dann süß, die Nase voll von Aromen.
Es war, als würde irgendetwas sie umhüllen, ein Kokon, der sie vor diesem süßen Wasser schützte. Mit kräftigen Schwanzschlägen arbeitete sie sich gegen den Strom voran, besonders, wenn er so stark wurde, dass er sie zurückwarf und das Wasser seicht und unberechenbar wurde, Steine am Bauch, Schwanzflosse in der Luft; dann suchte und kämpfte sie. Sie sprang, sie flog, Bären schlugen nach ihr, um sie ans Ufer zu werfen, überall lauerte Gefahr, aber sie arbeitete sich unermüdlich vor, denn mit jedem Schwanzschlag wurden die Spuren ihres Flusses ein wenig deutlicher; in dieser schwindelerregenden Mischung wurde doch dieses eine Aroma, das ihrer Jugend, immer vertrauter und eindeutiger, je länger sie gegen den Strom ankämpfte.