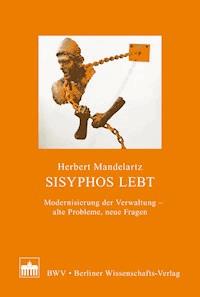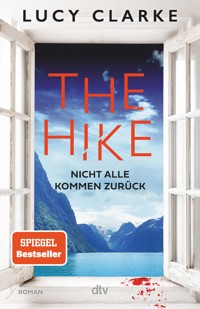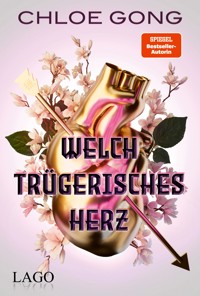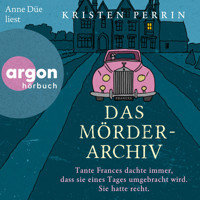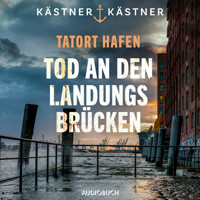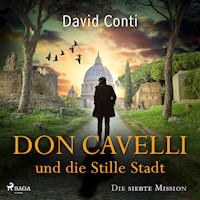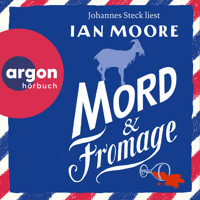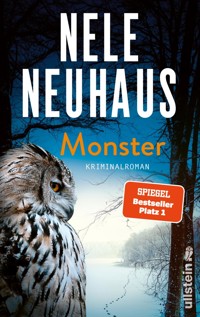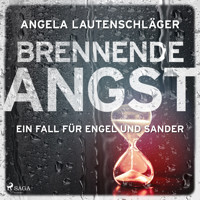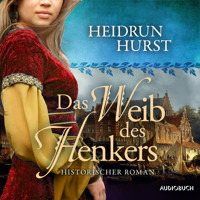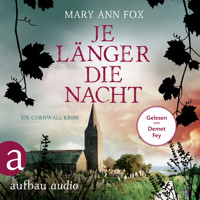Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Juristin Astrid Ruter
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Eine Leiche in einer Mülltonne in Neukölln. Nackt. Gefoltert. Weggeworfen. Die Polizei steht bei der Suche nach der Identität des Mannes vor einem Rätsel. Schließlich findet sie heraus, dass es sich um den Redakteur Werner Küster handelt. Hat er seine Nase zu tief in fremde Angelegenheiten gesteckt? Ein anonymer Brief mit brisantem Inhalt über ein Mitglied der Brandenburger Landesregierung könnte Aufschluss bringen. Musste Küster sterben, um das Geheimnis des Politikers zu wahren?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herbert Mandelartz
Unter Verschluss
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-digital.de
Vertreten durch: Lektorat und Konzeption Frau Palma Müller-Scherf, Berlin
Gmeiner Digital
Ein Imprint der Gmeiner-Verlag GmbH
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Katja Ernst
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlagbild: © arturbo – iStockphoto
Umschlaggestaltung: Simone Hölsch
ISBN 978-3-7349-9292-6
Zitat
Er war tot und ist wieder lebendig geworden.
Er war verloren und ist gefunden worden.
Ob es gut war, ist die Frage.
Dienstag, 7. August 2001
1. Kapitel
Es war kurz vor 12 Uhr. Werner Küster saß an seinem Schreibtisch in der Redaktion der Brandenburgischen Allgemeinen Zeitung und schaute durch das geöffnete Fenster auf das gegenüberliegende Geschäftshaus. Die Sonne schien. Ein leichter Wind wehte. Eigentlich kein schlechter Tag. Doch er hatte nicht gut geschlafen.
Es war eine nachrichtenarme Zeit. Aber dies interessierte Werner Küster weniger, denn er war Reporter für besondere Aufgaben. Er konnte sich aussuchen, worüber er berichten wollte. Seit einiger Zeit befasste er sich mit den Querelen innerhalb der SPD und der Frage, ob die Große Koalition in Brandenburg der Partei nutzen oder schaden würde. Richtig zufrieden war er mit den Ergebnissen seiner bisherigen Arbeit nicht. Er schaute auf den einzigen Wandschmuck in seinem Zimmer. Andy Warhols »Willy Brandt, 1976.«
Ja, Willy Brandt! Wo ist der neue Willy Brandt? Jemand, der Visionen entwickelt und genügend Pragmatismus besitzt, sie umzusetzen?, fragte er sich und seufzte. Die Antwort wusste er nicht.
Sein zweites großes Thema waren Manipulationen der Wettmafia im Fußball. Hier stand er kurz vor dem Abschluss. Was er recherchiert hatte, hatte ihn erschüttert. Noch zwei, drei Anrufe, dann konnte er dieses Thema abschließen. Aber jetzt würde er erst einmal in die Mittagspause gehen und dann den Kommentar zu den Aussichten der Parteien bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr schreiben, um den ihn der Chefredakteur gebeten hatte. »Ja, so machen wir das.« Er schlug mit beiden Handflächen auf die Schreibunterlage. In dem Moment schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf: der Brief! Er hob die Schreibunterlage und nahm den Umschlag, der darunterlag. Er zog einen Brief heraus.
Er wusste nicht, warum er ihn aufbewahrt hatte. Anonyme Briefe warf er normalerweise in den Papierkorb. »vielleicht ist es für sie interessant ein mitglied der landesregierung besucht regelmäßig einen sexclub in polen.« stand darin. Kein Datum. Keine Anrede. Kein Punkt. Kein Komma. Kein Gruß.
Die Worte waren ausgeschnitten und auf ein Blatt Papier geklebt worden, das man anschließend kopiert hatte. Auch die kopierte Anschrift hatte der Absender ausgeschnitten und auf den Umschlag geklebt.
Werner Küster schaute auf den Brief und dann zum Fenster hinaus. Vielleicht sollte ich der Sache einmal nachgehen, dachte er. Quatsch, anonyme Briefe gehören in den Papierkorb – und zwar zerrissen.
Er wollte es gerade tun. Doch dann stockte er. Langsam schob er den Brief zurück in den Umschlag. Er hob die Schreibunterlage an und legte ihn wieder darunter. Anschließend schob er den Stuhl zurück, stand auf und ging in seine Stammkneipe »Bei Kati«.
2. Kapitel
Werner Küster war in einem kleinen Dorf in der Eifel geboren und hatte in Bonn Politologie, Soziologie und Niederlandistik studiert. Schon während des Studiums hatte er kleine Artikel für den Bonner Generalanzeiger geschrieben und eine Promotion über »Die Haltung der katholischen Presse im Jahre 1933« begonnen. Aber die wissenschaftliche Arbeit befriedigte ihn nicht. Als ein guter Freund ihm den Vorschlag machte, es bei einer Tageszeitung zu versuchen, überlegte er nicht lange und bewarb sich dann offiziell beim Bonner Generalanzeiger und beim Kölner Stadtanzeiger. Zu seiner Überraschung wurde er nach wenigen Tagen vom Stadtanzeiger zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Wenig später unterbreitete man ihm ein Angebot als Volontär, das er annahm. Er zog nach Köln und lernte beim Stadtanzeiger Journalistik von der Pike auf.
Werner Küster war ungefähr 1,80 Meter groß, schlank und hatte blondes Haar. Seine Hobbys waren Tennis und Radfahren. Während seiner Studienzeit war er mit dem Fahrrad von Bonn nach Barcelona in 20 Tagen gefahren. Er liebte einfaches, deftiges Essen und ein kühles Bier. Manchmal trank er einen Wodka. Während des Studiums hatte er einige Frauenbekanntschaften, ohne sich zu binden. In Köln lernte er nach wenigen Wochen eine junge Malerin kennen, die Teil der Kölner Kunstszene war. Bei ihr war alles anders. Sie sah gut aus, war ihm intellektuell ebenbürtig und forderte ihn sexuell. Er brauchte diese Herausforderung. Sie zogen zusammen und Werner Küster war mit seinem Leben zufrieden.
Die Öffnung der Mauer 1989 nahm er zur Kenntnis. Er war zwar politisch interessiert und seit mehreren Jahren Mitglied der SPD, aber Berlin war weit weg und er konnte sich nicht vorstellen, dass es zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten kommen würde. Sein Chefredakteur dachte anders. Er spürte, dass sich in Berlin ein weltgeschichtliches Ereignis anbahnte. Deshalb suchte er jemanden, der direkt aus Ost-Berlin über die Entwicklung in der DDR berichten sollte. Auch Werner Küster erkannte nach wenigen Wochen, dass sich dort Großes abspielte, und wollte dabei sein. Er besprach die Angelegenheit mit seiner Partnerin und bekundete beim Chefredakteur sein Interesse. Der war einverstanden, und Mitte Februar 1990 nahm Werner Küster seine Arbeit in Ost-Berlin auf. Er wohnte in einer Zweiraumwohnung in der Brunnenstraße nahe dem Rosenthaler Platz. Das Büro befand sich in der Potsdamer Straße im Westteil der Stadt. Seine Partnerin blieb in Köln. Sie hatten verabredet, dass er alle 14 Tage übers Wochenende nach Köln kommen und sie ihn alle 14 Tage in Berlin besuchen sollte.
Die Wendezeit und die folgenden Monate und Jahre empfand er als die spannendste Zeit seines bisherigen Lebens. Das, was er sah und worüber er schrieb, bedrückte und begeisterte ihn. Verfallene Häuser am Prenzlauer Berg und im Scheunenviertel, ohne Bad und Toilette, keine Heizung. Die Betonwüsten in Marzahn und Hohenschönhausen. Das Geknattere der Trabbis und die verpestete Luft. Die Dunkelheit und Stille nach Sonnenuntergang. Er berichtete über Abriss und Aufbruch. Verzweiflung und Euphorie. Leben und Sterben. Über politische Diskussionen und das Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Er sprach mit SED-Kadern, die keine Fehler in der Vergangenheit erkannten; mit Reformern, die eine reformierte DDR als antifaschistische Antwort auf die Nazi-Diktatur und als Alternative zum Kapitalismus erhalten wollten. Er schrieb über die, die ihren Arbeitsplatz verloren, weil das, was sie produzierten, nicht konkurrenzfähig war; über ehemalige Mitglieder des Politbüros, die sich als Hausmeister durchschlugen; über frühere Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit, die Karriere im Bewachungsgewerbe machten; über ehemalige Mitarbeiter des Ministeriums für Außenhandel, die plötzlich Generalvertreter eines großen Automobilkonzerns waren.
Anfangs hielten er und seine Partnerin die Vereinbarung ein. Werner Küster fuhr zweimal pro Monat nach Köln und blieb meist über ein verlängertes Wochenende. Er traf sich mit Freunden und schilderte begeistert die Veränderungen in Berlin. Seine Freundin saß dabei und hörte zu. Im Bett sehnte er sich nach ihrer Haut. Er wollte glücklich sein und sie glücklich machen. Doch er spürte, dass sich etwas zwischen sie schob. Es war die Vereinigung. Selbst im Bett erzählte er von den Verhandlungen am Runden Tisch und den Veränderungen im Ostteil der Stadt. Seine Freundin konnte seine Begeisterung über den Veränderungsprozess nicht teilen. Ihre Welt war das Rheinland. Ostberlin deprimierte sie. Ihre Besuche wurden seltener. Er hatte das Gefühl, dass zwischen ihnen eine Mauer entstand. Auch seine Besuche wurden seltener. Dann lernte er eine Ostdeutsche kennen, die bei einer Wohnungsbaugesellschaft arbeitete. Sie war zweimal geschieden und lebte mit drei Kindern in Hohenschönhausen. Die ersten Nächte waren intensiv. Doch er konnte sich nicht vorstellen, in Hohenschönhausen zu leben. Die Kinder betrachteten ihn als Eindringling. Ein »Wessi«, der alles wusste, alles konnte und alles hatte. Nach einiger Zeit trennten sie sich. Da hatte er auch mit seiner Freundin in Köln schon über die Trennung gesprochen.
Mit der Zeit dehnte er sein Betätigungsfeld aus und schrieb auch über die Entwicklung im Land Brandenburg: verfallende Höfe, sterbende Dörfer, frustrierte Jugendliche, traurige Alte. Mitte der 90er-Jahre machte ihm der Chefredakteur der Brandenburgischen Allgemeinen Zeitung das Angebot, als Reporter für besondere Aufgaben für die Zeitung zu arbeiten. Werner Küster nahm das Angebot an und zog nach Potsdam. Seinen Wechsel bereute er nicht. Er konnte weitgehend selbst bestimmen, worüber er schrieb. Hierbei kam ihm zugute, dass er sich schnell in neue und unbekannte Themen einarbeiten konnte.
Er hatte sich einen Freundeskreis aufgebaut. Samstags traf er sich mit anderen Fußballfans und schaute sich in Helmuts Kneipe die Bundesligaspiele an. Dort hatte er auch Bernd getroffen, der bei der Brandenburger Polizei arbeitete. Seinen Nachnamen hatte er vergessen, irgendwas wie »Haberhand« ging ihm durch den Kopf. Natürlich drückten sie Energie Cottbus die Daumen und ärgerten sich über Siege des FC Bayern. Über ihn lernte er einen Mitarbeiter der brandenburgischen Regierung kennen: Dr. Leuschner, der in Aachen geboren war und in Berlin-Steglitz wohnte. Mit ihm traf er sich unregelmäßig im »Bei Kati«, einer gemütlich Kneipe, die von einer sympathischen Wirtin geführt wurde. Ab und an fuhr Werner nach Berlin ins Theater. Feste Bekanntschaften ging er nicht ein. Eine Zeit lang war er mit einer Krankenschwester aus Potsdam liiert, dann mit einer Lehrerin aus Zehlendorf.
3. Kapitel
Als er aus der Mittagspause zurückkam, fand er einen Zettel auf seinem Schreibtisch: »Bitte Chef anrufen.« Der Chefredakteur kam gleich zur Sache. »Werner, du musst mich heute Abend bei einer Podiumsdiskussion vertreten, die ich moderieren soll. Frau Kastrow ist schon auf dem Weg zu dir. Sie bringt dir die Unterlagen und das Material, das ich zur Vorbereitung zusammengestellt habe. Es geht um die Frage, ob in den letzten Jahren im deutsch-polnischen Grenzgebiet die Kriminalität gestiegen ist, wie dies die CDU behauptet, oder nicht. In dem Thema bist du ja drin. Ich kann wirklich nicht. Wenn du noch Fragen hast, ruf mich an. Aber die Sache ist relativ einfach, denn du bist der Moderator und hast alles in der Hand. Ich verlasse mich auf dich.«
Bevor Werner Küster etwas sagen konnte, hatte der Chefredakteur schon aufgelegt. Er wusste natürlich, dass der Chef keine Fragen erwartete. Dass er seine Zeitung gut vertreten musste, brauchte man ihm nicht zu sagen. Aber er wollte auch selbst gut aussehen. Der Kommentar zu den Aussichten der Parteien musste warten.
Mit dem Thema »Steigerung der Kriminalität im deutsch-polnischen Grenzgebiet und den Konsequenzen für Brandenburg« hatte er sich noch nicht befasst. In der Mappe, die Frau Kastrow ihm gebracht hatte, befanden sich neben der Einladung zu der Veranstaltung Statistiken aus dem brandenburgischen Ministerium für Inneres, Sport und Modernisierung der Verwaltung. Es folgten Unterlagen des Bundesgrenzschutzes, zwei Presseerklärungen der CDU, einige Zeitungsausschnitte sowie ein Interview mit der Staatssekretärin in diesem brandenburgischen Superministerium, Dr. Astrid Ruter. Werner Küster schüttelte den Kopf. Wer sich solche Bezeichnungen für ein Ministerium wohl einfallen lässt, dachte er. Sei’s drum. Ich werde sie als Staatssekretärin im Innenministerium vorstellen.
Er ging die Unterlagen, insbesondere die Statistiken, durch und kam zu dem Ergebnis, dass die Kriminalität nicht angestiegen war und die Sicherheitslage sich nicht verschärft hatte. Die Zahlen sprachen eine eindeutige Sprache. In ihren Presseerklärungen ging die CDU darauf jedoch nicht ein, sondern wies auf die Ängste der Bevölkerung und die Gefährdung der allgemeinen Sicherheitslage hin. In dem Interview zeigte die Staatssekretärin Verständnis für die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger und wies die Vorwürfe der CDU zurück. Sie kündigte an, sich um eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem Bundesgrenzschutz zu bemühen. Geschickt, dachte Werner Küster. Sie zeigt einen Lösungsweg auf und zieht zugleich den CDU-Bundesinnenminister mit in die Verantwortung.
Er machte sich ein paar Notizen für seine Einleitung und schrieb die Punkte auf, die er während der Veranstaltung ansprechen wollte. Vielleicht sollte ich einen Kollegen anrufen, der näher am Geschehen ist, ging ihm durch den Kopf. Er dachte nach, wer wohl am ehesten in Betracht käme, und rief den Kollegen Kurt Kohlmann in Cottbus an. »Ich verstehe eines noch nicht«, sagte er, nachdem er ihm den Grund seines Anrufs geschildert hatte. »Wenn ich mir die Zahlen anschaue, hat die Situation sich nicht verschärft. Wie kommt es dann zu Ängsten und einer allgemeinen Verunsicherung? Oder stimmt das überhaupt nicht?«
Sein Kollege überlegte einen Augenblick lang. »Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen der objektiven Lage und dem subjektiven Sicherheitsgefühl. Wenn einer Frau am Bahnhof die Handtasche gestohlen wird, wird sie sich am Bahnhof immer unsicher fühlen, auch wenn die Zahl der Diebstähle am Bahnhof zurückgeht. Das Unsicherheitsgefühl bleibt.«
»Hm, da ist was dran. Und was kann man dagegen machen?«
»Die einen fordern mehr Präsenz der Polizei, andere mehr Videoüberwachung. Beides ist umstritten. Frag doch einfach mal in die Runde.«
»Guter Vorschlag, das werde ich tun.« Werner Küster bedankte sich bei seinem Kollegen und legte auf. Er schrieb sich noch zwei Hinweise auf. Dann klappte er die Mappe mit den Unterlagen zu. Er war gespannt auf die Veranstaltung.
4. Kapitel
Während Werner Küster mit seinem Kollegen in Cottbus telefonierte, saß Staatssekretärin Dr. Astrid Ruter an ihrem Schreibtisch und bereitete sich ebenfalls auf die abendliche Veranstaltung vor. Eigentlich war das überflüssig, weil sie alle Fakten und die wesentlichen Gesichtspunkte auswendig konnte, aber sie wollte nichts dem Zufall überlassen. Deshalb hatte sie die Polizeiabteilung gebeten, ihr die neusten Zahlen zu übermitteln und eine Einschätzung des Bundesgrenzschutzes einzuholen. Für sie war klar, dass die CDU mit diesem Thema Politik machen wollte. Unverantwortlich, ging es ihr durch den Kopf. Aber so läuft Politik. Sie nahm sich vor, klare Aussagen zu machen und keine Rücksicht auf den Koalitionspartner zu nehmen.
Dr. Astrid Ruter war in Wilmersdorf geboren und im alten West-Berlin aufgewachsen. Ihre Jugend verlief unspektakulär. Nach dem Abitur studierte sie an der Freien Universität Jura. Ihr erstes Staatsexamen schloss sie nach acht Semestern mit »gut«, das Referendarexamen mit »vollbefriedigend« ab. Anschließend schrieb sie eine Doktorarbeit zum Thema »Über die Bedeutung von Ernst-Wolfgang Böckenförde für die Rezeption von Carl Schmitt in der BRD.« Sie arbeitete kurze Zeit als Rechtsanwältin und wechselte dann in die Berliner Justizverwaltung. Gleichzeitig war sie Mitglied der SPD in der Bezirksversammlung Schöneberg. In der Justizverwaltung wurde sie schnell zur Referatsleiterin und stellvertretenden Abteilungsleiterin befördert. Nach der Wende wechselte sie in das Brandenburgische Ministerium für Inneres, Sport und Modernisierung der Verwaltung und wurde Leiterin der Abteilung »Recht«.
Sie war nicht nur außerordentlich intelligent und eloquent, sondern hatte praktisches Geschick und verfügte über das, was man eine glückliche Hand nannte. Strickt trennte sie Berufsleben von Privatleben, über das fast nichts bekannt war. Sie begleitete ihr praktisches Handeln durch wissenschaftliche Veröffentlichungen, in denen sie es reflektierte und theoretisch untermauerte. Nach dem Wechsel nach Brandenburg wurde sie stellvertretende Vorsitzende der Hegel-Gesellschaft Brandenburg. Ihr Mandat in der Bezirksvertretung Schöneberg legte sie nieder.
Sie sah gut aus. Mindestens einmal pro Woche ging sie in ein Sportstudio, lief fünf Kilometer, machte ein paar Kraftübungen, schwamm eine Viertelstunde und ruhte sich anschließend in der Sauna aus. Im April nahm sie am Berliner Halbmarathon teil.
Ihr Vater war am 23. Januar 1945 von den Nazis ermordet worden. Jedes Jahr fuhr sie an diesem Tag zur Gedenkstätte nach Plötzensee, gedachte ihres Vaters und schwor Rache.
Im Jahr 1999 verübte der damalige Staatssekretär Selbstmord. Im Ministerium wurde getuschelt, sie habe ein Verhältnis mit ihm gehabt. Aber so richtig wurde die Sache nie aufgeklärt. Und nach einem halben Jahr war alles vergessen. Sie war in der Tat mit dem Staatssekretär eine Affäre eingegangen. Als er sich ihretwegen von seiner Frau trennen wollte, sagte sie ihm, es sei aus zwischen ihnen. Außerdem informierte sie ihn, dass der SPIEGEL in der nächsten Ausgabe eine Geschichte über frühere Inoffizielle Mitarbeiter, zu denen auch der Staatssekretär während seiner Studentenzeit für einige Jahre gehört hatte, und ihre jetzige Tätigkeit in Bundes- und Landesbehörden bringe. Sie schaute ihn an und sagte ihm völlig emotionslos, das Beste für ihn sei wohl Selbstmord. Sie wollte, dass er starb. Denn er war der Sohn des Richters, der ihren Vater zum Tode verurteilt hatte. An ihm rächte sie ihren Vater. Aber das war ihr Geheimnis.
Astrid Ruter hatte noch ein zweites Geheimnis. Sie war Mutter eines Sohnes. Während des dritten Semesters hatte sie auf einer Geburtstagsfeier einen südamerikanischen Musikstudenten kennengelernt. Sie war mit ihm nach Hause und ins Bett gegangen, begann eine Beziehung mit ihm. Sechs Wochen später teilte ihr Gynäkologe ihr mit, dass sie schwanger sei. Sie wusste nicht, ob sie sich freuen sollte. Ihr Freund nahm die Nachricht kommentarlos auf. Zwei Wochen später rief er sie an und erklärte, er müsse dringend in seine Heimat zurück. Sie sah ihn nie wieder. Es gelang ihr, die Schwangerschaft zu verheimlichen. Als die Niederkunft näher rückte, fuhr sie nach Bayern, mietete sich für drei Wochen in einem Hotel ein und gebar das Kind, einen Sohn, im Badezimmer. Am Abend legte sie ihn vor dem katholischen Pfarrhaus ab. Von einer Telefonzelle aus informierte sie den Pfarrer. Niemand bemerkte etwas. Von ihrem Sohn hörte sie nie mehr etwas. Sie stellte auch keine Nachforschungen an. Doch bis heute hatte sie sich dies nicht verziehen.
5. Kapitel
Als nach der Landtagswahl 2000 das Innenministerium an die SPD fiel, sollte ihr Kollege Dr. Theodor Leuschner Staatssekretär werden. Doch weil seine Frau an Krebs erkrankt war, lehnte Dr. Leuschner lehnte das Angebot ab und schlug seine Kollegin Dr. Ruter vor. Dr. Leuschner war der Einzige im Ministerium, der die Hintergründe des Selbstmords des Staatssekretärs kannte. Aber er sprach mit niemandem darüber und war der Meinung, dass es letztlich die eigene Entscheidung des Staatssekretärs gewesen sei. Er hätte – so Dr. Leuschner – auch anders handeln können.
Der Kandidat für den Posten des Innenministers war gegen Dr. Leuschners Vorschlag. Er kam aus dem Osten und wollte als Staatssekretär jemanden, der aus Brandenburg stammte, und keinen zugereisten Wessi. Allerdings hatte er keinen eigenen Kandidaten.
Am Tag, an dem der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden sollte, erhielt Dr. Ruter einen Anruf aus dem Landtag. Es war Dieter Kehl, der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, der gleichzeitig Landesvorsitzender der Partei war und von seinen Bekannten nur »Großer Vorsitzender genannt« wurde. »Kehl, Dieter Kehl«, meldete er sich. Die tiefe und raue Stimme klang ruhig, obwohl der Vorsitzende stark unter Druck stand. Denn zwei Punkte mussten mit dem Koalitionspartner noch abgestimmt und in der SPD mussten noch einige Personalien geklärt werden. Aber Dieter Kehl liebte solche Situationen.
»Ja, Herr Vorsitzender?« Dr. Ruter hatte keine Ahnung, was der Mann von ihr wollte.
»Ich mache es kurz. Ich werde Sie gleich als Staatssekretärin für Ihr Ministerium vorschlagen. Und was ich vorschlage, wird gemacht. Einverstanden?«
Astrid Ruter schluckte. Sie fand kaum Worte. »Ja. Ich, ich … Danke.«
»Okay, wir sehen uns später.« Dieter Kehl hatte aufgelegt.
Und so kam es. Dr. Astrid Ruter wurde Staatssekretärin. Die Zusammenarbeit mit dem Minister, dem seine Stellvertreterin aufgezwungen worden war, entwickelte sich gut. Denn der Minister erkannte schnell, dass seine Staatssekretärin eine exzellente, politisch denkende Verwaltungsjuristin war, ohne deren Ratschläge und Hinweise er im Ministerium verloren gewesen wäre.
Ungefähr drei Wochen nach Beginn der neuen Legislaturperiode rief die Sekretärin von Dieter Kehl bei Frau Mehlis, der Sekretärin von Dr. Ruter, an und bat die Staatssekretärin für den übernächsten Tag um 11 Uhr zu einem Gespräch beim Fraktionsvorsitzenden.
»Oh, das tut mir leid. Aber der Termin ist belegt.«
»Na, die Staatssekretärin wird doch wissen, dass man den Fraktions- und Landesvorsitzenden nicht warten lässt. Verschieben Sie den Termin«, sagte die Sekretärin in befehlendem Ton.
Am übernächsten Tag war Frau Ruter kurz vor 11 Uhr im Vorzimmer von Dieter Kehl. Dessen Sekretärin schaute auf. »Na also, geht doch. Nehmen Sie bitte Platz. Der Chef kommt gleich.«
Ungefähr zehn Minuten später kam der starke Mann der SPD. Er sah wirklich stark aus. Mindestens 1,90 Meter groß, 90 Kilo schwer, breites Kreuz, ein massiver Kopf, was durch den Kurzhaarschnitt noch betont wurde. Er trug sein Jackett offen. Das Hemd war ein wenig verrutscht. Die Krawatte hatte er gelockert; auch sie hatte sich verschoben. Vor dem Schreibtisch seiner Sekretärin blieb er stehen: »Gibt’s was Neues?«
Die Sekretärin sagte nichts, sondern wies mit dem Kopf Richtung Besucherstuhl, der sich hinter der geöffneten Tür im Rücken von Dieter Kehl befand. Er drehte sich um und schaute Dr. Ruter von oben herab an. »Sie sind also die Staatssekretärin. Na, dann kommen Sie mal mit.«
Dieter Kehl gab ihr die Hand und ging voraus in sein Arbeitszimmer, wo er auf eine Sitzecke wies. Astrid Ruter schaute sich um. Das Zimmer war sehr groß – eigentlich waren es zwei Zimmer. Im hinteren Teil standen der Schreibtisch und ein Stehpult. Im vorderen Teil befanden sich ein Besprechungstisch, auf dem eine chinesische Skulptur stand, und die kleine Sitzecke. An den Wänden Regale voller Bücher. Dazwischen Bilder von Horst Janssen. Der große Raum war unterteilt durch einen Schrank von ungefähr einem Meter Höhe, auf dem einige chinesische Skulpturen standen. Ganz schöne Bibliothek, dachte sie.
Der Vorsitzende kam zur Sitzecke herüber.
»Ganz schön viele Bücher«, stellte Astrid Ruter fest.
»Circa 3.000.« Dieter Kehl fühlte sich offensichtlich geschmeichelt.
»Haben Sie die alle gelesen?«
Dieter Kehl lachte. »Die Zeit habe ich im Moment nicht. Aber später«, er überlegte einen Augenblick, »in 20 Jahren vielleicht.« Er lachte wieder. »Kaffee?«
»Nein danke.«
»Frau Roth, bringen Sie mir bitte einen Kaffee. Stark wie immer«, rief er ins Vorzimmer. »Wir werden ja in den nächsten Jahren zusammenarbeiten und da sollten wir uns kennenlernen.«
Frau Ruter nickte.
»Ich rede nicht lange drum herum. Ich habe Sie zur Staatssekretärin gemacht und ich kann Sie auch zur Ministerin machen.«
Dr. Ruter nickte nicht, sondern schaute Dieter Kehl fragend an. Was will der?, überlegte sie.
Dieter Kehl griff in die Seitentasche seines Jacketts und holte einen Zettel heraus. Er reichte ihn Astrid Ruter. »Peter Henning« las sie. Der Name sagte ihr nichts.
»Der arbeitet bei Ihnen. Kümmern Sie sich um den Fall.«
»Können Sie mir vielleicht noch sagen, worum es geht?«
»Polizei. Beförderung.«
»Gut«, antwortete Frau Ruter und steckte den Zettel ein.
»Ja, das war’s schon. Gut sehen Sie aus. Lassen Sie sich mal wieder sehen.«
Astrid Ruter stand auf und reichte dem Fraktionsvorsitzenden die Hand. Der blieb sitzen.
»Den Weg hinaus finden Sie ja.«
Frau Ruter nickte.
Der Fall »Peter Henning« war einfach. Er stand beim nächsten Termin zur Beförderung an. Drei Tage nach ihrem Besuch bei Dieter Kehl rief sie ihn an und teilte ihm das mit.
»Na also, geht doch«, meinte Kehl.
»Ein ganz normaler Vorgang. Er steht einfach an.«
»Stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel«, sagte Dieter Kehl und legte auf.
Und jetzt saß Astrid Ruter an ihrem Schreibtisch und schaute sich noch einmal die Kriminalitätsstatistiken an. Die Zahlen sprachen für sie. Aber sie wusste, dass sie mit den Zahlen allein die Teilnehmer nicht erreichen und überzeugen konnte. Ich muss sie emotional packen, sagte sie sich. Wie ihr das gelingen sollte, war ihr bislang nicht klar. Aber sie hatte ja noch ein paar Stunden Zeit.
6. Kapitel
Dr. Leuschner, der nach dem Verzicht auf den Posten des Staatssekretärs weiterhin Leiter der Zentralabteilung war, saß zu diesem Zeitpunkt ebenfalls an seinem Schreibtisch. Gegen 17 Uhr hatte er sich aus dem Kühlschrank, der in der Kaffeeecke seiner Sekretärin stand, einen Wodka geholt. Den brauchte er, um den Vorgang zu bearbeiten, der auf seinem Schreibtisch lag. Er schüttelte den Kopf. Der Minister hatte ihm eine Akte zukommen lassen mit der Bitte, die Angelegenheit vertraulich zu prüfen und ihm mündlich zu berichten. Dr. Leuschner mochte das nicht. Er war ein korrekter Beamter. Und der korrekte Beamte hielt den Dienstweg ein. Geschah das nicht, war die Sache meistens faul. Und hier wurde die Staatssekretärin umgangen. Er hatte den Minister schon vor einiger Zeit in einer anderen Angelegenheit darauf hingewiesen. Der hatte aber nur gesagt: »Machen Sie sich keine Sorgen. Ich regele das schon. Manchmal muss es schnell gehen und dann geht es von Hand zu Hand.«
Dr. Leuschner hatte sich hierüber einen Vermerk gemacht. Und das tat er jetzt auch.
Dr. Leuschner war 54 Jahre alt. Er war in Aachen geboren. Nach dem Jurastudium, der Referendarzeit und der Promotion trat er in den Dienst des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen. Er begann als Referent im Referat allgemeines Polizeirecht und wechselte nach einem Jahr in das Referat kommunales Haushaltsrecht. Danach übernahm er die Leitung des Personalreferates, war kurzzeitig Leiter des Haushaltsreferates und wurde mit knapp 38 Jahren stellvertretender Leiter der Polizeiabteilung. Darauf war sein Vater, der Polizeibeamter im mittleren Dienst gewesen war, sehr stolz. Er hatte vier Monate bei einem großen Unternehmen in München und jeweils drei Monate bei der EU-Kommission und dem amerikanischen Heimatschutzministerium hospitiert. Seine Kollegen, die ihn schätzten, gingen davon aus, dass er in zwei Jahren Nachfolger des Leiters der Polizeiabteilung und später Staatssekretär werden würde. Doch es kam anders.
Nach Gründung des Landes Brandenburg wurde der Leiter der Kommunalabteilung des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen Staatssekretär im Brandenburgischen Innenministerium. Er bat Dr. Leuschner, die Leitung der Zentralabteilung zu übernehmen. Nach kurzem Überlegen sagte Dr. Leuschner zu. Er war der Meinung, jetzt sei Hilfe beim Aufbau der Innenverwaltung des Landes Brandenburg nötig. Die regierende Koalition aus SPD und BÜNDNIS 90/Die Grünen wurde 1995 durch eine CDU/FDP-Koalition abgelöst. Dadurch war die ursprüngliche Planung, wonach er im Laufe der zweiten Legislaturperiode Staatssekretär werden sollte, hinfällig. Die meisten Kollegen rechneten damit, dass er auf einen weniger bedeutenden Posten abgeschoben würde. Aber der neue CDU-Innenminister beließ ihn gegen starken Widerstand auf seiner bisherigen Funktion, weil er auf Dr. Leuschners Kenntnisse nicht verzichten wollte und in einem Gespräch mit ihm den Eindruck gewonnen hatte, dass er loyal sei. Nach Bildung der Großen Koalition im Jahre 2000 sollte er Staatssekretär werden. Doch er lehnte wegen einer Krebserkrankung seiner Frau ab.
Dr. Leuschner war ein Ministerialbeamte wie er im Buche steht: grauer Anzug und weißes Hemd. Dazu trug er eine Fliege. Die hob ihn von den Kollegen ab und verlieh ihm etwas Exotisches. Später kam altersbedingt noch eine randlose Brille hinzu. Er trennte klar Dienst- und Privatleben. Deshalb wusste man so gut wie nichts über ihn. Nur dass er ein exzellenter Verwaltungsjurist war.
Er war seit fast 33 Jahren Mitglied der SPD. Er litt immer darunter, dass seine Partei in seinen Augen häufig keinen klaren Kurs fuhr. Im Wahlkampf machte er Hausbesuche und verteilte an Infoständen Parteimaterial. Die Genossinnen und Genossen rechneten ihm das hoch an. Manch einer schüttelte allerdings auch den Kopf.
Er war befreundet mit dem Schauspieler Wolfgang Holz, der die große Demonstration am 4. November 1989 auf dem Alexanderplatz mit organisiert hatte, mit dem Schriftsteller Bernd Schlingmann, der den bedeutenden Roman »Der Verrat« über das Leben eines Inoffiziellen Mitarbeiters, hinter dem Kenner Ibrahim Böhme vermuteten, geschrieben hatte und – was niemand wusste – mit dem Frontmann der Punkrockband Blue Day. Gegen Ende der 1990er-Jahre hatte er begonnen, einen Roman zu schreiben. Doch er kam nicht richtig voran. Vor rund zwei Jahren hatte er dem ermittelnden Kriminalhauptkommissar Haberland einen wichtigen Hinweis bei der Aufklärung des Todes des Staatssekretärs Dr. Hans Schwenk gegeben. Seit dieser Zeit traf er sich in unregelmäßigen Abständen mit ihm in der Kneipe »Bei Kati«.
7. Kapitel
Dr. Leuschner schaute auf die vor ihm liegende Akte. Es ging um eine Beförderungsangelegenheit. »Möchte Polizeirat Heinrich Kuckelmann befördern. Bitte Rückruf«, hatte der Minister auf einen kleinen Zettel geschrieben, der mit einer Heftklammer an dem Aktendeckel befestigt war. Die Akte enthielt eine Liste der Beförderungskandidaten mit den persönlichen Daten und den Beurteilungsergebnissen. Zum nächsten Beförderungstermin konnten zwei Polizeiräte befördert werden. Dr. Leuschner überflog die Beurteilungsergebnisse. Zwei Kandidaten waren mit »gut« beurteilt. Einer der beiden war – wenn Dr. Leuschner sich richtig erinnerte – Mitglied der CDU-Stadtratsfraktion in Frankfurt. Kuckelmann und ein weiterer Kandidat hatten ein »vollbefriedigend«. Der andere war zwar um einen Punkt besser als Kuckelmann, aber man konnte beide noch als im Wesentlichen gleich bezeichnen. Zwar war der andere ein Jahr länger Polizeirat als Kuckelmann, das spielte jedoch letztlich keine Rolle, da die beiden mit »gut« beurteilten Kandidaten auf jeden Fall vor Kuckelmann befördert werden mussten. Dr. Leuschner ging noch einmal die Daten durch, dann wählte er die Nummer der Sekretärin des Ministers.
»Herr Dr. Leuschner, was kann ich für Sie tun?«
»Guten Tag, Frau Allmachen, der Herr Minister möchte mich sprechen.«
»Dann soll das geschehen, Herr Dr. Leuschner. Einen Moment bitte.« Frau Allmachen stellte durch.
»Lieber Herr Dr. Leuschner«, meldete sich der Minister.
Das verheißt nichts Gutes, dachte Dr. Leuschner.
»Was haben Sie denn rausbekommen?«, fuhr der Minister fort.
»Kurz und knapp: Insgesamt stehen drei Kandidaten vor Polizeirat Kuckelmann. Er kann beim nächsten Termin nicht befördert werden«, sagte Dr. Leuschner ruhig.
»Aber das gibt es doch nicht.« Die Stimme des Ministers wurde laut. »Der ist doch schon länger als drei Jahre Polizeirat. In einem anderen Ministerium wäre er längst befördert.«
»Das kann ich nicht beurteilen. Aber unsere Stellensituation gibt es nicht her.« Dr. Leuschner blieb weiterhin ruhig.
»Da muss man sich was einfallen lassen.«
Dr. Leuschner sah den Minister vor sich: drohender Blick, roter Kopf. »Herr Minister, es tut mir leid. Aber zwei Kandidaten sind mit ›gut‹ beurteilt. Polizeirat Kuckelmann leider nur mit ›vollbefriedigend‹. Damit kommt er an den beiden nicht vorbei. Und wir haben nur zwei Beförderungsmöglichkeiten.« Den Hinweis auf das CDU-Stadtratsmitglied verkniff er sich.
»Die Schwarzen würden einen Weg finden. Die wären nicht so pingelig.« Der Minister atmete heftig.
»Ich kann nur warnen. Einen Rechtsstreit werden wir verlieren. Und die Presse wird den Fall, da bin ich mir sicher, aufgreifen: parteipolitische Ämterpatronage.«
»Ach, die Presse. Die ist mir ehrlich gesagt egal. Das müssen wir aushalten.«
»Ich kann nur warnen«, wiederholte Dr. Leuschner. »Darf«, Dr. Leuschner machte eine kleine Pause, »darf ich fragen, wer dahintersteckt?«
»Ach, der Unterbezirksvorsitzende von Prignitz.«
»Entschuldigung, von dem habe ich noch nichts gehört. Hat der denn innerparteilich etwas zu sagen?«, fragte Dr. Leuschner.
»Das nicht. Aber er ist ein guter Freund des Landesvorsitzenden. Und der wartet nur darauf, mir eins auszuwischen.«
»So, der Landesvorsitzende. Dann schicken Sie Ihre Staatssekretärin vor. Ich glaube, die versteht sich mit dem Großen Vorsitzenden ganz gut.«
»So, so. Frau Dr. Ruter versteht sich mit dem Landesvorsitzenden ganz gut. Das ist ja interessant.« Die Stimme des Ministers klang überrascht. »Das ist ja wirklich interessant«, sagte er leise. Dr. Leuschner ahnte, was dem Minister jetzt durch den Kopf ging.
»Meine Sekretärin holt den Vorgang bei ihnen ab. Vielen Dank für Ihre Mühe.« Der Minister legte auf.
Dr. Leuschner atmete tief durch. Morgen würde er die Staatssekretärin mündlich informieren.
8. Kapitel
Ungefähr 20Minuten vor Beginn der Veranstaltung betrat Werner Küster den Gemeindesaal der Evangelischen Friedenskirche in Potsdam, der zur Hälfte gefüllt war. Er schaute sich um. Bekannte Gesichter sah er nicht. Er ging zum Podium. Fünf Stühle, fünf Namensschilder, fünf Flaschen Mineralwasser und fünf Gläser. In diesem Moment trat eine Frau auf ihn zu. »Sind Sie Chefredakteur Peter Michels?« Sie gab ihm die Hand. »Ich bin Dr. Petra Wilk vom Verein zur Förderung der Demokratie. Wir sind die Initiatoren der Veranstaltung.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!