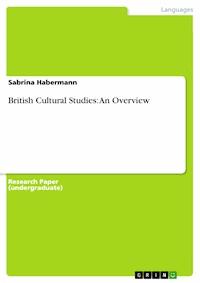15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Pädagogik - Schulpädagogik, Note: 1,5, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Sprache: Deutsch, Abstract: Wer kennt sie nicht? Ob aus Erfahrungen in der eigenen Schullaufbahn oder aus einem Schulpraktikum im Rahmen des Lehramtsstudiums – Unterrichtsstörungen sind allgegenwärtig und waren noch nie gefürchteter als heute. In vielen Diskussionen wird der Ruf danach laut, Lehrern, wie in früheren Zeiten, wieder mehr Kontroll- und Disziplinierungsmöglichkeiten an die Hand zu geben, um die Schülerinnen und Schüler gegebenenfalls durch das Einsetzen von Gewalt in ihre Schranken zu weisen und somit die Kontrolle über die Klasse zurückzugewinnen. Hierbei stellt sich jedoch die Frage, ob es sinnvoll ist, in einer Gesellschaft, deren Werte und Normen sich im Bezug auf den schulischen, aber auch familiären Umgang miteinander stark verändert haben, auf althergebrachte Disziplinierungsmaßnahmen zurückzugreifen, wo doch gerade heutzutage der Institution „Schule“ weitaus mehr Aufgaben zugerechnet werden, als die bloße Vermittlung von Lerninhalten. Schülerinnen und Schüler sollen in der Schule vor allem auch bei der Persönlichkeitsbildung unterstützt werden, um ihnen die Orientierung in der Gesellschaft zu erleichtern. Hierzu gehören laut BRÜNDEL und SIMON Kompetenzen wie „Verantwortungsbewusstsein, die Anerkennung von Regeln im Umgang miteinander, Entscheidungs- und Antizipationsfähigkeit, Problemlösekompetenzen sowie Kooperations- und Kommunikationsbereitschaft“ (2003, S. 9). Somit sollten Unterrichtsstörungen nicht durch übertriebene Disziplinierungsmaßnahmen unterdrückt werden, sondern der Lehrperson vor allem als Feedback für die eigene Unterrichtsgestaltung dienen. Der Lehrer ist also dazu angehalten, mit jeder Art von Unterrichtsstörung reflexiv umzugehen. Einerseits ist es ihm somit möglich herauszufinden, inwieweit die sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler, wie Kooperations- und Kommunikationsbereitschaft, schon ausgebildet sind, andererseits besteht aber auch die Möglichkeit, sich selbst, als Lehrperson, zum Gegenstand der Reflexion zu machen. Lehrerinnen und Lehrer sind mit ihrem Verhalten in gewisser Weise immer Vorbild für die Schüler und sollten sich darüber im Klaren sein, dass sich dieses positiv, aber auch negativ auf das Verhalten der Schüler auswirken kann. Dies bedeutet, dass auch Faktoren wie Lehrerverhalten, Klassenmanagement oder Unterrichtsführung zu Unterrichtsstörungen führen können und die Ursachen nicht grundsätzlich bei den Schülern zu suchen sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffsklärung
3. Gründe für Unterrichtsstörungen
3.1 Störfaktor 1 - Schule als Institution
3.2 Störfaktor 2 - Lehrerverhalten
3.2.1 Fallbeispiel: fehlende Präsenz
3.2.2 Subjektivität
3.2.3 Inkonsequenz/ ineffektive Ermahnungen
3.2.4 Vermittlung des Unterrichtsstoffes
3.3 Störfaktoren 3 - Schülerverhalten
3.3.1 Warum stören Schüler?
3.3.2 Warum stören sich für Klassenclowns lohnt
4. Prävention durch Reflexion
5. Intervention
6. Die Trainingsraummethode
6.1 Grundlagen
6.2 Praxis
6.2.1 Rechte und Pflichten
6.2.2 Vorgehen bei einer Unterrichtsstörung
6.2.3 Im Trainingsraum
6.2.4 Fallbeispiel
6.3 Kritik
6.4 Chancen
7. Resümee
8. Quellen
8.1 Bücher
8.2 Websites
1. Einleitung
Wer kennt sie nicht? Ob aus Erfahrungen in der eigenen Schullaufbahn oder aus einem Schulpraktikum im Rahmen des Lehramtsstudiums - Unterrichtsstörungen sind allgegenwärtig und waren noch nie gefürchteter als heute.
In vielen Diskussionen wird der Ruf danach laut, Lehrern, wie in früheren Zeiten, wieder mehr Kontroll- und Disziplinierungsmöglichkeiten an die Hand zu geben, um die Schülerinnen und Schüler gegebenenfalls durch das Einsetzen von Gewalt in ihre Schranken zu weisen und somit die Kontrolle über die Klasse zurückzugewinnen. Hierbei stellt sich jedoch die Frage, ob es sinnvoll ist, in einer Gesellschaft, deren Werte und Normen sich im Bezug auf den schulischen, aber auch familiären Umgang miteinander stark verändert haben, auf althergebrachte Disziplinierungsmaßnahmen zurückzugreifen, wo doch gerade heutzutage der Institution „Schule" weitaus mehr Aufgaben zugerechnet werden, als die bloße Vermittlung von Lerninhalten. Schülerinnen und Schüler sollen in der Schule vor allem auch bei der Persönlichkeitsbildung unterstützt werden, um ihnen die Orientierung in der Gesellschaft zu erleichtern. Hierzu gehören laut BRÜNDEL und SIMON Kompetenzen wie „Verantwortungsbewusstsein, die Anerkennung von Regeln im Umgang miteinander, Entscheidungs- und Antizipationsfähigkeit, Problemlösekompetenzen sowie Kooperations- und Kommunikationsbereitschaft“ (2003, S. 9). Somit sollten Unterrichtsstörungen nicht durch übertriebene Disziplinierungsmaßnahmen unterdrückt werden, sondern der Lehrperson vor allem als Feedback für die eigene Unterrichtsgestaltung dienen.
2. Begriffsklärung
Störungen in der Klasse können einen großen Teil des Unterrichts ausmachen, wobei nicht nur die Beeinträchtigung durch den Schüler, sondern auch die darauf folgende Reaktion des Lehrers oft sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.
Natürlich ist ein „störungsfreier Unterricht eine didaktische Fiktion" (Lohmann, 2003, S. 13), dennoch ist es wichtig zu wissen, durch welche Faktoren eine Beeinträchtigung des Unterrichts entstehen kann, um dieser schon im Vorfeld entgegenzuwirken oder vorzubeugen.
Wann genau von einer Störung des Unterrichtsgeschehens zu sprechen ist, ist wohl nicht definitiv festzulegen. Dennoch lassen sich aus einigen Definitionen Kriterien herausarbeiten, welche für die Begriffsklärung des Terminus „Unterrichtsstörung“ existenziell sind.
Im Folgenden möchte ich auf Definitionen einiger Autoren eingehen, um deren unterschiedliche Ansichten aufzuzeigen und ihre divergenten Maßstäbe zu verdeutlichen.
WINKEL erläutert in seinem Werk „Der gestörte Unterricht“, dass eine Unterrichtsstörung dann vorliegt, wenn „der Unterricht gestört ist, d.h., wenn das Lehren und Lernen stockt, aufhört, pervertiert, unerträglich oder inhuman wird“ (2009, S. 29).
Somit legt der Autor sein Augenmerk auf den Akt des Lehrens und Lernens an sich, der durch eine Unterrichtsstörung negativ beeinflusst wird. Auf Personen, welche den Unterricht stören oder auf solche, welche durch eine Beeinträchtigung des Unterrichts gestört werden, wird nicht eingegangen. Durch diese Art der Definition möchte der Autor verdeutlichen, dass seiner Meinung nach der Begriff „Unterrichtsstörungen“ am besten beschrieben werden kann, wenn er unabhängig von Personen ist.
Genau diese Subjektivität ist es jedoch, die das Thema „Unterrichtsstörungen“ so schwer greifbar macht. Ob eine entpersonalisierte Definition hilfreich ist, um Lehrern zu verdeutlichen, worin die Probleme bei Beeinträchtigungen des Unterrichts liegen, ist fraglich.
Im alltäglichen Unterrichtsgeschehen ist natürlich zu erkennen, wann der Lehr-Lern- Prozess stockt oder abbricht, offen bleibt jedoch bei WINKELs Definition, abwelchem Moment der Unterricht nicht mehr seinen ursprünglichen Zielen folgt und ab wann bzw. für welche Personen er unerträglich oder inhuman wird. Natürlich mag es an der subjektiven Meinung einer Lehrperson liegen, ob er eine bestimmte Schülerhandlung als störend erachtet oder nicht, wichtig ist jedoch für eine Begriffsklärung zuerst einmal, sich darüber klar zu werden, dass diese Subjektivität überhaupt existiert.
Genau um dieses Element erweitert ein anderer Autor, NOLTING, seine „normative Definition“, indem er einräumt: „Was Lehrer X als unruhig bezeichnet, nennt seine Kollegin Y vielleicht lebhaft“.