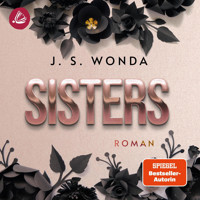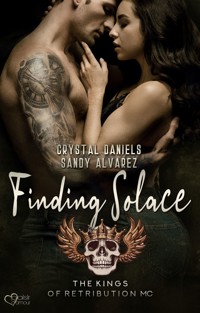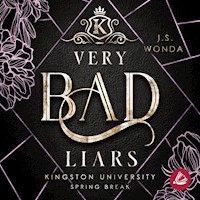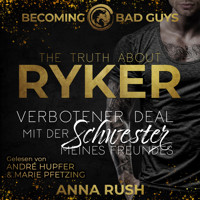9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Erotik
- Serie: Die Beautifully Broken-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Eine zweite Chance für die Liebe - Das große Finale der New-Adult-Serie "Beautifully Broken" von Courntey Cole Als Ex-Soldat Brand in seine Heimatstadt zurückkehrt, muss er sich wohl oder übel der Vergangenheit stellen, vor der er vor Jahren geflohen ist: Seiner Mutter, die ihn nie geliebt hat – und der jungen Nora, die sich seit der Highschool nach ihm verzehrt. Noras feuriges Temperament überwältigt Brand, doch sie hat ein dunkles Geheimnis, das ihrer beider Liebe zu zerstören droht. Wird es den beiden gelingen, ihre Furcht zu überwinden und einander zu retten? Alle Bände der New-Adult-Serie "Beautifully Broken" von Courntey Cole: Band 1 - "If you stay - Füreinander bestimmt" Band 2 - "If you leave - Niemals getrennt" Band 3 - "Before we fall - Vollkommen verzaubert" Band 4 - "Until We Fly - Ewig vereint"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 349
Ähnliche
Courtney Cole
Until we fly – Ewig vereint
Roman
Aus dem Amerikanischen von Silvia Gleißner
Knaur e-books
Über dieses Buch
Als Ex-Soldat Brand in seine Heimatstadt zurückkehrt, muss er sich wohl oder übel der Vergangenheit stellen, vor der er vor Jahren geflohen ist: Seiner Mutter, die ihn nie geliebt hat – und der jungen Nora, die sich seit der Highschool nach ihm verzehrt. Noras feuriges Temperament überwältigt Brand, doch sie hat ein dunkles Geheimnis, das ihrer beider Liebe zu zerstören droht.
Inhaltsübersicht
Für schmerzerfüllte Herzen und gebrochene Seelen.
Fluctuat nec mergitur
Sie schwankt, aber geht nicht unter.
(Seit 1853 Wappenspruch der Stadt Paris.)
Entscheidet euch dafür, nicht unterzugehen.
Vorwort
Am Anfang, als ich die Serie Beautifully Broken geplant habe, hatte ich sie mit drei Bänden vorgesehen. Die Geschichte von Pax, die Geschichte von Gabriel und die Geschichte von Dominic. Aber wie Romanfiguren es so oft tun, hat Brand Killien sich in mein Herz geschlichen, und auch in eures, und er verlangte danach, dass auch seine Stimme gehört werden soll.
Ich habe so viele Mails bekommen von Leserinnen, die mehr von Brand und seinem Hintergrund hören wollten und die erleben wollten, dass auch er sein Happy End erlebt.
Diese Geschichte ist für euch.
Weil ihr danach gefragt habt.
Prolog
Ich träume von Kugeln und Blut. Wie immer.
Natürlich sind auch Schreie zu hören, weil es immer Schreie gibt. Hoch und schrill, tief und klagend. Sie sind voller Schmerz, Angst, Qual. Quälende Laute, und ich wälze mich hin und her und versuche, ihnen zu entkommen.
Das ist der Moment, in dem ich etwas bemerke.
Außerhalb meines Traumes, draußen in der dichten und schweren Stille, ist ein Geräusch zu hören.
Ein reales Geräusch.
Das Klingeln eines Telefons zerreißt die Stille und zersplittert die Nacht in eine Million Stücke. Schlagartig öffnen sich meine Augen, und ich starre trübe auf die Uhr.
Drei Uhr morgens.
Ein Anruf zu dieser Zeit bedeutet nie etwas Gutes.
Meine Ausbildung übernimmt die Regie, und meine Sinne werden gefühllos und lösen mich von der Situation, während ich nach dem Telefon taste. Was auch immer da kommen mag, ich bin gefasst und bereit. Das bin ich, und dafür wurde ich ausgebildet.
Ich drücke einen Knopf und halte mir das Gerät ans Ohr. Ich warte und rechne damit, meinen besten Freund Gabe, seine Schwester Jacey oder einen unserer Freunde zu hören. Wenn es darum geht, jemandem aus Schwierigkeiten herauszuhelfen, fungiere ich immer als Anlaufstelle, hauptsächlich deshalb, weil ich ruhig und besonnen bin. Ich beurteile die Menschen nicht nach dem Mist, den sie bauen. Daher bin ich solche Anrufe gewohnt.
Nicht gewohnt jedoch bin ich die Stimme, die jetzt in der Dunkelheit spricht.
Eine dünne, schwache Stimme, die ich seit Jahren nicht mehr gehört habe.
»Brand?«
Die Stimme trifft mich wie ein Schlag in den Magen, und ich erstarre augenblicklich. Jeder Nerv in mir ist wie eingefroren.
»Mom«, sage ich, und das Wort fühlt sich fremd in meinem Mund an.
Sie bemerkt nicht einmal, dass ich etwas gesagt habe. Sie seufzt, ein zittriger Laut in der Dunkelheit.
»Es geht um deinen Vater. Er hatte heute Nacht einen Herzanfall.«
Sie hält inne, und ich erwidere nichts, obwohl mein Herz hämmert und meine Ohren mit einem Rauschen erfüllt sind. Mein Blut ist wie Eis, das durch meine Adern gepumpt wird, meine Finger und Zehen kalt werden lässt und jedes Gefühl abtötet.
Ich antworte ihr nicht.
Einen lautlosen Herzschlag lang.
Dann noch einen.
Dann spricht sie weiter, und ihre Stimme klingt müde und rauh.
»Er ist tot, Brand.«
Ich sage immer noch nichts, bin immer noch wie erstarrt, unfähig, mich zu rühren, aber meine Handflächen werden augenblicklich feucht, und ich atme hektisch. Ich habe Angst, dass, wenn ich etwas sage, es dann nicht real ist, dass es nur ein Teil meines Traumes ist, und sobald ich aufwache, verschwindet alles.
Also sage ich kein Wort.
Sei real.
»Du musst nach Hause kommen«, fordert meine Mutter.
Ihre Aufforderung ist wie eine Befreiung für mich, und ich kann mich wieder rühren. Ein knappes Nicken.
»Ich werde da sein.«
Denn das ist real.
Ohne ein weiteres Wort lege ich auf. Meine Hände zittern.
Ich starre meine linke Hand an, meine Finger, groß und kräftig. Ich bin ein erwachsener Mann. Und doch bringt der bloße Gedanke an meinen Vater instinktiv meine Hände zum Zittern wie bei dem verängstigten Jungen, der ich einst war. Doch ich gestatte mir dieses ohnmächtige Gefühl nur einen Augenblick lang, bevor ich die Furcht in Wut verwandle, eine blendende, heiße Wut, die zu empfinden ich jedes Recht habe.
Mein Vater ist tot.
Ich sollte bestürzt sein, ja, am Boden zerstört. Jeder normaler Mensch würde so empfinden.
Aber außer meiner Wut gibt es nur eines, was ich empfinde:
Erleichterung.
Kapitel 1
Nora, hörst du mir zu?«
Nein.
Ich wende meine Aufmerksamkeit von den Autos, die langsam auf der Hauptstraße der kleinen Stadt vorbeifahren, ab und sehe meinen Vater an. Maxwell Greene hat seine stechenden Augen auf mich gerichtet, das Haar an seinen Schläfen glitzert silbern in der Sonne, und ich schlucke.
»Ja, natürlich«, lüge ich.
Er nickt beschwichtigt.
»Gut. Ich weiß, dieses letzte Jahr an der juristischen Fakultät war schwierig, aber jetzt ist es vorüber. Ich will, dass du dir den Sommer über freinimmst, hier in Angel Bay mit deiner Mutter ausspannst, und dann im Herbst übernimmst du, wie geplant, die Rechtsabteilung bei Greene Corp.«
Er ist begeistert – natürlich, denn das ist alles, was er je wollte. Das war schon immer der Plan, bereits seit dem Augenblick, als ich eingeschult wurde. Wahrscheinlich schon vor meiner Geburt.
»Was ist mit Peter?«, frage ich zögernd und denke dabei an den Anwalt mittleren Alters, der bis heute die Position des Vizepräsidenten für juristische Belange in unserer Firma innehat. Er war stets freundlich zu mir und hat mir immer Bilder von seiner hübschen Frau und seinen vier Töchtern gezeigt.
Mein Vater verdreht die Augen. »Er wird entlassen. Ich bin sicher, er weiß schon eine ganze Weile, dass es dazu kommt. Jeder wusste doch, dass du in Stanford Jura studierst. Die können eins und eins zusammenzählen, Nora.«
Er ist so gleichgültig, wenn es darum geht, das Leben eines anderen Menschen zu zerstören. Ich schlucke schwer und spiele an dem Strohhalm in meinem Glas Limonade herum. Der Schirm unseres kleinen Bistrotisches auf dem breiten Bürgersteig wirft einen Schatten über meine Schultern, und ich schaudere beinahe – ob wegen der kühlen Brise, die vom See her weht, oder wegen der kalten Art meines Vaters, weiß ich nicht.
Er reagiert ungehalten.
»Nora, du brauchst mehr Rückgrat. In Sachen Firmenrecht gibt es kein Herumgedruckse. Da heißt es töten oder getötet werden. Du musst eine Greene sein und tun, was nötig ist. Sei der Mensch, den ich brauche.«
Seine Stimme klingt sogar noch kälter, als sein Blick ist. Aus alter Gewohnheit sehe ich ihm nicht in die Augen.
»Okay«, flüstere ich.
Schließlich meldet sich meine Mutter zu Wort und schenkt mir ein strahlendes Lächeln. Von uns allen war sie immer die Liebenswürdigste. Die Gütigste. Und sie weiß, dass ich jetzt jemanden brauche, der mir zu Hilfe kommt. Ich sehe es in ihren sanften blauen Augen.
»Ma belle fille«, sagt sie in ihrem singenden Tonfall und greift über den Tisch nach meiner Hand. »Wir werden einen wundervollen Sommer haben. Du kannst auf Rebel reiten, dich am Strand erholen, wir gehen zur Maniküre und Pediküre … wir genießen Tee mit Croissants. Es wird reizend sein. Du brauchst die Zeit zur Erholung.«
Meine wunderschöne Tochter. Obwohl meine Mutter schon in den Staaten lebt, seit sie meinen Vater vor fünfundzwanzig Jahren geheiratet hat, ist ihr französischer Akzent so stark wie eh und je. Er bezaubert jeden, der ihn hört.
Ich schenke ihr ein Lächeln – ein echtes.
»Danke, Maman. Ich freue mich darauf, Zeit mit dir zu verbringen. Du hast mir gefehlt.«
Das ist keine Lüge.
Nicht vermisst habe ich allerdings meinen Vater. Und die ständigen Vorträge darüber, »eine gute Greene« zu sein, und dass ich tun muss, was ich kann, zum Wohle der Familie und unserer Firma.
Egal, was es einen persönlich kostet.
Und mich persönlich hat es eine Menge gekostet.
Nicht, dass es irgendjemanden interessieren würde.
Die Verbitterung steigt wieder in mir hoch, und wenn ich sie nicht unterdrücke, wird sie mich überwältigen. Das würde nichts besser machen.
Sie weiß es nicht, rufe ich mir ins Gedächtnis.
»Wie geht es Rebel?«, frage ich meine Mutter und lenke damit das Thema ganz bewusst auf mein altes Pferd. Ich habe es seit dem letzten Sommer nicht mehr gesehen. Meine Mutter plaudert über den Hengst, erzählt, dass er dick wird, und ich wende mich wieder ab.
Um meine Verbitterung zu verscheuchen, schaue ich in die Wolken, beobachte die Autos, die kuriosen kleinen Läden, die Kreuzung. Irgendwas, um mich abzulenken und den ätzenden Geschmack der Erinnerung an das, was war, zu verjagen.
Sie weiß es nicht.
Aber mein Vater weiß es. Ich werfe einen Blick auf ihn, und der Zorn kommt wieder hoch. O ja, er weiß es. Tu, was nötig ist, Nora.
Ich beiße die Zähne zusammen. Es ist vorbei. Und in Ordnung bringen kann es sowieso niemand mehr. Alles, was ich jetzt tun kann, ist, eine gute Greene zu sein.
Ich konzentriere mich wieder angestrengt auf die Kreuzung und zwinge mich dazu, Interesse an etwas anderem zu finden.
Egal, was.
Ein rotes Auto hält kurz an und fährt dann über die Kreuzung. Angel Bay ist so klein, dass es hier nur eine größere Kreuzung gibt, und die befindet sich direkt vor dem Café. Es gibt nicht einmal eine Ampel, nur zwei Straßen, die sich kreuzen.
Wenn man Leute beobachten will, ist hier der beste Ort dafür.
Ich registriere die bezaubernde Stimme meiner Mutter, als sie weiterplaudert, und beobachte geistesabwesend einen weißen Suburban, der nach links abbiegt. Dann kommt ein gelber Käfer, der eine junge Mutter mit Kinderwagen über die Straße lässt, bevor er weiterfährt. Der Fahrer winkt im Vorbeigehen; ein freundlicher Fremder.
Ich lächle. Angel Bay ist voll von freundlichen Fremden. Man ist gewöhnt an Sommertouristen, und man ist freundlich zu jedem von ihnen, freut sich über das Geld, das sie hier ausgeben, und teilt gern die kleine Stadt am Lake Michigan mit ihnen.
Ein Bus in verschossenem Weiß fährt etwas weiter die Straße hinunter. An den Seiten sind Schilder festgemacht, und ich kann eines erkennen.
Hupt für den alljährlichen Campingausflug der Troop 52.
Erneut lächle ich beim Anblick der kleinen Pfadfinder, die sich die Nasen an den Fensterscheiben platt drücken. Wahrscheinlich sind sie auf dem Weg zum Warren Dunes State Park … in dem Fall sind sie beinahe am Ziel, und wie es bei kleinen Jungs oft so ist, werden sie langsam zappelig.
Hinter dem Bus, in einigem Abstand, kommt ein riesiger marineblauer Pick-up. Die Fenster sind getönt, aber ich erhasche einen kurzen Blick auf sonnenblondes Haar. Aus reiner Neugier sehe ich genauer hin. Leute zu beobachten, das war schon immer ein Hobby von mir. Wenn ich das Leben anderer Menschen verfolge, lenkt mich das von meinem eigenen ab.
Armselig, aber wahr.
Als der Pick-up näher kommt, kann ich das Gesicht des Fahrers besser sehen, und ich muss beinahe laut keuchen.
Das kann doch nicht sein.
Ich starre angestrengt hin, mit halb zusammengekniffenen Augen hinter meiner Sonnenbrille. Der Fahrer des Wagens trägt auch eine Sonnenbrille, was es schwieriger macht, ihn zu erkennen.
Aber dieses blonde Haar … honigblondes Haar, das aussieht wie von der Sonne geküsst. Die hohen Wangenknochen, das Grübchen am Kinn, die kräftige Kieferpartie, die stolze Nase. Dieses Profil würde ich überall erkennen, selbst durch eine getönte Frontscheibe hindurch, und das, obwohl es fast zehn Jahre her ist, seit ich es zum letzten Mal gesehen habe.
Brand Killien.
Nie im Leben.
Mir fällt auf, dass ich den Atem anhalte, und ich hole Luft, während ich ihn weiter anstarre.
Er sieht immer noch aus wie ein nordischer Gott, immer noch wie der Junge, in den ich mich vor so vielen Jahren verliebt hatte. Natürlich wusste er nichts davon, denn ich bin vier Jahre jünger als er. Ich war so überhaupt nicht auf seinem Radar. Aber er immer auf meinem … aus zwei Gründen.
Erstens: Weil er immer das Schönste war, das ich je gesehen habe.
Zweitens, und noch wichtiger: Er schafft es, dass ich mich gut fühle. Sicher und geborgen. So, als könnte mich nichts berühren und nichts verletzen, wenn ich bei ihm bin.
Jeden einzelnen Sommer habe ich mit offenen Augen von ihm geträumt, und irgendwann kam ich nach einem langen Winter wieder nach Angel Bay, nur um zu erfahren, dass Brand nicht hier war. Er war fortgegangen, aufs College und dann zur Army.
Von da an hielt ich jeden Sommer nach ihm Ausschau, ob er vielleicht heimkommt.
Und jeden Sommer war er nicht hier.
Die Leute redeten, natürlich, denn Angel Bay ist so klein, und Kleinstadtleute reden nun mal. Im winzigen Lebensmittelladen hörte ich, dass er ein harter Soldat in einer Eliteeinheit geworden war und als Ranger nach Afghanistan ging. Im Café hörte ich, dass ihm dort etwas Schreckliches zugestoßen war und dass er danach wieder in die Staaten zurückgekehrt sei.
Aber sehr zu meiner Enttäuschung kam er nie zurück nach Angel Bay.
Bis jetzt.
Schmetterlinge flattern explosionsartig in meinem Bauch herum, ihre Flügel kitzeln an meinen Rippen, und ihre lebhaften samtigen kleinen Leiber pressen sich gegen mein Zwerchfell und machen mir das Atmen schwer. Es ist, als wüssten sogar sie um die Intensität dieses Augenblicks, um das absolute Wunder, das er darstellt.
Brand Killien ist hier.
Ein Farmtruck mit Tieflader schlingert auf die Kreuzung und versperrt mir vorübergehend die Sicht. Ich beuge mich vor und versuche, unauffällig Brand wiederzufinden, nur um sicherzugehen, dass er auch wirklich da ist und ich ihn mir nicht nur eingebildet habe.
Und da erkenne ich das Problem. Und obwohl alles so schnell passiert, dass ich nicht einmal schreien kann, scheint es doch gleichzeitig in Zeitlupe abzulaufen.
Ein Kipplaster rast von der anderen Seite über die Kreuzung und kracht in den Ammoniaktank, der auf dem Anhänger des Farmtrucks steht.
Die Explosion erfolgt augenblicklich, und sie ist heftig.
Ich fühle die Hitzewelle, noch bevor ich den Donner höre. Aber als der dann kommt, reißt er den Himmel auseinander. Der Knall ist so laut, dass er in meinem Oberkörper widerhallt, jede einzelne meiner Rippen erfasst und die Schmetterlinge freisetzt. Plötzlich hänge ich in der Luft. Meine Beine baumeln wie bei einer bedauernswerten Lumpenpuppe, und überall wirbelt heißer Wind um mich herum. Ich bin im Wind. Ich bin der Wind.
Ich fliege und registriere dabei instinktiv Bruchstücke um mich herum.
Hitze.
Lärm.
Schreie.
Bersten von Glas.
Mein Flug währt nur kurz, und ich krache in etwas Hartes. Mein Kopf knallt auf den Boden. Den Boden?
Schwärze.
Hitze.
Als ich die Augen öffne, weiß ich nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Ich weiß nur, dass mein Kopf sich schwer anfühlt und schmerzt, als sei er aufgeplatzt. Mit zitternden Fingern greife ich nach hinten, und als ich die Fingerspitzen betrachte, sind sie voller Blut.
Ich sehe auf.
Die Hitze kommt vom Feuer. Und das Feuer ist überall.
Ich liege in einem Schutthaufen, der einmal das Café gewesen war. Bretter, Stühle und Tische türmen sich um mich herum, und auf dem Boden liegen Menschen. Überall ist Staub, und ich kann kaum etwas erkennen. Aber ich kann das Feuer sehen.
Und ich kann Brand sehen.
Wie ein prächtiger und grimmiger Engel geht er durch den dichten Rauch, und ich erkenne, wie er die Türen des Schulbusses aufbricht. Er springt hinein, und nur einen kurzen Moment später taucht er wieder auf, mit einem Kind auf den muskelbepackten Armen. Er übergibt das Kind an jemanden und geht zurück in den rauchenden, verkohlten Bus. Immer wieder sehe ich ihn hin und her laufen.
Einige der Kinder, die er herausbringt, sind blutig, manche bewegen sich nicht. Aber er geht immer wieder hinein.
Bis er schließlich mit leeren Händen herauskommt.
Einen Augenblick lang steht er einfach nur da, und ich sehe, dass sein Shirt vorn zerrissen ist. Hinter dem großen Riss kann ich einen harten Waschbrettbauch erkennen. Auf seiner Wange ist Ruß verschmiert, und derselbe Ruß hat auch sein Haar geschwärzt.
Ich sehe, wie er tief Luft holt; ich sehe, wie er sich umschaut in dem Blutbad auf der Straße, ob noch jemand Rettung nötig hat.
Und dann entdeckt er mich.
Ich brauche einen Retter. Mehr als er je erfahren wird.
Seine Augen sind so strahlend blau, dass ich es gar nicht beschreiben kann. Saphirblau vielleicht? Sie leuchten durch den Ruß, durch die Flammen hindurch. Sein Blick richtet sich auf mich, und dann, mit langen Schritten, kommt er auf mich zu. Direkt zu mir. Durch Chaos und Verwüstung.
»Miss, sind Sie in Ordnung?« Seine Stimme klingt belegt, wahrscheinlich vom Rauch. Ich kann mich nicht rühren.
»Ich stecke fest«, bringe ich dann heraus. »Meine Beine.«
Meine Beine stecken unter zersplitterten Brettern, die einmal die Wand eines Cafés waren. Als ich zu Brand aufschaue, sehe ich meine Eltern bei einem Rettungssanitäter stehen. Ich kann beobachten, wie meine Mutter hektisch die Arme bewegt, und ich kann von ihren Lippen ablesen.
Meine Tochter.
Ich hole Luft, aber sie könnte mich nicht hören, wenn ich jetzt nach ihr riefe. Sie wird warten müssen.
Brand lenkt meine Aufmerksamkeit wieder auf sich, auf seine strahlend blauen Augen, als er mich anspricht.
»Ich räume die Trümmer über Ihnen weg. Ich versuche, Ihnen nicht weh zu tun«, erklärt er mir ruhig. Mit starken Armen hebt er die schartigen Bretter von mir herunter, eines nach dem anderen. Er hält Wort und tut mir nicht weh dabei.
Als er fertig ist und ich frei bin, hilft er mir nicht beim Aufstehen.
Stattdessen bückt er sich und hebt mich hoch.
Mein Kopf ruht an seiner Brust, und ich kann sein Herz schlagen hören, als er mich mühelos durch das Chaos trägt.
Ba-bump.
Ba-bump.
Sein Herz ist so stark wie er.
Darauf konzentriere ich mich, auf seinen kräftigen Herzschlag, um nicht auf die Menschen, die am Boden liegen, sehen zu müssen. Anstatt auf das Blut zu schauen oder den Rauch zu riechen oder eine Panikattacke zu bekommen.
»Sind Sie in Ordnung?«, fragt Brand und sieht mich an. Sein Gesichtsausdruck ist zuversichtlich, seine Stimme klingt ruhig. »Es wird alles gut.«
Ich nicke, denn ich glaube ihm; wie könnte ich auch einer Stimme, die so selbstsicher ist, nicht vertrauen?
Doch gleich darauf spielt das keine Rolle mehr.
Wie aus dem Nichts höre ich ein grässliches lautes Krachen, und urplötzlich stürzt die Wand neben uns ein, ein Orkan aus metallischem Kreischen und Ächzen.
Etwas schlitzt mir den Arm auf, und ich kann das Blut riechen.
Dann werde ich aus Brands sicherem Griff gerissen, aus seinen Armen, und ich falle, falle immer tiefer.
Dann wird alles schwarz.
Kapitel 2
Gottverdammte Scheiße.
Weißglühender Schmerz durchfährt mich, von der Hüfte bis zum Knöchel. Ich verziehe das Gesicht und versuche, mich aus den Trümmern zu ziehen, aber vergeblich. Jetzt bin ich es, der feststeckt, in einem Haufen aus zersplittertem Holz und Asche; ich kann mich nicht befreien, und es tut weh.
Der Rauch, der mich umgibt, bringt schlimme Erinnerungen an Afghanistan zurück, an Bomben und Blut. Aber ich schüttle die Bilder ab. Dort bin ich nicht mehr.
Ich bin hier. Und ich muss meine fünf Sinne zusammenhalten.
Die Frau.
Die Frau, die ich getragen habe, die Frau mit dem tiefroten Haar und den großen blauen Augen. Sie hat mir vertraut. Ich sah es in ihrem Gesicht.
Ich drehe und wende mich, um sie zu finden, suche alles nach ihr ab. Und dann sehe ich ihren schlanken Arm aus einem Schutthaufen ragen. An dem türkisfarbenen Armband an ihrem schmalen Handgelenk erkenne ich, dass es ihr Arm ist.
»Hilfe!«, rufe ich zu den Rettungskräften, die jetzt vor Ort sind. Einer hört mich und kommt eilig zu mir, aber ich winke ihn weiter zu der Frau.
»Holen Sie sie zuerst!«, rufe ich ihm zu. »Sie ist unter all dem Schutt. Holt sie zuerst raus. Es zerquetscht sie.«
Er tut, was ich ihm gesagt habe, und sie müssen sie zu zweit ausgraben. Ich sehe, wie sie sie davontragen, sehe, dass ihre Augen immer noch geschlossen sind, und ich sehe, wie sie ihren reglosen Körper auf eine Transportliege betten, bevor sie zu mir kommen.
Fuck.
»Danke«, sage ich aufrichtig. Sie bewegen vorsichtig das Holz, die Gipsplatten und das verdrehte Metall, das mich festhält, bevor sie mich auf eine Trage rollen.
»Es geht mir gut«, sage ich und will aufstehen.
Aber ich kann nicht aufstehen. Mein linkes Bein ist unter mir verrenkt, und mein Fuß ist ganz unnatürlich verdreht. Ich starre darauf, fassungslos und erstaunt, und registriere dabei, dass mein Knie nach außen, aber mein Knöchel nach innen gedreht ist.
Fuck.
Ich fühle keinen Schmerz, daher weiß ich, dass ich unter Schock stehe. Ich lasse mich wieder auf die Trage zurücksinken, während sie mich zu einem wartenden Rettungswagen rollen.
Mein Bein wurde in Afghanistan zertrümmert. Ich habe mehrfache Operationen und monatelange Physiotherapie hinter mir, und ich hatte gerade erst wieder angefangen zu laufen, ohne dabei zu humpeln. Und wofür? Damit alles wieder von vorn losgeht? Hier im verdammten Angel Bay?
Hölle, verflucht.
Sie laden mich ins Auto und schließen die Tür, und ich starre einen Augenblick lang auf das weiße Metall, bevor ich die Augen schließe. Das kann doch jetzt nicht passieren. Das kann nicht wahr sein.
Aber es ist wahr.
Das laute Heulen der Sirenen sagt es mir.
Wie betäubt warte ich. Und dann wird mir etwas klar: Wieso fahren die mit Sirenen wegen eines gebrochenen Beins?
Der Gedanke ist mir kaum gekommen, als auch schon meine Finger kalt und meine Gedanken verschwommen und verworren werden.
Was zum Henker …?
Aber dann spielt das auch keine Rolle mehr, denn ich bin so verdammt müde. Nichts ist wichtig, weder der Schmerz, noch die Tatsache, dass er nicht da ist; nicht einmal die Frau.
Meine Arme und Beine werden schwer, ich schließe die Augen, und ein Seufzen rasselt in meinem Brustkorb.
Die Frau. Ihre blauen Augen sind das Letzte, was ich sehe, bevor ich wegdämmere.
Es kommt mir vor, als seien nur Minuten vergangen, als der Rettungswagen quietschend zum Stehen kommt und ich eilig ausgeladen werde.
Ich packe einen der Rettungssanitäter am Arm, als sie mich im Laufschritt ins Krankenhaus fahren.
»Was ist denn los?«
Er sieht mich an, während er mit mir weiterrennt. »Keine Sorge. Die bringen Sie in Ordnung.«
Ich kann nichts weiter tun, als zuzusehen und den Dingen ihren Lauf zu lassen. Wellen absoluter Erschöpfung und Müdigkeit überkommen mich, und ich will nur noch die Augen schließen.
Also tue ich das, aber ich kann nicht einschlafen, weil irgendein verdammter gesichtsloser Mensch mir ständig Fragen stellt, während zugleich andere gesichtslose Leute an meinem Bein herumfummeln und meine Hose aufschneiden.
Wie ist Ihr Name?
»Brand Killien«, murmele ich.
Wie alt sind Sie?
»Siebenundzwanzig.«
Haben Sie irgendwelche Allergien?
Nein.
Können wir jemanden für Sie anrufen?
»Nein.«
Ich öffne die Augen, als sie mir eine Infusionsnadel in den Arm jagen. Das Licht ist grell, und das Medikament, das sie mir einflößen, lässt alles verschwimmen.
Vor mir taucht das undeutliche Gesicht einer Krankenschwester auf.
»Sie kommen in den OP-Saal, Schätzchen«, sagt sie. Ich kann ihr Gesicht nicht sehen, obwohl meine Augen weit offen sind. »Sie haben einen Riss in der Arterie, der muss versorgt werden.«
Einen Riss in meiner verdammten Arterie?
Das soll doch wohl ein Witz sein. Ich habe die verdammten Hügel von Afghanistan überlebt. Ich werde doch jetzt hier nicht verbluten. Auf gar keinen verdammten Fall. Ach du Scheiße. Wieso habe ich sie nicht Gabe oder Jacey anrufen lassen … nur für alle Fälle?
Ich will ihnen sagen, dass sie Gabe anrufen sollen, aber sie können mich nicht verstehen.
Ein anderes verschwommenes Gesicht taucht vor mir auf, irgendwer mit schwarzem Haar. »Es wird alles gut, Sir. Zählen Sie einfach von einhundert an rückwärts.«
Die Lichter verwirbeln, die Geräusche hallen wider.
Neunundneunzig.
Achtundneunzig.
Siebenundneunzig.
Nichts.
Nichts.
Ich höre die schweren Schritte meines Vaters aus dem Zimmer meiner kleinen Schwester kommen, höre, wie er die Tür mit einem Klicken schließt und sich dann auf das Geländer stützt, als er die Treppe hinuntergeht.
Siebzehn.
Sechzehn.
Jede der siebzehn Stufen knarrt, und dann herrscht wieder Stille. Ich starre hinauf an die Decke und warte, bis ich den Auspuff seines alten Trucks losröhren höre, bevor ich wieder atme.
Er ist weg.
Erleichterung überkommt mich, und ich fühle mich dumm. Ich bin sechs Jahre alt. Ich sollte nicht so ängstlich sein.
Aber ich habe Angst.
Ich stehe auf, um zur Toilette zu gehen, etwas, das ich nie tun würde, wenn er noch zu Hause ist. Ich würde es nicht riskieren. Auf Zehenspitzen schleiche ich in die Küche und hole mir eine Handvoll Kekse. Dabei passe ich auf, dass ich die Keksdose nicht auf den Boden auskippe, bevor ich zurück in mein Zimmer schleiche, durch die Schatten laufe und ins Bett klettere.
Ich drehe mich auf die Seite und starre aus dem Fenster, während ich die Schokokekse esse. Meine Mutter hatte sie heute Abend extra zum Abendessen gemacht, aber mein Vater ließ mich keinen nehmen.
»Jungen, die nicht auf ihre kleine Schwester aufpassen, bekommen keine Kekse«, hatte er mir streng erklärt und mich mit seinen kalten blauen Augen angesehen.
Ich schluckte und warf Alison aus halb geschlossenen Augen einen Blick zu. Sie kaute zufrieden an einem Keks herum, und die Krümel landeten vorn auf ihrem Shirt. Ihre schmutzigen Finger hielten ihre süße Beute fest. Sie bekam nichts mit von den Schwierigkeiten, in denen ich ihretwegen steckte.
»Aber ich habe auf sie aufgepasst«, sagte ich meinem Vater. »Ich habe versucht, sie dazu zu bringen, dass sie hereinkommt und sich zum Abendessen die Hände wäscht, aber sie wollte einfach nicht auf mich hören.«
Mein Vater hatte kein Verständnis. »Sie ist erst vier Jahre alt. Du musst auf sie aufpassen. Du bist größer als sie. Willst du mir erzählen, du kannst sie nicht am Arm nehmen und hereinbringen? Bist du so schwächlich, Branden?«
Ich schluckte und schüttelte den Kopf. »Nein.«
Er schüttelte ebenfalls den Kopf, und sein stählerner Blick durchbohrte mich. »Da bin ich nicht so sicher. Wenn das noch einmal vorkommt, muss ich dir eine Lektion erteilen. Dann zeige ich dir ganz genau, wie man jemanden, der kleiner und schwächer ist, dazu bringt, das zu tun, was man will.«
Panik stieg damals in mir auf, und auch jetzt, bei der bloßen Erinnerung, kommt sie wieder hoch.
Ich will diese Lektion nicht.
Ich starre aus dem Fenster auf den See hinaus und sehe, wie das Wasser sanft an den Strand plätschert. Nachts schimmert der Sand wie Silber. Die Möwen schlafen, und so ist alles still, bis auf das rauschende Wasser.
Ein weißer Ball taucht auf, schwebt auf den Wellen, und ich betrachte ihn eine Weile, sehe zu, wie er schwebt und dann verschwindet.
Ich wünsche mir, ich könnte dieser Ball sein und weit von hier wegschweben.
Ich schrecke hoch, reiße die Augen auf, und das Licht blendet mich. Blinzelnd sehe ich hinein und versuche, mir klarzuwerden, wo ich bin. Krankenhausgeruch, weiße Wände.
Die Klinik.
Ich stöhne, und mein Hals fühlt sich rauh an. Dieses Gefühl erkenne ich wieder. Ich muss einen Atemschlauch gehabt haben. Operation. Ich erkenne auch die nebelhaften Nachwirkungen der Narkose wieder.
Was zum Teufel …?
Eine Krankenschwester kommt eilig zur Tür herein und macht große Augen, als sie sieht, dass ich wach bin. Ihre kühlen Finger fühlen meinen Puls und zählen die Schläge.
»Mr. Killien.« Sie lächelt. »Ich bin sehr froh, dass Sie wach sind. Wie fühlen Sie sich?«
Ich schlucke noch mal, versuche es jedenfalls trotz meiner rauhen Kehle.
»Ich weiß nicht«, antworte ich wahrheitsgemäß. »Was ist passiert?«
Ihre Augen sind voller Mitgefühl.
»Sie haben Kinder aus einem Bus gerettet«, sagt sie. »Es gab einen Unfall; ein Truck hat ein Stoppschild missachtet und ist in einen Tank mit Ammoniak gekracht. Es gab eine Explosion. Erinnern Sie sich?«
Darüber denke ich nach, und ich erinnere mich tatsächlich. Ich erinnere mich an den Rauch, das Blut und die Kinder.
Und dann fällt mir die rothaarige Frau wieder ein.
»Da war ein Mädchen«, sage ich der Schwester. »Ich meine, eine Frau. Rotes Haar. Ich habe sie getragen, als das Gebäude über uns einstürzte. Ist sie okay? Lebt sie?«
Gott, sie muss am Leben sein. Sie hat mir doch vertraut. Ihre Augen, so groß und blau, hatten mir das gesagt. Sie hat darauf gezählt, dass ich sie in Sicherheit bringe, und ich habe es nicht geschafft.
Meine Eingeweide verkrampfen sich, und ich zucke schmerzerfüllt zusammen.
Aber die Schwester nickt. »Alle sind am Leben, Mr. Killien. Und ich denke, Sie meinen Ms. Greene. Sie ist hier, und sie hat nach Ihnen gefragt. Kann ich ihr sagen, dass Sie wach sind? Sie hat sich große Sorgen um Sie gemacht.«
Ms. Greene?
Ich nicke, und die Krankenschwester lächelt.
»Ich sage es ihr. Sie wartet schon seit mehreren Stunden hier. Sie hatte Glück – sie und ihre Eltern erlitten nur kleinere Verletzungen. Aber sie wollte nicht gehen, bevor Sie aufwachen.«
Ich seufze erleichtert. Auch wenn ich sie nicht in Sicherheit bringen konnte, ist sie doch okay.
Gott sei Dank.
Ich schließe die Augen, noch ganz benebelt von der Narkose.
Plötzlich höre ich das leise Räuspern einer Frau.
Ich öffne die Augen.
Und blicke direkt in die blauen Augen der Frau.
Ms. Greene.
Einen Augenblick lang sehe ich etwas Vertrautes darin, etwas, das an mir nagt. Kenne ich sie?
Ich betrachte den Rest von ihr … das lange tiefrote Haar, das ihr bis über die Hälfte des Rückens fällt, schlanker Körper, üppige Oberweite und kurvige Hüften. Sogar durch den Medikamentennebel registriert meine Lendengegend ihre offensichtliche Schönheit.
Ich würde mich erinnern, wenn ich sie kenne.
Sie lächelt, ein strahlendes Lächeln. Ich bemerke, dass sie Schmutz auf Wangen und Stirn hat.
»Alles okay?«, fragt sie, und ihre Stimme klingt weich wie Seide.
Ich nicke. »Ja. Wird schon wieder, denke ich.«
Sie blickt mitfühlend auf mein Bein; Schatten in ihren Augen. »Es tut mir so leid. Sie wären nicht in dem Café gewesen ohne mich. Es ist meine Schuld, dass Sie jetzt hier in diesem Bett liegen.«
Ich schüttle schon den Kopf. Auf keinen Fall. Ich weiß, wie es ist, Verantwortung für etwas zu übernehmen, an dem man keine Schuld hat. Ich werde nicht zulassen, dass diese Frau dasselbe tut.
»Nein«, sage ich nachdrücklich. »Ich wollte helfen. Wenn ich nicht Sie gesehen hätte, dann jemand anderen. Also wäre ich sowieso da gewesen.«
Wahrscheinlich.
Sie schüttelt leicht den Kopf, und ein Lächeln spielt um ihre Mundwinkel.
»So ein Gentleman«, sagt sie leise. Sie gleitet auf den Stuhl an meinem Bett, graziös und elegant.
»Du erkennst mich nicht, oder, Brand?«
Ich hebe ruckartig den Kopf, als sie meinen Namen sagt.
Sie kennt mich tatsächlich.
Ich mustere sie noch einmal. Ihr Gesicht. Ihre Nase. Ihr Haar. Ihre Augen.
Ms. Greene.
Die Greenes.
Grundgütiger.
Ich unterdrücke ein Stöhnen. Ich war zu lange weg von hier. Ich habe vieles vergessen. Unter anderem auch, dass die Greenes eine feste Größe in Angel Bay sind. Sie besitzen ein riesiges Anwesen am See, in dem sie nur im Sommer residieren, und sie sind Mitglieder des Country Club, in dem ich früher gearbeitet habe.
Klar kenne ich sie. Beziehungsweise ich erinnere mich an das Mädchen, das sie einmal war. Inzwischen ist sie auf jeden Fall erwachsen geworden.
»Ich habe früher immer den Wagen deines Vaters im Club geparkt«, sage ich langsam.
Nora lächelt. »Und einmal hast du mir aufgeholfen, als ich in den Dreck gefallen war. Weißt du noch?«
O ja.
Nora war damals jünger, noch ein Teenager, und ihr Pferd hatte sie abgeworfen. Ich war auf dem Weg zum Clubhaus gewesen, um mir Limonade für meine Pause zu holen, als ich das Ganze beobachtete. Sie war der Länge nach im Dreck gelandet, und das Erste, was sie tat, war, sich heimlich umzusehen, ob es auch niemand beobachtet hatte.
Aber es war ein übler Sturz gewesen, also war ich hingegangen, um ihr zu helfen. Ihre Hände zitterten, und ich wollte sie nicht allein lassen, obwohl es gegen die strenge Vorschrift verstieß, dass das Dienstpersonal sich von den Clubmitgliedern fernzuhalten habe.
»Hat mein Vater es gesehen?«, hatte sie mich hastig gefragt, die Lippe zwischen die Zähne geklemmt. Von ihrer Spange war dort ein kleiner blutiger Riss, und ich hatte die Hand ausgestreckt und das Blut für sie weggewischt. Aber sie war nicht besorgt gewesen wegen ihrer aufgeplatzten Lippe. Sie hatte furchtbare Angst, dass ihr Vater ihr Missgeschick gesehen haben könnte.
»Nein«, versicherte ich ihr, »außer mir ist niemand in der Nähe.«
»Gott sei Dank«, hatte sie gehaucht.
»Soll ich dich zu ihm bringen?«, fragte ich sie schnell, da ich dachte, er könnte sie beruhigen.
Daraufhin packte sie mich am Arm, so fest, dass ihre Fingernägel sich in meine Haut gruben. »Bitte nicht«, flehte sie, und plötzlich standen Tränen in ihren Augen. »Bitte.«
Das hatte mich geschockt, ihre unmittelbare und felsenfeste Ablehnung. Es war, als hätte sie Angst vor ihm. Also versicherte ich ihr, dass ich ihn nicht holen würde, und brachte sie stattdessen zurück, um sie selbst zu beruhigen. Ich war eine halbe Stunde bei ihr geblieben.
»Dafür habe ich eine schriftliche Verwarnung kassiert«, erinnere ich mich. Auf Noras Gesicht legt sich ein Schatten.
»Wirklich?«, fragt sie verwirrt. »Aber wieso, um alles in der Welt?«
Der Ausdruck des Erstaunens auf ihrem Gesicht lässt mich fast glauben, dass sie es wirklich nicht weiß.
»Dein Vater hat sich beschwert«, sage ich schlicht. »Jemand hat es ihm erzählt, und er hat mich gemeldet. Das Dienstpersonal sollte nicht mit den Mitgliedern verkehren, weißt du.«
»Aber du hast nicht mit mir verkehrt«, wendet sie ein. »Du hast mir geholfen.«
Ich zucke mit den Schultern. »Das ist lange her.«
Aber ihr Blick ist immer noch bestürzt. Ein Teil von mir empfindet das als befriedigend. Vielleicht ist sie doch nicht das eiskalte Biest, das ich erwartet hatte. Mit einem Vater wie ihrem allerdings habe ich keine Ahnung, wie es anders sein könnte.
»Ich wollte einfach nach dir sehen«, sagt Nora zögernd. »Ich fühle mich verantwortlich, und ich wollte helfen. Daher habe ich ihnen gesagt, sie sollten deine Mutter anrufen. In deiner Brieftasche waren keine Kontaktdaten, und dein Handy ist passwortgeschützt.«
Meine Mutter? In dem Moment, als sie meine Mutter erwähnt hat, habe ich aufgehört, zuzuhören.
»Wieso sollten sie denn meine Mutter anrufen?«, frage ich blöde. Nora schüttelt verwirrt den Kopf.
»Weil du ganz allein hier warst. Ich wusste nicht, wen man sonst anrufen sollte. Ich dachte, du möchtest vielleicht ein Mitglied der Familie um dich haben …« Sie verstummt, als sie meinen Gesichtsausdruck bemerkt. »Aber jetzt sehe ich, dass ich mich geirrt habe. Es tut mir sehr leid. Ich wollte nur helfen.«
Das wollte sie, da bin ich mir sicher.
Aber meine Mutter anzurufen, das war so weit von helfen entfernt, wie es nur geht.
»Hat sie sich denn überhaupt bequemt zu kommen?«, frage ich müde. Ich war zwölf Stunden im Auto unterwegs, um hierherzukommen, weil sie mich gerufen hat, und ich bezweifle, dass meine Mutter sich überhaupt die Mühe gemacht hat, ins Krankenhaus zu kommen.
Nora schüttelt zögernd den Kopf. »Sie hat der Krankenschwester gesagt, dass sie dich abholen käme, wenn du entlassen wirst.«
Und dabei wurde ich wegen einer aufgeschlitzten Arterie operiert. Nach allem, was sie wusste, hätte ich auf dem OP-Tisch sterben können, und trotzdem ist sie nicht gekommen.
Wieso überrascht mich das? Als ich in Afghanistan war und gekämpft habe, hat sie sich ja auch nicht die Mühe gemacht, anzurufen und zu fragen, wie es mir geht.
Übelkeit macht sich in meinem Magen breit, und ich schlucke schwer.
»Tja, das ist keine Überraschung. Danke, dass du versucht hast, mir zu helfen, Ms. Greene. Ich weiß das zu schätzen. Du bist sicher müde. Du musst nicht hierbleiben.«
Sie hebt den Blick. »Ich heiße Nora.«
Ich nicke. »Okay. Danke, dass du nach mir gesehen hast, Nora. Ich bin froh, dass es dir gutgeht.«
Ihr Blick wird weicher, und in ihren Augen glitzert etwas, das ich nicht benennen kann. »Danke, dass du dafür gesorgt hast, dass es mir gutgeht. Du hast mich da herausgeholt, Brand. Wenn du nicht gewesen wärst …«
Ich falle ihr ins Wort. »Wenn ich dich nicht rausgeholt hätte, dann hätte es jemand anderer getan.«
Sie zuckt mit den Schultern. »Vielleicht. Aber so oder so, danke. Ich sehe morgen wieder nach dir.«
In ihren Augen steht etwas Sanftes, doch dann verbirgt sie es. Ich sollte ihr sagen, dass sie nicht kommen soll, ich sollte ihr sagen, dass sie sich nicht damit belasten soll. Aber der sanfte Blick in ihren Augen, dieser flüchtige Ausdruck, lässt mir die Worte auf der Zunge ersterben. Sie kommt mir vor wie jemand, der diese Sanftheit nicht oft durchscheinen lässt.
Also nicke ich stattdessen. »Ich bin sicher, dass ich dann noch da bin.«
Ich werfe einen Blick nach unten auf mein Bein und seufze schwer. Nora zuckt zusammen.
»Ich hoffe, du kannst dich ein wenig erholen«, sagt sie im Hinausgehen. »Bis morgen.«
Sie geht zur offenen Tür, und ich beobachte ihren sanften Hüftschwung, bis sie plötzlich in der Tür stehen bleibt. Sie dreht sich um und sieht mich an. Unsere Blicke treffen sich, und elektrische Spannung baut sich explosionsartig zwischen uns auf, zwischen ihrem sanften Blick und meinem.
Ihr Blick birgt ein Versprechen. Ich komme wieder.
Aus irgendeinem Grund gefällt mir das. Vielleicht, weil ich aus einer Welt komme, in der es nie irgendwelche Versprechen gab, in der ein Morgen nie erwartet oder erhofft wurde, eine Welt, in der Eltern nicht einmal zu ihrem Kind ins Krankenhaus kommen.
Was auch immer.
Ich sollte sie nicht ermutigen. Ich werde nicht lange hier sein.
Also sehe ich weg.
Ich weiß, dass sie geht, denn ich kann die Abwesenheit ihres Blickes spüren. Ich schaue wieder zur Tür, und sie ist tatsächlich gegangen.
Komischerweise fühle ich mich jetzt allein.
Ich kenne sie eigentlich nicht, aber jetzt, wo sie weg ist, fühle ich mich allein.
Ich bleibe nicht lange allein.
Ein paar Minuten später kommt ein Arzt in mein Zimmer.
»Mr. Killien«, begrüßt er mich und blättert durch seine Aufzeichnungen. »Sie hatten echtes Glück. Ihre Arterie war aufgeschlitzt, aber wir konnten das reparieren. Ihr Bein allerdings …« Er verstummt, dann konzentriert er sich wieder. »Ihr Bein wurde offensichtlich schon einmal verletzt, und das anscheinend schwer. Sie hatten mehrere Platten und Schrauben darin, vom Fuß bis zur Hüfte. Sie haben Ihr Knie heute überdehnt, aber auch das Weichgewebe um Ihren Knöchel wurde erneut beschädigt. Ich weiß, dass Sie wahrscheinlich die Nase voll haben von Physiotherapie, sie werden jedoch einiges an gewissenhafter PT brauchen, um diesen Bereich wieder zu kräftigen. Es tut mir leid.«
Seine Stimme klingt tatsächlich so, als würde es ihm leidtun, und sein Blick sagt dasselbe. Aber das macht die Neuigkeiten auch nicht besser.
»Ihr Oberschenkel braucht absolute Ruhe. Ich möchte nicht, dass die Nähte wieder aufreißen. Und Ihr Knie … vermeiden Sie vorerst jegliche Belastung. Mit der Zeit können Sie es wieder belasten, soweit es verträglich ist. Wurde Ihr Bein im Ausland verletzt?«, will er wissen. Ich sehe ihn fragend an, und er senkt den Blick.
»Ihre Tattoos. Ich nehme an, Sie sind, oder waren, Soldat.«
Ich nicke. »Ja. Mein Humvee ist explodiert, und mein Bein wurde zertrümmert. Ich brauchte monatelange Reha, um wieder laufen zu können.«
Der Arzt nickt mit grimmiger Miene. »Das dachte ich mir. Ich weiß nicht, welche Prognose ich Ihnen für dieses Mal geben soll. Nachdem Ihre frühere Verletzung so massiv war, wird der Genesungsprozess dieses Mal noch etwas schwieriger werden. Ich habe keine Zweifel, dass Sie das bewältigen, aber Sie müssen sehr gewissenhaft mit der Reha sein. Schonen Sie das Bein, kühlen Sie es und belasten Sie es nicht.«
Seine Worte sollen mich aufrichten, aber das tun sie nicht.
Stattdessen schließe ich die Augen.
»Wir schicken einen Physiotherapeuten zu Ihnen nach Hause. Wo werden Sie wohnen?«
Das ist eine gute Frage.
»Wahrscheinlich gehe ich zurück nach Hause«, sage ich schnell. Aber er schüttelt den Kopf.
»Ich möchte nicht, dass Sie irgendwohin gehen, mindestens ein oder zwei Wochen lang. Vor allem möchte ich nicht, dass Ihre Arterie belastet wird. Wir haben sie zusammengeflickt, aber wie Sie vielleicht schon wissen, ist mit Verletzungen der Oberschenkelarterie nicht zu spaßen. Ich möchte nicht, dass Sie sie durch Reisen erschüttern. Außerdem dürfen Sie diesen Fuß nicht belasten. Auf ihrem Führerschein steht eine Adresse in Connecticut. Wohnen Sie dort?«
Ich nicke. »Mein Vater ist gerade gestorben, und ich bin nur hier, um mich darum zu kümmern. Ich fahre bald wieder nach Hause.«
Doch der Arzt schüttelt schon wieder den Kopf. »Sie sollten mindestens ein paar Wochen lang hierbleiben und sich schonen. Falls möglich, sollten Sie noch länger bleiben, um das Knie auszuheilen. Sollte das absolut nicht machbar sein, dann können Sie reisen, sobald Ihre Arterie stabil verheilt ist. Aber bis dahin müssen Sie bleiben, wo Sie sind.«
Er spricht noch ein paar Dinge mit mir durch und verlässt mich dann wieder. Ich tue das Einzige, was mir einfällt.
Ich rufe Gabe an.
Als mein bester Freund und Geschäftspartner ist er mit mir durchs Feuer gegangen. Wir haben jeden Sommer zusammen verbracht, den er mit seinen Großeltern hier war, wir waren zusammen in West Point, wir sind gemeinsam zu den Rangers gegangen, und wir waren zusammen, als unser Humvee von Talibanrebellen bombardiert wurde.
Er geht beim ersten Läuten ran.
»Was gibt’s, Kumpel?«
Ich gebe ihm einen kurzen Überblick.
»Jesus«, ächzt Gabe. »Tut mir leid, Brand. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich komme mit dem nächsten Flug.«