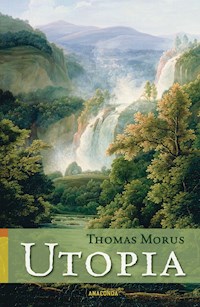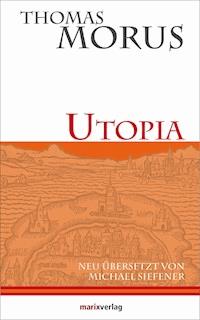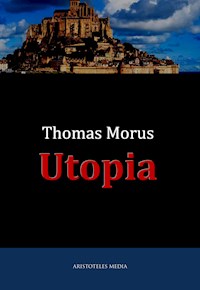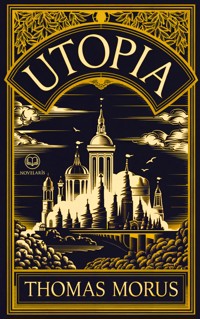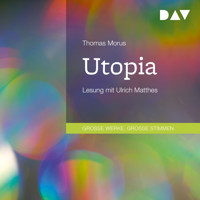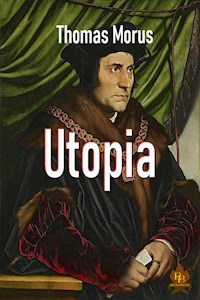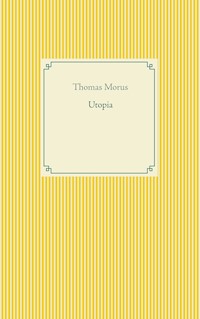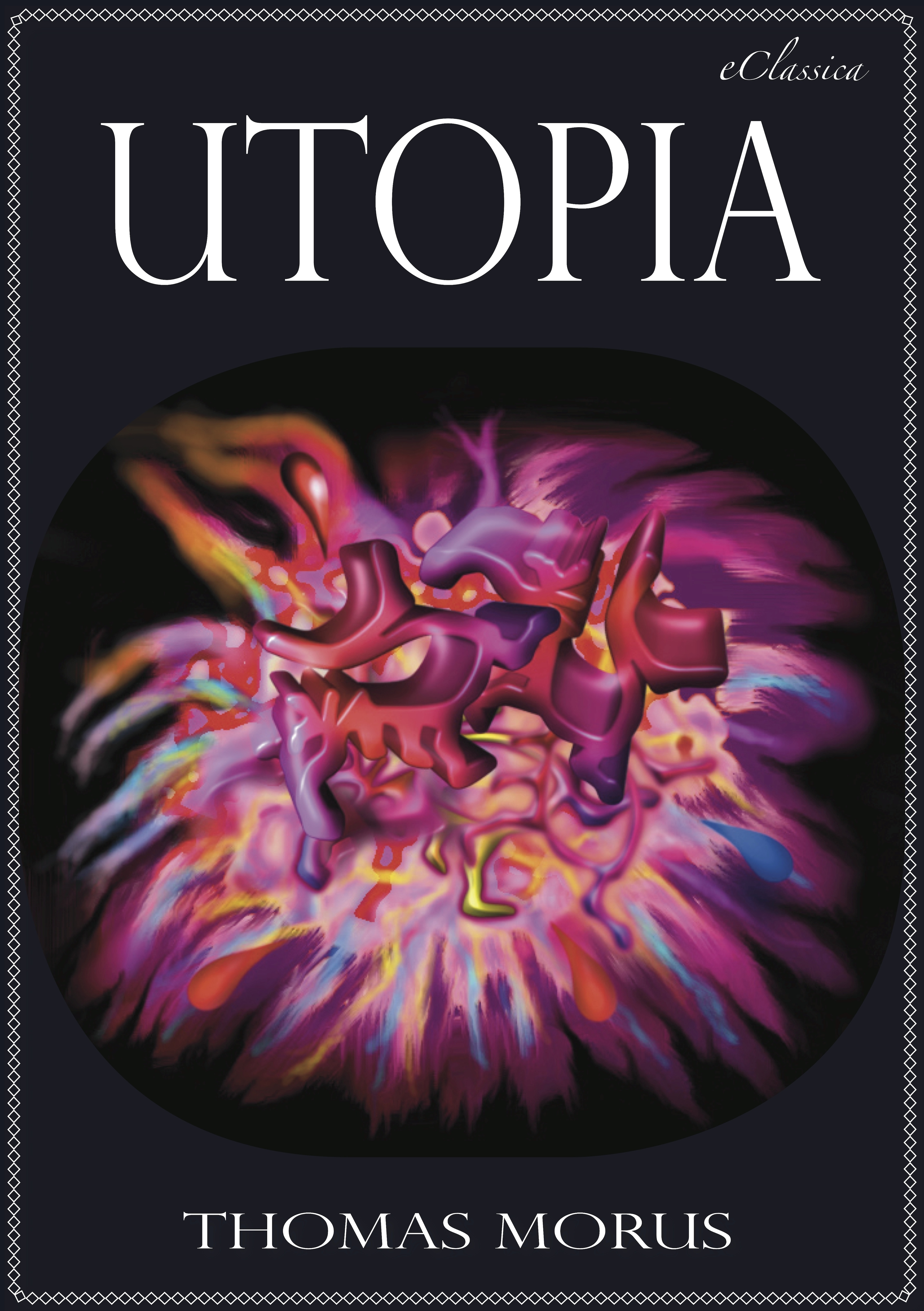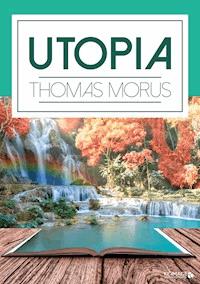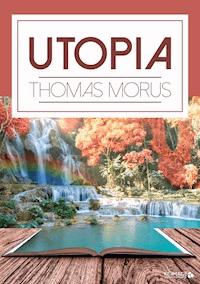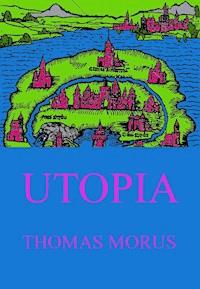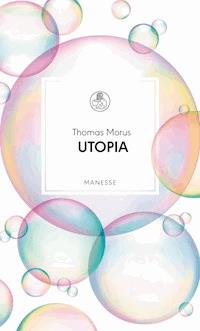
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manesse Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Manesse Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Berühmter Vorläufer von "1984" und "Schöne neue Welt"
Wohlstand und leichte Arbeit für alle, Partnerschaften ohne Konflikte und Kultur von Kindesbeinen an - so muss sie aussehen, die beste aller möglichen Welten. Nie wieder wurde über das Zusammenleben in einer Gesellschaft so menschenfreundlich fantasiert wie in «Utopia» («Nichtort»), diesem ersten Staatsroman unserer Zeit. Dabei konnte der Kontrast im 16. Jahrhundert, geprägt durch soziale Missstände, Konflikte und Kriminalität, kaum größer sein. Thomas Morus' Schilderung einer Reise zum Hort purer Harmonie war vor diesem Hintergrund auch nicht durchwegs ernst gemeint. Vielmehr kippt «Utopia» häufig ins Ironische, was den Roman zu einer noch heute ebenso anregenden wie sympathischen Lektüre macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Wohlstand und leichte Arbeit für alle, Partnerschaft ohne Konflikte und Kultur von Kindesbeinen an – so muss sie aussehen, die beste aller möglichen Welten. Nie wieder wurde über das Zusammenleben in einer Gesellschaft ähnlich menschenfreundlich fantasiert wie in diesem Roman.
«Die Utopie entwickelt sich zu dem geschichtlichen Reflex jenes Geschehens, das seit wenigen Jahrzehnten die Globalisierung heißt.» Peter Sloterdijk
Thomas Morus (1478–1535), britischer Gelehrter und hochrangiger Politiker am Hof König Heinrichs VIII., schlug 1516 mit «Utopia» («Nichtort») ein neues Kapitel in der Literaturgeschichte auf. Sein Staatsroman fand viele berühmte Fortschreibungen, darunter bis heute aktuelle Klassiker wie «1984» von George Orwell oder «Schöne neue Welt» von Aldous Huxley.
Jacques Laager ist ein in der Schweiz lebender Übersetzer aus dem Lateinischen und Griechischen. Für den Manesse Verlag übertrug er u.a. die «Legenda aurea», Pausanias’ «Beschreibung Griechenlands» und Benvenuto Cellinis «Mein Leben».
Peter Sloterdijk (geb. 1947) ist einer der bekanntesten deutschen Philosophen unserer Zeit, zudem Kulturwissenschaftler und Buchautor. Bis 2017 lehrte er an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe Philosophie und Ästhetik.
Thomas Morus
UTOPIA
Aus dem Lateinischen übersetztvon Jacques Laager
Neuausgabe
Nachwort von Peter Sloterdijk
MANESSE VERLAG
Erstes Buch
Als der unbesiegbare König Heinrich1 von England – der achte seines Namens –, der mit allen Tugenden eines vortrefflichen Fürsten ausgezeichnet ist, jüngst eine bedeutende Meinungsverschiedenheit mit Karl2 hatte, dem erlauchten Fürsten von Kastilien, schickte er mich als Gesandten3 nach Flandern, um in dieser Kontroverse zu vermitteln und sie beizulegen. Ich war Begleiter und Kollege des unvergleichlichen Cuthbert Tunstall4, den er kürzlich unter größtem Beifall aller zum Vorsteher des königlichen Archivs ernannt hatte. Zu dessen Lob werde ich jetzt nichts sagen – nicht etwa weil ich fürchtete, meine Freundschaft mit ihm beeinträchtige meine Glaubwürdigkeit als Zeuge, sondern weil seine Tüchtigkeit und Gelehrsamkeit größer sind, als ich sie zu loben vermöchte, zudem allgemein bekannter und berühmter, als dass sie des Lobes bedürften. Ich würde mir andernfalls anmaßen, die Sonne mit der Laterne zeigen zu wollen, wie es im Sprichwort heißt.
In Brügge – so war es vereinbart – trafen uns jene Leute, denen diese Aufgabe vom Fürsten anvertraut worden war: allesamt hervorragende Männer, unter ihnen, als ihr Führer und Vertreter, der Präfekt von Brügge5, ein Mann von hohem Ansehen. Ihr Sprecher und die Seele der Gesandtschaft war im Übrigen Georg Temsicius6, der Propst von Cassel, ein nicht erst durch seine Ausbildung, sondern von Natur aus redegewandter Mann, überdies ein ausgezeichneter Rechtsgelehrter, ein dank Begabung wie auch langer praktischer Erfahrung ganz hervorragender Meister im Führen von Verhandlungen. Nachdem wir mehrfach zusammengekommen waren, verabschiedeten sich jene für einige Tage von uns, da wir in gewissen Fragen keine Übereinstimmung erzielen konnten, und reisten nach Brüssel, um sich nach dem Orakel7 ihres Fürsten zu erkundigen.
Ich begab mich unterdessen nach Antwerpen – so brachten es die Geschäfte mit sich. Während meines dortigen Aufenthalts besuchte mich unter anderen – aber mir lieber als jeder andere! – Petrus Aegidius8, ein gebürtiger Antwerpener, ein Mann von großer Redlichkeit, der bei seinen Landsleuten eine ehrenvolle Stellung innehat, ja der ehrenvollsten würdig wäre. Ich wage nämlich zu bezweifeln, dass es einen gelehrteren und charaktervolleren jungen Mann gibt; vortrefflich und sehr gebildet ist er, dazu von edler Gesinnung gegenüber jedermann und Freunden gegenüber von solcher Zuneigung, Liebe, Treue und aufrichtigem Wohlwollen, dass sich kaum jemand finden ließe, den man in allen Belangen der Freundschaft mit ihm vergleichen könnte. Er ist von seltener Bescheidenheit, keinem liegt es ferner, sich zu verstellen, keiner ist verständnisvoller und aufrichtiger. Er versteht sich zudem so geistreich zu unterhalten und ist auf solch unaufdringliche Weise witzig, dass er mir durch seinen äußerst angenehmen Umgang und sein anmutiges Geplauder die Sehnsucht nach meiner Heimat und dem häuslichen Lar9, nach Gattin und Kindern zu lindern wusste; quälte mich doch, überaus ängstlich, wie ich war, das Verlangen nach einem Wiedersehen, denn zu besagtem Zeitpunkt war ich schon mehr als vier Monate fern von zu Hause.
Als ich eines Tages in der Liebfrauenkirche10, einem herrlichen, vom Volk viel besuchten Bauwerk, dem Gottesdienst beigewohnt hatte und mich danach anschickte, in meine Herberge zurückzukehren, sah ich Petrus zufällig mit einem Fremden sprechen, der schon fast das Greisenalter erreicht hatte. Sein Gesicht war sonnengebräunt, er trug einen langen Bart und einen nachlässig von den Schultern herabhängenden Reisemantel. Dem Aussehen und der Kleidung nach schien er mir ein Seemann zu sein.
Sobald mich Petrus erblickte, kam er auf mich zu, grüßte, führte mich, der ich eben den Gruß erwidern wollte, etwas abseits und sagte: «Siehst du diesen Mann da?» Zugleich wies er auf den, mit dem ich ihn im Gespräch gesehen hatte: «Eben hatte ich vor, ihn geradewegs zu dir zu führen.»
«Schon allein deinetwegen wäre er mir sehr willkommen gewesen», sagte ich.
«Er sollte es vielmehr um seiner selbst willen sein», antwortete er. «Wenn du den Mann kenntest! Unter allen Sterblichen lebt heute keiner, der dir über Menschen und unbekannte Länder so viel erzählen könnte wie er, und ich weiß doch, wie begierig du bist, solche Dinge zu hören!»
«Also lag ich nicht gänzlich daneben! Denn ich habe gleich auf den ersten Blick gemerkt, dass es sich um einen Seefahrer handelt.»
«Du hast dich gleichwohl geirrt! Gewiss fuhr er zur See, jedoch nicht wie Palinurus, sondern wie Odysseus, wenn nicht gar wie Platon!11 Das ist Raphael12, mit Familiennamen heißt er Hythlodaeus, ein der lateinischen Sprache zwar nicht unkundiger, der griechischen jedoch noch weit kundigerer Mann; er hat diese mehr als die lateinische studiert, weil er sich ganz der Philosophie gewidmet und dabei erkannt hat, dass es im Lateinischen auf diesem Gebiet außer einigen Schriften von Seneca und Cicero nichts von wirklicher Bedeutung gibt. Nachdem er sein häusliches Erbteil seinen Brüdern überlassen hatte, schloss er sich – er ist nicht umsonst Lusitaner13 – voller Begierde, die Welt zu sehen, Amerigo Vespucci14 an und war auf den drei letzten von jenen vier Seefahrten, über die bereits überall zu lesen ist, dessen ständiger Begleiter. Von der letzten Fahrt kehrte er jedoch nicht mit ihm zurück. Er sorgte vielmehr dafür, ja trotzte es Amerigo geradezu ab, dass er zu jenen vierundzwanzig Männern gehörte, die gegen Ende der Seereise im Kastell15 zurückgelassen wurden. Dort blieb er, gehorchte seinem inneren Trieb und sorgte sich mehr um das Reisen als um sein Grab, führte er doch ständig Sprüche im Mund wie ‹Wer keine Urne hat, den deckt der Himmel zu› und ‹Der Weg zu den Göttern ist von überall gleich weit›.16 Wäre ihm Gott nicht gnädig beigestanden, ihn wäre diese Einstellung recht teuer gekommen! Nach der Abreise von Vespucci hat er zusammen mit fünf Begleitern aus dem Kastell viele Gegenden durchstreift und wurde schließlich durch einen wunderbaren Zufall nach Taprobane17 verschlagen; von dort aus gelangte er nach Kalikut18, wo er ganz mühelos lusitanische Schiffe ausfindig machte, und so fuhr er schließlich wider Erwarten in seine Heimat zurück.»
Das also erzählte Petrus. Ich dankte ihm, dass er sich mir gegenüber so gefällig gezeigt und in Erwägung gezogen hatte, mich in den Genuss eines Gesprächs mit einem Mann zu bringen, dessen Gesellschaft mir – wie er hoffte – angenehm wäre.
Ich wandte mich also an Raphael, und nachdem wir uns gegenseitig begrüßt und die üblichen Höflichkeitsfloskeln ausgetauscht hatten, die beim ersten Zusammentreffen von Gästen gewöhnlich geäußert werden, gingen wir alle gemeinsam zu meinem Wohnsitz, wo wir uns im Garten auf einer Rasenbank niederließen und uns zu unterhalten begannen.
Er erzählte uns, wie er und seine Gefährten, die nach Vespuccis Abreise im Kastell zurückgeblieben waren, nach und nach das Wohlwollen der Stämme jenes Landes gewannen, indem sie sich mit ihnen trafen und ihnen schmeichelten, und wie sie bald nicht nur unbehelligt, sondern sogar freundschaftlich mit ihnen verkehrten. Vor allem seien sie einem Fürsten, dessen Land und Name mir entfallen sind, lieb und teuer geworden. Dank seiner Freigebigkeit, so erzählte er weiter, seien ihm und seinen Gefährten reichlich Proviant und alles zu einer Reise Notwendige geschenkt worden. Dazu ein für die Reise, die sie zu Wasser mit Flößen und zu Land mit Wagen unternahmen, äußerst zuverlässiger Führer, der sie noch zu anderen Fürsten bringen sollte, die sie, in so gebührender Weise empfohlen, aufsuchen konnten. Nach mehreren Tagesreisen hätten sie kleine und auch große Städte erreicht sowie Staaten mit zahlreicher Bevölkerung, die durchaus nicht schlecht organisiert gewesen seien.
Unterhalb des Äquators, in beide Richtungen ungefähr so weit, wie der Umlauf der Sonne an Gebiet umfasst, lägen allerdings Einöden, die von der ständigen Glut ausgetrocknet seien – weit und breit nichts als Unwirtlichkeit, ein trauriger Anblick, alles schauerlich und unbebaut, nur von wilden Tieren und Schlangen bewohnt, schließlich auch von Menschen, die aber nicht weniger roh, nicht weniger gefährlich als wilde Tiere seien. Reise man dagegen etwas weiter, zeige sich alles allmählich freundlicher, das Klima sei weniger rau, der Boden wegen seines Grüns gefällig, die Lebewesen sanfter. Endlich zeigten sich Völker, große und kleine Städte, die zu Wasser und zu Land regen Austausch pflegten, und zwar nicht nur untereinander und mit ihren direkten Nachbarn, sondern auch mit in weiter Ferne gelegenen Völkern.
So habe sich für ihn die Möglichkeit ergeben, diesseits und jenseits des Äquators viele Länder zu besuchen, da kein Schiff zu einer Reise gerüstet habe, auf dem er und seine Begleiter nicht mit großem Wohlwollen aufgenommen worden seien. Die Schiffe, die sie in den zuerst bereisten Regionen sahen, wiesen – wie er erzählte – einen flachen Kiel auf und Segel, die aus zusammengenähten Papyrusstängeln und miteinander verflochtenen Weideruten bestanden, anderswo auch aus Leder. Später hätten sie freilich auch spitze Kiele vorgefunden, Segel aus Hanf und schließlich solche, die völlig den unsrigen glichen.
Die Seeleute seien des Meeres und Wetters nicht unkundig. Aber gar wunderbare Gunst habe er sich dadurch erworben, dass er ihnen den Gebrauch der Magnetnadel19 beigebracht habe, die sie vordem nicht kannten. Aus diesem Grunde sei ihr Umgang mit dem Meer behutsam gewesen, und sie hätten sich ihm zu keiner anderen Zeit als im Sommer anvertraut. Jetzt hingegen unterschätzten sie, im Vertrauen auf den Magnetstein, die Unbill des Winters geradezu sorglos, sodass etwas, das ihrer Ansicht nach nur Gutes habe bewirken sollen, aus Leichtsinn womöglich großes Unglück verursache.
Zu erzählen, was er nach eigenen Worten an jedem Ort gesehen hat, würde zu weit führen, auch liegt dies nicht in der Absicht dieses Werkes. Wir werden vielleicht an anderer Stelle davon berichten können, vor allem von dem, was zu wissen von Nutzen sein könnte, und insbesondere auch von all den trefflichen Einrichtungen, die er da und dort bei Völkern erlebt hat, die in bürgerlicher Eintracht leben. Danach fragten wir besonders begierig, und auch er selbst sprach davon am liebsten, während wir von Ungeheuern, über die er kaum Neues zu berichten hatte, nichts wissen wollten. Denn Monstren wie die Skylla und die raubgierige Kelaino, die menschenfressenden Laistrygonen20 und andere schreckliche Scheusale dieser Art gibt es wohl fast überall – nicht jedoch Bürger mit einem vernünftigen und klugen Staatswesen!
Übrigens: Wie er bei vielen dieser neu entdeckten Völker auch völlig Ungereimtes vorfinden musste, so zählte er gleichwohl nicht weniges auf, das als gutes Beispiel dienen könnte, um Missstände in unseren Städten, Nationen, Völkern und Reichen zu beheben. Doch soll davon – wie ich bereits gesagt habe – an anderer Stelle die Rede sein. Fürs Erste habe ich die Absicht, nur das zu berichten, was Hythlodaeus von den Sitten und Institutionen der Utopier erzählt hat, wobei ich allerdings zunächst das Gespräch vorausschicken will, in dem wie zwangsläufig jener Staat erwähnt wurde.
Nachdem Raphael nämlich sehr klug irrige Verhaltensweisen aufgezählt hatte, die bald hier, bald dort existieren – und auf beiden Seiten gibt es derer sehr viele! –, dann aber auch solches erwähnt hatte, das mal bei uns, mal aber auch bei jenen vernünftiger geregelt ist, und da er Sitten und Institutionen eines jeden Volkes so genau kannte, als ob er bei jedem sein ganzes Leben verbracht hätte, sagte Petrus voller Bewunderung: «Wahrhaftig, mein lieber Raphael, ich frage mich, warum du dich nicht von einem König anstellen lässt! Ich bin mir sicher, dass es unter diesen keinen gibt, dem du nicht in hohem Grade willkommen wärst, bist du doch imstande, sie mit deinem Wissen und deinen Kenntnissen von Land und Leuten nicht nur zu unterhalten, sondern auch mit entsprechenden Beispielen zu belehren und ihnen mit deinem Rat zu helfen. Auf diese Weise könntest du dich selbst und all deine Angehörigen vortrefflich versorgen.»
«Was die Meinigen betrifft», entgegnete er, «so mache ich mir keine großen Gedanken, glaube ich doch, mein Pflichtteil ihnen gegenüber einigermaßen geleistet zu haben. Denn worauf andere erst als Greise und Kranke verzichten – und auch dann nur missmutig, weil sie nicht länger daran festhalten können –, das habe ich bei voller Gesundheit und Lebenskraft und bereits in jungen Jahren an meine Verwandten und Freunde verteilt. Ich glaube, sie sollten mit dieser meiner Freigebigkeit zufrieden sein und nicht darüber hinaus verlangen und erwarten dürfen, dass ich mich ihretwegen zum Knecht von Königen mache.»
«Vortrefflich gesprochen», sagte Petrus, «doch scheint mir, du solltest nicht in Diensten, sondern zu Diensten der Könige sein.»21
«Das», entgegnete da jener, «unterscheidet sich lediglich um zwei Buchstaben von ‹in Diensten›!»
«Ich meine es aber so», sagte Petrus. «Du magst es nennen, wie du willst: Gerade das wäre der Weg, auf dem du privat wie öffentlich nicht nur anderen nützen, sondern auch deine eigene Lage glücklicher gestalten könntest.»
«Glücklicher?», fragte Raphael. «Und das auf einem Weg, vor dem ich meiner ganzen Überzeugung nach zurückschrecke? Jetzt lebe ich so, wie ich will, und ich vermute sehr, dass dies unter Purpurträgern nur sehr wenigen gelingt! Von solchen, die sich eifrig um die Freundschaft der Mächtigen bemühen, gibt es ja genug, daher sollte es niemand für einen großen Verlust halten, wenn sie auf mich oder den einen und andern meinesgleichen verzichten müssen.»
Darauf entgegnete ich: «Es ist offensichtlich, dass du weder nach Reichtum noch nach Macht gierst, mein lieber Raphael, und ich verehre und bewundere einen Menschen deiner Geisteshaltung nicht weniger als irgendeinen unter den Mächtigsten. Gleichwohl scheint mir, du würdest etwas tun, das deinem Charakter und deiner hochherzigen und wahrhaft philosophischen Gesinnung würdig wäre, wenn du dich dazu durchringen könntest, dein Talent und deinen Fleiß – selbst wenn dies mit einigen persönlichen Nachteilen verbunden wäre – der Allgemeinheit zu widmen. Und das könntest du mit gleichem Gewinn, wie wenn du zu den Ratgebern irgendeines großen Fürsten gehörtest und diesen – was sicherlich der Fall wäre – richtig und ehrenhaft berietest. Denn von einem Fürsten ergießt sich wie aus einer nie versiegenden Quelle ein Sturzbach von Gutem und Bösem gleichermaßen über das ganze Volk! Du besitzt, selbst wenn ihr große praktische Erfahrung fehlen sollte, eine so vollkommene Gelehrsamkeit und obendrein so große Sachkenntnis in allem, dass du dich auch ohne jegliche Unterweisung für jeden König als vortrefflicher Berater erweisen würdest.»
«Du irrst dich doppelt, mein lieber Morus: zunächst in mir, dann in der Sache. Denn ich besitze die Fähigkeiten, die du mir unterstellst, gar nicht, und selbst wenn sie in hohem Maße vorhanden wären, würde ich dem Staat doch nichts nützen, nicht einmal dann, wenn ich meine Muße in Geschäftigkeit22 verwandelte. Zunächst einmal interessieren sich die meisten Fürsten nämlich mehr für militärische Dinge23 – in denen ich keine Erfahrung habe und auch keine zu haben wünsche – als für die gedeihlichen Künste des Friedens. Sorgen sie sich doch weit mehr darum, wie sie – zu Recht oder Unrecht – neue Reiche für sich erwerben, als wie sie das bereits Erworbene gut verwalten können! Abgesehen davon gibt es unter allen königlichen Ratgebern keinen, der nicht entweder wahrhaftig so gescheit ist, dass er überhaupt keines anderen Menschen Rat bedarf, oder zumindest so viel zu verstehen glaubt, dass er den Rat eines anderen nicht billigen möchte; jedem noch so törichten Ausspruch stimmen sie zu und pflichten nach Schmarotzerart denen bei, die sie für sich gewinnen wollen, weil sie besonders hoch in der Gunst des Fürsten stehen. Es gilt ja von Natur aus die Regel, dass jeder seine eigenen Einfälle gut findet. Und so sagt dem Raben sein eigenes Junges am meisten zu, und auch dem Affen gefällt der eigene Sprössling am besten!
Wenn aber aus jener Rotte von Leuten, die andere grundsätzlich beneiden und immer ihre eigene Meinung bevorzugen, einer etwas vorbringt, was er entweder über frühere Zeiten gelesen oder was er anderswo gesehen hat, so gebärden sich seine Zuhörer, als wenn der Ruf ihrer Weisheit in Gefahr stünde und sie nach alledem für völlig dumm zu halten wären – es sei denn, sie finden etwas, das sie an den Einfällen der anderen kritisieren können. Und wenn sie schon sonst nichts auszusetzen haben, flüchten sie sich in Aussagen wie: ‹So war es unsern Vorfahren genehm – wenn wir nur ihre Klugheit hätten!›, und wenn sie das gesagt haben, setzen sie sich wieder, als wäre die Angelegenheit gründlich durchbesprochen worden! Als stellte es eine große Gefahr dar, wenn jemand in einer Angelegenheit klüger als seine Vorfahren wäre! Und wo wir doch gleichzeitig allem, was die Vorfahren bestens erdacht hatten, ganz gelassen Lebewohl sagen. Hätte freilich etwas klüger angeordnet werden können, so greifen wir sofort leidenschaftlich danach und halten verbissen daran fest! Bin ich oft anderswo auf solch hochmütige, ungereimte und eigensinnige Urteile gestoßen, so ganz besonders einmal in England.»
«Wie? Du bist bei uns gewesen?», warf ich ein.
«Ja, das war ich. Ich habe sogar einige Monate dort verbracht, und zwar nicht lange nach jener Niederlage, in der der Bürgerkrieg der westlichen Engländer gegen den König in einem jammernswerten Blutbad erstickt worden ist.24 Ich verdankte während dieses Aufenthalts viel dem sehr ehrwürdigen Vater Johannes Morton25, dem Kardinal und Erzbischof von Canterbury, der damals auch Kanzler von England war. Einem Mann, mein lieber Petrus – dem Morus werde ich damit ja nichts Neues erzählen –, von großem Ansehen, besonders verehrungswürdiger Klugheit und Tugend. Er war von mittlerer Statur, ließ sich sein schon fortgeschrittenes Alter nicht anmerken und hatte einen Gesichtsausdruck, den man verehren, nicht fürchten musste. Im Umgang mit anderen war er keineswegs zurückhaltend und behielt trotzdem seinen Ernst und seine Würde bei. Es machte ihm Freude, Bittsteller bisweilen etwas härter anzufassen – ohne ihnen freilich schaden zu wollen –, um dadurch in Erfahrung zu bringen, wes Geistes einer sei und welche Geistesgegenwart er an den Tag lege, ein Wesensmerkmal, an dem er sich wie an einem ihm selbst eigenen Charakterzug freute und das er zur Führung von Staatsgeschäften für geeignet einschätzte – wenn nur keine Unverschämtheit mit im Spiel war. Seine Rede war gebildet und wirkungsvoll. Er besaß große Rechtskenntnis, hatte generell ein unvergleichliches Talent und zeichnete sich durch ein an ein Wunder grenzendes Gedächtnis aus. Die von Natur aus vortrefflichen Geistesgaben bildete er durch Studium und Übung noch weiter aus. Zu der Zeit, da ich dort war, schien der König seinen Ratschlägen Vertrauen zu schenken und der Staat sich auf ihn zu verlassen. Er war schon in früher Jugend an den Hof gebracht worden, hatte sich während seines ganzen Lebens mit sehr wichtigen Staatsgeschäften abgegeben, war von der Brandung des Schicksals hin und her geworfen worden und hatte sich in vielen gefährlichen Situationen große Lebenserfahrung angeeignet, die, auf solche Weise erworben, nicht so leicht wieder verloren geht.
Als ich eines Tages bei ihm zu Tisch saß, war auch ein in euren Gesetzen Kundiger – ein Laie – anwesend. Welche Gelegenheit er genau zum Anlass nahm, weiß ich nicht mehr, doch begann er die strenge Justiz zu loben, die damals dort gegen Diebe vorging und die, wie er erzählte, mancherorts nicht selten fast zwanzig Mann gleichzeitig an einen Galgen hängen ließ. Er erklärte, er wundere sich, welch übles Verhängnis daran schuld sei, dass sich überall so viele Diebe herumtreiben könnten – obwohl eigentlich nur wenige der Hinrichtung entkämen.
Da sagte ich – konnte ich es doch wagen, vor dem Kardinal frei zu reden: ‹Du brauchst dich gar nicht zu wundern! Eine solch harte Bestrafung für Diebe überschreitet jedes Maß an Gerechtigkeit, und der Allgemeinheit nutzt sie auch nicht. Es ist eine zu grausame Strafe für Diebstahl, und um ihn in Schranken zu halten, taugt sie ebenfalls nicht. Denn ein einfacher Diebstahl ist gewiss kein so ungeheures Verbrechen, das verdiente, mit dem Tode bestraft zu werden. Andererseits ist keine Strafe so groß, dass sie die Menschen vor Räubereien abhielte, die keine andere Möglichkeit haben, sich den Lebensunterhalt zu verschaffen. Es sieht fast so aus, als würdet in dieser Angelegenheit nicht nur ihr, sondern ein beträchtlicher Teil der Menschen dieses Erdkreises die schlechten Lehrer nachahmt, welche die Schüler lieber schlagen als unterrichten. Da werden für Diebe schwere und schreckliche Strafen beschlossen, obwohl man weit eher dafür sorgen sollte, dass sie genug zum Lebensunterhalt haben. Denn niemand sollte es grausamerweise nötig haben, zunächst zu stehlen, nur um dann zu sterben.›
‹Dafür›, sagte er, ‹ist gesorgt. Es gibt handwerkliche Berufe, es gibt den Ackerbau, und von beidem kann man sein Leben fristen. Es sei denn, man will mit voller Absicht lieber schlecht sein!›
‹So kommst du mir nicht davon!›, entgegnete ich. ‹Lassen wir zunächst einmal die beiseite, die von im In- und Ausland geführten Kriegen nicht selten als Krüppel nach Hause zurückkehren – wie neulich eure Leute aus der Schlacht von Cornwall oder, vor nicht langer Zeit, aus dem Krieg mit den Franzosen: Menschen, die ihre Glieder für den Staat oder für den König gegeben haben und denen ihre Verkrüppelung nicht gestattet, ihr früheres Handwerk auszuüben oder deren Alter es nicht zulässt, ein neues zu erlernen. Wie gesagt: Diese wollen wir beiseitelassen, da ja Kriege nur von Zeit zu Zeit auftreten. Betrachten wir lediglich das, was sich Tag für Tag ereignet! Da gibt es zum Beispiel zahlreiche Adlige, die nicht nur wie Drohnen26 träge von der Arbeit anderer leben, die sie zum Beispiel als Pächter auf ihren Ländereien zwecks Vermehrung ihrer eigenen Einkünfte bis aufs Blut schinden. Sie kennen nämlich nur diese eine Art des Wirtschaftens; im Übrigen sind sie Menschen, die ihre eigene Verschwendung fast an den Bettelstab bringt. Sie führen eine gewaltige Schar müßiger Trabanten mit sich, die nie einen Beruf erlernt haben, um damit ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Stirbt ihr Herr, oder werden sie selbst krank, wirft man die Pächter unverzüglich hinaus, denn lieber ernährt man Nichtstuer als Kranke. Oft ist der Erbe nicht imstande, für den Unterhalt der väterlichen Dienerschaft zu sorgen. Jene hungern sich unterdessen unentwegt durch, falls sie nicht ebenso mutig zu Räubern werden. Was sollen sie auch tun? Haben sie nämlich erst einmal durch stetes Herumtreiben ihre Kleidung verschlissen und ihre Gesundheit zerrüttet, geruhen die Adligen keinesfalls, die von Krankheit und Schmutz Gezeichneten und in Lumpen Gehüllten bei sich aufzunehmen. Und auch die Bauern wollen dieses Wagnis nicht eingehen, wissen sie doch nur zu gut, dass einer, der in Muße und Üppigkeit aufgezogen wurde und gewohnt war, ausgerüstet mit Schwert und Schild, mit dünkelhafter Miene auf seine Mitmenschen herabzublicken und alle, außer sich selbst, zu verachten, auf keinen Fall bei geringem Lohn und karger Ernährung mit Hacke und Haue einem Armen dienen wird!›
Darauf erwiderte jener Gast: ‹Und doch müssen wir gerade diese Menschen ganz besonders hegen und pflegen. Denn auf ihnen, auf Menschen mit weit höherer Gesinnung, als sie Handwerkern und Bauern zu eigen ist, beruhen Kraft und Stärke eines Heeres, wenn man sich im Krieg zu messen hat!›
‹Wahrhaftig›, sagte ich, ‹genauso könntest du behaupten, die Diebe seien des Krieges wegen zu hegen und pflegen. Solange es jene gibt, werdet ihr zweifellos auch daran nie Mangel haben. Denn weder sind Räuber feige Soldaten, noch sind die Soldaten unter den Räubern die trägsten – so ähnlich sind sich diese Berufe! Aber so häufig dieses Laster bei euch auch ist, so ist es trotzdem nicht für euch allein charakteristisch, sondern vielmehr allen Völkern gemein.
Frankreich bedroht noch eine andere, noch verheerendere Pest: Das ganze Land ist selbst zu Friedenszeiten – wenn dort überhaupt einmal Frieden herrscht – belagert von Soldaten, die sich aus derselben Überzeugung heraus zum Kriegsdienst haben locken lassen, mit der ihr hier glaubt, müßige Helfershelfer ernähren zu müssen. Den Narrweisen27 schien nämlich das öffentliche Wohl nur dann sicher zu sein, wenn zu allen Zeiten eine mächtige und starke Truppe – vor allem von Veteranen – bereitsteht. Sie haben keinerlei Vertrauen in Ungeübte, sodass sie Krieg anzetteln müssen, nur um keine unerfahrenen Soldaten zu haben; sodass sie nach Menschen suchen müssen, die grundlos abgeschlachtet werden können, nur damit den Soldaten – wie Sallust geistreich bemerkt28 – Hand und Sinn infolge Muße nicht zu erlahmen beginnen. Doch welch schlimme Folgen es zeitigt, wenn man sich wilde Tiere dieser Art zieht, hat Frankreich zu seinem eigenen Schaden gelernt, und auch die Beispiele der Römer, Karthager, Syrer und so vieler anderer Völker zeigen das ganz klar. Ihre eigenen Bereitschaftsheere haben nicht nur die Herrschaft all dieser Völker, sondern auch deren Äcker und Städte zu jeder Gelegenheit verwüstet. Wie wenige von ihnen dazu nötig sind, wird auch aus der Tatsache ersichtlich, dass sich nicht einmal die französischen Soldaten – obwohl sie von Kindesbeinen an im Umgang mit Waffen geübt sind – rühmen können, aus dem Kampf mit euren von Fall zu Fall aufgebotenen Truppen allzu oft als Sieger hervorgegangen zu sein – mehr will ich darüber gar nicht sagen, um nicht den Anschein zu erwecken, als wollte ich euch hier Anwesenden schmeicheln. Aber es ist nun einmal nicht anzunehmen, dass eure städtischen Handwerker oder eure naturwüchsigen und derben Bauern die müßigen Trabanten der Adligen allzu sehr fürchten, abgesehen vielleicht von denen, deren körperliche Verfassung Gewalt und Wagemut kaum zulassen, oder deren Mut infolge häuslicher Not gelähmt ist. So besteht also keine Gefahr, dass Menschen, deren Körper gesund und kräftig sind – die Adligen geruhen nämlich nur ausgesuchte Leute zu verderben! –, infolge Nichtstun erschlaffen, durch fast schon weibische Tätigkeiten verweichlichen oder gar verweiblichen, wenn sie in einem guten, dem Lebensunterhalt dienenden Beruf geschult und in männlicher Arbeit geübt sind. Wie auch immer sich die Sache verhält, so scheint es mir dem Staat auf keinen Fall zuträglich zu sein, im Hinblick auf einen Krieg – den ihr ja nur habt, wenn ihr ihn wollt – eine unendliche Schar von Leuten solcher Art zu unterhalten. Das gefährdet ja nur den Frieden, um den man sich weit mehr bemühen sollte als um Krieg. Trotz alledem ist dies nicht der einzige Grund zum Stehlen. Es gibt noch einen anderen, der – wie ich glaube – bei euch zutrifft!›
‹Welchen denn?›, fragte der Kardinal.
‹Eure Schafe›, sagte ich, ‹die doch so sanft zu sein und mit so wenig ernährt zu werden pflegten! Neuerdings sind sie – so heißt es – so gefräßig und zügellos, dass sie die Menschen selbst verschlingen, die Felder, Häuser und Städte verwüsten und plündern. Denn in all jenen Gegenden des Königreichs, in denen feinere und daher teurere Wolle produziert wird, sind Leute aus dem hohen und niederen Adel, auch einige Äbte – heilige Männer29 – nicht mehr zufrieden mit dem jährlichen Ertrag, wie er ihren Vorfahren aus ihren Gütern zu erwachsen pflegte. Es genügt ihnen auch nicht, dass sie in Muße und vornehm leben, der Öffentlichkeit nichts nützen – ja ihr sogar schaden! Sie lassen keinen Platz mehr für Ackerland, alles hegen sie für Weideland ein, reißen Wohnhäuser nieder und verwüsten Dörfer, nachdem sie lediglich die Kirchen zur Nutzung als Schafställe haben stehen lassen – als ob Jagdgründe und Tiergehege bei euch nicht schon genug Land verschwendeten! So haben jene großartigen Leute alle Wohnungen und was es allerorts an bebautem Land gab, in eine Einöde verwandelt.
Damit also ein einziger Prasser, unersättlich und eine grässliche Pest für sein Land, nach Zusammenlegung von Ackerland einige Tausend Morgen mit einem einzigen Zaun umgeben kann, werden die Pächter verjagt, mit Tücke hintergangen oder mit Gewalt unterdrückt, werden ihrer Habe beraubt oder durch allerlei widerrechtliches Verhalten zum Verkauf gezwungen. So oder so, die Unglücklichen wandern aus: Männer, Frauen, Ehemänner und deren Gattinnen, Waisen, Witwen, Eltern mit ihren kleinen Kindern, zusammen mit einer mehr zahlreichen als wohlhabenden Familie, wie viel Hände eben die Landwirtschaft benötigt. Sie verlassen also wie gesagt ihre gewohnten und vertrauten Laren und finden keinen Ort, wo sie sich zurückziehen könnten. Den gesamten Hausrat, der ohnehin nicht teuer abgesetzt werden kann, verschachern sie, selbst wenn man noch auf einen anderen Käufer warten könnte, da man ihn loswerden muss, zum niedrigsten Preis. Wenn sie diesen Erlös auf ihrer Irrfahrt in kürzester Zeit aufgebraucht haben, was bleibt ihnen dann anderes übrig, als zu stehlen und schließlich – versteht sich: mit Recht – am Galgen zu hängen oder ein Vagantenleben zu führen und zu betteln? Selbst dann werden sie indes als Vagabunden in den Kerker geworfen, denn sie streichen ja ohne Arbeit herum, da sich niemand findet, der sie beschäftigt, mögen sie sich noch so sehr anbieten. Schließlich gibt es da, wo nicht gesät wird, auch keine Landwirtschaft, auf die sie sich verstehen. Genügt doch ein einziger Schaf- oder Rinderhirte, um das Land vom Vieh abweiden zu lassen, zu dessen Bestellung sonst viele Hände erforderlich sind. Und so kommt es, dass der Getreidepreis inzwischen vielerorts um einiges höher ist. Ja selbst der Preis für Wolle ist so sehr gestiegen, dass Minderbemittelte, die bei euch gewöhnlich in der Tuchherstellung beschäftigt sind, sie sich überhaupt nicht mehr leisten können. Nicht wenige Leute sind deswegen zum Nichtstun verdammt.
Nach dem Vergrößern der Weidefläche raffte eine Seuche eine ungeheure Menge von Schafen hinweg, so als wollte Gott durch die über die Schafe verhängte Krankheit die Gier jener rächen, auf die sich die Rache gewiss gerechterweise hätte entladen sollen. Mag die Zahl der Schafe noch so sehr zunehmen: Der Preis sinkt trotzdem kein bisschen. Kann man in diesem Zusammenhang zwar nicht von einem Monopol sprechen, da es ja nicht nur einer allein ist, der Schafe verkauft, so doch gewiss von einem Oligopol30. Die Schafe gehören ja nur einigen wenigen, und das sind reiche Leute, die nichts zwingt, früher zu verkaufen, als ihnen beliebt. Und es beliebt ihnen nicht, bevor sie nicht in der Lage sind zu verkaufen, für wie viel es ihnen beliebt.31 Das hat auch zur Folge, dass die übrigen Viehsorten ebenfalls teuer geworden sind – dies umso mehr, da sich nach Zerstörung der Dörfer und Schwächung der Landwirtschaft niemand mehr um die Nachzucht sorgen kann. Denn jene Reichen kümmern sich um die Aufzucht von Großvieh deutlich weniger als um die der Schafe, vielmehr verkaufen sie von anderswoher billig erworbenes Magervieh um einen hohen Preis weiter, nachdem es auf ihren Weiden fett geworden ist. Meiner Ansicht nach hat man nur deshalb die schädlichen Auswirkungen dieses Sachverhalts noch nicht wahrgenommen, weil sie das Fleisch bislang nur an jenen Plätzen verteuern, an denen sie es gerade verkaufen. Sollten sie aber über eine lange Zeit hinweg das Vieh schneller wegschaffen, als es nachgezüchtet werden kann, dann wird man notwendigerweise auch an dem Ort, an dem es aufgekauft wird, bei allmählich sinkendem Bestand erheblichen Mangel leiden. So hat die ruchlose Gier einiger weniger gerade die Schafzucht, durch die eure Insel ja ganz besonders reich schien, in Unheil gestürzt. Schließlich ist die Teuerung des Lebensunterhaltes schuld daran, dass jeder so viele Leute als möglich aus seiner Dienerschaft entlässt – und wohin, frage ich, außer zum Betteln oder, wozu man Gemüter mit größerem Heldenmut eher überreden kann, zur Räuberei? Und was soll man dazu sagen, dass dieser elenden Armut und Not eine rücksichtslose Genusssucht gegenübersteht? Denn nicht nur bei den Dienern der Adligen und den Handwerkern, sondern fast schon bei den Bauern und schließlich bei allen Ständen wird viel unverschämter Aufwand an Kleidung betrieben und herrscht übermäßige Verschwendung beim Lebensunterhalt. Nicht zu reden von den Garküchen, von Spelunken, Bordellen und bordellähnlichen Orten wie Kneipen, Weinschenken und Bierlokalen, schließlich allen verdorbenen Belustigungen wie Würfel- und Kartenspielen, Würfelbecher32, Ball- und Kugelspiel sowie Scheibenwerfen. Treibt nicht all dies seine Anhänger, wenn sie ihr Geld erst einmal verzehrt haben, geradewegs in den Diebstahl?
So rottet denn diese verderblichen Seuchen aus, verordnet, dass diejenigen, die Höfe und Dörfer zerstört haben, diese wieder aufbauen oder denen überlassen müssen, die sie instand setzen oder neu errichten! Schränkt diese Aufkäufe der Reichen ein, nehmt ihnen die Möglichkeit, gleichsam ein Monopol auszuüben! Weniger Leute sollten sich vom Müßiggang ernähren können, die Landwirtschaft sollte belebt, die Verarbeitung von Wolle neu angegangen werden. Auf dass es wieder eine anständige Beschäftigung gibt, die jene träge gewordene Schar zu ihrem Nutzen ausüben kann – Menschen, welche die Not bislang hat Diebe werden lassen oder die momentan noch Vagabunden oder dem Müßiggang ergebene Diener sind und erst in naher Zukunft zu Dieben werden. Wenn ihr diesem Übel nicht entgegensteuert, dann brüstet ihr euch wohl vergeblich eurer Gerechtigkeit, die ihr bei der Bestrafung von Diebstählen ausübt – einer Gerechtigkeit, die mehr durch äußeren Schein blendet, als wirklich gerecht und nutzbringend zu sein: Sofern ihr es nämlich zulasst, dass Menschen so schlecht erzogen werden und ihr Charakter vom zarten Alter an allmählich verdorben wird, offenbar um sie erst dann zu bestrafen, wenn sie als Männer jene Schandtaten an den Tag legen, die sie bereits von Kindheit an erwarten ließen – nun, ich bitte euch: Was tut ihr denn anderes, als dass ihr sie zunächst zu Dieben macht, dann aber bestraft?›
Noch während ich so sprach, hatte jener Rechtsgelehrte sich bestens auf seine Replik vorbereitet und sich vorgenommen, feierlich wie jene Disputierenden vorzugehen, die lieber von anderen Gesagtes wiederholen, als Eigenes entgegnen und folglich einen nicht geringen Teil ihres Ruhmes ihrem Gedächtnis verdanken.
‹Wahrhaftig›, begann er, ‹das hast du ganz nett vorgetragen, obwohl du ja eigentlich ein Fremder bist, der von diesen Dingen mehr dem Hörensagen nach weiß, als dass er darin Erfahrung hätte, was ich in wenigen Worten klar beweisen werde. Indem ich zuerst der Reihe nach durchgehen werde, was du dargelegt hast, und dann zeigen will, warum die Unkenntnis unserer Verhältnisse dich zu falschen Schlüssen verleitet hat; schließlich werde ich sämtliche von dir aufgeführten Argumente widerlegen und zunichtemachen.33 Ich beginne also, wie versprochen, beim ersten Punkt: Du schienst mir vier …›
‹Schweig!›, sagte da der Kardinal. ‹Wenn du schon so