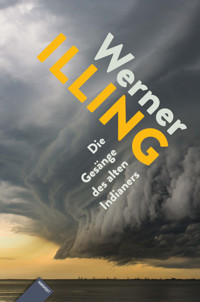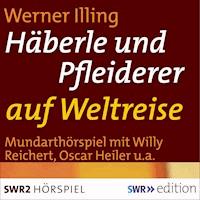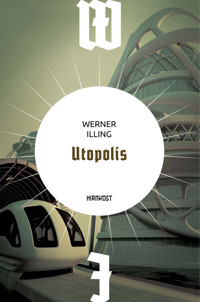
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hirnkost
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Wiederentdeckte Schätze der Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Werner Illings (1895–1979) Roman "Utopolis" erschien erstmals 1930 in der sozialdemokratischen Buchgemeinschaft »Der Bücherkreis« und zählt zu den wenigen deutschen Science-Fiction-Romanen der Zwischenkriegszeit, die keine revanchistische und antidemokratische Haltung an den Tag legen, sondern eine Zukunft oder eine Alternativwelt von einem sozialistischen Standpunkt aus beschreiben und zugleich Verhältnisse und Personen der Weimarer Republik karikieren. Dieses Alleinstellungsmerkmal und die literarische Qualität machen die Alternativweltgeschichte des Filmemachers, Autors und Journalisten auch heute noch zu einem der wahren Klassiker der deutschen Science Fiction, der nicht in Vergessenheit geraten darf. Der 8. Band der Edition "Wiederentdeckte Schätze der deutschsprachigen Science Fiction" enthält zusätzlich zum Klassiker eine Auswahl von Erzählungen dieses Ausnahmeautors.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Originalausgabe
© 2025 Hirnkost KG, Lahnstraße 25, 12055 Berlin;
[email protected]; http://www.hirnkost.de/
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage März 2025
Die Erstauflage des Romans erschien 1930 im Verlag Der Bücherkreis, Berlin.
Verlag und Herausgeber danken Herrn Dr. Joachim Ruf, dem Nachlassverwalter Werner Illings, für die angenehme und sehr engagierte Zusammenarbeit.
Vertrieb für den Buchhandel:
Runge Verlagsauslieferung; [email protected]
Privatkunden und Mailorder:
https://shop.hirnkost.de/
Herausgeber: Hans Frey † 2024, Klaus Farin
Lektorat: Klaus Farin
Korrektorat: Christian W. Winkelmann
Layout: benSwerk: www.benswerk.com
E-Book: Hardy Kettlitz
ISBN:
PRINT: 978-3-98857-072-7
PDF: 978-3-98857-074-1
EPUB: 978-3-98857-073-4
Hirnkost versteht sich als engagierter Verlag für engagierte Literatur.
Mehr Infos: www.hirnkost.de/der-engagierte-verlag
Dieses Buch erschien als Band VII der Reihe »Wiederentdeckte Schätze der deutschsprachigen Science Fiction«. Alle Titel und weitere Informationen finden Sie hier: https://shop.hirnkost.de/produkt/schaetze/
Werner Illing . 1895 – 1979
Werner Illing, geboren in Chemnitz, war Schriftsteller, Drehbuchautor und Filmregisseur. Er studierte Medizin und Germanistik in Leipzig und Graz. Bereits in dieser Zeit verfasste er Gedichte, Geschichten, Erzählungen und Dramen. 1921 erschien seine erste PublikationVor Tagmit Gedichten und Erzählungen.
1922 brach er sein Studium ab, weil sein Vater gestorben war, und übernahm die elterliche Marmor- und Baumittelhandlung in Chemnitz. In seiner Freizeit war er weiterhin schriftstellerisch tätig, gründete einen Sprech- und Bewegungschor und arbeitete an der Chemnitzer Volksbühne u.a. mit Mary Wigman. 1925 gab er den Geschäftsführerposten in der Firma auf und wurde freier Mitarbeiter derVossischen Zeitung, 1928/29 als Auslandskorrespondent des Blattes in der Provence und in Paris. Seit 1927 war er zudem Mitarbeiter derMitteldeutschen Rundfunk AG. Er übersetzte für den Ullstein Verlag sechs Romane von Ellery Queen aus dem Englischen. In dieser Zeit verfasste er auch den RomanUtopolis, der als »proletarische Utopie« viel Beachtung fand.
1939 bis 1945 leistete Illing Kriegsdienst, um nicht in die Kulturpropaganda eingespannt zu werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog er nach Stuttgart um, war ab 1949 hauptsächlich für denSüddeutschen Rundfunktätig und schrieb auch Bühnenstücke (Die große Flut, 1947) sowie Drehbücher. Seine KurzgeschichteDer Herr vom anderen Sterndiente als Grundlage für das Drehbuch zum gleichnamigen Film mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle.
Werner Illing war Mitglied des deutschen PEN-Clubs, Präsident der Bundesvereinigung der deutschen Schriftstellerverbände sowie Vorsitzender des Süddeutschen Schriftstellerverbandes. 1979 starb er im Alter von 84 Jahren in Esslingen am Neckar, wo er seit 1958 lebte.
Zuletzt bei Hirnkost:die gesänge des alten indianers.
benSwerk
geboren 1970, lebt in Berlin. Studierte Werbegrafik und freie Kunst. Wenn sie nicht für Hirnkost layoutet, porträtiert sie das kleine Volk und andere Wesenheiten der Anderswelt, ersinnt Orakelkarten oder gestaltet andere Bücher – mit Vorliebe in den Bereichen WeirdFiction oder Phantastik. www.benswerk.com
Emil Fadel
geboren 1992, studierte an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz Germanistik und Filmwissenschaften sowie weiterführend Deutsche Literatur. In seinen Abschlussarbeiten behandelte er das dramatische und publizistische Werk des deutsch-jüdischen Exilliteraten Ernst Toller. 2014 wurde sein Roman-ManuskriptSchnittblumen machen mich traurigmit dem Martha-Saalfeld-Preis ausgezeichnet. Emil Fadel lebt in Wiesbaden und arbeitet als freier Lektor beim Frankfurter Westend-Verlag.
Klaus Farin
geboren 1958 in Gelsenkirchen, lebt seit 1980 – Punk sei Dank – in Berlin-Neukölln. Nach Tätigkeiten als Konzertveranstalter und -Security, Buchhändler und Journalist nun freier Autor und Lektor, Aktivist und Vortragsreisender. Bis heute hat Farin 29 Bücher verfasst und weitere herausgegeben, zuletzt gemeinsam mit Rafik Schami: Flucht aus Syrien – neue Heimat Deutschland? und mit Eberhard Seidel: Wendejugend. Er ist Vorsitzender der Stiftung Respekt! und ehrenamtlich Geschäftsführer des Hirnkost Verlags. Weitere Infos: https://klausfarin.de/ueber-klaus-farin/biographie.
Hans Frey
*1949 – † 2024, Germanist, Lehrer und Ex-NRW-Landtagsabgeordneter, war in seinem »dritten Leben« Autor und Publizist. Seine Spezialität war die Aufarbeitung der Science Fiction. Er veröffentlichte ein umfangreiches Werk über Isaac Asimov, das Sachbuch Philosophie und Science Fiction und Monographien über Alfred Bester, J. G. Ballard und James Tiptree Jr. Seit 2016 arbeitete er an einer Literaturgeschichte der deutschsprachigen SF. Vier Bände sind bislang bei Memoranda erschienen. Für die ersten beiden Bände erhielt er den Kurd Laßwitz Preis 2021.
Joachim Ruf
geboren 1943 in Esslingen am Neckar. Studium der Medizin in Bonn, anschließend als Arzt in eigener Allgemeinpraxis tätig.
Werner Illing lernte er in den 1970er Jahren in Esslingen-Wiflingshausen kennen. Dieser wohnte nicht weit von seinem Elternhaus entfernt.
Christian W. Winkelmann
geboren 1963, studierte Geschichte, Publizistik und Skandinavistik, bereiste zwischendurch und anschließend die halbe Welt, wirkte 20 Jahre als Privatlehrer und ist heute in Berlin im Verlagswesen tätig. Er schrieb u. a. Bücher über Erfindungen und Kultur der deutschsprachigen Länder sowie Brasilien.
Inhalt
Zum Geleit
Vorwort von Hans Frey
Utopolis
Kurzgeschichten von Werner Illing
Nachwort von Joachim Ruf
Zum Geleit
Wir leben in einer Gegenwart des radikalen Umbruchs, der alle Bereiche der menschlichen Zivilisation durchdringt. Die Probleme scheinen uns über den Kopf zu wachsen. Wir brauchen kluge Ideen, tragfähige Lösungen, vielleicht sogar Utopien, die neue Perspektiven aufzeigen.
Vielleicht ist es gerade in dieser aufwühlenden Situation auch hilfreich, einmal innezuhalten und zurückzublicken. Denn vieles, was uns heute beschäftigt, ist nicht wirklich neu. Schon vor über einhundert Jahren machten sich Autoren und Autorinnen Gedanken über das Klima, über Armut, Wohnen, Ernährung und das Bildungssystem, ob und inwieweit Technik einen Motor für den Fortschritt oder eine existenzielle Gefahr darstellen kann (beispielsweise Atomkraft, Geoengineering, Gentechnik). Vor allem die Autoren und Autorinnen der einst »Zukunftsliteratur« genannten Science Fiction entwarfen wie in keinem anderen Genre gesellschaftliche Utopien und Dystopien, die noch heute so gegenwärtig wirken, als wären sie gerade erst entstanden. Sie sind trotz oder vielleicht gerade wegen ihres oberflächlich antiquiert wirkenden Charmes heute noch mit Gewinn und Genuss zu lesen. Vierzig Perlen aus der deutschsprachigen Science Fiction möchte Ihnen diese Edition im Laufe der nächsten Jahre präsentieren.
Jedes Buch der Edition enthält den Roman selbst sowie in einigen Fällen ergänzende Texte der jeweiligen Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Umrahmt werden die Originaltexte von einem Vorwort namhafter Autoren und Autorinnen der Gegenwart und einem historisch-analytischen Nachwort von anerkannten Expertinnen und Experten, das vornehmlich die literaturhistorischen und zeitgeschichtlichen Hintergründe des Textes beleuchtet.
Parallel zur gedruckten Version erscheinen ePubs in allen Formaten und Vertriebsoptionen, die in der Regel zusätzliche ergänzende Materialien (etwa dazugehörige weitere Romane, Sachbücher und Essays der Autoren und Autorinnen, zeitgenössische Rezensionen und andere Leserstimmen sowie weitere Analysen) enthalten und so vor allem für die wissenschaftliche Beschäftigung eine wertvolle Bereicherung darstellen. Damit werden nicht nur die Originaltitel wieder einem größeren Lesepublikum zugänglich gemacht, sondern auch der Forschung in bislang einzigartiger Weise sowohl historisches Quellenmaterial als auch aktuelle Analysen aufbereitet zur Verfügung gestellt.
Besonderen Wert legen wir auf die Gestaltung. Auch sie soll zum Lesen einladen, denn die von uns herausgegebenen Werke haben es allemal verdient, neue Leser und Leserinnen zu finden. So werden die Werke nicht einfach als Faksimile reproduziert, sondern komplett neu Korrektur gelesen und gesetzt.
Wir, der Verleger Klaus Farin (*1958) und der Herausgeber Hans Frey (*1949), beide Sachbuchautoren, kennen uns schon seit Jugendjahren. Wir stammen beide aus dem Herzen des Ruhrgebiets, aus Gelsenkirchen, engagier(t)en uns für eine bessere, gerechtere Gesellschaft und sind seit unserer Jugend leidenschaftliche Science-Fiction-Leser. Als wir uns nach Jahren zufällig in Berlin wiedertrafen, wurden sofort Pläne geschmiedet. Angeregt durch die deutschsprachige SF-Literaturgeschichte von Hans Frey im Memoranda Verlag wurde die Idee geboren, eine langfristig angelegte Reihe mit wichtigen, aber fast vergessenen Originaltexten der deutschsprachigen Science Fiction zu veröffentlichen.
Aus dieser Idee ist Realität geworden. Die Reihe leistet einen wesentlichen Beitrag zur lebendigen Aufarbeitung und Bewahrung bedeutender Werke der deutschsprachigen SF. Zudem ist sie ein einzigartiges Dokument für die Vielfalt und Vielschichtigkeit des über die Jahre gewachsenen Genres.
Wahr bleibt indes auch: Ohne engagierte Leser und Leserinnen, die die Bücher kaufen und sich an ihnen erfreuen, kann das Projekt nicht gelingen. Empfehlen Sie es bitte weiter. Abonnieren Sie die Reihe. Wir unterbreiten Ihnen ein verlockendes Angebot. Greifen Sie zu!
Hans Frey, Klaus Farin
Vorwort
Utopolis oder Die wunderbare Arbeiterrepublik Vorwort von Hans Frey
Der Schriftsteller, Drehbuchautor und Regisseur Werner Illing (1885 – 1979) war kein originärer SF-Autor. Das verblüfft umso mehr, weil er ausgerechnet mit einer sozialistischen SF-Utopie, die gleichzeitig das Loblied einer sich ungestüm entwickelnden, als segensreich empfundenen Wissenschaft und Technik singt, seinen größten Autorenerfolg erzielte und damit neben Ri Tokkos Das Automatenzeitalter (1930) die wohl bedeutendste Utopie der Weimarer Republik vorlegte.
Von Werner Illing gibt es im engeren Genrebereich nur die Erzählung Der Herr vom andern Stern von 1948 (mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle verfilmt) und den ungleich berühmteren sozialistischen SF-Roman Utopolis (1930). Diese Auftragsarbeit der sozialdemokratischen Buchgemeinschaft DIE BÜCHERFREUNDE erfreute sich direkt bei Erscheinen eines großen Zuspruchs, blieb aber letztlich in ihrer Wirkung auf das Umfeld der SPD beschränkt. Nach der Machtübernahme durch die Nazis bereitete ihm sein Buch wenig überraschend erheblichen Ärger, und nur mühsam konnte sich Illing den braunen Fängen entziehen. Ähnlich wie Erich Kästner „überwinterte“ er im Schreckensregime, um ab 1946 vor allem als Rundfunkjournalist und Drehbuchautor wieder Fuß zu fassen.
Neben vielen Bezügen, Anspielungen und Gedankenspielen, die das Buch durchziehen und die es wert wären, im Einzelnen analysiert zu werden, möchte ich nur einige, aber wichtige Aspekte herausstellen. Ein Vorwort soll ja auch nicht überstrapaziert werden.
An Utopolis berühren sowohl die liebevolle Ausmalung des marxistischen Arbeiterstaats „Utopien“ als auch die Darstellung der Exzesse in „U-Privat“, dem Bezirk der alten Kapitalisten, in dem sie noch schalten und walten können, wie sie wollen. Bezeichnend ist aber auch die Naivität, mit der Illing den „neuen“ Menschen ebenso wie den Konflikt zwischen den Kapitalisten und den Sozialisten schildert. Selbst im sozialistischen Binnenverhältnis kann sich Illing offensichtlich nur schwer vorstellen, dass die Arbeiter aus internen Konflikten heraus mit ihrer Führung querliegen könnten. Da bedarf es schon eines „Hypnosesenders“, den die Ausbeuter gegen den Staat Utopien einsetzen, um die aufrechten Arbeiter vom richtigen Weg abzubringen.
Aus heutiger Sicht kann diese holzschnittartige Konstruktion des Romans kaum überzeugen. Es darf aber nicht vergessen werden, dass der Roman zu seiner Zeit großes Aufsehen erregte, weil er eine der wenigen marxistischen Utopien war, die es wagten, mehr als nur vage Andeutungen über die neue Gesellschaft zu machen. Insofern mag er auch für so manchen sozialdemokratisch oder kommunistisch gesinnten Arbeiter in der Weimarer Republik eine ideologische Stärkung gewesen sein. Nicht zu übersehen ist die starke utopische Kraft, die das Werk ausstrahlt. Von deren Macht bekommen selbst heutige Leser:innen noch einiges mit.
Wichtig ist, dass Illing immer wieder aktuelle Fragen aufgreift. So arbeitet er z. B. die innerhalb der damaligen Arbeiterbewegung erbittert geführte Kontroverse über Reform oder Revolution belletristisch auf. Obwohl er einen klaren Standpunkt bezieht, der sich ganz eindeutig am klassischen Marxismus orientiert, bleibt er human und intellektuell redlich, weil er auch die Argumente der Reformer würdigt. Sie liegen zwar aus seiner Sicht falsch, werden aber nicht als „Verräter“ oder „Verbrecher“ gebrandmarkt. Illing bezieht eine linkssozialdemokratische Position und grenzt sich damit vom SPD-Revisionismus ebenso ab wie von den totalitären Stalinisten der KPD.
Literarisch ist Utopolis bemerkenswert, weil der Roman – wieder einmal – die oft wiederholte Behauptung widerlegt, dass ein nach den Regeln des Unterhaltungsromans geschriebenes Werk nicht in der Lage sei, Inhalte und Botschaften eines seriösen Themas zu vermitteln – in diesem Fall die Auseinandersetzung über Gesellschaftsmodelle. Im Rahmen seiner legitimen Fiktionalität belegt Utopolis das Gegenteil.
Angesprochen werden soll noch eine in gewisser Weise innerdeutsche Angelegenheit, die sich mit dem Roman verbindet. Es gehört zu den Merkwürdigkeiten der DDR und ihrer SF-Szene, das Illing und Utopolis dort konsequent ignoriert wurden. Mag man gerade wegen des Inhalts spontan glauben, sie seien bevorzugt behandelt worden – so wie es ja auch bei Bernhard Kellermanns Der Tunnel (1913) der Fall gewesen war –, so stellt sich das schnell als Irrtum heraus. Um diese Eskapade besser verstehen zu können, muss die Vorgeschichte erzählt werden.
Die Science Fiction war nach Meinung des kommunistischen Dogmas lange Jahre pauschal eine in sich verkommene, imperialistisch-faschistische Literatur. Deshalb wurde die DDR-SF, die es natürlich auch gab, mit dem Begriff der „wissenschaftlichen Phantastik“ von der vermeintlich dunklen Zwillingsschwester im Westen abgegrenzt. Indes kamen intelligentere und sachkundigere Kenner der Materie im sozialistischen Lager nicht um die Tatsache herum, dass es vor und während des Kalten Krieges durchaus westliche SF-Autoren gab, denen eine Wertschätzung nicht abgesprochen werden konnte – so z. B. Jules Verne, H. G. Wells, Aldous Huxley, Isaac Asimov oder Ray Bradbury. Diese waren zwar alles andere als Kommunisten, aber man musste doch zugeben, dass sie trotzdem in das offizielle Schwarzweißbild imperialistischer Hetzer nicht hineinpassten. Deutsche Autoren wie Kurd Laßwitz, Kurt Karl Doberer oder eben Werner Illing passten ebenfalls nicht hinein.
Die Ächtung durch die DDR verwundert namentlich bei Illing, bewegte er sich doch mit Utopolis eindeutig in einem marxistischen Umfeld. Des Rätsels Lösung liegt wohl in der begründeten Vermutung, dass er den SED-Zensoren immer noch zu sozialdemokratisch war. Da bekanntlich Konflikte, die in einem gemeinsamen Ursprung wurzeln, zu besonders harten und unversöhnlichen Kämpfen führen, wurde die „Abweichung“ stärker bestraft als eine von vornherein existierende Gegnerschaft. Illing wurde nicht gewürdigt, geschweige denn gemocht, und seine Arbeit erschien nie in den Buchhandlungen der DDR.
Nichtsdestotrotz ist Utopolis eines der wichtigsten Werke der fortschrittlichen Weimarer Social Science Fiction.1 Dennoch muss es immer wieder dem Vergessen entrissen werden. Das geschah bislang lediglich durch zwei Neuauflagen: einmal 1974 bei Fischer in einem unansehnlichen Taschenbüchlein und 2005 beim Shayol Verlag mit einem aufwendigen Hardcover-Band. Die Hirnkost-Ausgabe, die Sie jetzt in Händen halten, gehört, wenn ich es unbescheiden, aber nicht unbegründet sagen darf, zu der editorisch schönsten und kompetentesten Auflage, die es bislang zu Utopolis gegeben hat.
Illings Fantasie einer erfolgreichen Umsetzung der marxschen Vision in ein rundum gut funktionierendes sozialistisches Gemeinwesen ist ein ebenso kurzweiliges wie bedeutendes Werk, das beeindruckt und zurecht die Zeiten überdauert hat. In der Bilanz ist Illings Text ein Leuchtturm in einer stürmischen Zeit und repräsentiert die „gute“ SF in der literarischen Weimarer Republik. Zu oft wurde unterschlagen, dass auch und gerade in der Weimarer Science Fiction keineswegs nur Elaborate des reaktionären Modernismus mit mehr oder weniger klaren faschistischen Elementen auf den Markt geworfen wurden, sondern es gab einen nennenswerten Anteil passabler bis bedeutender SF-Werke, die sich ausdrücklich einer demokratisch-republikanischen Tradition verpflichtet fühlten und diese offensiv vertraten.2
Indes wohnt Utopolis und seiner Werkgeschichte ein tragischer Zug inne. Als das Buch erstmalig veröffentlicht wurde, war der Kampf in Illings Sinn bereits verloren. Ein Monster machte sich breit, und das hatte seinen propagandistischen Ausdruck unter anderem schon 1926 in Thea von Harbous Roman Metropolis gefunden.
1) Social Science Fiction nenne ich den Teil der SF, der sich in Utopien und Dystopien schwerpunktmäßig mit den politisch-sozialen Aspekten einer zukünftigen Gesellschaft befasst.
2) In meinem Buch Aufbruch in den Abgrund habe ich dies detailliert nachgewiesen.
Utopolis
1
Als ich die Augen aufschlug, begriff ich endlich, dass ich nicht als stiller Mann zwischen Seegras und Meerdisteln umhertrieb, ein Tischleindeckdich für Krebse und Aale. Über mir war blauer Himmel. Eine frische Brise klatschte mir die nassen Kleiderfetzen an den Leib.
Ich fror wie ein junger Hund. Sprang auf, um mir Bewegung zu machen.
Zehn Schritt weit lag ein armseliger Lumpenhaufen, um einen Holzbalken gewickelt. Armer Kamerad! Es ist ein verteufelter Scherz des Schicksals, einen Schiffbrüchigen, nachdem er ertrunken ist, an Land zu werfen.
Ich trat näher.
Der Tote schnarchte fürchterlich.
Ich schüttelte ihn wie einen Baum, von dem man unreife Pflaumen abschütteln will. Endlich ließ er den hölzernen Notanker fahren, tastete mit vorsichtigen Händen in den trocknen Sand, setzte sich auf, rieb sich die Augen, gähnte, blickte mich ohne Erstaunen an und brummte:
»Hast du wat to essen?«
Da spürte ich, dass ich anstelle des Magens ein schwarzes, leeres Loch hatte.
Hein sah mit Interesse, wie ich mir die Fäuste in den hohlen Bauch drehte, seufzte und wusste Bescheid.
»Los!«, kommandierte er.
Wir rappelten uns zusammen hoch und erkletterten die nächste Düne. Etwa fünftausend Schritt vor uns lag an der Bucht eine Stadt von ansehnlicher Größe.
Hein nickte zufrieden und sagte mit der Sicherheit eines Menschen, der sich auf seine Ortskenntnis verlassen kann:
»Stimmt!«
Wir trotteten mühsam am Strand entlang, in der Hoffnung, noch diesen oder jenen unserer Kameraden auflesen zu können. Damit war es leider nichts.
Unvermittelt standen wir plötzlich in einer breiten Straße. Kein Mensch ließ sich blicken, in der Ferne sausten Autos und bogen schwarmweise um die Ecken.
Wir suchten nach einem Bäcker- oder Fleischerladen und hofften, durch unseren jammernswerten Aufzug eine Mahlzeit zu erbetteln. Die schönen bunten Häuser, jedes einen Straßenblock breit, zeigten uns weder Schaufenster noch Ladeneingänge noch Reklamen.
»Junge, Junge«, Hein kratzte sich hinterm Ohr, »dat is ’ne stinkfeine Gegend, ’ne Art Uhlenhorst mit lütten Wolkenkratzern – bloß für’n Sonntag.«
Er spuckte kräftig aus und meinte, wenn das ’n orntlicher seebefahrener Ort wäre, müsse sich ein Seemannsheim finden lassen.
Wir schleppten uns mühsam weiter in der Hoffnung, dass die vornehmen Paläste abbröckeln und in schmale dunkle Proletarierbudiken übergehen würden, wo man versteht, wie es armen Teufeln zumute ist, denen das Salzwasser näher war als Erbsensuppe mit Speck.
Es blieb aber, wie wir es angetroffen hatten, und unsere Verzweiflung wuchs. Ich schlug vor, Fensterscheiben einzuschmeißen, dann würde man sich schon um uns kümmern. Aber womit? Die Straßen waren mit Gummi gepflastert und reinlich und wir merkten auf Schritt und Tritt, dass wir nicht hineingehörten, denn die blitzblanke Sauberkeit verhöhnt allzu nüchterne Mägen. Als wir so in die Luft guckten, weil von dort die guten Gedanken kommen, sahen wir über der Straßenkreuzung elegant geschwungene Brücken, die die flachen Dächer der Häuser miteinander verbanden. Dort oben in sechs oder mehr Stock Höhe gingen Menschen spazieren, das war deutlich zu erkennen. Hein missbilligte diese wunderliche Einrichtung und fand sie verdächtig, trichterte aber doch seine Hände vor den Mund und schrie:
»Ahoi!«
Bevor eine Antwort herunterkam, schlug uns ein neuer Schrecken in die Glieder. Es jagte nämlich ein Wagen heran, völlig geräuschlos und so schnell, dass uns keine Zeit blieb, beiseitezuspringen. Feierabend, dachte ich und überließ das Weitere der Unfallstatistik. Aber kaum zwei Meter vor uns wich das Fahrzeug aus und hielt so rasch und sanft, als wäre es gegen einen Berg von Watte gerannt.
Drei Männer in weißen Hosen und Sandalen kletterten heraus. Sie sahen aus, als hätten sie gut gefrühstückt und wollten nun zum Tennisplatz fahren, um sich Appetit für das Mittagessen zu machen. Sie bewegten sich wie Leute, die der Not den Rücken zukehren, frei und ohne Zwang. Ihr Auto – wirklich hatte ich noch nirgendwo einen so prächtigen Wagen gesehen – verströmte Millionärsgeruch, obwohl es nicht nach Benzin roch.
Sie schimpften nicht etwa, weil wir ihnen den Weg versperrt hatten, sondern lachten freundlich und schüttelten uns die Hände. Was sie dabei sprachen, verstanden wir nicht, aber es klang angenehm. Ehe wir recht zum Bewusstsein kamen, hatten sie uns im Auto verstaut. Wir sausten los, ohne dass jemand das Steuerrad hielt, flitzten um Ecken, wichen andern ebenso feinen Kraftkutschen aus, niemand hupte ...
Wir saßen steif und starr vor Angst, während die drei Herren, die uns zu dieser Spazierfahrt im Rekordtempo eingeladen hatten, sorglos wie Kinder lächelten und sich nicht im Geringsten darum kümmerten, dass die wild gewordene Maschine mit uns durchging.
Hein stieß mich leise an und flüsterte misstrauisch zwischen den Zähnen, ohne den Kopf zu drehen:
»Dat gefällt mich nich, Korl – dat is ’n gemeingefährlicher Jux. Keen Taifun schlägt mir in die Kaldaunen, aber dat Geschunkel in die Achterbahn bekömmt mich nich.«
– Und er war blass im Angesicht.
Wir fuhren durch ein Tor. Im Innenhof des Hauses schraubte sich die Straße wie ein ausgebohrtes Gewinde von Stockwerk zu Stockwerk. Dicht unterm Himmel hielten wir und durften aussteigen. Die Tennisspieler fassten uns unter die Arme, das hieß, wir sollten mit ihnen gehen. Heins Muskeln zuckten unter dem zerschlissenen Wollschwitzer. Ich riet ihm aber ab, schon jetzt handgreiflich zu werden, die Leute sähen nicht wie Bösewichter aus, auch mache eine allzu schnelle Faust am Kinn des Nachbarn keinen guten Eindruck. Da bezwang er sich. Das war zu unserm Vorteil. Wir traten in einen großen Speisesaal mit langen, weiß gedeckten Tafeln. Blumen waren zierlich zwischen den Tellern ausgestreut. Ich hatte Ähnliches in großen Hotels von außen durch die Fenster gesehen. Während wir den Ort musterten, rückten auf einem blanken Metallband inmitten des Tisches Schüsseln an, aus denen es dampfte. Wir sahen und hörten nichts mehr, die Welt hatte nur noch durch die Nasenlöcher Zutritt zu unserm Innern. Die Schüsseln machten vor uns halt und öffneten ihre silbrigen Deckel. Uns wurde schwach in den Knien, da saßen wir schon auf den Stühlen.
Es war uns anfangs peinlich, in Anwesenheit so sauber gekleideter Leute, die sich so bequem und wohlhabend in ihren Gebärden hielten, unsern Hunger zu stillen. Aber wir gewöhnten uns rasch, zumal noch einige Gerichte heranschwebten und uns niemand die Bissen in den Mund zählte. Die drei Leute in Tennisanzügen freuten sich über unsern Appetit – später staunten sie. Wir schnallten an die drei- oder viermal den Leibgurt nach. Endlich lehnten wir uns in die Sessel zurück und fühlten uns leiblich neu geboren.
Den Rosinenkuchen ließen wir unversehrt. Wir gedachten ihn als Proviant an uns zu nehmen, aber die Gelegenheit war gegen uns, mindestens einer von den dreien hatte immer ein Auge auf uns, wenn auch nur zufällig.
Wir reckten und dehnten uns, wobei unversehens Hein seinen Dank für die reichliche Mahlzeit kurz, aber sehr heftig zum Ausdruck brachte. Wir erschraken peinlich, traten doch gerade in diesem Augenblick einige sehr schöne junge Frauen durch die Tür, denen dieses unbedachte Geräusch nicht entgangen war. Sie waren indessen nicht beleidigt, sondern lachten und vermieden es nur, unsere Nähe zu suchen, wie auch die drei Tennisspieler, ohne uns zu verjagen, heiter blieben und lediglich einige Schritte zurückwichen.
Nachdem sie der Natur ihre Zeit gelassen hatten, schüttelten sie uns wie guten Freunden die Hände und gingen. Bezahlt hatten sie nicht, wir erwarteten mit einiger Besorgnis den Kellner. Stattdessen winkte uns eine von den Damen. Weil wir jedoch nicht glauben konnten, dass es uns galt, drehten wir die Köpfe weg. Sie kam näher, berührte unsere Schultern mit ihren feinen Händen und redete sehr zutraulich. Obwohl wir es nicht verstanden, merkten wir doch, dass wir mit ihr gehen sollten. Wir wussten keinen Grund, ihr diesen Wunsch zu verweigern, denn sie war sehr hübsch, nur etwas zu mager, meinte Hein.
Wir folgten ihr in den Fahrstuhl, sausten abwärts, trabten durch einige gekachelte Gänge und kamen in einen weiten hellen Raum. In dem großen runden Wasserbecken inmitten der Halle schwammen und plantschten Männer und Frauen. Badehosen trug niemand, aber sie bewegten sich trotzdem ganz natürlich und waren sehr lustig. Sie spielten wie schöne Tiere, freuten sich an der Gewandtheit ihrer prächtig geformten Leiber. Scheele Blicke auf das Besondere, das wir verhüllen, als wäre es krank und böse, sah ich nicht. Es blieb uns jedoch vorerst nicht viel Gelegenheit, uns zu wundern, da uns die Dame vor zwei Duschen führte und bedeutete, wir sollten uns ausziehen. Wir zierten uns aus Anstand. Sie glaubte aber, wir hätten sie nicht verstanden, und fing ohne Weiteres an, mir die Kleider zu lösen. Hein fand sich schneller in die Lage.
»Denn man tau!«, rief er, fuhr flink aus der alten Schale und ließ das Wasser über sich hinbrausen.
Das Fräulein nickte ihm munter zu. Dann besah es uns vom Kopf bis zu den Füßen, als wollte es uns auswendig lernen. Hein meinte, es sei an der Zeit, sich der Dame gefällig zu erweisen, und pikte sie mit dem Finger in die Seite. Sie wich aus ohne Zorn, vielmehr wusste sie nicht, was Hein mit dieser Zärtlichkeit bekunden wollte – die Sitten in diesem Land waren eben sehr verschieden von den unsern, das zeigte sich immer deutlicher –, raffte unsere alten Klamotten zusammen, winkte uns beruhigend zu und verschwand.
Wir säuberten uns in Eile, während mir Hein seine Erfahrungen in gewissen japanischen Dampfbädern mitteilte. Sie ließen sich jedoch nicht ohne Weiteres auf die Verhältnisse übertragen, die wir hier angetroffen hatten. Vieles blieb rätselhaft.
Wir trockneten uns über einem Fußbodengitter, aus dem warme Luft strömte und uns wohlig umhüllte. Die Dame kam zurück und trug weiße Wäsche auf den Armen, in die wir uns kleiden mussten, auch gab sie uns Sandalen aus weichem, weißem Gummi. Alles passte wie auf Maß gemacht, und ich meinte, dass Heins Vermutungen bezüglich der kritischen Musterung unserer bloßen Männlichkeit falsch gewesen seien. Er stimmte mir zögernd bei. Wir sahen jetzt aus wie die Mannschaft einer Luxusjacht in den kurzärmligen, am Hals weit offenen Hemden aus feinem Zeug und den breiten Hosen. Hein befühlte den Stoff zwischen den Fingern und behauptete, er übertreffe die beste indische hausgewebte Bergwolle und er werde einen Ballen davon mitnehmen, wenn der Baas einen Vorschuss auf die Heuer herausrücken würde, denn wir hofften Schiffsarbeit zu finden.
Indessen fasste uns das Fräulein an den Händen, als ob wir Kinder wären, und führte uns in den Hof, wo viele Autos von der gleichen Art standen wie das, mit dem wir in dieses gastliche Haus gekommen waren. Wir mussten eins besteigen, das Mädchen machte sich am Vordersitz zu schaffen, wo der Lenker zu sitzen pflegt, sprang aber in dem Augenblick, als der Wagen anzog, heraus, rief uns einen Gruß zu und entschwand unseren Blicken, weil das Fahrzeug in die Straße einbog und wie der Teufel abging.
»Dat der Chauffeur vorn in der Blechschnauze bei ’n Motor eingesperrt is, dat is ’ne polizeiwidrige Menschenschinderei«, brummte Hein, »un dat beweist mich, dat hier wat nich stimmen kann mit die Freundlichkeit.«
Ich mochte das nicht glauben, zumal der Vorderkasten schmächtiger war als gewöhnlich und kaum ein Kind hätte aufnehmen können. Freilich wusste auch ich keine Erklärung.
Geheuer war uns nicht. Mir fielen Geschichten ein von verkapptem Sklavenhandel, die ab und zu durch die Zeitungen zogen. Hein bestätigte meinen Verdacht:
»Mit ’n strammet Essen geiht dat an und bi die Fremdenlegschon hört et af, und ick will’n armstarkes Tauende fressen, wenn wir nich im Rekrutendepot vor Anker geihn un morgen Griffe kloppen.«
Trotz des Wohlgefühls in unseren Mägen trübten sich unsere Gedanken. Am liebsten wären wir von Bord gegangen, aber die Maschine flitzte wie ein Pfeil durch die breiten Alleen. Gewaltsam aus dem Leben zu scheiden war später immer noch Zeit.
Wir tauchten in ein sehr hohes und stattliches Gebäude ein, kurvten etliche Schraubengänge empor und hielten vor einer offenen Säulenhalle, durch die man in der Ferne das Meer blauen sah. Schon trat ein Mann zu uns heran mit derselben freimütigen Höflichkeit, die uns alle anderen bisher erwiesen hatten. Er sprach uns auf Deutsch an.
»Folgt mir bitte«, sagte er langsam und mit fremdartigem Einschlag. »Joll möchte euch sprechen.«
Das überraschte uns so heftig, dass wir zu fragen vergaßen; auch ging er rasch vor uns her, öffnete ein Zimmer und schob uns über die Schwelle.
»Ein wenig warten.«
Er deutete auf die bequemen Stühle, lächelte und ließ uns allein.
Der Raum war nach einer Seite offen und ging, wie es schien, auf einen breiten Balkon hinaus. Ein mächtiger Schreibtisch in der Form eines Hufeisens beherrschte die Mitte. Kleine Hebel, Drehknöpfe und matt erleuchtete Glasplatten machten ihn fremd. Plötzlich sprach eine Stimme, ohne dass wir ahnten, woher sie kam. In einer der gläsernen Schreibunterlagen zeigte sich bunt der Kopf eines Mannes, neigte sich wie lauschend vor, als erwartete er eine Antwort, und zerfloss vor unseren Augen in hellen Nebel.
Hein sah sich nach allen Seiten vorsichtig um und wischte mit dem Daumen über die Stelle, wo das Bild verschwunden war, es folgte jedoch nichts.
»In den Südstaaten«, flüsterte er und trat mir zur Bekräftigung auf den Fuß, »haben sie elektrische Folterkammern! Da war old Kappy, ein Schauermann, schwarz von Angesicht, aber mit einem engelweißen Herzen ... Sie brauchten aber ein Geständnis, wer die hundert Barrels Tran gestohlen habe. Der Frachter hatte sie selbst auf die Seite gebracht, wegen die Versicherung, musst du wissen … Als old Kappy aus der Zelle wieder rauskam, hatte er zeitlebens ’n schiefes Gesicht, dat linke Bein war außer Gang gesetzt un er hatte allens gestanden, wat er nicht begangen hatte. Später haben sie ihn gehangen, womit er zufrieden war, wat is ’n Docker mit ’n lahmes Bein, frag ich?«
Er wurde noch leiser.
»De Düwel mag wissen, wat for Halunken uns hier in ihr Garn verwickeln. Dat Schlimmste is, dat sie dir mit ’n büschen Strom windelweich machen wie ’n Schwabber, un wenn du sonst ’n Kerl bist, der mit Doppelzentnern Fangball spielt …«
Er ballte in ohnmächtiger Wut seine Fäuste.
Man hatte uns bisher zu viel guten Willen bewiesen, während wir doch gewohnt waren, mit groben Nieten ans Elend gehämmert zu werden, sobald uns die Groschen in der Tasche ausgingen. Wären wir noch lange uns überlassen geblieben, hätten wir vielleicht zu unserer »Rettung« eine Dummheit ausgeheckt, denn Heins Befürchtungen hatten mich angesteckt. Zum Glück öffnete sich die Tür, und der Mann trat ein, von dem, wie wir nach seiner ganzen Art merkten, unser weiteres Schicksal abhing.
Er blieb dicht vor uns stehen und lugte uns scharf aus hellen grauen Augen an. Ich glaube, wir gefielen ihm.
»Du bist Seemann?«, fragte er in gutem Deutsch Hein.
Hein klappte die Hacken zusammen und meldete forsch für uns beide:
»Hein un Korl, schiffbrüchig von der Dreimastbark Albatros, Heimathafen Hamborg …«
Etwas weniger sicher fügte er bei:
»Unsre Papiere sind versoffen, Herr Präsident, aber dat wir Hein und Korl sind, dat mögen Sie man gläuwen …«
Der Mann vor uns schüttelte verwundert seinen mächtigen angegrauten Kopf, seine schmalen Lippen pressten sich einen Augenblick lang hart aufeinander und wir fürchteten, er werde uns in den Hackwolf hineinstoßen, der aus Menschenfleisch amtliche Dauerwurst macht.
»Wir sind hier keine Hampelmänner«, sagte er halb finster, halb spöttisch, und ahmte Heins stramme Haltung nach. »Um Ausweispapiere kümmern wir uns schon gar nicht, das lasst mal alles mit dem Albatros auf Grund gegangen sein.«
Wahrscheinlich haben wir auf diese Rede nicht mit gescheiten Gesichtern reagiert, denn er lächelte, und das flog uns wie eine gute Botschaft ins Herz. Deshalb mochte ich ihn nicht anschwindeln, als er mich fragte, was mich in die Fremde getrieben habe. Er gehörte zu den Leuten, vor denen Unaufrichtigkeiten krank werden und krepieren.
»Sie wollten mich auf zwei Jahre zum Tütenkleben abkommandieren«, sagte ich.
»Weshalb?«
Die grauen Augen verhakten sich in mir, aber von dem Abscheu, den »gebildete Leute« vor einem Zuchthausaspiranten haben, merkte ich nichts. So fasste ich Mut:
»Wegen revolutionärer Umtriebe, meinte der Staatsanwalt …«
Der Mann schwieg lange; was er bei sich dachte, blieb uns hinter seiner hohen breiten Stirn verborgen. Endlich sprach er:
»Der Sturm hat euch an die Küste der freien Arbeitergenossenschaft von Utopien geworfen. Wenn ihr klassenbewusste Proletarier seid, werdet ihr euch bei uns wohlfühlen. Mehr als irgendwo auf der Welt gilt bei uns gleiches Recht von Geburt an und solidarisches Handeln. Wir haben unser Haus nach unserem Willen gezimmert, und ich denke, ihr werdet finden, dass sich darin gut wohnen lässt.
Wir behaupten in unserem Land die unbeschränkte politische Macht. Eine dünne Schicht von Geschäftemachern hat sich noch halten können, weil die letzte Revolution glaubte, ihnen Handelsvorrechte einräumen zu müssen, um uns vor Mangel zu schützen. Diese Zeiten liegen längst hinter uns, dennoch hält es die Mehrzahl von uns für eine unnötige Härte, ihren Besitz einzuziehen, und meint, diese Leute würden allmählich im eigenen Fett ersticken.«
Seine Brauen schoben sich finster zusammen; es war deutlich, dass er diese Ansicht nicht teilte. So spann er wohl einige Sekunden lang eigene Gedanken fort; es schien, als hätte er uns vergessen.
Endlich besann er sich und kam uns einen Schritt entgegen.
»Ihr müsst wählen: Wenn ihr Lakaien bei den Geldleuten werden wollt, könnt ihr euch an einen der Gehröcke hängen, die ihr auf den Dachstraßen spazieren seht, sie brauchen jederzeit Speichellecker und Kammerdiener. Wenn ihr aber von unserm Schlage seid …«
Da unterbrach ihn Hein und sagte mit starker Stimme, als müsste er gegen den Wind anrufen:
»Ick war schon im Mutterleib ’n organisierter Prolet, un wat de Korl is, da liegt et ooch in de Familie … Seinen Ollen hat der Bismarck ins Loch gestochen, weil er ’n roten Schlips getragen hat am 1. Mai …«
Der Mann mit dem Namen Joll schüttelte uns herzlich die Hände:
»Willkommen, Genossen!«
2
Ihr müsst vor allem erst Utopisch lernen«, hatte uns Joll geraten, als er uns entließ, »damit ihr euch frei bewegen könnt …«
Ich habe mir das Lernen von fremden Sprachen stets als eine ungeheuer schwierige Sache vorgestellt, was wohl daher kam, dass man uns von Jugend auf eingeredet hatte, alles, was über den Platz an der Maschine und die Mietkaserne hinausgehe, tauge nicht für ein Arbeiterhirn. In Wahrheit gehört nicht mehr Grips dazu, die Zunge und das Gedächtnis gelehrig zu machen, als den richtigen Ansatz von Hobel oder Feile zu begreifen. Ein tüchtiger Tischler oder Schlosser, der seinen Kram versteht, entwickelt mehr Intelligenz als der durchschnittlich »Gebildete«, der sich für einen Halbgott hält, weil er seine Rede mit fremden Wörtern schmücken kann und Kostproben von Geschichts- oder Kunstverständnis verteilt, die nach gegorenem Pflaumenmus schmecken.
Damals hatte ich noch einen dunklen Respekt vor dieser Art und traute mir nicht zu, in Kürze im neuen Leben Wurzel zu schlagen.
Es kam aber anders.
Man führte uns in ein Zimmer, das wir für eine noble Barbierstube hielten, und setzte uns in die verstellbaren Nickelstühle.
»Mir hinten kurz raus!«, sagte Hein und deutete auf seinen Haarschopf.
Der Mann im weißen Mantel, der hier hantierte, wunderte sich und schüttelte den Kopf.
»Nein«, meinte er freundlich auf Deutsch, »durch die Ohren und Augen hinein …«
Wir sprangen auf und wollten ausbüxen, aber er beruhigte uns.
»Ihr seid hier im Institut für Lehrschlaf«, erklärte er, »und lernt in der Hypnose die Grundlagen unserer Sprache. Wenn ihr jeden Tag ein bis zwei Stunden zu mir kommt und in der Zwischenzeit euch lebhaft mit den Genossen unterhaltet, seid ihr in spätestens einer Woche perfekte Utopier.«
Wir widerstrebten nicht länger, zumal die Art dieses Mannes wohlig einschläfernd auf uns wirkte. Halb liegend wurden uns Hörbügel an die Ohren geklemmt. Aus einem Schrank holte der Mann eine flache Scheibe, einer Fonografenplatte ähnlich, und steckte sie in einen Apparat. Über die Wand vor uns begannen Schriftzeichen zu laufen. Bevor wir noch recht was denken konnten, schliefen wir schon.
Wir erwachten wie aus traumlosem, erfrischendem Schlummer. Einige Leute umstanden uns, ihre Rede klang nicht mehr fremd, und als sie uns ansprachen und wie gute Freunde begrüßten, antworteten wir, als wäre das ganz natürlich, in ihrer Sprache und konnten ihnen für ihre Mühe danken. Ihr werdet verstehen, wie froh wir waren, nicht mehr stumm wie Stockfische zwischen vergnügten Menschen herumschwimmen zu müssen.
Wir zogen los. Unseren neuen Freunden machte es Spaß, uns in ihre Welt einzuführen. Sie wunderten sich, dass wir über Dinge staunten, die ihnen selbstverständlich waren.
Allein schon die Tatsache, dass sich das ganze Leben oben auf den Dachstraßen abspielte, dass es da Gartenanlagen und Spielplätze gab und Hallen mit versenkbaren Glaswänden, die bei starkem Wind oder Regenwetter nach Belieben geschlossen werden konnten, mutete uns märchenhaft und unwirklich an. Breite bequeme Liegestühle luden überall zum Sitzen ein, ohne dass ein dienstbarer Geist auftauchte und Benutzungsgebühr verlangte. Es war wie in einem schönen gepflegten Kurpark, nur dass Kranke, Gebrechliche und aufgeputzte Nichtstuer fehlten. Denn das Wunderbarste an allem waren die Menschen, die sich Proletarier nannten und sich doch so frei und ungebeugt, so leicht, kraftvoll und sicher bewegten, wie es nur dem gegeben ist, der niemals mit der Not auf Leben und Tod ringen musste. Aufrecht und wohlgebildet wie ihre Körper waren ihre Gedanken. Alle die tausend Listen und kleinen Betrügereien, die wir täglich anwenden müssen, um uns Geltung zu verschaffen und den Vorteil zu erjagen, ohne den wir von den Nachdrängenden zertrampelt werden, hatten hier keinen Sinn. Vielleicht waren sie keine »besseren« Menschen als wir, aber die Form des Zusammenlebens, die sich unter ihnen herausgebildet hatte, schloss böse Raubleidenschaften einfach aus und erzog sie zu geraden heiteren Wesen, denen nichts natürlicher war als Hilfsbereitschaft und mitteilsame Freundschaft. Weshalb sie so sein konnten? Der ungeteilte Ertrag ihrer Arbeit floss ihrer Gemeinschaft zu, die Arbeitsenergien waren ökonomisch zusammengefasst, und in weit höherem Maße als bei uns ersetzte der Maschinen-Automat das Werk der Hand. Bis ins Letzte durchdachte Technik und Rationalisierung bedrohte hier nicht die Existenz des Arbeiters, sondern steigerte sie. Die tägliche Arbeitspflicht betrug vier Stunden.
Bei diesem ersten Spaziergang begegneten wir auch anderen Gestalten: Männern mit schwarzem Gehrock, den Zylinder auf dem Haupt, die Brust übersät mit klirrenden Orden und Medaillen. Sie schwitzten unter ihrer Würde und zeigten saure Mienen. Das waren die Geschäftemacher, von denen Joll gesprochen hatte. Kein Mensch kümmerte sich um sie, wenn sie steif gebügelt vorüberstelzten. Sie mochten wohl selbst fühlen, dass sie nur noch geduldet waren, so griesgrämig und verbissen schauten sie drein und verschluckten ihren Ärger, wenn sie den fröhlichen, leicht gekleideten Genossen ausweichen mussten. Man nannte sie kurz: die Privaten.
Wir wunderten uns, dass sie so feierliche Anzüge trugen und so schweren Klimperkram. Darüber belehrten uns lachend die Genossen.
»Staatsgesetz!«, erklärten sie. »Ihr wisst doch, wie sehr diese Herren an Titeln und sichtbaren Auszeichnungen hingen und sie benutzten, um sich über das ›gemeine Volk‹ zu erheben. Wir verleihen sie ihnen noch viel bereitwilliger als ihre Regierungen in früheren Zeiten. Nur knüpfen wir daran die Bedingung, dass sämtliche Orden und Ehrenzeichen ständig zu tragen und im Verkehr mit den Behörden alle Titel und Rang-Bezeichnungen zu nennen sind, bei Strafe der Enteignung des Besitzes. Der da drüben«, sie zeigten auf einen vorüberschnaufenden Specknacken, »schleppt zum Beispiel die dreipfündige Staatsmedaille für Klassenmord über dem Herzen und die fünfpfündige Ehrenkette für Presseschwindel mit dem Großkomturkreuz für fortgesetzte Steuersabotage um den Hals, und man kann begreifen, dass er sich dabei nicht besonders wohlfühlt. Wollen mal hören, wie er heißt.«
Wir traten zu ihm und fragten nach seinem Namen. Er rollte fürchterlich die Augen, zog jedoch höflich den Hut und ächzte:
»Graf Speck zu Klauburg, wirklicher geheimer Dividendenschlucker und Konjunkturschwindler, Staatskassenausplünderungsrat a. D. und Ehrenmitglied der Akademie der erfolgreichen Konkurskünste, zu Diensten, meine Herren.«
Wir bedankten uns und ließen ihn laufen.
Hein kniff mich in den Arm.
»Schade«, meinte er, »dat hier nich Willem seine flüchtigen Zelte aufgeschlagen hat. Ick würd’ ihm ’ne hundertpfündige Gasgranate mit Weltkriegsleichengestank unter die Nees hängen und ihn zum Professor für Fahnenflucht und Volksverrat ernennen.«
3
Am Abend bezogen wir ein großes luftiges Zimmer in einem der Gemeinschaftshäuser.
Wir vermissten leider in unserer Wohnung die ersehnten Betten und glaubten schon, in Utopia lege man sich nachts auf den kalten Fußboden und decke sich mit seiner eigenen Haut zu. Einer unserer neuen Freunde, der unseren Kummer bemerkte, drückte lächelnd auf einen Knopf. Da schoben sich die getäfelten Wände auseinander und je ein blitzendes Metallbett klappte sich geräuschlos herunter. Ebenso kam eine Wascheinrichtung zum Vorschein, die man tagsüber verschwinden ließ. Wohn- und Schlafzimmer getrennt in einem Raum.
Während wir uns auszogen und wuschen, meinte Hein, wenn das so weitergehe, werde er in acht Tagen zu faul sein, sich noch einen Hosenknopf selber zuzumachen. Er stemmte zwanzig Mal den massiven Tisch, der zwischen den Fenstern stand, um sich auszuarbeiten, fiel dann in die Kissen und atmete sofort im Schlaf wie ein gewaltiger Blasebalg.
Ich löschte das Licht und schaute hinaus auf das Meer. Boote mit bunten Lampen schwankten auf der glitzernden Fläche. Fröhlicher Gesang tönte herauf. Im Süden und Norden der Bucht strebten wie Lichtsäulen riesige Scheinwerferstrahlen gegen den Himmel und erleuchteten die Dunstschicht der dünnen Wolkendecke. Über dem Zentralhaus der Genossenschaft brannte eine riesige rote Fackel, deren Schein über die ganze Stadt flog.
Dieses gewaltige Wahrzeichen leuchtete noch in meine Träume hinein.
Am nächsten Morgen waren wir uns selbst überlassen. Nachdem wir im Lehrschlaf unsere Kenntnisse mühelos erweitert hatten, bummelten wir durch die Hafenanlagen, die Hein fachmännisch und höchst anerkennend beurteilte.
»Dat is allens wunderscheun«, meinte er, »aber wat fehlt, dat sind lütte Kneipen, wo man sich von ’t Zukieken erholen kann.«
Als wir einigen schmucken Mädels begegneten, lud er sie zu einem kleinen Amüsemang ein, aber sie lachten bloß und gingen weiter. Er kaute kräftige Worte zwischen den Zähnen, die zum Glück niemand verstand. Seine Laune war überhaupt nicht die beste. Wir hatten im Genossenschaftshaus um Arbeit angesucht. Das hat Zeit, Jungens, hatte man uns gesagt, ruht euch aus, schaut euch im Land um. Die Genossenschaft sorgt für alles, was ihr braucht. Ihr könnt auch Privatgeld kriegen, wenn ihr mal den Pfeffersäcken einen Besuch abstatten wollt. Nur bitten wir euch, ihre Schnapsdestillen zu meiden … Werdet schon selbst darauf kommen, dass man den Goldonkels am besten aus dem Wege bleibt; sie gehören in eine andere Welt, die uns nichts angeht.«
Hein hatte draußen gebrummt, umsonst, auf Staatskosten lebten nur die feinen Leute, er würde lieber ’ne tüchtige Heuer verdienen und alles mit einem Mal auf den Kopp hau’n, und so was wie St. Pauli habe er hier noch nicht bemerkt, und Vorschriften lasse er sich schon gar nicht machen. Wir hatten uns deshalb ein bisschen verzankt.
So gingen wir nebeneinander her, ohne eben viel zu reden, und kamen in ein anderes Stadtviertel, das unregelmäßig gebaut und europäisch war. Ich wollte umkehren, hier begann die Siedlung der Privaten, und das kannte ich. Aber Hein pfiff sich eins und wurde munter. Vor einem niedrigen Laden, durch dessen Scheiben ein Bartisch mit Flaschen in allen Formen und Farben schimmerte, blieb er wie hypnotisiert stehen.
Ich ahnte das Verhängnis. Weder gute noch böse Worte halfen. Hein schob mich energisch beiseite, stieß die Tür auf, trat wuchtig ein und forderte einen »Drink«.
Der Bürger hinter dem Bartisch verstand nicht und geriet sichtlich in Verlegenheit.
Kurz entschlossen ergriff Hein eine der Flaschen und tat einen kräftigen, prüfenden Schluck.
»Gut!«, sagte er zufrieden und trank weiter.
Der Bürger erhob Zetergeschrei. Von der Straße liefen Genossen und Private herbei. Die Arbeiter waren starr vor Staunen, dann versuchte einer, Hein die Flasche vom Mund zu reißen.
Ha, da kam Leben in die Bude.
Hein begann sich wohlzufühlen. Er zerschmiss mit der leeren Bottel ein Fenster, schob sich im Nu die Ärmel hoch und ging wie ein wütender Bulle auf die Leute los. Er boxte, als wollte er die Weltmeisterschaft gewinnen. Stühle flogen, Haarbüschel sausten durch die Finger. Einige Gehröcke wurden verstaucht. Ordenssterne klirrten über den Boden.Doch die Männer von Utopia waren stärker, als der brave Hein gerechnet hatte, und bald lag er reglos in der Schraube von acht festen Fäusten.
Jetzt stecken sie uns ins Loch, dachte ich. Der schöne Traum hat ein Ende.
Sie schleppten Hein, der nur mit den Augen gefährlich rollen konnte, in die Zentrale. Ein älterer Genosse hörte ihren Bericht. Hein, jetzt freigegeben, stand halb trotzig, halb verlegen vor ihm.
Der Utopier schaute ihn lange ruhig an, sagte dann:
»Armer Kerl, du hast deinen Lebtag noch nie eine sorgenlose Stunde gehabt, kannst mit dir selber nicht umgehen, wenn dich mal keiner hetzt, musst die Freiheit des Proletariers erst lernen.«
Hein senkte beschämt den Kopf.
»Willst du mit den Fischern auf See?«
»Topp«, sagte Hein und schüttelte dem Alten kräftig die Hand, »’n Kerl wie ich taugt nicht zum Spazierengehen.«
Die Genossen lächelten.
4
Hein hatte nun seinen Dienst, blieb tagelang auf See. Wenn er zurückkam, brachte er frische Salzluft und gute Laune mit. Seine Kameraden gefielen ihm, waren derbe, fröhliche Gesellen. Er vergaß seine Rauflust, packte nur zu, wenn es praktische Arbeit galt.
Ich dagegen beherzigte den Rat der Genossen, mir die Einrichtungen ihres Landes anzuschauen, bevor ich eine Tätigkeit wählen wollte.
Zunächst fuhr ich hinaus in die Kindersiedlung. Sie umfasste einen gewaltigen Landkomplex. Die Gebäude, nur einstöckig, rings von breiten überdachten Terrassen umlaufen, lagen weit verstreut im Park- und Wiesengelände.
In jedem Haus waren ungefähr hundert Buben und Mädel untergebracht. Im ersten Stock lagen die luftigen Schlafsäle und Wohnräume, im Erdgeschoss die Werkstätten, Schulräume, ein Weiheraum. Elektrische Küche, Speicher, Wasch- und Baderäume im Keller.
Solange es das Wetter einigermaßen erlaubte, spielte sich alles Leben im Freien ab. In den schwülen Sommernächten zog die ganze Kolonie mit Hängematten in die benachbarten Wälder und schlief dort.
Ich wanderte von Haus zu Haus und merkte kaum, wie der Tag verging. Gegen Abend kam ich auf eine sanfte Anhöhe. Die Vorsteherin des weißen Hauses, das dort zwischen immergrünen Bäumen wie auf einer Insel lag, bewillkommnete mich herzlich. Sie war ein schönes Mädchen von etwa 24 Jahren.
Wir setzten uns vor die Terrasse auf eine Bank und genossen den Ausblick auf das ferne Meer, über das die letzten Strahlen der Sonne liefen. Vor uns, auf den Wiesen, tollten die Buben und Mädel nackt und unbekümmert.
Sie kamen zu uns heraufgesprungen und baten uns, ein Fangespiel mitzumachen.
Ich kratzte mich bedenklich hinterm Ohr. Aber schon war die Genossin aufgestanden, hatte ihren Rock abgestreift, gab mir lachend einen Klaps auf die Schulter und lief davon.
Ich erinnerte mich plötzlich, vor 20 Jahren ein berühmter Indianerhäuptling gewesen zu sein, wofür mir mein Vater häufig genug die Hosen strammgezogen hatte.
Mit echtem Siouxgeheul sprang ich auf und setzte der hellen schlanken Gestalt nach. Die Kinder rannten mit, schrien und feuerten uns an. Leider sah ich bald ein, dass der große Häuptling seine Künste überschätzt hatte. Die schöne Verfolgte neckte mich, versteckte sich hinter Bäumen, schlug die gefährlichsten Haken, entwischte immer wieder wie der Wind. Schließlich, als ich wie ein gefoppter Jagdhund japste, ließ sie sich freiwillig fangen. Die Kinder jubelten und verspotteten meinen kurzen Atem.
Inzwischen waren die Sterne aufgegangen, und ich dachte mit Wehmut an den weiten Rückmarsch.
Die Genossin rief die Kinder zusammen und sprach mit ihnen:
»Wollen wir dem Genossen Karl – sie hatte sich meinen fremdländischen Namen gut gemerkt – Asylrecht gewähren?«
»Ja«, schrien alle, »er soll bei uns bleiben und uns morgen von den Genossen in Europa erzählen!«
Ein Fünfzehnjähriger, der wohl die Hausverwaltung führte, trat vor und meinte sachlich:
»Wir haben in den Schlafsälen alle Betten belegt, du musst Karl mit in dein Zimmer nehmen, Genossin.«
Sie nickte zustimmend.
»Gewiss, das zweite Bett bei mir steht frei, komm!«
Mir wurde heiß und kalt und ich wäre plötzlich herzlich gerne nach der Stadt zurückgetrabt. Aber weshalb denn? Ich gab mir einen Ruck. Endlich frei werden von der Schamlosigkeit, den Körper wie ein aussätziges Geschwür zu verbergen. Endlich sich seiner wohlgeratenen Glieder freuen dürfen. Erst hier spürte ich, wie weit ich schon vermuckert war.
Ich schlug freudig ein und gelobte mir im Stillen, den ganzen Plunder einer verlogenen Unmoral gründlich zu vergessen.
Wir gingen in das Haus. Lange Tische wurden auf die Terrassen herausgeschoben, dort aßen wir. Lieder wurden gesungen. Zart girrende Instrumente summten in die Nacht hinaus. Von einem Nachbarhaus kamen Burschen und Mädel zu Besuch. Sie hatten in ihrer Werkstatt in monatelanger Arbeit eine Verbesserung an der automatischen Weichenstellung ausgetüftelt und berichteten nun voller Erfinderstolz von den Vorzügen ihres Systems.
Die Debatte wurde von unseren Jungen sachkundig geführt. Als man sich in einigen technischen Fragen an mich wandte, konnte ich leider nur mit den Schultern zucken. Ich war froh, als meine Zimmerkameradin die Sitzung aufhob.
Lange lag ich wach und lauschte auf die ruhigen, tiefen Atemzüge der Schläferin neben mir.
»Jana« war sie von den Kindern gerufen worden.
»Jana – Jana«, flüsterte ich vor mich hin.
Und ich pries unseren Schiffbruch als ein glückliches Verhängnis.
Ich blieb etliche Tage in der Kindersiedlung. Wir durchstreiften gemeinsam den riesigen Park, badeten im Meer, trieben Laufsport am Strand, kletterten im Felsgebiet der Berge. Häufig übernachteten wir im Freien und ließen uns von dem nächstgelegenen Siedlungshaus verpflegen.
Unsere schöne Führerin und Kameradin wuchs mir immer mehr ans Herz. Da ich ihr offenbar auch nicht gleichgültig war, wälzte ich schüchterne Heiratsgedanken, wagte mich aber nicht damit heraus. Die Utopier dachten in allen Stücken anders als wir. Ich wollte nicht ausgelacht werden.
Zum Glück fehlte es nicht an Ablenkung.
Die Jugendgenossen fragten mir die Seele aus dem Leib. Sie wollten von mir als einem Augenzeugen bis in die geringsten Kleinigkeiten wissen, wie es jenseits von Utopien in der Welt aussehe. Besonders ausgiebig musste ich vom großen Weltkrieg erzählen. Des Staunens und Wunderns war kein Ende. Vor allem wollten sie nicht glauben, dass die Proletarier der verschiedenen Nationen einander als Feinde totgeschossen und -gestochen hatten.
»Wie dumm, wie dumm!«, schrie ein zehnjähriger Knirps und schlug einen Purzelbaum auf der Wiese.
»Wie dumm!«, riefen die anderen im Chor und schüttelten verwundert die Köpfe.
Ich antwortete verärgert, man dürfe den gewaltsamen Tod von Millionen Menschenbrüdern nicht mit so leichtfertigen Worten abtun.
Jana fiel mir in die Rede:
»Warum nicht?«, sagte sie. »Die Genossen in Europa und Amerika kannten die Verlogenheit der kapitalistischen Presse und ließen sich doch von ihr zum Massenmord begeistern. Sie wussten, dass die Herstellung von Granaten, Minen, Gasen durch einen Weltrüstungsstreik augenblicklich hätte unterbunden werden können, streikten aber nicht. Wir nennen dergleichen dumm und haben kein Mitleid mit Leuten, die durch ihre eigene Torheit umkommen.«
Ich versuchte, nun wenigstens durch den Veitstanz der Milliarden und Billionen aus der Inflationszeit meinen Zuhörern zu imponieren. Da kam ich aber schön an.
»Kennen wir!«, riefen sie durcheinander und forderten lachend Jana auf, mir die Geschichte von Ludo Stinkes zu erzählen.
»Ludo Stinkes«, hob sie an, »war Besitzer von Bergwerken, großen Industriewerkstätten und der einflussreichste Bankier von Utopia. Sein Lieblingsplan war, das ganze Verkehrsnetz des Landes, Eisenbahnen und Schifffahrt, in seine Hände zu bekommen. So gewaltig nun aber auch seine Mittel waren, wusste er doch, dass sie nicht ausreichten, den großen Nationalbesitz an sich zu bringen. Er entwertete daher durch viele Kniffe und bestochene Politiker das Geld, ramschte zusammen, was erreichbar war, und bezahlte mit wertlosen Scheinen.
Die Arbeitergenossenschaft, der es bis dahin nicht viel besser gegangen war als bei euch, erkannte den günstigen Augenblick. Sie ließ sofort ihre sämtlichen Druckmaschinen Banknoten drucken. Tag und Nacht. Wochenlang konnten die Zeitungen nicht erscheinen. Durch zuverlässige Mittelsmänner, die sich den Anschein von zunftmäßigen Kapitalisten gaben, kaufte sie alle Wasserkräfte des Landes und die ganze Meeresküste an. In den größten Werkzeugfabriken wurden Streiks provoziert und scheinbare Zerstörungen angerichtet. Die Aktien fielen gewaltig, und wir kauften die Mehrheit für einen Pappenstiel. Im Höhepunkt der Bewegung wurde plötzlich ein Generalstreik der Eisenbahner verkündet, und am gleichen Tage entwaffnete das Proletariat die gesamte Polizeitruppe. Die sofort gebildete Arbeiter-Regierung übernahm den Schutz der Nationalgüter und erklärte die bisherige Verwaltung für unmündig. Die Spitzen der alten Behörden wurden, soweit sie sich widerspenstig zeigten, als unartige Kinder in Erziehungsheime geschickt, wo sie praktischen Unterricht in Gemeinschaftsarbeit erhielten.
Es war eine rechte Freude, den Herren Sekretären, Räten und Anwälten des Unrechts zuzusehen, wenn sie im Takte Straßen pflasterten oder unter kräftigem ›Zu-gleich!‹ Balken trimmten.
Die Genossenschaft aber war im Besitz der Produktionskräfte. Wir bauten die ungeheuren Fernkraftwerke, die die Gewalt des Meeres und der Ströme in Elektrizität umsetzten, und haben das Monopol der Energie.
Stinkes floh auf seiner Jacht noch rechtzeitig nach Europa, in der Hoffnung, dort Dümmere als uns zu finden.«
Ich beteiligte mich am Unterricht, hatte aber wenig Gewinn davon, weil mir alle Grundlagen fehlten. Selbst wenn ich, wie es bei den Kindern geschah, im Lehrschlaf die Grundelemente gelernt hätte, so fielen doch alle Zwischenglieder aus, vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern, die einen breiten Raum einnahmen. Überhaupt wunderte ich mich, dass die Jungens und Mädels geradezu eine Leidenschaft für Mathematik entwickelten. Von dieser hatte ich bisher meine eigene Ansicht.
Als ich ein halbwüchsiger Bursche war, kam manchmal der Hermann von Doktors aus dem ersten Stock zu uns runter in die Kellerwohnung. Ich musste ihm auf Vaters Hobelbank ein Gestell für seine Steinsammlung oder was Ähnliches zusammenpfuschen. Er saß dann neben mir, passte auf, wie ich Vaters Hobel stumpf schob, und schimpfte sich mal gehörig aus.
»Was du auf dem Gymnasium lernst, Karl«, belehrte er mich mit fuchtelnden Armen, »das ist alles Quatsch. Vater sagt’s auch. Aber wenn du mal ’n tüchtiger Rechtsanwalt werden willst, so wie mein Alter einer ist, da musst du dich eben durchpauken. Mit den Sprachen … Na ja, das gehört eben zur Bildung, weißt du, damit kannste Eindruck schinden. Aber die Mathese, das ist der größte Bockmist, den es auf der Welt gibt.«
Er kritzelte mir mit dem breiten Zimmermannsblei allerlei Buchstaben, Klammern und spitze Tüten auf ein frisch abgezogenes Brettchen und fragte mich, ob ich mir was dabei denken könne. Ich gab ihm recht.
»Klar, Hermann, das ist Bockmist«, sagte ich aus innerster Überzeugung und freute mich, dass ihn diese deutliche Zustimmung tröstete.
Der Genosse Ingenieur, der wöchentlich einige Male in die Jugendsiedlung kam, um die theoretisch-praktischen Diskussionen zu leiten, belehrte mich eines anderen.
»Von den praktischen Forderungen der Technik her«, sagte er, »die jeden von uns beschäftigen, weil sie ein Element unserer Freiheit sind, dringen wir zu den Grundbegriffen der Chemie und Physik vor. Dazu gehört vor allem Mathematik. Sie stellt die Verbindung dort wieder her, wo unvollkommene Einsicht das Naturwirken in zwei Hälften geteilt hat.
Hast du einmal durchdacht, Karl, wie wichtig es für die Arbeiterschaft ist, die Technik unseres Zeitalters mit allen, auch den theoretischen Voraussetzungen zu beherrschen? Sie ist das Nervensystem des Gemeinschaftskörpers. Durch sie leben wir alle in der gleichen Gegenwart. Bei euch aber leben die Menschen nur äußerlich im gleichen Augenblick. Ihr Denken spaltet sie in viele Jahrhunderte. Leibeigenschaft, Gespensterfurcht und Aberglaube verdunkeln noch viele Köpfe, Raffgier, Herrschsucht und Landsknechtrohheit halten andere für ihr gutes Recht. Gewiss finden sich auch freiere Geister, die über den persönlichen Vorteil hinausdenken. Die halten sich dann für einzigartig, sind einsam und gehen an der Hochmutskrankheit zugrunde.
Selbst in der organisierten Arbeiterschaft sind genug, die sich für viel gescheiter halten als die anderen und nur so tun, als wollten sie sich’s nicht anmerken lassen. Wenn ein solcher Führer wird, ist er auch schon ein kleiner Alleinherrscher, der Respekt und guten Glauben verlangt. Der gute Glaube ist der Tod des Sozialismus, so hat uns Joll gelehrt.
Wie die Erde und die Welt eingerichtet ist, welche Kräfte sie uns schenkt, damit der Körper nicht mehr ermüden muss, wo ihn die Maschine ersetzen kann, das geht jeden von uns an. Wir lernen es in unseren Jugendgemeinschaften fast im Spiel.«
»Ihr lernt es, weil niemand euch dazu zwingt«, sagte ich.
Mir war, als spiegelten sich in dem klaren Gesicht des Mannes eigene Gedanken, zu denen ich früher keinen Mut gehabt hatte.
Jana, die zugehört hatte, sprach sie für mich aus:
»Die Freiheit, die alle bindet, duldet keinen Zwang, da hast du recht. Aber jeder, der in ihr aufwächst, will ihren Raum erweitern und dient so dem Gemeinsamen.«
Mit Jana kam ich in diesen Tagen nicht über herzliche Kameradschaft hinaus. Ich wagte kein ernstes Wort zu sprechen, denn ich fühlte, dass meine Begriffe vom Zusammenleben – auch in der Liebe – wahrscheinlich immer noch zu europäisch waren, um recht verstanden zu werden.
5
Ich ertrug die stille Reinheit des Kinderparadieses nicht länger und zog wieder in die Stadt zurück in der Absicht, meinen Liebeskummer in Vergnügungen oder Arbeit zu ersticken.
Im Quartier traf ich Hein, der einige Tage Urlaub hatte, denn der Bedarf an Fischen war gedeckt und man fing nicht mehr, als man brauchte.
Der große Kerl fiel mir um den Hals und freute sich mächtig, mich wiederzusehen. Er merkte gleich, dass bei mir etwas nicht stimmte. Ich verschwieg ihm mannhaft mein Leid und ärgerte mich, als er ahnungsvoll durch die Zähne pfiff.
»Mensch, du hängst ja die Flügel wie ’n angeschossener Enterich«, meinte er. »Komm, heute Abend wollen wir mal ’n ordentliches Ding drehn. Soll doch mit ’m Deibel zugehen, wenn’s hier nich so was wie St. Pauli und die Reeperbahn gibt. Erst fallen wir mal in ’n Kintopp rin. Ich hab ’ne mächtige Sehnsucht nach ’m Drama mit ’ner Portion Liebe drin …«
Na schön. Ein Wort für Kino hatten wir nicht gelernt. Wir erklärten also mühsam einem Genossen, was wir suchten. Richtig, so was hatte es früher gegeben, vor dreißig oder mehr Jahren.
»Jetzt machen wir das anders«, sagte er stolz und führte uns in eine gewaltige Arena, in der schon Tausende von Menschen in bequemen Sesseln warteten. Der Raum war gegen den Nachthimmel offen, konnte aber im Winter oder bei Regen durch riesige Faltwände, die jetzt unterirdisch versenkt waren, geschlossen werden.
Die Lampen erloschen. Dafür erstrahlte die leere Mitte des Raumes in Tageshelle. Gewaltige Eisenkonstruktionen und Maschinen fügten sich zur Fabrikhalle, in der sich plötzlich, wie aus dem Boden gewachsen, Menschen bewegten und sprachen. Obwohl wir ziemlich am Rand des Theaters saßen, verstanden wir jedes Wort, ohne dass die Spieler sich anzustrengen schienen.
»Das müssen ja Riesenkerle sein«, sagte Hein. »Wir sitzen unsere dreißig Meter von ihnen weg, dabei sind sie so groß, als stünden sie neben uns.«
Er grübelte jedoch nicht lange nach und war ganz Spannung. Mein Nachbar erklärte mir leise, das Ganze beruhe auf einer plastischen Lichtspiegelung. Die Vorstellung gehe soeben 1000 Kilometer von hier in der Hauptstadt Utopolis vor sich und werde drahtlos an alle Theater Utopiens telegrafiert. Ebenso würden die Worte übertragen und durch Lautsprecher über den ganzen Raum in natürlichem Redeton verbreitet. Die Übertragung war in Farbe und Ton so vollkommen, dass ich geschworen hätte, lebendige Menschen vor mir zu sehen.
Das Stück selbst gab einen Ausschnitt aus der revolutionären Geschichte der Arbeitergenossenschaft. Schauplatz des Spiels war ein Eisenwalzwerk.
Rot glühende Eisenblöcke werden von schweißtriefenden Männern auf niedrigen Karren an die Walzen herangebracht.
»Wie sich die armen Hunde damals schinden mussten«, sagte eine Genossin vor mir.
Der Unternehmer im weißen Sommeranzug steht dabei und schimpft über die Saumseligkeit der Arbeiter.
Einer der Schmiede tritt auf den Unternehmer zu, während die anderen sich auf die langen Greifzangen stützen, und bittet ihn um eine Lohnzulage. Es sei unmöglich, mehr zu leisten, wenn man kaum den größten Hunger stillen könne.
Der Unternehmer brüllt den Mann an, er sei entlassen, er dulde keine Aufwiegler …
Der mächtige Schmied tut einen Schritt gegen den zornroten Mann in der weißen Kapitänsmütze, nicht drohend, sondern als will er eindringlicher seine Forderung begründen.
Der Unternehmer schlägt ihm die Faust ins Gesicht, reißt zwei Revolver aus den Taschen und kreischt:
»Hände hoch!«
Der Getroffene taumelt rückwärts, rutscht und stürzt auf den glühenden Eisenblock, der ihn grässlich verbrennt. Die Kameraden müssen seiner grausamen Qual mit erhobenen Händen untätig zusehen, denn zwei Feuerrohre drohen zwölffachen Tod.
»Dieser Schmied war ein Vorfahre von Joll«, belehrte mich mein Nachbar.
Leidenschaftliche Streikversammlungen folgen. Kämpfe gegen das Militär, das die Eisenwerke besetzt hält, fordern Proletarierblut. Die Villa des Unternehmers geht in Flammen auf. Ein Teil des Militärs tritt auf die Seite der Revolutionäre. Der Kampf ist gewonnen. Über den gewaltigen Eisenhallen des Werkes flattert im Sturm die riesige rote Fahne.
Die Zuschauer jubelten ihr zu, sprangen von ihren Sitzen, und brausend erscholl im Massengesang die Internationale.
Nach einer Pause kam Das Leben in der alten Welt. Der Genosse neben mir erklärte, dass als Frachtdampfer maskierte Schiffe der Utopier ständig unterwegs waren, um mit feinsten Aufnahmeapparaten die Vorgänge auf den alten Kontinenten zu kontrollieren und als Anschauungsunterricht nach Utopien zu telegrafieren.
Plötzlich erschien in leibhaftiger Größe im schönsten Sonnenschein die Einfahrt in den Hamburger Hafen. Langsam näherten wir uns den Landungsbrücken.
Hein war aufgesprungen und röchelte, keines Wortes mächtig, wie ein verwundeter Stier.
Da war ja auch seine geliebte Reeperbahn. Matrosen schlenderten, ihre Mädchen am Arm, und verschwanden in den kleinen Kellerkneipen.
Um die Ecke eines Seitengässchens bog ein hübsches, dralles, aufgeputztes Frauenzimmer. Da krachte unter Heins Fäusten die Barriere zusammen. Er brüllte:
»Hallo, Kathrin! Hier ist Hein!«
Sie scherte sich nicht um den Zuruf, winkte sich einen Heizer, der an der Laterne lehnte, heran und drückte sich an seine Schulter.
In Heins Faust sah ich plötzlich ein Messer blitzen. Wie besessen schreiend, sprang, flog er über die Sitzreihen hinunter zur Mitte, stach nach den schimmernden Lichtschemen, schlug um sich und brach ohnmächtig zusammen.
Man trug den Bewusstlosen hinaus.
6
Das Erlebnis in der Lichtspiel-Arena hatte Heins Gemüt umdüstert. Er stellte tiefsinnige Betrachtungen über die Treulosigkeit der Weiber an und schwor seinem Nebenbuhler fürchterliche Rache. Überhaupt fühlte er sich seit dieser Sache nicht mehr recht geheuer in Utopien. Er verwechselte Schein und Wirklichkeit, und das Wesen jener großartigen technischen Fata Morgana wollte ihm nicht einleuchten.
Wir machten einen Spaziergang am Strand in der Gegend, wo wir uns als Schiffbrüchige gefunden hatten. Hein seufzte, dass sich die kleinen Strandpfützen kräuselten, und wünschte sich, mit den versunkenen Kameraden als Seegespenst in der Kajüte des Wracks »Meine Tante – deine Tante« zu spielen.
Über solchen Gesprächen wären wir beinahe über einen Körper gestolpert, der, halb in den Sand eingegraben, vor uns lag. Ein hübsches Köpfchen hob sich und blickte uns mit schlaftrunkenen Augen an. Dann kam Leben in die Gestalt. Sie sprang elastisch auf.