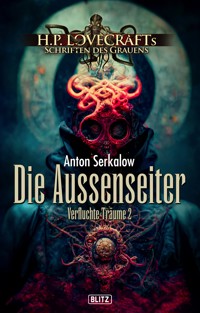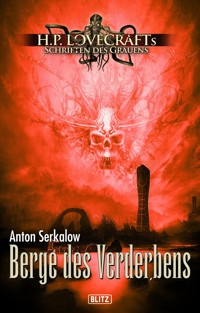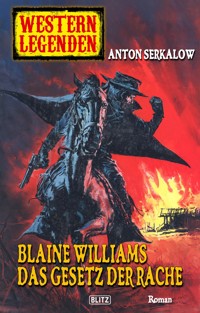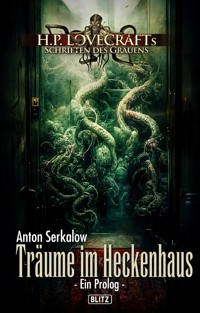5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Manche Orte sollten nie betreten werden. Herzlich willkommen in Vakkerville! Einer Stadt, in der eigentlich alles so ist, wie in jeder anderen Stadt ... eigentlich ... bis ... Der Überfall auf ein Restaurant löst eine Kette von Ereignissen aus, bei denen u.a. das Tor zur Dämonenwelt geöffnet wird und die Stadt in Wahnsinn und Chaos versinkt. »Pulp Fiction« trifft »Zauberer von Oz« und »Silent Hill«. Irrsinniger Mix aus Krimi, Horror, Mystery, Thriller und Komödie. Trauen Sie sich, diesem Ort einen Besuch abzustatten? Ein Agoraphobiker verlässt nach Jahren doch seine Wohnung, weil ihm ein Geistermädchen bei der Suche nach einem verschollenen Freund hilft. Auf dem Parkplatz eines Feinschmeckerrestaurants angekommen, überschlagen sich die Ereignisse, denn ein Zwerg und ein Pirat überfallen gerade jetzt dieses Lokal, wo der örtliche Pate diniert. Ein Gothic-Girl und die Vogelscheuche sind ebenfalls da. Eine Ex-Polizistin will sich mit den Erpressern ihres Chefs treffen. Ein obdachloser Flaschensammler, ein mysteriöser Auftragskiller und noch andere skurrile, ausgeflippte und undurchsichtige Gestalten tauchen ebenso auf, wie die toten Kinder aus dem Nebel und der Schatten eines nie gefassten Serienkillers. So begann 2016 der Auftakt einer Genregrenzen sprengenden Trilogie, die hier erstmals als Sammelband vorliegt. Alle drei Teile „Dämmergrau“, „Nebelgrenze“ und „Spiegelgrund“ in einem E-Book.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Vakkerville-Mysteries
Sammelband
Anton Serkalow
c/o
Thomas Sabottka
Klintum 169
25938 Oldsum
thomas-sabottka[ät]t-online.de
www.anton-serkalow.de
Die Handlung, Figuren und Organisationen in diesem Werk wurde(n) vom Autor frei erfunden beziehungsweise fiktionalisiert.
© Anton Serkalow. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages/Autors wiedergegeben werden.
Titelbild: © Mario Heyer MTP Art
Inhaltsverzeichnis
Band 1 Dämmergrau
Etwas erwacht
Der Überfall (An einem Freitag im Oktober, 18:32 Uhr)
Familienaufstellung (Einige Tage zuvor)
Der Überfall (18:47 Uhr)
Leo (Einige Tage zuvor)
Der Überfall (18:52 Uhr)
Die Verrückten (Einige Tage zuvor)
Der Überfall (18:53 Uhr)
Samira (Einige Tage zuvor)
Der Überfall (18:56 Uhr)
Nottingham (Einige Tage zuvor)
Der Überfall (18:54 Uhr)
BügeGeV (Einige Tage zuvor)
Der Überfall (Freitag 31. Oktober 18:53 Uhr)
Alles auf Anfang
Anhang
Band 2 Nebelgrenze
Schattenwelt
Nach dem Überfall
Geöffnete und geschlossene Türen
Keine Stille vor dem Sturm
Risse im Gebilde
Der äußere Kreis der Hölle
Spiegelscherben und Schattensplitter
Jenseits von Zeit und Raum
Über die Nebelgrenze
In den Spiegel
Anhang
Band 3 Spiegelgrund
Willkommen im Spiegelgrund
... dann werden wir uns wiedersehen (3 Jahre später)
Die Wasser des Grauens (77 Jahre später)
Eines jeden Bestimmung
... und vergib uns unsere Schuld
Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren!
Die Lebenden und die Toten
... das alte Lied erklingt
Einige Tage später
Anhang
Der Autor
Band 1 Dämmergrau
Etwas erwacht
Ein Flüstern wehte durch die alten Backsteinmauern. Wispernd, wie der Flügelschlag eines Schmetterlings.
Meistens verhielten sie sich ruhig. Aber wenn sich etwas andeutete, das Menschen nicht wahrnahmen, ein unbestimmtes Gefühl, wenn in der Welt einiges in Bewegung geriet, sich verschob, ein Schwingen einsetzte ... Dann wurden sie unruhig. Viele Jahre verweilten sie schon hier. Verloren im Nebel ihrer eigenen Erinnerungen. Nur flüchtig hinter der dünnen Membran ihrer Träume auszumachen. Träume, die wiederum nur die Schatten von Träumen waren.
Dann schlichen sie mit resignierten Gesichtern durch die rostfarbenen, zerfallenden Gänge. Kaum zu erkennen in der staubflimmernden Dämmerung der trübblinden Lichter. Unter den Lampen, die jederzeit zu verglimmen schienen.
Gelegentlich gab es jedoch Momente, da wurden sie aufmerksam. Blieben stehen, hoben die traurigen Gesichter und schauten nach oben. Dort über ihnen könnte sich jetzt gleich ein Spalt in der Decke öffnen. Eine Tür?
Sonnenstrahlen würden sich auf ihre Köpfe ergießen. Oh, das wäre schön. Licht und Wärme. Wenn dann die Mauern endgültig zusammenbrechen ...
Dann könnten sie die Sonne auf ihrer blassen Haut spüren und lachend durch das hohe Gras einer blühenden Wiese laufen.
Ein Raunen schwebte durch die vergessenen Fundamente. Sie erwachten aus ihrer Lethargie und lauschten.
Hoffnungsvoll. Erwartungsvoll. Ihr Flüstern und Seufzen störte manch einen, der einen leichten Schlaf hatte.
Es verbreitete sich weiter durch die Mauern. Brachte Glasscheiben zum Erzittern, Dielen zum Knarzen, Türklinken zum Quietschen, Wasserhähne zum Tropfen. Glitt durch die Oberflächen der Spiegel an den Wänden. Huschte durch Fenster, als wären ihre reflektierenden Scheiben geöffnete Türen. Portale, durch die das Flüstern hindurch gelangte, um bei der nächsten Glasfront wieder aufzutauchen.
Wehte über die nebligen Wege in den weitläufigen Park, über die Oberfläche des Teichs, der als dunkler Spiegel in der beginnenden Dämmerung träumte.
Brachte die alten Akazien und mächtigen Eichen dazu, sich zu schütteln. Morgentau rieselte von ihren Ästen, obwohl in dieser Nacht kein Wind ging. Das Flüstern ließ die Krähen die Köpfe unter den Flügeln hervornehmen und ein verwundertes Krächzen in den Nachthimmel schicken. Ein Maultier wieherte im Schlaf. Die Säulen des Tores, die einen Steinbogen trugen, bebten sanft. Von dem alten, tief angebrachten Metallschild rutschten die Zweige eines hölzernen, verknoteten Dornbusches beiseite. Erzeugten auf der grün angelaufenen Metallplatte ein knirschendes Geräusch, als würden Fingernägel über eine Schiefertafel kratzen. Zweige, die so alt waren wie das untere Schild selbst. Die ersten Jahre hatte ein Gärtner diese noch daran gehindert, das Schild zu erreichen und zu verbergen. So war der Strauch stabil und dicht geworden.
Dann hatte man ihn vergessen. Die Natur holte sich alles zurück.
Es war gut, dass über solche Dinge irgendwann das Gras wuchs.
Auch wenn es kein Gras, sondern ein Dornbusch war. Der würde schon seinen Zweck erfüllen.
Das Schild darüber war viel schöner. Viel moderner. Vor allem beruhigender für die ohnehin schon gestressten Einwohner der Stadt.
Es reichte, wenn der Strauch dieses Schild nicht überdeckte.
Durch das Verrutschen der Zweige von der angerosteten Metalltafel wurde jetzt ein Ausschnitt sichtbar. Ein Bruchteil der Schrift wurde durch das Wispern aus den alten Mauern freigelegt:
›... 5 starben min ... 472 Kind ...‹
Etwas würde geschehen. Sie wussten es. In ihre Erwartungshaltung mischte sich ein Funken von hoffnungsvoller Vorfreude.
Der Überfall (An einem Freitag im Oktober, 18:32 Uhr)
»Meine Fresse«, staunte der Zwerg, den man für diesen Abend nach einer Figur aus ›Der Herr der Ringe‹ benannte, »wo hast du die denn her?«
Er fuhr mit dem Zeigefinger vorsichtig über den Lauf der Waffe, die der Piratenkapitän ihm rüber gereicht hatte.
Der Angesprochene zuckte mit den Schultern.
Er wedelte kurz mit der ringebesetzten Hand und schüttelte die Dreadlocks unter dem Kopftuch. Entsprechend seiner Verkleidung hatte er sich für ihr Vorhaben den Namen ›Jack Sparrow‹, dem Protagonisten aus ›Pirates of the Caribbean‹, zugelegt.
Der als ›Gimli‹ titulierte, warf einen Blick in den Rückspiegel. Betrachtete seinen roten Rauschebart, die Zöpfe, die aus dem Helm hervorquollen, die Metallplatten vor der Brust. Sah aus dem Augenwinkel zu Sparrow hinüber, der mit den dick Kajal umrandeten Augen stur auf die Straße schaute.
»Ist die echt?« Der Zwerg schielte vorsichtig in den Lauf der Waffe.
Sparrow legte seine Pistole in den Schoß. Die Waffe sah alt aus. Aber gepflegt. Obwohl sich Gimli mit solchen Sachen gar nicht auskannte.
»Nein. Natürlich nicht. Aber wir müssen überzeugend sein. Mach dir nicht so viele Sorgen. Wir haben alles besprochen. Alles im Griff. Die Typen da drin sind kein katholischer Mädchenverein. Die müssen das alles für echt halten.«
Gimli klappte der Unterkiefer runter, er starrte den Piratenkapitän von der Seite an.
»Du meinst, es könnte ...« Sein Blick wanderte in die Richtung, in der das ›Chez Serge‹ lag.
Sparrow zuckte mit den Schultern.
»Mach das, was wir besprochen haben. Im Zweifelsfall das, was ich dir sage. Dann sind wir schwuppdiewupp aus der Nummer raus. Alles ist in Butter.«
»Hmm«, murmelte Gimli.
Der Pirat sah ihn von der Seite an.
»Willst du abspringen?«
Gimli umklammerte das Lenkrad. Sein Unterkiefer mahlte.
»Nein, nein. Wir ziehen das jetzt durch.«
Sparrow nickte.
Eine Weile hing jeder seinen Gedanken nach. Sie starrten durch die Frontscheibe auf den grauen Asphalt, der im Abenddunst verschwamm.
»Mir ist schlecht«, maulte Sparrow, »und das liegt daran, dass dein blöder Wagen so stinkt.«
»Das ist ein ›Comanche Chief‹ von 1987.«
»Ach? Deswegen muss er nach totem Indianer riechen oder was?«
»Nein. Der ist einfach nur alt. Das Leder der Sitze, das Metall, das alles hat ja schon eine Menge aufgesogen ...« Gimli schnippte gegen das Duftbäumchen am Rückspiegel. »Dafür gibt’s ja die hier.«
»Das macht es nur noch schlimmer!«, quengelte Sparrow zurück.
»Du hast kein Auto! Also musst du mit dem hier klarkommen. Ich schwitze«, knurrte der Zwerg, »und das liegt an diesem bescheuerten Bart.«
»Ist besser, als erkannt zu werden«, erwiderte der Pirat. Dabei verschränkte er die Arme vor der Brust. Hob das Kinn und starrte mit zusammengekniffenen Lippen in den Schatten der Nebenstraße.
»Ja, ja. Schon gut«, murrte der Zwerg.
Sparrow holte tief durch den Mund tief Luft, da er nicht durch die Nase atmen wollte.
»Lass uns die Sache nochmal durchgehen. Wir gehen die Straße runter, dann nach rechts, über den Parkplatz, alles ganz ruhig und entspannt ...«
»Entspannt? In dem Outfit?«
Der Pirat stöhnte.
»Vertrau mir endlich! Rein in den Laden. Schmuck, Brieftaschen, Smartphones und schwuppdiewupp ... sind wir wieder raus.«
Gimli seufzte.
Vor ihnen schlurfte Flaschen-Heiner an einen Papierkorb und suchte nach Pfandflaschen. Er hatte keinen Erfolg bei seiner Suche. Der Müllbehälter war leer. Heiner drehte sich um.
Blickte direkt in die Frontscheibe.
»Scheiße«, murmelte Gimli und duckte sich instinktiv.
Sparrow allerdings winkte dem Flaschensammler fröhlich zu. Der Flaschensammler schien das nicht wahrzunehmen. Nach einem Moment lief er an dem Jeep vorbei.
»Du bist echt eine Pfeife. Hier drin ist es dunkel. Man sieht uns nicht. Reiß dich bloß zusammen.«
»Ja, ich bin nervös. Na und! Ich hab so was noch nie gemacht.«
»Oh, Mann. Ich mach das ja auch nicht jeden Tag. Aber du hast gesagt, du bist dabei. Dann gilt ganz oder gar nicht.«
»Du bist echt voll bei der Sache, was?«
Gimli sah den Piraten von der Seite an. Dieser blickte mit einem Hundeblick durch die Kajalaugen zurück. Dann zwinkerte er ihm zu.
Wie will der die Schminke eigentlich so schnell abkriegen?, ging es Gimli durch den Kopf.
Ich kann dieses bescheuerte Zwergenoutfit einfach irgendwo hinwerfen, noch bevor ich in der Metro bin.
»Was soll schon passieren?«, gab Jack zurück. »Ich habe alles geplant. Mit so was rechnet da drin kein Mensch. Die fühlen sich sicher. Ist ja keine Bank. Der Überraschungseffekt ist auf unserer Seite. Es kommt auf das Timing an! Also: Uhrenvergleich!«
»Ja, ja, schon gut.«
Sie sahen beide jeweils auf ihre Armbanduhren und gaben einander die Zeiten an.
Ich bin nur der Fahrer, versuchte Gimli, sich zu beruhigen. Er wollte gerade den Mund aufmachen und noch etwas fragen. Oder etwas sagen. Etwas, das die Sache noch ein wenig hinauszögerte, aber der Pirat kam ihm zuvor.
»Es ist soweit!«
Beide sprangen links und rechts aus dem Jeep und zogen die Pistolen. Ohne noch weiter auf ihre Umgebung zu achten, huschten sie aus der Nebenstraße heraus. Die Hauptstraße, ›Paseo de Europa‹, war mit ihren Laternen und der Schaufensterdekoration fröhlich erleuchtet. Ein schöner Herbstabend. Laub wehte leise über den Asphalt. Die Luft war nicht zu kalt. Ein wenig feucht aber wenigstens regnete es nicht.
Sie bogen um die Ecke und eilten auf das ›Chez Serge‹ zu.
Ab jetzt gab es kein Zurück mehr.
Auf dem Parkplatz davor standen einige Autos. Stellplätze waren in Vakkerville rar, gerade hier ringsum das Restaurant und entlang der Einkaufsmeile, eigentlich rar.
Seltsam, dass die Straße um diese Zeit beinahe wie leer gefegt wirkte.
Sparrow lief schnurstracks über die Fläche zwischen den Autos durch. Er erreichte als erster die Tür, die zur Hälfte aus Milchglas bestand. Dadrüber zierten goldenen Lettern den Eingang mit dem Namen des Restaurants.
Der Freibeuter stieß den Flügel auf und trat mit Schwung ein. Hob die Pistole.
Bevor Gimli hinter ihm eintreten konnte, wurde er unsanft beiseite gestoßen. Ein schwarz gekleidetes Mädchen drängte an ihm vorbei.
Hey, pass doch auf, wäre es Gimli beinahe rausgerutscht. Dann fiel ihm zum Glück blitzartig ein, dass er dabei war, einen Überfall zu verüben. Das Mädchen rannte die Straße hinunter. Der Zwerg erkannte, dass es etwas fallen gelassen hatte.
Ein Smartphone in einer schwarzen Hülle im Gothic-Style. Ein bleiches Gesicht, das wie ein Rohrschach-Test bemalt war.
Gimli bückte sich automatisch, um es aufzuheben.
»Hände hoch, das ist ein Überfall!«, ertönte vor ihm Sparrows quäkende Stimme.
Der Zwerg steckte das Handy blitzschnell weg. Trat entschlossen neben Jack. Versuchte, mit einer ganz tiefen Stimmlage ... so wie es die Girls mochten, wenn sie ihn baten, dass er ›die Marlene Dietrich‹ zu machen ...
Was einem in so einem Moment alles durch den Kopf geht. Dann brüllte er:
»Und wenn sich nur einer von euch stinkenden Pimmeln rührt ...«
Das wollte er schon immer mal sagen. Jetzt fing die Sache an, auch ihm Spaß zu machen.
* * *
Das ist jetzt aber nicht Johnny Depp, dachte Iida Szabó enttäuscht, als sie, ihre Tochter verfolgend, beinahe mit der Gestalt zusammenprallte, die plötzlich in der Tür des ›Chez Serge‹ auftauchte.
Lichie huschte an dem Piraten vorbei, bevor sie von dem dahinter auftauchenden Zwerg aufgehalten werden konnte.
Nein, es war nicht Johnny Depp. Viel zu dick. So ein teigiger Typ. Wie diese Diktatorenfamilie, die seit hundert Jahren in Nordkorea herrschte.
Aber im Outfit von Captain Jack Sparrow mit Dreadlocks, Kajal, Ringen, sogar einer Pistole. Nur, irgendwie gar nicht so ein Piratending.
Der speckige Typ stieß Iida Szabó unsanft beiseite, bevor diese ihrer Tochter aus der Tür heraus folgen konnte. Unnötigerweise brüllte er:
»Hände hoch, das ist ein Überfall!«
Als ob das anhand der Waffen nicht schon zu erkennen gewesen wäre. An ihm vorbei schob sich Gimli aus ›Der Herr der Ringe‹. Für einen Zwerg war er allerdings viel zu groß und anstelle einer Axt hob er zwei Maschinenpistolen:
»Und wenn sich nur einer von euch stinkenden Pimmeln rührt ...«
Das kenne ich irgendwoher, dachte Iida Szabó. Wahrscheinlich aus einem alten Film. Sie mochte alte Filme. Was einem so alles durch den Kopf ging, obwohl gerade zwei Verkleidete dabei waren, das beste französische ...
Gimli stieß Iida ebenfalls unsanft beiseite, so dass sie sich wie eine Flipperkugel vorkam, bevor sie den Gedanken zu Ende bringen konnte, dass es strenggenommen, ein ›bretonisches Feinschmeckerrestaurant‹ war. Das beste der Stadt.
Hier war sie nun also. Statt eines gepflegten Essens, ein Tennisball im Duell zweier Wahnsinniger. Seltsamerweise spürte Iida keine Panik. Nur etwas Trauer.
Dabei hatte der Tag so schön angefangen.
Wenn es doch wenigstens wirklich Johnny Depp wäre, der da gerade mit der Pistole fuchtelnd ... Sie schniefte. Dann spürte sie, wie ihr die Tränen aus den blauen Augen kullerten.
Familienaufstellung (Einige Tage zuvor)
Iida sog den Duft durch ihre Nasenflügel ein.
»Das ist der Hauch eines Herbstwaldes im Nebel«, flötete die Verkäuferin mit affektiertem Gehabe, verdrehte die Augen, als würde sie den Orgasmus ihres Lebens erleben und breitete wie ein Teenager auf der Bühne einer Castingshow die Arme aus, »würziges Harz vermischt mit der Kühle des herannahenden Winters. Elegant und geheimnisvoll. Erdig. Wie die bunten Blätter des Herbstes ...«
Die Verkäuferin, eines dieser magersüchtigen Models, die es immer irgendwie schafften, wie ein verführerisches Girlie auszusehen, obwohl sie den Körper einer Hungerstreikenden hatten, verlor sich regelrecht in ihren Ausführungen, die sie inbrünstig deklamierte.
Iida warf einen flüchtigen Blick in einen der goldumrahmten Spiegel. Wann hatte sie aufgehört, so eine unwiderstehliche Erscheinung zu sein? Waren die Hüften breiter und die Brüste kleiner geworden?
»Passend zum Herbst des Lebens?«, fragte Iida Szabó die Servicekraft mit einem diabolischen Unterton. Erwischt. Was jetzt? Da stehen dir die vollen Lippen unter den klimpernden, großen Augen offen. Ihr Blick schweifte flüchtig über die Verkäuferin und dann nach draußen.
Gegenüber lächelte ihr Mann von einem Plakat herunter. Selbstbewusst. Vertrauenserweckend: ›Für Sicherheit und Wohlstand.‹
Das Girlie verschluckte sich.
»Nein, natürlich nicht. Frau ... äh ...«, die Kulleraugen unter den Wimpern folgten dem Blick der Kundin zum Wahlkampfplakat auf der anderen Straßenseite, »Frau Innens ... also ... ähm ... Frau Szabó ... natürlich nicht. Es ist mehr ... der Duft des ...« Sie war eindeutig aus dem Konzept gebracht und vergaß ihre auswendig gelernten Werbetexte, die der Hersteller den Packungen beilegte.
Iida winkte großzügig ab und schenkte der Verkäuferin ein verständnisvolles Lächeln. Nichts für ungut, sollte es bedeuten. Die Anorexe machte doch auch nur ihren Job. Jung, engagiert und karriereorientiert.
Als ich jung war, habe ich mich auch für unbesiegbar und unsterblich gehalten. Dann ließ Iida den Papierstreifen mit der Duftprobe achtlos in einen Eimer aus gebürstetem Metall fallen, der nicht größer war als eins von Kristófs Whiskeygläsern. Was für bescheuerte Abfalleimer, die sie in diesem Laden hatten. Langweilig. Nahm sie lieber einen Schal? Es wurde kalt jetzt im Herbst, wo der Winter in den Startlöchern lauerte.
Ihr Blick schweifte durch die Boutique. Über die Gestalt der Angestellten, die erwartungsvoll verharrte, wie diese Kandidatinnen in den Shows, kurz bevor die Jury ihr Urteil sprach. Ein Outfit zwischen künstlich punkig, auf schmuddelig gemacht, aber mit dem eindeutigen Hinweis, dass es teuer war.
Iida seufzte im Inneren auf, dann sah sie wieder zum Plakat ihres Mannes.
Gut sah er aus. Keine Frage. Er erinnerte an Alec Baldwin. Das erste Grau in den Haaren stand ihm ausgezeichnet, genauso wie die zarten Krähenfüße an den Augen.
Iida ließ für einen Moment die Lider fallen. Die Gerüche in der Boutique waren mittlerweile so aufdringlich, dass sie sich nicht mehr entspannen konnte. Ich werde jetzt einfach gehen, dachte sie und öffnete die Augen ...
Draußen vor dem Fenster stand ein Mädchen. Ein grauer Schemen, dessen Umrisse verschwammen. Die Arme hingen an den Seiten hinunter. Das Gesicht, bleich, gräulich wie alter Putz. Von dunklen Rissen durchzogen, als wären die Adern mit schwarzer Tinte gefüllt und würden durch die dünne Haut schimmern. Der starre Blick fixierte Iida, brannte sich durch ihre Iris ins Hirn. Es fühlte sich wie eiskalte Kanülen an, die ihr in den Kopf gejagt wurden. Am schlimmsten war allerdings, dass das Mädchen gar keine Augen hatte. Nur ausgeschabte Höhlen, in denen sich eine unendliche Schwärze auftat.
Iida keuchte und sackte zusammen.
»Frau Szabó ...« Der Aufschrei der Verkäuferin drang nur schwach in ihr Bewusstsein.
Iida stolperte rückwärts, presste die Fäuste auf die Augen. Die Angestellte konnte sie kaum auffangen, sodass beide gemeinsam erst gegen die Theke stießen und dann zusammen in dem cremefarbenen Sessel landeten.
Die Verkäuferin arbeitete sich bemüht eilig und im Versuch, ihre Kundin noch weniger zu berühren, als es bei dem vereinten Sturz bereits geschehen war, unter Iida hervor. Ließ sie allein in dem thronähnlichen Möbelstück zurück.
»Frau Szabó, soll ich Ihnen ein Glas Wasser holen?«
Iida nickte, hielt die Hände weiter vor dem Gesicht. Diesen Anblick wollte sie nie wieder sehen. Nach einer gefühlten Ewigkeit trat die Servicekraft an sie heran.
»Bitte.« Sie hielt Iida ein Glas Wasser hin. Diese nahm vorsichtig die Hände herunter. Vermied es aber partout, in Richtung Schaufenster zu blicken, griff nach dem Glas und trank es langsam in gleichmäßigen Schlucken leer.
»Sie sehen aus, als hätten Sie einen Geist gesehen.«
Iida gab das Glas mit zitternder Hand zurück.
»Na ja«, giggelte die Verkäuferin, nachdem sie zum Fenster geschaut hatte, »da kann man sich schon mal erschrecken. Aber der ist harmlos. Den kennen doch alle im Viertel«, plapperte sie.
Iida wagte einen vorsichtigen Blick:
Kein Mädchen ohne Augen. Da stand nur dieser Flaschensammler. Er schien nichts Bestimmtes in der Boutique anzuschauen.
Iida atmete auf. Ja, den Flaschen-Heiner kannte jeder in Vakkerville. Der Obdachlose drehte sich vom Fenster weg, hin zum Abfallkorb an der Laterne.
Eine Initiative hatte über den Papierkörben Aufkleber angebracht. Darauf bat man, Pfandflaschen nicht in die Abfallbehälter zu werfen, sondern danebenzustellen. Für Leute wie ihn. Damit sie nicht im Dreck, zwischen Essensresten, Zigarettenkippen und wer weiß-was-noch-allem nach dem suchen mussten, womit sie ihren Lebensunterhalt verdienten.
Bei Flaschen-Heiner war man in einem Punkt uneingeschränkt einig.
»Dieser Flaschensammler ... der ist nicht wie andere Clochards. Oder Junkies oder so. Der riecht immer total sauber. Immer so nach Creme ... Wie der das bloß macht? Ich meine, wo geht der denn duschen?«
Das Geplapper der Verkäuferin plätscherte an Iida vorbei.
»Nur der Kreislauf«, murmelte sie.
Nickte. Ja. Der arme Kerl war zwar völlig verrückt, aber harmlos.
Iida richtete sich auf. Ein guter Moment, um zu gehen. Dieser Geruch und diese Musik hier. Sie ertrug es nicht mehr. Die Verkäuferin begleitete ihre geschätzte Kundin noch bis zur Tür.
Iida sprang in den feuchten Dunst des Abends auf der ›Sällskapsvägen‹, die Straße mit den edelsten Boutiquen in ganz Vakkerville, wie ein Delfin aus dem Meer herausbrach. Saugte ihre Lungen mit Luft voll.
Der leichte Nebel filterte das Licht des Schaufensters, das sich auf den Gehweg ergoss.
Der Flaschensammler und Iida wurden von einer plappernden Gruppe japanischer Touristen umspült wie eine Klippe im Meer vom Wasser. Selfiestangen reckten sich in die Höhe. Nebenan verließen mehrere Krawattenträger den ›After-Work-Lunch‹ im ›Seifrieds‹.
Heiner tänzelte zwischen den Japanern hindurch. Streifte Iidas Arm.
»Immer außerhalb des Rasters bleiben«, murmelte er, »immer in Bewegung bleiben.«
Die Asiaten lächelten beflissen und nickten freundlich. Der Obdachlose pirschte sich an den Papierkorb zu Füßen der Laterne heran, wie ein Indianer an das Wild.
»Kein guter Tag heute. Kein guter Tag«, ging das Flüstern weiter. Sein Haar war lang und wirr, sein Bart so dicht, dass man das Gesicht darunter kaum erkennen konnte.
Gestern war er am ›Temple‹ unterwegs gewesen. Da war gut was zusammengekommen. Die Kids schmissen ihre Bierflaschen, mit denen sie ›vorglühten‹, um die teuren Drinks bei der ›Dance-Night‹ zu sparen, immer einfach weg. Für Heiner entsprach ihr Gegenwert Essen und Trinken für einen halben Monat. Der Winter stand vor der Tür. Er würde einen neuen Schlafsack brauchen.
»Gegen die Kälte. Nur gegen die Kälte«, flüsterte er, »nicht zum Schlafen.« Ein Kichern folgte. Das konnte man ja denken, wenn man das Wort Schlafsack hörte. Dass er den zum Schlafen brauchte. Aber Heiner schlief nicht. Seit Jahren.
»Schlafen ist nicht gut. Ab und zu mal hinlegen. Ja. Etwas ausruhen, mein Freund. Und immer woanders. Niemals den gleichen Platz benutzen. Immer andere Wege. Immer außerhalb des Rasters bewegen. Niemals schlafen. Beim Schlafen dringen sie in dein Hirn ein. Pflanzen dir Gedanken ein. Wünsche und Bedürfnisse, mein Freund. Damit du im Wachzustand all die Sachen kaufst, die du nicht brauchst.«
Heiner wusste Bescheid.
Die Leute im Viertel kannten ihn. Es war ein schönes Viertel. Man kannte sich. Manche gaben ihm zu essen, einige etwas Kleingeld.
In ›Çelals Süpermarket‹ sah man ihn niemals schief an, wenn er die Flaschen abgab. Er mochte den Laden, da es dort keinen Alkohol gab. Alkohol war nicht gut. Machte unaufmerksam. Machte schläfrig. Heiner nickte vor sich hin. Ein feines Viertel, mit guten Leuten. Aber man durfte ihnen dennoch nicht trauen.
»Immer in Bewegung bleiben«, murmelte er weiter, »sie beobachten dich. Sie beobachten alles, mein Freund.«
Heiner wandte den Kopf nach oben zur Hauptstraße, an der das ›Chez Serge‹ lag und ließ seinen wirren Blick zur Kamera am Laternenpfahl gleiten.
Die Kameras in dieser Straße waren fest ausgerichtet, sodass Heiner keine Probleme hatte, in ihrem Schatten vorbeizuhuschen.
»Sie beobachten dich.«
Iida sah, wie er mit einem silbrigen Gegenstand in seiner Hand spielte. Manche Leute im Viertel unterstützten ihn auch mit etwas anderem als Geld oder Lebensmitteln. Der Beutel an seiner Seite klirrte mit der mageren Ausbeute des heutigen Streifzugs. Heiner war so unter Schichten verschiedener Sachen verborgen, dass niemand sagen konnte, ob er dünn oder eher normalgewichtig war.
Der Flaschensammler huschte geduckt, wie ein Frontsoldat im Sperrfeuer, über die Straße. Hielt dabei den Blick auf das Ding in seiner Hand gesenkt.
Achtete nicht auf entgegenkommende Passanten, die ihm aber alle auswichen. Wenn auch der eine oder andere gehetzte Feierabendpendler ihm einen entnervten Blick zuwarf.
Iida beobachtete die Szenerie, und ihre Mundwinkel zogen sich nach oben. Fast konnte man Heiner bei seiner Beurteilung der anderen Bürger zustimmen.
Spurtete im Zickzack über den Bürgersteig. An dem Wahlplakat von Kristóf Szabó vorbei. Versuchte, nicht allzu lange im Licht der Schaufensterauslagen zu bleiben.
Er würde demnächst wieder über den Zaun dieses großen Internethändlers klettern müssen. Dort, wo sie die Pakete packten. Die Pakete mit all den Sachen, die die Leute im ›World Wide Web‹ bestellten. Heiner war ein Mann der ersten Stunden, darum sagte er niemals: Internet. Aber die Leute kauften da ein. Weil man im Schlaf mit ihnen diese Experimente machte. Jetzt konnten sie all den Botschaften auf den Plakaten, an den Bussen und in den Schaufenstern nicht mehr widerstehen. Aber die Luftpolsterfolie, die sie zum Verpacken all der nutzlosen Sachen verwendeten, die war gut, wenn es kalt wurde. Wärmte.
Heiner blieb abrupt stehen. Als wäre er gegen eine Wand gerannt.
Starrte auf das Ding in der Hand. Die Finger tänzelten auf dem silbrigen Glänzen wie seine Füße auf dem Asphalt.
»Eine Tür. Eine Tür ist aufgegangen!«
Heiner kribbelte es, als würden tausende von Ameisen über seine Haut laufen.
»Das ist es! Da!«
Ein Teenagerpärchen sah ihn erschrocken an.
Heiner lachte. Das war das, worauf er gewartet hatte. Eine Tür. Ja. Eine Tür, durch die er hindurchsehen konnte.
Iida beobachtete verwundert, wie der Flaschensammler einen grotesken Tanz aufführte. Wie ein Derwisch.
»Es ist soweit. Die Tür. Die Tür ist offen!« Er schlenkerte mit den Armen, während er sich im Kreis drehte.
Das Ding in seiner Hand warf ein silbernes Licht auf das Gesicht des Obdachlosen, sodass es diesem ein metallisches Schimmern verlieh. Die Augen glänzten vor Freude. Oder doch vor Wahnsinn?
Der könnte auch ohne Verkleidung zu Halloween gehen. Iida Szabó schüttelte den Kopf.
»Das ist es. Ich sehe euch. Heute sehe ich euch. Nicht ihr mich. Ich beobachte euch. Heute bin ich der Jäger ...«, brabbelte Heiner.
Sie starrte ihn an. Ihre Nackenhaare stellten sich auf. Mit einem Mal fühlte sie sich schwindlig. Als trüge sie das erste Mal Kontaktlinsen. Bei der Bewegung des Kopfes hatte sie das unwirkliche Gefühl, das Bild würde am Rand ihres Blickfeldes nachgezogen werden. Als würden die Augen das Gesehene zwar erfassen, aber das Hirn es erst den Bruchteil einer Sekunde später verarbeiten. Sodass sich das eben noch Erblickte mit dem jetzt vor den Augen liegenden Bild für einen Moment überschnitt.
Die ›Sällskapsvägen‹ vor ihr schien sich mit einem Mal in die Länge zu ziehen. Als wäre am Ende ein Strudel, der alles in sich hinein saugte. Die Fronten der Häuser verschwammen, als wären sie mit Wasserfarben gemalt, die noch nicht trocken waren, und ein feuchter, breiter Pinsel würde darüber weggezogen. In Richtung des alles verschlingenden Schlunds am Ende ihres Blickfelds.
Iida bemerkte einen Schemen im Spiegelbild einer Fensterscheibe.
Sie drehte sich vorsichtig im Kreis. Niemand. Zu beiden Seiten zog sich die Straße unnatürlich lang. Wie ein gestrafftes Gummiband. Durch die Spannung waren keine Einzelheiten mehr auszumachen. Die Farben schienen zu verblassen. Selbst die Beleuchtung wirkte trüb. Iida spürte den Sog, das Ziehen des Strudels bis in die Knochen. Als befände sie sich in einem Luftkanal. Ihre Umgebung erschien ihr wie das Foto einer befahrenen Straße bei Langzeitbelichtung.
Außer ihr und dem Flaschensammler war niemand in der Straße.
Die Läden waren alle geschlossen. Graue Spinnweben überzogen Eingangstüren, die Scheiben waren teilweise gesprungen. Schmutziger Staub bedeckte die leer gähnenden Auslagen. Manche Türen waren mit alten Brettern vernagelt.
Da.
Erneut ein Schatten. Es schien, als würde er von einer Scheibe zur anderen huschen. Wie das Spiegelbild der Landschaft in den Scheiben eines vorbeifahrenden Zuges. Immer wieder von den Zwischenräumen unterbrochen.
Iida konnte sich nicht mehr rühren. Ihre Augen wurden von dem Schatten angezogen. Er huschte durch eine Scheibe, tauchte in der nächsten wieder auf, glitt hindurch, als wären die Mauern dazwischen Türen, die sich vor ihm automatisch öffneten. An der nächsten Häuserecke sprang der Schemen auf den Gehsteig. Drehte sich zu ihr um.
Ein kleines Mädchen in einem Kapuzenzipper, sodass das Gesicht im Schatten lag. Iida konnte die Augen nicht sehen.
»Es beginnt wieder«, erklang ein Flüstern in ihrem Kopf. Sie konnte es unmöglich gehört haben.
Das Kind war so weit weg ... Das Kind?
Iida blinzelte. In ihrem Kopf hämmerte es. Sie spürte ihr Herz gegen die Rippen schlagen.
Da war kein Kind.
Die Lichter und Farben der ›Sällskapsvägen‹ waren hell und bunt. Jedes Detail in den Auslagen perfekt ausgeleuchtet. Bars und Boutiquen gossen einen warmen, freundlichen Schein auf den Asphalt, der dem trüben Grau des Herbstes trotzte. Stimmen drangen an Iidas Ohr. Das fröhliche Geplapper ganz normaler Menschen.
Anstelle eines eingebildeten Kindes verschwand nur der Flaschensammler trippelnd um die Ecke.
Die Gruppe der Asiaten kreiselte immer noch um sie herum. Einige hörten tatsächlich auf zu lächeln und warfen ihr nachdenkliche Blicke zu.
Iida tastete mit der Hand nach der Fassade. Zwang sich, bewusst zu atmen, während ein Frösteln ihre Haut überzog. Damit sie nicht noch einmal zusammenklappte. Nicht hier auf der Straße, zwischen all den Leuten.
* * *
»Ich stehe für eine Stärkung der Demokratie und der demokratischen Bürgerrechte. Wir wollen Volksabstimmungen und Initiativen einführen. Das gilt insbesondere für die Abtretung wichtiger Befugnisse an die EU.« Kristóf Szabó lächelte charmant in die Kameras und zwinkerte der Fragestellerin zu. »Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit. Schluss mit der Korruption. Schluss mit der Bevormundung durch die EU.«
Die Journalistin fiel allerdings nicht auf die Alec Baldwin-Pose herein. Sie streckte ihm ihr digitales Aufnahmegerät entgegen, als wäre es ein Revolver:
»Wie stellen Sie sich nach Ihrer möglichen Wahl zum Bürgermeister die Zukunft Vakkervilles vor?«
Szabó reckte das Kinn.
»Ich werde die Werte bewahren, die unser Viertel ausmachen. Dies ist eine Heimat für ehrliche, freiheitlich denkende und handelnde Bürger. Für die Familien, die hier seit Generationen leben und arbeiten. Der Schutz der Familie als Keimzelle der Gesellschaft ist die wichtigste Investition in unsere gemeinsame Zukunft.«
Kristóf sprach die Blondine direkt an. Mit einer Stimmlage, als würde er sie zu einem Abendessen im ›Chez Serge‹ einladen.
Die Journalistin senkte für einen Moment die Wimpern. Auf ihren Wangen zeichneten sich Grübchen ab.
»Ich stehe für Sicherheit und Wohlstand. Vakkerville wird seinem Namen wieder voll und ganz gerecht werden. Für alle, die sich hier einbringen und nicht nur auf Kosten anderer den Rahm von der Milch abschöpfen möchten. Das muss auch klar sein. Es geht hier nicht nur darum, was ich als zukünftiger Bürgermeister für uns tun werde. Es geht vor allem auch darum, was jeder Einzelne, auch Sie, meine Damen und Herren von der Presse, für dieses Viertel schaffen kann. Gemeinsamkeit ist das Wort der Stunde.«
»Was sagen Sie, Herr Szabó, zu solchen Aktionen wie die Zwangsräumung der Familie Üzal letztens?«, schoss ein Typ mit Nerdbrille, Norwegerpulli und Schirmmütze dazwischen.
Einer dieser neuliberalen, linken Blogger. Der mehr Follower hatte als manche Fernsehshow. Vor allem messbar. Diese Kanäle müssen genutzt werden.
»Soweit mir bekannt ist, hatte der Eigentümer zunächst einmal eine Räumungsklage durch das zuständige Amtsgericht zugesprochen bekommen. Zu der Richtigkeit dieses Urteils kann ich im Moment nichts sagen, da ich die Hintergründe nicht kenne.«
»Sie sind aber immer noch Innensenator. Insofern dürfte die Eskalation bei der Räumung, in Ihrer Verantwortung für die Polizei, doch durchaus in Ihr Ressort fallen.«
»Eine sehr gute Frage. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie dieses Problem aufwerfen. Offensichtlich kam es im Verlauf der, zunächst einmal völlig gesetzeskonformen, Räumung leider zu einer Situation, die sich keiner wünscht. Ich garantiere Ihnen, dass wir die Vorgänge und Hintergründe genauestens untersuchen werden und mit den Verantwortlichen ...«, Szabó gab seinem Medienberater den vereinbarten Wink, »... auch die entsprechenden Gespräche führen werden, damit so etwas in Zukunft rechtzeitig vermieden wird.«
»Meine Damen und Herren!« Der Spin-Doctor, ein engagierter Typ im Nadelstreifenanzug und Undercut sprang auf. Er klatschte in die Hände wie ein Alleinunterhalter auf dem Kindergeburtstag. »Wir danken Ihnen, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Leider muss Herr Szabó jetzt noch zu einem Interview mit einer englischen Tageszeitung.«
Kristóf winkte den Journalisten jovial zu. Ganz der Entertainer. Dann verließ er den Raum. Tänzelnd wie ein Showmaster die Bühnentreppe. In seinem Kopf rauschte imaginärer Applaus.
»Ähm ... wie war noch mal der Name? ... egal ... Ich habe Ihnen gesagt, dass diese Scheiße zu viel Medieninteresse nach sich zieht.«
Der Spin-Doctor strich sich durch den geölten Bart.
»Aber für die Presse ist es wichtig. Den Leuten stößt es auf, dass hier Leute aus Italien, Spanien oder China über Makler Immobilien aufkaufen, die sie nie gesehen haben. Mit Entmietungen und Luxussanierungen, die auch noch vom Senat gefördert werden, werden Immobilien geschaffen, die sich kein Alteingesessener mehr leisten kann. Wer also wird in Zukunft darin wohnen? Niemand! Das werden Ferienwohnungen.«
Szabó sah aus dem Fenster. Auf die ›Rue Lamothe‹, mit ihren Fassaden aus groben Natursteinen und den Fensterrahmungen aus bunter Keramik. Mit Treppenhäusern, deren Verzierungen aussahen wie in Tropfsteinhöhlen erschaffene Sakralbauten.
»Wissen Sie ... ähm ... also, wie auch immer ... in dieser Gegend bin ich groß geworden.« Er nahm den Spin-Doctor bei der Schulter und brachte ihn so dazu, seinem Blick zu folgen.
»Im Hoffmanpark habe ich gespielt, und die Vorstadtplattenbauten sind damals genauso weit weg gewesen wie die Bankenhochhäuser am Meer. Das Altstadtviertel ist mein Spielplatz gewesen.«
Ein wehmütiger Hauch umwehte die Stimme des Innensenators. Er wies mit dem Finger auf die Stadt zu ihren Füßen.
»Dort, wo jetzt nur noch Touristen angekarrt werden, denen nicht auffällt, dass sie in den Kiezrestaurants ausschließlich neben anderen Touristen sitzen. Hier bin ich als Bürgermeister gefragt. Die gesamte Immobilien- und Baubranche ist ein einziger Korruptionssumpf. Das muss enden.«
Der Spin-Doctor nickte begeistert.
»Aber alles zu seiner Zeit. Das ist ein heikles Thema. Wir müssen die Balance zwischen Investitionen in die Zukunft und der Erhaltung der Strukturen bewahren.«
Kristóf Szabó ließ den jungen Mann mit dem Tablet in der Hand und drei Smartphones am Gürtel stehen, um die Treppen wieder hinunter zu gehen.
»Bereiten Sie entsprechende Erklärungen für die nächste Pressekonferenz, oder, noch besser, gleich für das TV-Duell mit der Hayato von den Sozis vor. Die wird sich das Thema sicherlich zu eigen machen wollen. Zeigen wir ihr, dass auch wir Konservative durchaus diese Entwicklung unserer Stadt mit, sagen wir, zumindest einem kritischen Blick betrachten.«
Der Berater wischte über sein Tablet und nickte wieder.
»Sie sind jetzt aber auch noch als Innensenator gefragt. Es müssen wegen der Zwangsräumungsgeschichte ein paar Köpfe rollen. Sonst verlieren wir an Glaubwürdigkeit. Gerade vor dem Duell. Die Linken haben sich das Thema Gentrifizierung ganz groß auf die Fahnen geschrieben.«
Szabó drehte sich noch einmal zu seinem Berater um.
»Die Vertreibung der Alteingesessenen, die sich den Kiez nach der Modernisierung nicht mehr leisten können. Es geht mittlerweile nicht mehr nur um Künstler und Studenten. Ganz normale Familien aus der Mittelschicht, Leute, die ganz normale Vollzeitjobs ausüben, können die Mieten nicht mehr bezahlen, weil reiche Zugezogene den Kiez kaputt machen. Das ist hochaktuell.«
Der Innensenator nickte und warf einen Blick auf seinen Instant-Messenger.
»Finden Sie heraus, wen wir als Bauernopfer nehmen können. Sie haben recht. Ein paar Demonstranten gegen die Räumung wären nicht weiter aufgefallen.« Er las ein paar ›Tsukai-News‹ durch.
Das Aufgebot von 300 Polizisten würden die Sozis als ›übertrieben‹ und ›unnötige Polizeigewalt‹ bezeichnen. Ohne dabei zu beachten, dass ein paar Spinner wieder mal den arabischen Schriftzug ›Intifada - Widerstand‹ an eine Wand gesprüht hatten. Er würde ihnen in der TV-Diskussion entgegen halten müssen, dass sich mit solchen Aktionen der Gegendemonstranten wieder die Angst vor Terrorismus breitmachen würde. Das konnte ja auch nicht im Sinne der Linken sein. Denken wir doch alle an die Zeiten zurück, als die sogenannten ›Gotteskrieger‹ noch aktiv waren.
Szabó nickte sich selbst zu, straffte die Schultern und rückte seine Krawatte zurecht.
Man nannte es nicht umsonst Wahlkampf. Dies hier war Krieg und im Krieg musste man Opfer bringen.
Er sah vom Messenger auf und den Wahlkampfleiter an:
»Bieten Sie dem Polizeipräsidenten eine schöne Pension im vorgezogenen Ruhestand an, wenn er die Verantwortung übernimmt und zurücktritt. Wir verkaufen das dann medienwirksam. Alt genug ist Heikkinen ja. Soll er sich doch auf seine Berghütte zurückziehen und Bordercollies züchten.«
Ein sarkastisches Grinsen umspielte die Lippen des Innensenators, das sein Charisma unterstrich, da es, wie bei dem amerikanischen Schauspieler in einer seiner wenigen ›bösen‹ Rollen durchaus immer noch eine gehörige Portion Charme ausstrahlte.
* * *
Ein sakraler Choral erhob sich aus dem Nichts. Langsam anschwellende Orchestersounds mischten sich hinein. Wie eine Flutwelle schob sich die Musik heran. Und dann:
Bang. Bang. Bang! Paukenschläge. Eine flirrende Gitarre über einer vibrierenden Basslinie.
Das Mädchen schüttelte die schwarzen Haare, sodass sie wild um ihr bleiches, schmales Gesicht wirbelten. Schwang die Arme mit den dunklen Lederbändern und knochenfarbenen Perlenketten wie Windmühlenflügel. Unter dem schwarzweiß gestreiften Shirt zeichnete sich die begonnene körperliche Veränderung ab, ebenso wie an den Hüften, die von mehreren Nietengürteln geziert wurden.
Sie stampfte mit den Beinen, die in zerrissenen, schwarzen Jeans, roten Strümpfen und Chucks steckten, auf dem Teppich.
»Gib mir deine Hand. Folge in mein dunkles Land. Die Welt hinter den Spiegeln erwacht. Hier beginnt die ew’ge Nacht. Gib mir deinen Zorn und deine Wut, in unseren Adern fließt Schatten statt Blut«, grölte sie mit hoher Stimme zu dem tiefen Bariton, der aus den Boxen dröhnte.
Lilian-Charlotte tanzte sich die Wut aus dem Bauch. Weil sie sich zu dick fühlte. Weil sie ihren Körper hasste. Weil sie ihr Leben hasste. Weil es wieder passiert war. Weil die anderen Mädchen sie diesmal nicht einfach nur geärgert hatten.
Gut. Es hatte auch einen Vorteil. Damit es nicht ganz so bescheuert aussah, musste ihre Mutter dem Undercut einfach zustimmen ... Radikale Umstände verlangten radikale Lösungen. Das war kein Wahlkampfslogan ihres Stiefvaters, das hatte der ›Nachttaucher‹ in einem seiner wenigen Interviews gesagt. Der ›Nachttaucher‹, dessen Stimme durch die Boxen in die Ohren und das Herz des Mädchens drang.
Es hatte verträumt in der Pause auf dem Schulhof gestanden, als sie plötzlich einen ekelerregenden Geruch in der Nase hatte. Um die Ursache zu ergründen, hatte sie sich umgedreht, und dabei war Marlene schnell zurückgesprungen. Das Feuerzeug noch in der Hand.
Panisch hatte Lichie mit der Hand an ihren Hinterkopf geschlagen und so die Flammen erstickt. Der Gestank war bestialisch und er blieb.
Marlene tanzte, vom Gekicher ihres Fanclubs begleitet.
»Es muss ja erst mal brennen«, sang die Zicke und wies dabei auf das Shirt ihrer Lieblingsband, das Lilian-Charlotte trug.
›In mir schwelt die schwarze Glut!‹, prangte dort in verschnörkelten Buchstaben um ein arabeskenhaftes Symbol herum.
Tränen der Wut stiegen ihr in die Augen.
Marlene lachte laut und stachelte die anderen drei Mädchen damit noch mehr an.
»Litschie. Kleine, fette Litschie.«
Seitdem sie aufgeschnappt hatten, dass ihre Mutter sie ›Lichie‹ nannte, verwendeten sie diese Verballhornung.
Lilian-Charlotte wischte immer noch mit der Hand in den Haaren herum. Voller Entsetzen spürte sie, dass seitlich am Hinterkopf eine Stelle ziemlich kahl geworden war.
Die Mädchengang hatte sie in die Ecke des Schulhofes gedrängt.
»Heule, Litschie, heule. Dann siehst du so aus wie dein Idol! Mit dem verschmierten Make-up. Buuuh!«
Erst das Signal, dass die nächste Stunde bevorstand, hatte Lichie erlöst.
Iida hatte zwar ziemlich erbost in der Schule angerufen, aber ihre Tochter auch gefragt, warum sie die Mitschülerinnen auch mit so einem albernen Shirt regelrecht provozieren musste ...
Schwer atmend blieb sie stehen und warf einen Blick in den ovalen Spiegel an der Wand, dessen Rahmen an ein altes Gemälde erinnerte.
»Nachher kommt ihre Stammfriseuse hierher, und dann muss sie mir einfach einen Undercut machen«, sprach sie laut. Dann sah das Mädchen zu dem Mann neben dem Spiegel. Dieser saß auf einem Thron, der aus bleichen Knochen gebaut war. Die Rückenlehne überragte den Sitzenden um einiges. Er sah müde aus. Wie er sein Doppelkinn in die rechte Faust stützte. Mit seinen Hundeaugen aus dem birnenförmigen Gesicht das Mädchen vor sich betrachtete.
Sein Antlitz wurde von einer aufgemalten Zeichnung bestimmt, die wie dieser Test aussah, den sie in der Klapse machten, um rauszufinden, ob man auch bei der Andeutung eines Schmetterlings an Brüste und Mord dachte.
Am Hinterkopf des Mannes war nur ein Skalp übrig, der in einigen langen Strähnen nach unten fiel. Das war eine keltische Kriegerfrisur.
»Das sagen sie den Frauen auch immer. Dass sie selbst schuld sind, weil sie im Sommer Miniröcke tragen.«
Die Musik verklang, und Lilian-Charlotte unterließ es, das nächste Lied anzuspielen.
Sie ließ sich vor dem Thron im Schneidersitz nieder.
Suchte etwas auf ihrem Smartphone.
»Schau mal«, gab sie nuschelnd von sich und hielt dem Mann ein Bild hin.
Ein typisches Bild. Verlegen grinsende Schüler, die Jungs betont cool, die Mädchen im ersten Versuch, kokett zu erscheinen. Drei Reihen. Die erste Reihe kniete oder hockte. Die zweite Reihe stand ganz normal, während ganz dahinter die standen, die viel größer waren. Die Gesichter aller Schüler und Schülerinnen waren entfernt worden. Sehr geschickt. Mit irgendeiner Grafik-App. Jetzt sah es nämlich so aus, als wären alle Schüler geköpft worden. Ihre Hälse endeten in blutigen Stümpfen. Teilweise lief rote Flüssigkeit noch in Schlieren den Oberkörper herunter. Die Lehrerin hatte zwar noch ihren Kopf, dafür allerdings keine Augen mehr. Ihr Mund war mit Fäden zugenäht.
Das einzige Kind, das noch vollständig und unversehrt erschien und in einer Mischung aus Trotz und Unschuld in die Kamera blickte, hielt eine Kettensäge vor der Brust.
Das Bild war vor dem großen Säulenportal des Eingangs zum Schulgebäude aufgenommen worden.
»Das hab ich gemacht«, fügte Lilian-Charlotte stolz hinzu.
Sie löste sich vom Display ihres Smartphones und sinnierte einen Augenblick lang vor sich hin. Dann sah sie auf und dem Mann fest in die Augen.
»Ich werde dich finden. Du bist bestimmt irgendwo gefangen. Im Landunter. Hinter den Spiegeln. Und wenn ich dich befreit habe, dann gibst du mir ein Stück von der Kraft, solche Dinge hier in der Wirklichkeit zu tun.«
Lichie bestätigte ihre Aussage selbst mit einem Nicken.
Sie drückte die Play-Taste auf ihrem Smartphone und über die Boxen der Anlage ertönte krachend der nächste Song. Ein schneller Gitarrenriff.
»Ich bin ein unendlich’ Ding, ich bin der düst’re Schattenschmetterling.«
Lichie sprang auf und begann wieder, laut mitsingend, zu Pogo zu tanzen. Die Gestalt auf dem Poster an der Wand zeigte weiterhin keine Reaktion.
* * *
»Sie haben ihr die Haare angezündet!«
»Ja, das ist schlimm, Iida. Ich bin ja auch froh, das nichts weiter passiert ist, aber ...«
»Das muss doch Konsequenzen haben, Kristóf. Ich habe ihr ja auch schon gesagt, dass sie dieses Shirt einfach nicht in der Schule anziehen soll. Aber sie ist so besessen von dieser Band. Dieser Musik. Manchmal frage ich mich, ob das was mit ihrem Vater zu tun hat.«
»Das Mädchen muss einfach lernen, sich zu wehren. Sie darf sich nicht alles gefallen lassen.«
»Du bist gut. Die haben ihr ein brennendes Feuerzeug an die Haare gehalten. Weißt du, wie schnell Haare brennen und vor allem, wie das stinkt?«
»Iida, Marlenes Vater gehört nun mal diese Fernsehproduktionsfirma. Wenn ich mich mit dem während des Wahlkampfs anlege, dann streicht er mich von drei Kanälen.«
»Das heißt, die kommt mit der Geschichte ungeschoren davon?«
Pause.
Iida hörte Kristóf atmen.
»Lichie wird uns das nie verzeihen. Wir müssen sie doch beschützen.«
»Schatz, bitte, rede mit ihr. Das Mädchen ist Dreizehn. Sie wird das verstehen. Sobald dieser ganze Wahnsinn vorbei ist ...«
Jetzt holte Iida tief Luft.
»Schatz?«
»Ja.«
»Ich muss jetzt ...«
»Klar.«
»Ich liebe euch.«
Kristóf legte auf.
Iida atmete tief durch.
»Ich krieg das hin.«
Sie legte den Kopf in den Nacken und sah nach oben. So als könne sie durch die Decke in das Zimmer ihrer Tochter blicken. Von dort drang die Musik wie ein waberndes Gas durch die Wände zu ihr hinunter.
Am liebsten hätte sie geschrien, dass Lichie diesen Scheiß leiser machen solle. Nein, das hatte keinen Sinn. Es würde die Situation noch mehr eskalieren lassen. Einfach nur hier raus.
Iida ging durch den Flur und ließ gedankenlos ihre Sachen nach und nach fallen. Diese Tätigkeit wurde von einem Hochziehen ihrer Mundwinkel begleitet. Als sie in ihrem Ankleidezimmer angelangt war und ihr Blick in den Spiegel fiel, seufzte sie auf. Ein romantisches Bild. Der schlanke, vollbusige Körper einer Frau. Mit ausgewogenen Formen und Kurven. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Die Haut immer noch straff. Die Brüste immer noch fest. Selbst von der Geburt ihrer Tochter waren kaum Spuren zurückgeblieben. Zu ihren Füßen zogen sich die abgelegten Kleidungsstücke, wie eine verlockende Spur auf dem Boden entlang. Verloren sich im Nichts.
Iida versank in den Augen ihres Spiegelbilds ...
Große, blaue Augen, mit langen Wimpern. Je länger sie hinsah, desto mehr änderte sich das Bild. Als würde man es in einem Grafikprogramm morphen ...
Die kleinen Fältchen in den Augenwinkeln strafften sich. Die Hautpartie um ihre schmalen Lippen wurde glatter. Das Gesicht spannte sich über den Wangenknochen. Sie fühlte, wie sich ihre Brüste leicht anhoben und die wenigen Spuren, die bisher noch zerknülltem Papier gleich waren, von ihren Oberschenkeln und Hüften verschwanden. Zwei schmale, raue Männerhände legten sich von hinten auf ihren Bauch. Iida lehnte den Kopf an die Schulter des Mannes und betrachtete sein Gesicht im Spiegel. »Larry«, hauchte sie, »ich muss dir was sagen.« Der Mann blickte erwartungsvoll zurück. Tiefe, braune Augen in einem ausgeprägten, markanten Gesicht mit einem weichen, spitzbübischen Zug. Seine unrasierten Wangen und die langen Haare kitzelten auf ihrer nackten Haut. »Ich bin schwanger.« Larrys Hände fielen von ihr herunter, als wäre ihr Bauch plötzlich eine glühende Herdplatte ...
»Arschloch!« Iida streckte der Erinnerung im Spiegel ihren Mittelfinger entgegen. »Wie du siehst: Ich komm auch ohne dich klar. Und, ist dein Leben wirklich so, wie du es dir vorgestellt hast? Hat es sich gelohnt, mich mit deinem Kind im Bauch sitzen zu lassen? Also, Larry-Arschloch-Möchtegern-Rockstar ... Leck mich!«
Sie atmete tief durch und zog nach und nach ihre Outdoorklamotten an.
Stülpte die neongrünen Kopfhörer über, griff nach den Nordic-Walking-Stöcken und ging zurück in den Flur.
Sollte sie Suse anrufen? Ein Blick auf ihre Smart-Watch zeigte ihr, dass ihre beste Freundin noch bei der Arbeit sein würde.
Dann ging sie eben allein. Durch die Straßen des Viertels kein Problem. Dies war eine gute Gegend. Die Nachbarn grüßten und achteten aufeinander. Der leichte Anstieg der neu asphaltierten ›Rue Lanet‹ verschaffte die richtige Trainingseinheit. Vier Runden durchs Viertel, das waren knapp zwölf Kilometer und am Ende könnte sie sich leicht angeschwitzt ins Café setzten und bei Luigi einen Latte Macchiato trinken. Iida war beinahe mit der Welt versöhnt, als sie hinter sich eine Bewegung wahrnahm.
»Lichie?«
Von oben drang immer noch das unerträgliche Gegröle aus dem Zimmer ihrer Tochter.
Iida drehte sich um.
Ein Kind huschte den Flur entlang.
»Was?«
Das Kind blieb am Ende stehen und schaute zu Iida zurück.
»... machst du in unserem Haus?«
Nein. Das konnte nicht wahr sein.
Die kleine Gestalt blickte mit leeren, blutigen Augenhöhlen in Iidas Richtung, um dann um die Ecke in den Wohn-Essbereich mit der amerikanischen Küche zu verschwinden.
»Nein. Nein. Nein!«, kreischte Iida. Trotz der Stöcke in ihrer Hand konnte sie sich nicht mehr halten. Sie wankte. Stützte sich mühsam an der Wand ab, um nicht sofort zusammenzubrechen.
Die Musik im ersten Stock verklang schlagartig.
»Nein. Nein. Nein. Ich will das nicht mehr.«
Iida hockte wimmernd auf dem Boden.
Von oben ertönte Lilian-Charlottes Stimme durch den Lichtschacht.
»Mama?«
Beinahe zärtlich. Der Streit von vorhin schien jetzt Besorgnis gewichen zu sein.
Sie musste sich zusammenreißen. Das Kind durfte davon nichts merken. Lichie durfte nicht erleben, wie ihre Mutter ... Nein!
»Es ist alles gut, Süße.«
Iida holte tief Luft und richtete sich langsam auf, die Hände in die Seiten gepresst.
»Ich bin nur gestolpert, aber nichts passiert.«
Sie wankte noch ein wenig. Dann ergriff Iida ihre Stöcke und stakste vorsichtig weiter.
»Ich gehe ein wenig walken!«
»Alles klar. Super«, ertönte als Antwort, und Sekunden später dröhnte die Musik erneut durchs Haus.
Iida betrat den Essbereich.
Dort angekommen sah sie nur die unaufgeräumten Frühstücksspuren ihrer Tochter und ihres Mannes, der früh das Haus verlassen hatte. Yelyzaveta, die Haushaltshilfe, war noch nicht hier gewesen.
Alles ganz normal.
Sie musste mit Suse reden. Unbedingt.
Iida holte ihr Smartphone heraus und schickte ihrer besten Freundin über ›Tsukai‹ eine Nachricht.
Dann sah sie sich noch einmal im Raum um.
Ihr Atem stockte.
Jemand hatte mit ungelenker Schrift etwas in die Feuchtigkeit der beschlagenen Scheibe der Verandatür geschrieben.
Iida biss sich die Lippen blutig und ballte die Fäuste zusammen.
Irgendwo schlug eine alte Turmuhr, mit einem tiefen Gong. Der Ton vibrierte langnachhallend durch Iidas Nervenkostüm.
»Sandmann, lieber Sandmann, wann kommst du vorbei?«
* * *
Kristóf Szabó starrte auf die Zeilen. Sein erster Gedanke war gewesen, dass es sich hierbei wohl um einen Witz handeln musste. Einen schlechten Witz. Er hatte sogar einen flüchtigen Blick über seine Schulter geworfen, obwohl er wusste, dass niemand außer ihm in seinem Büro war.
Löschen!
Das war sein zweiter Gedanke gewesen, den Finger schon auf der Taste.
Löschen! Dann ist es weg. Dann kann es keiner mehr sehen.
Was natürlich kompletter Blödsinn war.
Der oder die, die ihm das geschickt hatten, verfolgten eine Absicht damit. Und diese würde nicht verschwinden, nur weil er die E-Mail löschte.
Szabó wischte sich kalten Schweiß von der Stirn und dachte nach.
Mitten im Wahlkampf konnte das zu einer absoluten Katastrophe führen.
Er musste einen kühlen Kopf bewahren. Bis jetzt war er noch jeder Klippe geschickt ausgewichen, hatte sich selbstsicher und strahlend im kalten Ozean der Politik bewegt. Hatte sich von keinem Brecher umwerfen lassen, war auf keine Sandbank aufgelaufen.
Die Leute, die ihm diese E-Mail geschrieben hatten, hatten noch nicht gesagt, was sie wollten.
Meistens ging es um Geld. Vielleicht auch hier? Szabó überflog noch einmal den Text.
Durch die Tür seines Büros trat sein Spin-Doctor.
»Hören Sie, Herr Szabó, die Leute vom Fernsehen ...«
Kristóf fuhr hoch.
»Verdammt ... äh ... wieso kommst du hier einfach ohne anzuklopfen ... mach, dass du raus kommst!«, schrie er den Berater an.
»Die Tür war offen, Herr ...«
»Raus!«
Szabó sprang auf. Und rasier dich gefälligst, du rennst rum wie ein Holzfäller, dabei kannst du nicht mal einen Nagel in die Wand schlagen, hätte er am liebsten noch hinzugefügt. Er war sauer. Musste sich gerade jetzt, in der heißen Phase, der ganze Dreck eimerweise über ihn ergießen? Der Spin-Doctor ging in Deckung. Sprang drei Schritte zurück.
Kristóf ballte die Fäuste, holte tief Luft, bezwang seine Wut.
»Tut mir leid. Ich war gerade ...«, murmelte er beschwichtigend, »das ist im Moment ... immer muss ich mich zusammenreißen. Ständig den Strahlemann geben. Den Stress auszuhalten, ist nicht einfach ...«
Der Wahlkampfberater sah ihn an wie ein Hund, der sein Herrchen liebte, auch wenn es ihn gerade geschlagen hatte.
»Das verstehe ich doch. So etwas kann einem schon ...«
»Ach, Schwamm drüber«, wischte Szabó jedes weitere Wort mit einer wegwerfenden Handbewegung fort. »Man nennt das Wahlkampf. Kampf! Alles klar? Da darf sich der General keine Schwäche leisten. Also. Bring die Fernsehfutzis schon mal her. Ich bin gleich bei ihnen. Und entschuldige noch mal.«
Der bärtige Jüngling schlich im Rückwärtsgang buckelnd davon.
Kristóf Szabó klappte den Laptop unwirsch zu und versuchte dabei, nicht allzu sehr auf die E-Mail zu achten. Was wollten diese Arschlöcher? Das konnte ihm gerade jetzt im Wahlkampf den Kopf kosten. Das wussten die natürlich. Gut. Wenn ihr kämpfen wollt, dann bekommt ihr Krieg.
Er wählte in ›Tsukai‹ den Kontakt ›Samira‹ an und tippte eine Nachricht.
* * *
Die Frau lief im zügigen Tempo, Beine und Arme gleichmäßig im Rhythmus, konzentriert atmend durch den Park. Ihre Blicke streiften das Gras, das schon unverschämt grün leuchtete. Die blauen, gelben und rosafarbenen Wildblumen genossen den Himmel, auf dessen hellblauer Decke ein Maler nur wenige, weiße Pinselstriche hingehaucht hatte. Ihre Haut saugte die wärmenden Strahlen der Sonne auf, während ihre Schuhe den Weg entlang knirschten. Sie hörte das Singen und Trillern der Vögel. Feines Flattern kleiner Flügel. Ansonsten nur die summende Friedlichkeit der erwachenden Natur. Die Geräusche der Stadt lagen weit hinter ihr. Ein angenehmes Brennen floss wie Lava durch ihre Muskeln. Ihre Lungen weiteten sich, und der Schweiß auf ihrer Stirn war nur ein Zeichen dafür, dass sie ihrem Trainingsziel nahe kam. Sie bog um eine Kurve, vorbei an einem Busch, dessen gelbe Blüten sie sanft mit dem Arm streifte. Vor ihr breitete sich die runde Fläche aus, deren Mittelpunkt die Statue bildete. Weit und breit war kein Mensch zu sehen. Am Fuß des Steinsockels lag etwas. Sie bremste ab. Ihre Brüste hoben und senkten sich im Rhythmus ihres Atems. Ein Bündel alter Kleider? Die Leute warfen ja alles Mögliche in den Park. Selbst Waschmaschinen hatte man schon entsorgen müssen. Langsam ging sie näher. Da lag eine große Puppe. Die Frau blinzelte. Beim Sport trug sie niemals ihre Brille und Kontaktlinsen vertrug sie nicht. Als sie näher kam, stockte ihr der Atem. Keine Puppe. Ein Kind! Sie ließ sich in die Hocke fallen und warf dabei ihre Stöcke zu Boden. »Hallo? Kann ich dir ...« Sie fasste dem Mädchen vorsichtig an die Schulter. Der Kapuzensweater war kalt und feucht. Vom Morgentau. Wie lange lag die Kleine schon hier? Sie sann nicht weiter darüber nach, was das bedeutete. Iida drehte den kleinen Körper vorsichtig zu sich herum und ... starrte in zwei leere, blutverkrustete Höhlen, in denen einst Augen gewesen waren ... Nein! Säure stieg in ihr hoch. Sie würgte. Die blutigen Höhlen waren nicht leer. Sie waren mit Sand gefüllt ...
* * *
»Ich habe jahrelang nicht mehr daran gedacht.«
Iida rührte versonnen in ihrem Latte Macchiato, während sie die Augenlider gesenkt hielt. Ihre Stimme war leise.
»Und warum gerade jetzt wieder?«
Ihre beste Freundin, Susanne von Reinhofen, saß ihr gegenüber und schaute sie an.
Susanne war eine graue Erscheinung. Nicht unattraktiv, aber irgendwie war ihr gesamtes Äußeres sehr zurückhaltend. Diszipliniert. Sachlich.
Im Gegenteil zu Iida, die immer die blonde, strahlende Schönheit war, nach der sich die Männer umdrehten. Während kaum einer, der an Susanne vorbeigegangen war, sie danach hätte beschreiben können.
»Ich glaube, das hat etwas mit Lilian-Charlotte zu tun.«
Zwischen den Augenbrauen auf Susannes Stirn bildeten sich Falten.
Iida holte tief Luft.
»Das Mädchen ist in der Pubertät. Sie lässt mich nicht mal mehr in ihr Zimmer!«
Susanne legte Iida die Hand auf den Unterarm.
»Meinst du nicht, dass das in dieser Phase normal ist?«
»Sicher«, seufzte Ida, »aber ich muss doch auch wissen ... Ich meine, wenn sie nun Drogen nimmt. Sie ist so besessen, seitdem sie diese Band, diese Musik entdeckt hat. Ich war vorhin mal kurz drin, um zu schauen. Hast du eine Vorstellung, wie es da aussieht?«
Susanne schüttelte den Kopf, was mehr eine rhetorische Reaktion war. Sie wussten beide, dass von Reinhofen weder Mann noch Kinder in ihrem Leben hatte. Außer den Kindern im ... aber das war ein anderes Thema.
»Essensreste, Schmutzwäsche, CD-Hüllen, alte Spielsachen, Puppen und ...«
»Warum gehst du auch in ihr Zimmer, wenn Lilian-Charlotte nicht da ist?«
Ein paar Erkenntnisse brachte Susanne aus ihrem Arbeitsumfeld mit, auch wenn ihr Aufgabengebiet dort ein anderes war.
»Du weißt, man muss den Kindern auch Freiräume lassen.«
»Da drin sieht es aus wie in einem verdammten Saustall in irgend so einer ›Fremdschäm-Pseudo-Doku‹ im Fernsehen. Da muss ja wenigstens mal gelüftet werden. Hast du eine Ahnung, wie Mädchen in der Pubertät stinken, wenn sie sich nicht vernünftig waschen?«
Diesmal nickte von Reinhofen allerdings. Denn diesen Geruch kannte sie durchaus von ihrer Arbeit. Den Geruch pubertierender Teenager.
»Sie hat es natürlich mitbekommen, dass ich in ihrem Zimmer war. Ich hab ja wenigstens die angeschimmelten Essensreste rausräumen wollen ...«
Jetzt schniefte Iida:
»Und dann hat sie mich angeschrien. Mich beschimpft. Die übelsten Wörter. So etwas will man als Mutter nicht hören.«
Susanne winkte dem Kellner zu, der den Tisch schon eine Weile im Auge hatte. Natürlich wäre es diesem südländischen Typen lieber gewesen, wenn Iida ihn herbei zitiert hätte. Da die nordische Schönheit aber am selben Tisch saß, konnte er es verkraften, dass ihn die Business-Lady herablassend zu sich beorderte.
»Bringen Sie uns bitte zwei Hugo.«
»Sehr wohl die Damen«, säuselte der Latin Lover, aber von Reinhofen scheuchte ihn bereits mit einer Handbewegung fort.
»Vielleicht kommst du doch mal mit ihr zu mir auf Arbeit. Ich mag zwar nicht alle Kollegen, aber ein paar sind fachlich zumindest ...«
Iida schaute Susanne an und schüttelte energisch den Kopf.
»Nein, Suse! Niemals. Ich komme damit alleine klar. Damals hab ich auch keine Hilfe gebraucht. Es ist ja nichts passiert. Ich habe das Mädchen nur gefunden. Nichts weiter.«
Der Kellner unterbrach die beiden, als er die Hugos schwungvoll auf den Tisch stellte.
Nachdem er sich wieder getrollt hatte, sah Susanne ihrer besten Freundin tief in die Augen.
»Ich meinte wegen Lilian-Charlotte.«
»Sie ist nicht verrückt, Suse.«
»Nein. Natürlich nicht. Nur pubertär!«
Von Reinhofen hob das Glas.
Ihre Freundin zog ihr nach, und die beiden stießen an. Leise klirrten die Gläser.
»Und ein Mobbingopfer«, ergänzte Iida.
* * *
»Na, Lütschü. Was macht die Frisur? Zeig doch mal.«
Marlene, von ihren Mädels umringt, baute sich vor Lilian-Charlotte auf.
Lichie versuchte, sie zu ignorieren und sich an ihr vorbei zu schummeln.
Aber das schlanke Mädchen mit ihren bereits großen Brüsten und den aufwendig gestalteten Fingernägeln blieb in Bewegung.
Die Meute um sie herum kicherte hämisch.
»Mensch, das ist doch richtig punkig. Nicht mehr so ein Emo-Scheiß. Super, Lütschü. Da musst du mir ja richtig dankbar sein. Kann ich ja glatt Provision für die Imageberatung von dir verlangen.«
Marlene streckte die Hand aus und versuchte, Lilian-Charlotte an die abrasierte Seite ihres Kopfes zu fassen. Um dort hinzugelangen, schlug sie dem Mädchen das ›Nachttaucher‹-Cap mit dem stilisierten Schattenschmetterling vom Kopf.
Lilian-Charlotte versuchte noch, auszuweichen, was ihr aber nicht gelang.
Das Cap landete in einer Pfütze.
Lichie schniefte verzweifelt und wollte sich bücken, um nach der Mütze zu angeln.
»Na, Fettarsch? Kommst du nicht runter?«, höhnte Marlene.
Lilian-Charlotte erreichte die Mütze und griff danach. Da trat Marlene ihr mit den ›Marco Tozzi Kurzschaftstiefeln‹ auf die Hand.
»Nein. Du kommst dann nicht mehr hoch.«
Lichie quietschte.
Die anderen Mädchen lachten laut auf.
»Weißt du, Lütschü-Lutscher-Litschie, was ich gestern getan habe? Ich habe mich zu Hause allein vor den Badezimmerspiegel gestellt und dann ... oh Gott ...« Affektiert legte sie den Handrücken gegen die Stirn, während sie sich mit der anderen bei ihren Anhängerinnen abstützte. Als drohte sie sonst das Gleichgewicht zu verlieren. »Dann habe ich fünfmal seinen Namen geflüstert. Nachttopftaucher, Nachttopftaucher ...«
Lichie biss die Zähne so fest zusammen, dass ihr der Kiefer schmerzte.
»Nachttopftaucher ... und dann kam er aus dem Spiegel.«
Marlene stöhnte verzückt auf.
»Dein Held, Lutschlitschie, kam zu mir. Hier klebe ich auf meinem Sims, ich bin ein kitschiger Gotenprinz!«, intonierte sie jetzt lauthals und schräg.
Lilian-Charlotte sprang auf. Marlene verlor den Halt und stürzte, mit einem überraschten Gesichtsausdruck, rückwärts auf den Asphalt. Landete mit ihrem teuren ›Isassy-Leggins‹ in einem Haufen Matsch und Laub.
Bevor sich die Schulschönheit oder auch nur eine ihrer Anhängerinnen rühren konnten, war Lilian-Charlotte schon über ihr.
Vor ihren Augen tanzten wild rote Flecken.
* * *
Ceyda betrachtete das Mädchen vor sich.
Abgekaute Fingernägel.
Trotzig nach unten schauend.
Die Pubertät hatte den Körper zunächst in eine unmögliche Form gebracht.
Man konnte nur hoffen, dass sich das noch auswächst, dachte die Sozialpädagogin.
Das Mädchen war ihr zu gut bekannt. Die Stieftochter von Innensenator Kristóf Szabó. Wieder einmal hatte sie die Lehrerin zu ihr gebracht.
Man versuchte, die Konflikte zwischen den Schülern an diesem Gymnasium so zu lösen. Nicht vor der Direktorin. In einem Gespräch mit der Sozialarbeiterin. Für eine Psychologin gab man kein Geld aus. Aber Ceyda war froh über die Teilzeitanstellung.
Marlene hatte eine blutige Lippe und eine aufgeplatzte Augenbraue.
Zum Glück sah sie nicht so aus wie die Kinder und die Lehrerin auf dem Foto, das im Internet kursierte und eindeutig von Lilian-Charlotte stammte.
Sie hatten ihr das Smartphone abgenommen.
»Das ist eigentlich eine sehr gute Arbeit«, murmelte Ceyda und sah unter ihrem brünetten Stoppelhaarschnitt auf.
Lichie schob die Unterlippe vor.
»Rein grafisch betrachtet, meine ich«, fügte Ceyda hinzu. Sie legte dem Mädchen das Smartphone hin. Unbedingt recherchieren, was es zum Thema Amoklauf durch Mädchen gab. Die Schlägerei würde sie bewusst nicht ansprechen. Ceyda versuchte ein gewinnendes Lächeln.
»Du bist schon sehr kreativ.«
Lilian-Charlotte rollte die Augen und begann dann, ein paar ihrer frisch verschorften Schnitte an den Unterarmen aufzukratzen.
»Vielleicht könntest du am nächsten Freitag mitmachen?«
Lichie warf der Sozialarbeiterin einen möglichst abfälligen Blick unter ihrem Fransenpony zu.
Ceyda betrachtete das Mädchen und fragte sich, ob der Innensenator und ihre Mutter denn wirklich keine Ahnung von diesen Schnitten hatten.
Lilian-Charlotte kam in die Pubertät. Da wollte man sich vor seinen Eltern nicht mehr nackt zeigen.
»Du könntest helfen, Kostüme anzufertigen. Ich meine, du hast doch offensichtlich ganz gute Ideen ...«
Ceyda ließ ihren Blick über die Kombination aus schwarzem Schmuddellook, altem Schmuck, Netzstoffen und schwerem Samt schweifen, in die der sich verändernde Mädchenkörper gehüllt war.
»Das ist kein Karnevalskostüm!,« fuhr der Teenager ihr dazwischen.
Ceyda seufzte innerlich.
Das Mädchen sollte professionelle Hilfe bekommen. Marlenes Vater würde alles versuchen, um die Prügelei als Druckmittel zu verwenden. Ceyda konnte schon die Schlagzeilen sehen. ›Tochter des Innensenators schlägt Mitschülerin krankenhausreif‹. Dass Lilian-Charlotte das Mobbingopfer war, das sich endlich mal gewehrt hatte, würde niemanden interessieren. Was sie tun konnte, würde sie tun. Die Direktorin verlangte einen Bericht.
»Gut«, gab Ceyda zurück. »Was ist es dann? Erklär es mir.«
Der Teenager saß vor ihr auf dem Stuhl. Die Beine standen fest auf dem Boden, während sich der Hintern unter dem Oberkörper nur mit Mühe am Rand der Sitzfläche festhielt.
»Das verstehen Sie doch sowieso nicht«, gab Lichie verbissen zurück.
Ceyda schaute das Mädchen an.
»Eigentlich müsste ich jetzt wieder deine Mutter anrufen.«
Lichie sah sie trotzig an.
»Du willst wissen, warum ich es nicht tue?«
Das Mädchen tat so, als interessiere sie es nicht.
Ceyda wartete und tippte ein paar Sachen in ihren Laptop.
»Weil ich glaube, dass dir einfach nur noch nie jemand richtig zugehört hat.«
Lichie schaute bewusst entnervt aus dem Fenster.