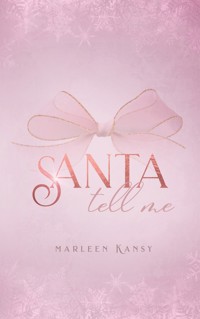8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Lucy ist eine Alleingängerin und taucht am liebsten in der Menge unter. Da sie ihren Vater nie kennengelernt hat und ihre Mutter mit ihren eigenen Dämonen kämpft, musste sie früh lernen, allein zurechtzukommen. Als ihr eines Tages jedoch plötzlich Flügel wachsen, sieht sie sich gezwungen, alles zu hinterfragen, was sie bisher geglaubt hat. Nach siebzehn Jahren steht Lucys Vater ihr unerwartet gegenüber und führt sie in eine Welt voller Magie und Verantwortung, denn Lucy ist Teil der Prophezeiung, die von der Rettung der Welt handelt. Zusammen mit Nathan, einem arroganten und äußerst attraktiven Engel, steht sie vor der Aufagbe, alles über das Engel-Dasein zu lernen, damit sie bereit ist, sich im Kampf gegen Lucifer zu behaupten. Dabei geraten die beiden nicht nur ständig aneinander, sondern müssen sich auch im Kampf gegen gefährliche Kreaturen behaupten. Währenddessen wird der Ruf der Erzengel immer drängender.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
GENDERKLAUSEL
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung von männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.
TRIGGERWARNUNG
Dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte, die möglicherweise negative Reaktionen hervorrufen können. Am Ende dieses Buches befindet sich eine Content Note.
Achtung: Diese beinhaltet Spoiler für die gesamte Geschichte! Ich wünsche euch das bestmögliche Lesevergnügen.
Eure Marleen
Für alle, die das Gefühl haben, ihr Leben gehöre nicht ihnen. Lass dir niemals vorschreiben, wie du zu sein hast.
PLAYLIST
If We Have Each Other – Alec Benjamin
Little Do You Know - Alex & Sierra
Halo – Alexander Stewart
E.T. – Katy Perry
Red Flag – Natalie Jane
Eyes Blue Like The Atlantic, Pt. 2 – Sista Prod, Powfu,
Alec Benjamin, Rxseboy, Sarcastic Sounds
Hold On – Chord Overstreet
Don’t You Worry Child – Madilyn Bailey
One Day – Tate McRae
Harry Styles – The Ballroom Thieves
Born Without a Heart – Faouzia
Dusk Till Dawn – Lara Kay
Clarity – Kurt Hugo Schneider, Sam Tsui
Prom Queen – Molly Kate Kestner
good 4 u – Olivia Rodrigo
i hate u, i love u – gnash, Olivia O’Brien
Couple of Kids – Maggie Lindemann
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
PROLOG
Das Gemurmel im Saal legte sich, als sich der Engel der Verkündigung erhob. »Ihr Schützling ist eine junge Dame, wohnhaft in Denver, Colorado. Ihr werdet sie achten und schützen. Für den Rest ihres Lebens.«
Bevor Gabriel mit dem Hammer auf das Pult schlagen und das Verfahren für entschieden erklären konnte, rief ich aufgebracht: »Schützling?! Was soll das? Ich bin euer bester Wächter! Dann begehe ich einmal einen Fehler und werde zur Strafe auf die Erde geschickt?! Das ist nicht fair. Ich verlange …«
Was ich verlangte, konnte ich nicht mehr äußern, denn jetzt rief Zadkiel, der Engel des Gerichts, verärgert: »Sie sollten sich glücklich schätzen! Andere Engel müssen das Leben von zehn Menschen schützen! Durch diesen Undank entlasse ich Sie von der Brüderschaft der Wächter. Packen Sie Ihre Sachen und verschwinden Sie. Ab sofort verbringen Sie Ihr Leben auf der Erde. Für immer!«
Damit verließen die Erzengel ihr Podium und ließen mich und die Anwesenden allein. Der Prozess war entschieden. Das Urteil stand. Und von einer auf die andere Sekunde hatte ich alles verloren. Meinen Job. Mein Zuhause. Meine Ehre.
Ich war wütend. So wütend. Ich weiß noch genau, wie ich dastand und einfach nicht glauben konnte, was gerade geschehen war. Diese Ironie! Mein Mund verzog sich zu einem hämischen Grinsen. Dann lachte ich schallend los. Der Klang der Gehässigkeit ließ alle Anwesenden im Gerichtssaal erstarren. Auch ich verstummte wieder.
Schmerzhaft erinnerte ich mich an eine nahezu identische Situation vor einigen Jahre zurück. Nur war ich damals einer der Zuschauer gewesen, nicht der Angeklagte. Es war die Verhandlung meines Bruders gewesen. Er war einst der Oberste Wächter gewesen, so wie ich es bis zu diesem Tag war. Ich hatte seinen Platz eingenommen, seit er fort war. Und nun traf mich das gleiche Schicksal wie ihn. Als er verbannt worden war, hatte er genauso gelacht, nur hatte er danach noch den Tempel und die halbe Stadt verwüstet, aus purem Zorn.
Inmitten des Déjà-vus schaute ich mich um und suchte Zuflucht und Mitleid in den Gesichtern der Anwesenden, meiner Freunde, doch ich stieß nur auf Abneigung. Keiner wagte es, mich auch nur anzuschauen, sie blickten beschämt zu Boden. Schnell senkte auch ich den Kopf und schloss die Augen. Ich wollte nicht wie mein Bruder enden, doch in diesem Moment schien es, als hätte ich mit ihm mehr gemeinsam, als mir lieb war.
Panik kroch in mir hoch. Ich klammerte mich an den Unterschied, dass mein Bruder abgrundtief böse war. Er gehörte den Paholainen an, den ehemaligen Engeln, die ihre Berufung hintergangen hatten und nur auf absolute Macht aus waren. Ich hingegen war ein Engel. Das war das letzte bisschen Ehre, welches ich noch besaß, nach meiner unehrenhaften Entlassung bei den Wächtern.
Immer noch herrschte vollkommene Stille im Saal. Keiner wagte es, sich auch nur zu bewegen. Ob mein Lachen sie auch an die die Verhandlung meines Bruders erinnert hatte?
Langsam blickte ich auf und realisierte, dass meine Freunde mich nun doch alle anstarrten. Anstelle von Mitleid und Zuneigung standen Angst und Abneigung in ihren Gesichtern. So sahen mich alle an. Alle außer Erikson. Ihre Augen waren mit Tränen gefüllt und sie blickte traurig zur Seite. Selbst meine beste Freundin konnte mich nicht mehr ansehen.
Das war’s dann wohl.
Ich erhob mich so würdevoll, wie es ging, und verließ meine geliebte Stadt. Meine Heimat. Meine Lebensfreude. Ich kehrte Valo den Rücken zu und flog mit seiner Wärme im Rücken über die Gläserne Brücke, der Erde entgegen, mit dem Gedanken, dass sich jetzt alles änderte. Doch wie sehr ich damit recht behalten würde, erfuhr ich erst später.
1
Engel können mich mal
»Vor Hunderten von Jahren, als die finsteren Mächte noch auf der Erde weilten, beschützten Engel die Menschheit. Doch im Laufe der Jahre, als das Zeitalter der Engel vorüberging und das Zeitalter der Technik und des Fortschritts begann, zogen die Engel sich immer mehr zurück. Heute leben nur noch sehr wenige Schutzengel auf der Erde.
Engel sind die mächtigsten Wesen, die es gibt. Sie sind alles und noch viel mehr:
Die Hüter des Schlüssels zur Gläsernen Brücke, die Herrscher des Himmels und der Erde, die Retter und Beschützer der Sterblichen, klug, wunderschön und unsterblich.«
Lucy blätterte gelangweilt weiter und schaute sehnsüchtig auf die Uhr. Gott sei Dank! Nur noch ein paar Minuten und dann konnte sie endlich nach Hause. Erwartungsvoll fieberte sie auf das Ende des Schultags hin, auch wenn es sie nicht sonderlich nach Hause zog. Dort musste sie schließlich noch den wöchentlichen Haushalt erledigen. Sie hoffte, dass sich noch genug Lebensmittel im Kühlschrank befanden, damit sie ihrer Mutter und sich etwas kochen konnte. So ging es nun schon seit Monaten. Wann sie das letzte Mal Zeit für sich gehabt hatte, um eines ihrer geliebten Bücher zu lesen oder im Garten zu arbeiten, wusste sie nicht mehr.
»Ihr Zuhause nennt sich Valo. Bei den Sterblichen auch als Himmel bekannt, welcher für diese jedoch bis zu ihrem Tod unzugänglich ist. Da die Stadt aus purem Licht geschaffen ist, strahlt sie heller als alles andere auf der Welt und sogar heller als die Sonne.
Doch nicht alle Engel haben Gutes im Sinn. Allgemein gibt es drei Arten von Engeln:
Die Engel, die die Menschen auf der Erde beschützen oder in Valo leben, …«
Pah! Wunderschöne Engel, die einen hier auf der Erde beschützten. So einen würde sie gerne mal kennenlernen! Lucys gesamtes Leben war eine einzige Katastrophe: Ihr Vater hatte ihre Mutter und sie im Stich gelassen, als sie zur Welt gekommen war. Ihre Großeltern waren bei einem Autounfall ums Leben gekommen, ihre Mutter am Ende mit ihren Nerven und seit fast einem Jahr arbeitslos. Dazu kam das Auto, das nicht anspringen wollte und dessen Reparatur natürlich nicht bezahlt werden konnte. An den Haufen an Rechnungen, die sich auf ihrem Küchentisch stapelten, wollte sie gar nicht erst denken. Wo waren denn diese Engel, die einen angeblich beschützen sollten?
» … die Paholainen, die Herrscher der Finsternis, die von den alten Stämmen der Menschen Dämonen genannt werden. Ihr Verlangen ist es, die Rasse der Menschheit auszulöschen und Valo zu regieren.
Außerdem die Kaatuneet, die gefallenen Engel. Diese Engel haben ein schlimmes Vergehen begangen und zur Strafe werden ihnen die Flügel ausgerissen und sie werden aus Valo verbannt. Sie sind dazu verdammt, auf der Erde zu bleiben und zu verkümmern, weil sie ohne Flügel weder Engel noch Mensch sind. Später bleibt nichts mehr von ihrer früheren Schönheit übrig und sie sterben langsam und qualvoll.«
Es klingelte.
»Nächste Stunde lesen wir über einen ganz besonderen Engel«, sagte Mr. Brown und beendete den Unterricht.
Zum x-ten Mal fragte sich Lucy, warum sie dieses Fach überhaupt gewählt hatte. Als sie sich vor einem Jahr für ein Wahlfach hatte entscheiden müssen, hatte ihre Mutter sie dazu gedrängt, Mythologie zu nehmen.
»Wozu brauch ich solchen Schwachsinn?«, hatte Lucy gefragt. Zwar waren die meisten Wahlfächer der Washington High etwas außergewöhnlich, aber da waren ihr der Astronomiekurs oder das Fach »Lebensglück« immer noch sinnvoller vorgekommen als Mythologie.
Ihre Mutter hatte diese Frage nur knapp erwidert: »Weil es wichtig ist, zu wissen, welch mystische Wesen in der Geschichte der Menschen existieren.«
Lucy hatte mehrere Male gefragt, was an erfundenen Wesen denn so wichtig sei, aber ihre Mutter hatte stur auf ihre kryptische Erklärung beharrt und dabei mehr Fragen als Antworten in Lucys Kopf hinterlassen. Und so hatte sie nachgegeben und sich in Mr. Browns Kurs eingeschrieben.
»Brauchst du noch irgendetwas?«, fragte ihr Mythologielehrer und riss Lucy damit aus ihren Grübeleien.
Sie schüttelte verwirrt den Kopf. Erst jetzt bemerkte sie, dass alle anderen schon gegangen waren und nur noch sie auf ihrem Platz saß.
»Lucy?«, fragte er und kam auf sie zu. »Geht es dir gut?«
»Äh ja«, sagte sie und musste wohl total neben der Spur ausgesehen haben.
Sie packte ihre Sachen ein und wollte gerade gehen, als Mr. Brown sie am Arm fasste und festhielt.
Erschrocken blickte sie ihm ins Gesicht. Seine eisgrauen Augen musterten sie besorgt durch seine schwarze Ray-Ban, doch sie hielt seinem Blick stand.
Sie seufzte genervt auf, denn sie konnte jetzt alles andere als einen überfürsorglichen Lehrer gebrauchen, und riss sich los. Dabei zischte sie etwas zu patzig: »Ja, alles bestens«, stürmte in den Korridor und ließ einen verdatterten Mr. Brown zurück.
Es war nicht alles bestens, aber das konnte sie ihm nicht sagen. Gut, er war Vertrauenslehrer, aber selbst wenn sie es ihm erzählte, würde er sowieso nichts dran ändern können.
An ihrem Spind hielt sie noch kurz, um die Bücher, die sie für ihre Hausaufgaben nicht brauchte, hineinzulegen. Dabei dachte sie an den besorgten Blick von Mr. Brown. Er war einer der jüngsten Lehrer an der Washington High. Mit seinen haselnussbraunen Haaren, seiner männlichen Statur und seinen eisgrauen Augen, die einen immer durch seine Brille hindurch anblickten, war er so ziemlich der attraktivste Lehrer der ganzen Schule. Alle Mädchen verzehrten sich heimlich nach ihm und Lucy musste zugeben, dass auch sie ihn durchaus attraktiv fand. Ein weiterer Bonuspunkt war, dass er auch ziemlich guten Unterricht machte. Zu all seinen Schülern hatte er ein gutes Verhältnis, er war verständnis- und rücksichtsvoll, zudem der Vertrauenslehrer der Schüler A – F. Mr. Brown war schon immer die Sorte Lehrer gewesen, die sich extrem um ihre Schüler kümmerten. Er schien einen richtigen Beschützerinstinkt zu haben, was das anging. Doch dass er wirklich so weit ging und auf sie zukam, ohne dass sie ihn um Hilfe bat? Das erschien ihr ein wenig zu engagiert.
Völlig durcheinander knallte Lucy die Tür ihres Spindes zu. Dann stürmte sie mit einem mulmigen Gefühl in der Magengrube aus der Schule.
Auf dem Nachhauseweg überkam sie, wie immer seit ein paar Wochen, das Gefühl, dass jemand sie verfolgte. Paranoid schaute Lucy über ihre Schulter. In einer dunklen Gasse nahm sie eine Bewegung wahr. Sie sah genauer hin und das reichte auch schon. Ein Schauer lief ihr über den Rücken und sie drehte würgend den Kopf weg.
Das Wesen, welches dort kauerte, war das Scheußlichste, was sie je gesehen hatte. Seine Haut schimmerte aschgrau, die stumpfen weißen Haare hatte es sich büschelweise ausgerissen und jegliche Zähne fehlten. Sein linkes Auge blickte matt und orientierungslos durch die Gegend, doch das rechte fixierte Lucy. Sie wollte sich abwenden, aber sie war in seinem Blick gefangen, wie festgefroren. Es war, als würde sie in einen Spiegel schauen.
Gänsehaut überzog ihren Körper. Sein intaktes Auge war smaragdgrün und funkelte wie ein Edelstein.
Blitzartig tauchte ein Bild vor ihr auf: Ein wunderschöner junger Mann, mit blonden Haaren und grünen Augen, lachte ihr entgegen. Kannte sie ihn?
Wie an einem Seil zog eine unbekannte Macht sie zu ihm. Dabei fühlte Lucy nichts anderes als Geborgenheit. Doch so schnell, wie ihr dieses Bild gekommen war, so schnell verschwand es auch wieder.
Lucy blinzelte. War das gerade eben wirklich geschehen? Schlagartig holte sie die Panik ein. Schweiß rann ihr die Wirbelsäule entlang und sie holte zittrig Luft. Noch immer hielt sie das Wesen mit seinem Blick fest im Griff.
Lucy konnte weder erkennen, ob es ein Mann oder eine Frau war, noch ob es überhaupt menschlich war. Obwohl sie bei seinem Anblick erschauderte, fühlte sie sich seltsam verbunden mit ihm, so, als würden sie sich von irgendwoher kennen. Ganz schwach, jedoch sehr deutlich, fühlte sie tief in ihrem Innersten ein Verlangen, welches einen weiteren Schauer durch ihren Körper jagte.
Habe ich es schon einmal irgendwo gesehen?
Lucy schüttelte sich, um das unangenehme Gefühl, das die Begegnung mit diesem Wesen bei ihr verursacht hatte, loszuwerden. Endlich schaffte sie es, sich von dem Anblick der Kreatur loszureißen. Schnell ging sie weiter, während sie sich immer wieder umdrehte, um sicherzugehen, dass es sie nicht verfolgte.
Auf dem restlichen Nachhauseweg musste Lucy die ganze Zeit an die Begegnung denken. Wieder lief ihr ein Schauer über den Rücken, als sie sich daran erinnerte, wie sicher und verbunden sie sich mit dem Wesen gefühlt hatte. Lauter Fragen schwirrten ihr durch den Kopf:
Wieso war sie nicht vor Angst schreiend weggelaufen?
Warum hatte sie diese seltsame Verbundenheit zu ihm gehabt?
Wer war der Mann gewesen, dessen Gesicht sie kurz vor Augen gehabt hatte?
Hatte er etwas mit dem Wesen in der Gasse zu tun?
Sie war sich sicher, dass sie den Mann, dessen Erscheinung ihr gekommen war, nicht kannte, jedoch war sein Gesicht viel zu detailliert in ihrem Kopf gewesen, um es sich ausgedacht zu haben.
So in Grübeleien versunken, hatte Lucy gar nicht mitbekommen, wie sie die Haustür aufgeschlossen und ihr Haus betreten hatte.
Es war ein kleines Haus in Sonny Vale, Denver, welches sich nach einer sehr viel schöneren Gegend anhörte, als es eigentlich war. Mehr konnten ihre Mutter und sie sich allerdings nicht leisten, da ihr Vater keinen Unterhalt zahlte.
Während sie die Tür hinter sich schloss, wusste sie genau, was sie zu Hause erwartete: Alles ganz still, die Küche voll mit Bergen von schmutzigem Geschirr und ganze Stapel voll mit Rechnungen, die sie nicht bezahlen konnten. Ihre Mutter depressiv in ihrer Decke eingerollt, auf dem Bett liegend, ihre glasigen braunen Augen ins Leere starrend, nicht mehr fähig, noch mehr Tränen zu vergießen.
Sobald sie sich die Schuhe ausgezogen und ihre Jacke weggehängt hatte, bemerkte Lucy jedoch, dass heute etwas anders war. An sich sah das Haus genauso aus, wie sie es heute Morgen verlassen hatte, doch irgendetwas …
Da fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Das Radio lief! Aus der Küche kam Musik.
Zögerlich folgte sie den Klängen und wurde von ihrer munteren Mutter begrüßt, die am Herd stand und Mittagessen vorbereitete. Der ganze Raum roch nach Rühreiern mit Speck. Dass Lucy dieses Gericht liebte, war nur allzu bekannt. Verblüfft musterte sie ihre Mutter, die sich zu ihr umdrehte und lächelte.
»Wie war’s in der Schule, Schatz?«
Als Lucy immer noch wie ein Fels dastand und ihre Mutter verwirrt betrachtete, sagte diese wiederum: »Ich habe Essen gemacht.«
Ein weiterer Augenblick verging, in dem Lucy sie weiterhin nur fassungslos anschauen konnte.
»Ja, das sehe ich«, brachte sie schließlich hervor und fragte sich immer noch, was in ihre Mutter gefahren war.
Diese wandte sich wieder dem Rührei zu und machte dabei einen ganz normalen Eindruck. Ihr kastanienbraunes Haar hatte sie zu einem Knoten zusammengebunden. Sie trug zwar immer noch eine Jogginghose und die blaue Strickjacke, aber es sah so aus, als hätte sie sich endlich geduscht.
Lucy suchte nach irgendwelchen Anzeichen, die ihre Mutter dazu gebracht hatten, nach einem Jahr endlich ihr Bett zu verlassen, um wieder am Leben teilzunehmen, doch sie konnte es sich beim besten Willen nicht erklären.
Sie stellte ihre Schultasche in den Flur und ging in ihr Zimmer, um sich umzuziehen. Und auch da erwartete sie eine Überraschung. Irgendetwas musste an diesem Tag doch passiert sein! Ihre Mutter hatte ihr Zimmer geputzt, das Bett gemacht und gesaugt. Dies hatte sie zuletzt gemacht, als Lucy zehn gewesen war. Sogar ihre Bücher hatte sie alle ordentlich in ihr Regal geräumt. Ihre Kleidung, die vorher überall auf dem Boden im Zimmer verstreut gelegen hatte, war gewaschen, gebügelt und ordentlich in den Schrank geräumt worden.
»Ich dachte, dir würde mal wieder ein bisschen Ordnung guttun«, meinte ihre Mutter, die sich, ohne dass es Lucy aufgefallen war, in den Türrahmen gestellt hatte. »Komm, das Essen ist fertig! Aber Händewaschen nicht vergessen!«
Lucy traute ihren Ohren nicht. Ihre Mutter achtete darauf, ob man sich die Hände ordentlich wusch? Da stimmte etwas gewaltig nicht und sie wollte endlich wissen, was.
Auf dem Weg ins Badezimmer fiel Lucy auf, dass auch alles andere im Haus geputzt worden war, und sie konnte sich einfach nicht vorstellen, wie man so viel in der so wenigen Zeit, die sie in der Schule verbracht hatte, putzen konnte. Na ja, eigentlich war das Haus gar nicht so groß. Es besaß ein Bad und ein Schlafzimmer, welches Lucy bekommen hatte. Das Wohnzimmer diente ihrer Mutter gleichzeitig auch als Schlaf- und Arbeitszimmer und zu guter Letzt gab es noch die kleine Küche, in welche maximal drei Personen auf einmal passten.
Nachdem sie sich die Hände gewaschen hatte, ging sie in die Küche, wo ihre Mutter schon den Tisch gedeckt hatte und nun die Teller mit Rührei und Speck belud. Sie setzte sich und forderte Lucy auf, es ihr gleichzutun. Immer noch verwirrt ließ sich Lucy auf einen Stuhl sinken und starrte ihre Mutter an, die sich eine volle Gabel nach der anderen in den Mund schaufelte. Als sie sich gerade erneut eine Gabel in den Rachen steckte, bemerkte sie Lucys Blick.
Schnell würgte sie das Rührei hinunter. »Ist irgendetwas, Lucy-Schatz?«
»Was ist los, Mom?«
Jetzt war ihre Mutter an der Reihe, verwirrt auszusehen. »Was sollte sein?«
Lucy holte tief Luft, um all das, was gerade in ihrem Kopf schwirrte, herunterzurasseln.
»Na ja, du warst heute Morgen noch so gut wie lebensunfähig, dann bin ich kurz in der Schule, komm nach Hause und du bist eine ganz normale Mutter: Du sitzt nicht mehr auf deinem Bett wie das vergangene Jahr über, sondern du putzt, wäschst, bügelst, räumst auf und was weiß ich noch alles! Du tust so, als wäre nichts gewesen, als wärst du die perfekte Mutter! Die Mutter, die ihr Kind niemals ein Jahr lang allein lässt, sodass es sich selbst versorgen, sich um das Haus kümmern, arbeiten gehen und Rechnungen bezahlen muss, damit es nicht das Haus verliert und mit der Mutter auf die Straße zieht. Ganz zu schweigen davon, dass es währenddessen noch in die Schule geht!«
Während der letzten Sätze war Lucys Stimme immer hysterischer und höher geworden. Ihre Mutter saß einfach nur da und ließ es über sich ergehen. Lucy hingegen hatte Tränen in den Augen, als ihr bewusst wurde, wie sehr sie die letzten Monate unter dem ganzen Stress gelitten hatte. Als ihre Mutter endlich ihre Sprache wiedergefunden hatte, gestand sie: »Es tut mir leid. Ich weiß, ich hätte dich nicht allein lassen dürfen. Immerhin bist du das Kind und ich die Mutter. Ich sollte mich um dich kümmern und nicht umgekehrt.« Sie holte zitternd Luft. »Aber ich kann nicht ungeschehen machen, was bereits passiert ist. Das Einzige, was ich machen kann, ist, dass ich ab jetzt immer für dich da sein werde und dir verspreche, es nie wieder so weit kommen zu lassen. Deshalb habe ich auch beschlossen, den Haushalt wieder zu übernehmen und mir einen Job zu suchen.«
Sie stand auf, räumte ihren Teller ab und holte die Zeitung. »Hier habe ich ein paar Anzeigen gesehen, die was werden könnten. Ich hätte auch schon früher angerufen, aber ich wollte auf dich warten.«
Ihre Mundwinkel zogen sich zu einem zaghaften Lächeln nach oben. Lucy dagegen hockte immer noch auf ihrem Stuhl und rührte sich nicht. Sie konnte nicht begreifen, was sie da gerade gehört hatte. Ihre Mutter hatte ihre Krise überwunden und wollte sich einen neuen Job suchen. Bald würde alles wieder einigermaßen normal sein. Bald könnten ihre Mutter und sie wieder die besten Freundinnen sein und bald müsste Lucy nicht mehr befürchten, dass ihre Mutter und sie auf der Straße landen würden.
Lucy atmete erleichtert auf, lächelte und warf sich ihrer Mutter um den Hals.
»Danke!«, flüsterte sie an den Hals ihrer Mutter.
»Nicht doch, Liebling. Ich muss dir danken. Ohne dich wäre hier alles schief gegangen und ich säße immer noch in meinem Bett und würde Löcher in die Luft starren«, sagte ihre Mutter und erwiderte glücklich die Umarmung ihrer Tochter.
2
Mein Rücken ist mein Freifahrtschein für den Early Access ins Seniorenheim
Während ihre Mutter sich für ein Telefonat ins Wohnzimmer verzogen hatte, räumte Lucy den Tisch ab. Bei jedem noch so kleinen Versuch, sich zu bücken, um das Geschirr in die Spülmaschine zu räumen, schmerzte ihr Rücken so sehr, dass sie dachte, jemand würde ihr ein Messer hineinrammen.
Als sie endlich den Tisch abgeräumt hatte, hatte sie das Gefühl, ihr Rücken würde bluten. Ihre Haut brannte wie Feuer und spannte sich schmerzhaft über ihre Schulterblätter. Lucy musste die Zähne zusammenbeißen, um ein Keuchen zu unterdrücken.
Auf dem Weg in ihr Zimmer kam sie am Wohnzimmer vorbei. Sie hörte Schritte und Gesprächsfetzen und schloss daraus, dass ihre Mutter noch am Telefonieren war. Sie ging dabei immer auf und ab wie sie selbst und Lucy musste bei dem Gedanken daran, wie sehr ihre Mutter und sie sich in ihrem Verhalten ähnelten, schmunzeln. Allerdings nur im Verhalten, denn sie sahen komplett unterschiedlich aus. Ihre Mutter hatte kastanienbraune Haare, die dazu passenden braunen Augen und war 1,60 Meter groß, während Lucy sie um 10 Zentimeter überragte und grüne Augen hatte, die einen richtig in ihren Bann ziehen konnten und strahlten – wie ihre Mutter ihr als kleines Kind immer gesagt hatte. Am meisten fiel aber ihr strohblondes Haar auf, welches im Sonnenlicht wie Gold schimmerte. Lucys Großmutter hatte es immer »flüssiges Gold« genannt, wobei Lucy immer vor Scham geantwortet hatte, dass es nur Haare seien und sie viel lieber wie ihre Mutter aussehen würde. Ihre Großmutter hatte stattdessen behauptet, sie sei ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Doch Lucy wollte nicht aussehen wie er. Ihr Vater war nicht gerade ein Vorbild, an dem sie sich orientieren wollte. Na ja, ehrlich gesagt wusste Lucy gar nicht, wie ihr Vater gewesen war, denn sie hatte ihn nie kennengelernt. Immer, wenn sie ihre Mutter auf ihren Vater ansprach, wechselte diese das Thema.
Als Lucy ihre Mutter vor wenigen Jahren das letzte Mal nach ihrem Vater gefragt hatte, war das Gespräch nicht schön geendet. Die beiden saßen bei den Großeltern in der Küche und waren am Puzzeln, als Lucy die ausgelassene Stimmung durch eine einzige Frage zerstörte: »Mom, wie war mein Vater so?«
Augenblicklich erstarrte ihre Mutter in der Bewegung. Sie hielt den Blick fest auf das Puzzle vor sich gerichtet.
»Mom?«, fragte sie erneut.
Schließlich holte ihre Mutter zittrig Luft. »Dein Vater ist für mich gestorben«, war alles, was sie sagte, bevor sie aufsprang und den Raum verließ.
Sie dachte wahrscheinlich, Lucy würde es nicht auffallen, doch auch dieses Mal hatten sich die Augen ihrer Mutter mit Tränen gefüllt, so wie jedes Mal, sobald Lucy sie auf ihren Vater ansprach. Kurz darauf hatte ihre Großmutter ihren Kopf in die Küche gesteckt und sich zu Lucy an den Tisch gesetzt.
»Dein Vater hat deiner Mutter sehr wehgetan.« Sie nahm Lucys Hand und sah ihr tröstend in die Augen. »Du musst verstehen, Lucy, deine Eltern waren noch sehr jung, als sie erfuhren, dass deine Mutter mit dir schwanger war. Deine Mutter stand noch am Anfang ihres Studiums, welches sie schließlich aufgeben musste, um sich einen Job zu suchen, damit sie dich unterstützen konnte.«
»Trotzdem sind wir dann bei euch gelandet«, erwiderte sie monoton.
Tadelnd sah ihre Großmutter sie an. »Es läuft eben nicht immer alles nach Plan im Leben. Deinen Großvater und mich hat es ebenso überrascht wie deine Mutter, als dein Vater sich nach deiner Geburt aus dem Staub gemacht hat und seit jeher nichts mehr von sich hat hören lassen.« An dieser Stelle stockte sie und sah betrübt drein, bevor sie mit einem wehleidigen Lächeln weitererzählte: »Er ist immer so anständig und zuvorkommend gewesen. Ich habe ihn wirklich gemocht.« Für einen Moment schwelgte sie augenscheinlich in Erinnerungen, dann seufzte sie. »Nun ja. Er war auch noch sehr jung und hat sich vermutlich doch noch nicht bereit gefühlt, Vater zu werden.« Sie tätschelte Lucy tröstend die Hand, als würde dies gutmachen, dass sie ihrem Vater egal war. »Eins kannst du mir glauben, Lucy. Auf einen Mann, der dich verlässt, kannst du getrost verzichten. Du hast nur das Beste verdient und nicht weniger. Genauso wie deine Mutter, auch wenn ich fürchte, dass sie es nie vollständig überwunden hat, dass dein Vater fort ist. Er war eben die Liebe ihres Lebens.«
Als Lucy erkannte, dass sich die Augen ihrer Großmutter nun auch mit Tränen gefüllt hatten, bei der Erinnerung daran, was ihre Tochter verloren hatte, beschloss sie, nicht weiter nachzufragen.
Sie war ihren Großeltern mehr als dankbar, dass sie sie und ihre Mutter damals aufgenommen hatten, denn sie war sich sicher, dass sie sonst vermutlich in einer Pflegefamilie und ihre Mutter in einer Klinik gelandet wäre.
Doch je älter Lucy wurde, desto lebendiger wurde ihre Mutter auch wieder und schien mit Lucys Heranwachsen auch die Freude am Leben wiederzufinden. Sie schaffte es immer noch nicht ohne die Großeltern, doch sie konnte sich wenigstens wieder mit ihrer Tochter beschäftigen, was Lucy sehr genoss. Doch all die Jahre über hörte Lucy ihre Mutter gelegentlich nachts weinen, auch heute noch, obwohl es jetzt schon siebzehn Jahre her war, seitdem ihr Vater sie verlassen hatte. Als dann ihre Großeltern gestorben und die beiden in das kleine Haus in Aurora gezogen waren, war von da an alles den Bach runtergegangen.
Also wollte sie selbstverständlich nicht so aussehen wie ihr Vater. Ein Mann, der vor seinen Verantwortungen davonlief.
Nach dem Unfall ihrer Großeltern war ihre Mutter wieder in ein großes Loch gefallen, hatte kaum noch gesprochen und ihr Zimmer nur selten verlassen. Sie schien wohl immer noch stark unter dem Trauma des Verlassenwerdens gelitten zu haben und mit dem Tod von Lucys Großeltern war auch ihre letzte Unterstützung im Alltag weggebrochen. Sie war nun mit Lucy wieder allein gewesen und schien damit nicht klar gekommen zu sein. Allerdings war Lucy zu dem Zeitpunkt alt genug gewesen, um sich allein zu versorgen, und so hatte sie es seitdem getan.
Erzürnt durch den Gedanken an ihren Vater ging sie in ihr Zimmer, um Hausaufgaben zu machen. Ihren schmerzenden Rücken hatte sie längst vergessen.
Während des Biologieunterrichts am Freitag dachte Lucy immer noch über den plötzlichen Gemütswandel ihrer Mutter nach. Sie traute dem Ganzen noch nicht wirklich, was sie innerlich noch unruhiger stimmte als sonst. Wie lange würde die gute Stimmung ihrer Mutter wohl anhalten? Eine Woche? Einen Monat? Diese Ungewissheit machte sie fertig.
»Willst du auch mal?«, riss ihr Laborpartner sie aus ihren Gedanken und deutete auf das vor ihnen platzierte Mikroskop.
»Hm?« O Gott, sie hatte den Unterricht gar nicht mehr verfolgt, weil sie so in Gedanken versunken gewesen war. Sie lächelte Simon zaghaft an. »Entschuldigung, was sehen wir uns gerade an?«
»Eine Zwiebelepidermis«, antwortete er mit einem aufrichtigen Lächeln auf dem Gesicht. Er schien es ihr kein bisschen übel zu nehmen, dass sie nicht nur nicht im Unterricht aufpasste, sondern ihn auch vollkommen allein arbeiten ließ. Mit ihm als Laborpartner hatte Lucy echt Glück. Er war einer der wenigen Schüler ihres Jahrgangs, der weder vollkommen hormongesteuert noch durchgeknallt zu sein schien. Bedauerlicherweise war dies eine Rarität an der Washington High, wie Lucy es bereits in ihrem Freshman-Jahr festgestellt hatte.
»Gibt es irgendetwas, worauf ich achten muss?« Vorsichtig linste sie durch das Mikroskop. Darunter waren knallpinke Zellen zu erkennen.
»Nein. Wir sollen lediglich versuchen, die einzelnen Zellbestandteile zu erkennen, so wie auf der Abbildung eben.«
Lucy hatte keinen blassen Schimmer, welche Abbildung Simon meinte, doch sie nickte einfach stumm und wandte sich vom Mikroskopab.
In diesem Moment klingelte es.
»Als Hausaufgabe zeichnen Sie bitte ihre eigene Version einer Pflanzenzelle und lassen sie unbeschriftet. In der nächsten Stunde werden Sie Ihre Zeichnungen dann gegenseitig begutachten und die einzelnen Bestandteile benennen. Seien Sie also in der Ausführung ordentlich, damit Ihr Partner keinerlei Schwierigkeiten hat«, rief Ms. Parker, während schon die Hälfte der Klasse in den Gang strömte.
Auch Lucy packte eilig ihre Sachen ein, da sie in der letzten Stunde Mathematik hatte und sie auf keinen Fall zu spät kommen durfte. Mrs. Ramsey, ihre Mathematiklehrerin, hasste Zuspätkommen wie die Pest, und wenn man Pech und sie besonders schlechte Laune hatte, wurde man von ihr dafür vom Unterricht ausgeschlossen.
Zügig verließ Lucy den Biologieraum und machte sich auf den Weg in den ersten Stock, als sie Simon hinter sich rufen hörte: »Hey, Lucy, warte!«
Verwundert drehte sie sich um.
»Willst du … na ja, also wollen wir … das heißt: du und ich …?«, stammelte er auf einmal ganz kleinlaut vor sich hin, sodass Lucy sich allerlei Mühe geben musste, um ihn über all das Stimmengewirr, das durch die Korridore hallte, hinweg zu hören. Verwundert zog sie die Stirn kraus. So schüchtern kannte sie Simon gar nicht. Warum um alles in der Welt war er nun so verlegen?
»Ja?«
Er holt tief Luft. Hoffentlich würde er bald mit der Sprache herausrücken, sonst würde es für sie und die Mathematikstunde knapp werden. »Wollen wir uns am Wochenende gemeinsam für die Biologieaufgabe treffen?«, platzte es schließlich aus ihm heraus.
»Aber es ist doch eine Einzelaufgabe …«, gab Lucy verwundert zurück, bis sie von einem auf den anderen Moment von dem nur allzu bekannten Stechen zwischen ihren Schulterblättern getroffen wurde. Allerdings erreichte der Schmerz eine neue Grenze. Leuchtende Punkte tanzten vor ihren Augen, während sie ein paar Schritte nach vorne taumelte.
»Lucy?«, hörte sie Simons Stimme besorgt. »Was hast du?«
»Schmerzen«, war alles, was Lucy zwischen zusammengepressten Zähnen herausbekam. Sie krümmte sich nach vorn und kniff angestrengt die Augen zusammen, um die Lichtpunkte zu vertreiben.
»Komm, ich bringe dich schnell zur Krankenschwester«, vernahm sie Simon, doch es war schwer, die Bedeutung seiner Worte nachzuvollziehen. Alles in ihrem Inneren schrie und ihr Rücken brannte wie Feuer. Sie fühlte, wie Simon ihr eine Hand behutsam auf den Rücken legte, um sie zu stützen, doch damit machte er alles nur noch schlimmer. Lucy wimmerte bei der Berührung auf. Sofort nahm Simon seine Hand von ihrem Rücken und legte sie stattdessen an ihren Oberarm.
»Ist das okay so?«
Sie nickte angestrengt, unfähig, weitere Laute über ihre Lippen zu bringen. Schweiß brach aus allen Poren ihres Körpers und benetzte ihre Haut mit einem fiebrigen Glanz. Mühsam setzte sie einen Schritt vor den anderen und ließ sich von Simon führen, denn ohne ihn hätte sie keinen Schritt mehr gehen können.
Vollkommen neben sich erreichte Lucy das Zimmer der Krankenschwester und wurde von weiteren Händen, die nach ihr griffen, auf eine Liege gelegt. Zitternd drehte sie sich mit aller Kraft auf die Seite. Immer noch tanzten Lichtpunkte vor ihren Augen und sie registrierte nur noch Stimmen, deren einzelne Worte nicht an ihr Ohr drangen, während ihr jemand einen kühlen Waschlappen auf die Stirn drückte.
Dankend nahm Lucy die Kälte in sich auf. Sie holte tief Luft und spürte, wie sich das Rauschen ihres Blutes in den Adern beruhigte, während die Punkte vor ihren Augen verblassten. Erschöpft schloss sie die Augen und hörte noch, wie die Krankenschwester Simon zurück in den Unterricht schickte, bevor sie einschlief.
Als sie wieder aufwachte, hatte sie Gesellschaft im Krankenzimmer. Erschrocken setzte sie sich auf, doch musste sich sogleich wieder hinlegen, da ihr Rücken bei dieser ruckartigen Bewegung wieder aufflammte.
»Na, Dornröschen? Gut geschlafen?«, fragte ihr Zimmergenosse.
Argwöhnisch verengte Lucy die Augen zu Schlitzen. Auf dem Stuhl ihr gegenüber saß Nathan Dawson, Quarterback der Footballmannschaft und ihrer Meinung nach Oberidiot der Schule. Es hätte sie nicht überraschen dürfen, ihn hier zu treffen, da er der Krankenschwester bekanntermaßen regelmäßig einen Besuch abstattete, weil er mindestens einmal in der Woche an handgreiflichen Auseinandersetzungen mit Mitschülern beteiligt war. Auch jetzt drückte er sich ein Coolpack auf seine rechte Hand, seine Unterlippe war aufgeplatzt. Doch er wirkte keinesfalls so, als hätte er Schmerzen.
Seine ozeanblauen Augen blitzten amüsiert auf und stierten sie durch sein schwarzes Haar, das ihm verspielt in die Stirn fiel, an. Bisher hatte Lucy ihm nie viel Beachtung in der Schule geschenkt, da er meist im Zentrum der Aufmerksamkeit stand, ob nun positiv oder negativ, und sie diese am liebsten mied. Doch jetzt aus der Nähe erkannte sie, warum er nicht nur der Oberidiot der Schule war, sondern auch der Mädchenschwarm. Sein Blick war so anziehend, dass sie sich nicht abwenden konnte, und das selbstgefällige Lächeln, das seine wohlgeformten Lippen umspielte, ließ sie nicht mehr klar denken.
»Kannst du auch sprechen? Oder hat es dir die Sprache verschlagen?« Nathan lachte.
»Ich …?«, stammelte Lucy und ihr wurde erneut so heiß wie zuvor. Wieso war ihr Hals auf einmal so trocken?
»Vergiss es.« Er schnaubte und winkte abfällig ab, dann richtete er seinen Blick gelangweilt gen Decke.
Was zum Teufel fällt ihm eigentlich ein?, dachte Lucy. Doch bevor sie zu einer Gegenantwort ansetzen konnte, erschien die Krankenschwester im Türrahmen. »Mr. Dawson, Sie können jetzt gehen. Vergessen sie jedoch nicht, auf ihrem Weg noch im Direktionsbüro vorbeizuschauen.«
Mit einem knappen Nicken erhob er sich vom Stuhl und warf noch einen letzten Blick auf Lucy. »Man sieht sich, Dornröschen.« Dann verschwand er aus ihrem Sichtfeld.
»Und nun zu Ihnen, Ms. Farrens.« Die Krankenschwester stand nun neben ihr. »Sie hatten hohes Fieber, als sie zu mir gekommen sind, doch es scheint schon wieder abgeklungen zu sein.« Verwundert runzelte sie die Stirn und überprüfte ihre Temperatur. »Mr. Dixon hat mir erzählt, dass Sie über Schmerzen geklagt haben. Wie sieht es mit denen aus?«
»Besser, danke«, war alles, was Lucy dazu sagte. Mit einem Blick auf die Wanduhr stellte sie erschrocken fest, dass in wenigen Minuten Schulschluss war. Sie wollte schnell nach Hause, weil sie am späten Nachmittag zur Arbeit musste und davor noch ein paar Schulaufgaben zu erledigen hatte. »Kann ich jetzt gehen?«, fragte sie eilig und setzte sich auf. Diesmal vorsichtig, damit sie nicht erneut auf die Liege zurückfiel. Sie griff nach ihrem Rucksack und behielt ihn in der Hand, wohlwissend, dass sie wieder zusammenbrechen würde, wenn sie den Rucksack auf ihrem Rücken trug.
»Nun gut. Ich kann Sie nicht gegen Ihren Willen hier festhalten, aber schonen Sie sich, bitte. Ihr Körper scheint gerade sehr gestresst zu sein.«
Sie hat ja keine Ahnung, dachte Lucy, bedankte sich und verließ das Krankenzimmer.
Auf ihrem Weg zum Ausgang der Schule begegnete sie erneut dem fesselnden Blick Nathans. In seinen Augen tobte der Ozean, als er sie fixierte. Um ihn herum hatte sich eine Traube aus Mädchen versammelt, die ihn allesamt gemeinsam anhimmelten und sich gegenseitig offenbar umbringen wollten.
Verächtlich verdrehte sie die Augen. So waren die meisten Mädchen hier. Sie standen in einer Ecke zusammen, die Köpfe zusammengesteckt, zogen über dieses und jenes her und warfen dabei verstohlen angewiderte Blicke in alle Richtungen. Alternativ glotzten sie Jungs an, wie besessene Stalker, um sich dann – sobald sie ihre Aufmerksamkeit erregt hatten – schwungvoll umzudrehen und die Haare in den Nacken zu werfen. Während sie weggingen, wackelten sie so sehr mit den Hintern, als wollten sie jedes andere Mädchen, das ihnen im Weg stand, aus der Bahn schleudern. Diese Schule schien nur so aus »Schöne Miene zu falschem Spiel« gemacht zu sein.
Einen Moment länger hielt Nathans Blick noch den ihren gefangen, bevor er sich abwandte und etwas zu den Mädchen sagte, wofür er einen ganzen Schwall an falschem Gelächter erntete.
Idiot, schnaubte sie innerlich auf und machte sich auf den Weg nach Hause.
3
Arbeiten, bis der Arzt kommt
Die Zeit verging so schnell, dass Lucy meinte, sie hätte sich gerade erst hingesetzt, als ihr Handywecker klingelte. Er erinnerte sie daran, dass sie sich für die Arbeit fertig machen musste. Müde ließ sie den Stift sinken und stand auf, wobei ihr ein Stöhnen entfuhr. Ihr Rücken hatte sich wieder gemeldet.
Von ihrer Mutter war weit und breit nichts zu hören oder zu sehen, also ging Lucy ohne Bedenken ins Bad und schloss die Tür nicht ab. Das heiße Wasser lief ihr über die Schultern und war so entspannend, dass der Schmerz sogar ein wenig nachließ. Mit einem Blick auf die Wanduhr bemerkte sie jedoch erschrocken, dass sie schon seit einer Viertelstunde unter der Dusche stand und ihren Bus verpassen würde, wenn sie sich jetzt nicht beeilte.
Zähneknirschend stellte sie die Dusche ab. Auf die Arbeit hatte sie gerade keine Lust. Von einem Tisch zum nächsten eilen, sich Mühe geben, alles so zu machen, wie die Leute es von ihr verlangten, um dann ein lausiges Trinkgeld zu bekommen. Das Einzige, worauf Lucy sich freute, oder eher die Einzige, war Jenny: Eine nette junge Frau, die mit ihr zusammen kellnerte. Mehr Freunde hatte Lucy nicht, weder im Rubys noch überhaupt. In der Schule hatte sie nie so richtig Anschluss gefunden, jetzt als Junior in der Highschool war es eindeutig zu spät dafür, aber eigentlich störte es Lucy auch gar nicht. Die meisten in ihrem Alter waren entweder kindisch oder oberflächlich, und Lucy hatte definitiv andere Sorgen, als welche Nagellackfarbe gerade in war oder wer am Wochenende die meisten Bier getrunken hatte.
Zu ihrem Bedauern herrschte an der Washington High ein altmodisches Klassendenken. Die Cheerleader und die Footballspieler hingen zusammen rum und die Nerds verbrachten ihre Nachmittage im Computerlabor. Die Bandmitglieder saßen alle gemeinsam in der Cafeteria zum Mittagessen und keine der Gruppen mischte sich. Jemals. Alles ziemlich stereotypisch, doch so hatte auch alles seine Ordnung und Lucy wusste genau, was von wem zu erwarten war, und das hatte eine beruhigende Wirkung auf sie.
Während sie sich ein Handtuch nahm, um sich abzutrocknen, fing ihr Rücken fürchterlich an zu jucken. Schon bereute sie das Duschen, denn ihr Rücken besaß die große Frechheit, danach immer wie verrückt zu kribbeln. Sie konnte sich aber auch nicht kratzen, weil die betroffene Stelle genau zwischen den Schulterblättern saß. So ungelenkig, wie Lucy war, konnte sie sie nicht erreichen, und so verbog sie sich, so gut es ging. Schließlich schaffte sie es, sich mit der rechten Hand zu kratzen. Um das Gleichgewicht nicht zu verlieren, hüpfte sie auf einem Bein durch das Badezimmer und hielt mit der linken Hand krampfhaft das Handtuch fest. Unangenehm klebten ihr nasse Strähnen auf der Stirn. Genau in diesem Moment ging die Badezimmertür auf und im Spiegel war ein verdatterter Mr. Brown zu sehen, der erschrocken die Augen aufriss.
»Bei den Erzengeln …«, stammelte er, doch Lucy ließ ihn nicht ausreden.
Sie schrie los, während sie sich augenblicklich gerade aufrichtete und dabei beinahe über ihre eigenen Füße stolperte. Mr. Brown war dagegen in eine Schockstarre verfallen und stand wie eine Salzstatue bewegungslos im Türrahmen. Schließlich kam er doch wieder zu sich, senkte den hochroten Kopf und murmelte »Entschuldigung«, bevor er schnell die Badezimmertür schloss.
Lucy versuchte zu verstehen, was gerade geschehen war. Ihr Mythologielehrer war hier. Bei ihr zu Hause. In ihrem Badezimmer.
Hinter der Tür hörte sie Stimmen und hoffte inständig, dass ihre Mutter diesen Spanner gerade rauswarf. Sie konnte doch nie wieder in Mr. Browns Unterricht, ohne vor Scham im Boden zu versinken. Er war in ihr Badezimmer geplatzt, während sie nichts weiter trug als ein Handtuch.
Immer noch entsetzt von dem, was eben geschehen war, hechtete Lucy zur Tür und schloss sie zweimal ab, obwohl sie sich sicher war, dass jetzt keiner mehr hereinkommen würde. Während sie versuchte, sich zu beruhigen, fragte sie sich unentwegt, wieso er hier war.
Nachdem Lucy sich angezogen hatte, verließ sie das Badezimmer, packte Schlüssel und Handy ein und begab sich ins Wohnzimmer, um sich zu verabschieden. Dort fand sie allerdings nicht nur ihre Mutter auf der Couch lachend wieder, sondern auch den Spanner. Sofort wurde dieser wieder rot, aber Lucy ließ den beiden keine Zeit zu reagieren.
»Warum ist Mr. Brown hier, Mom?«
Ihre Mutter räusperte sich vernehmlich. »Weil er dein Vertrauenslehrer ist, mein Schatz. Ich hatte das Gefühl, du wärst in letzter Zeit ein bisschen überanstrengt, und wollte mit ihm über Möglichkeiten reden, wie wir dir ein wenig Last von den Schultern nehmen könnten.« Sie warf Lucys Lehrer, der bei diesen Worten immer weiter in die Couch rutschte, einen Seitenblick zu. »Und im Namen von Mr. Brown entschuldige ich mich dafür, dass er eben ins Bad geplatzt ist. Wir dachten nämlich, du wärst schon zur Arbeit. Und apropos Arbeit, du musst dich beeilen, wenn du den Bus noch bekommen möchtest.«
Dies sagte sie so eindringlich, dass es Lucy so vorkam, als hätte ihre Mutter ihr »Jetzt lass uns bitte endlich allein!« ins Gesicht geschrien.
Sie holte Luft, um zu protestieren, aber nach einem Blick auf die Uhr blieb nur noch Zeit für ein flüchtiges »Tschüss!«, dann rannte sie schnell zur Tür.
Den Bus bekam sie gerade noch so. Der Fahrer hatte die Türen bereits geschlossen, doch als er Lucy heranhechten sah, öffnete er sie noch einmal. Nach Luft ringend ließ sie sich auf einen freien Platz am Fenster sinken und lehnte ihre überhitzte Stirn an das kühlende Glas. Mr. Browns Besuch ließ sie nicht los. Sie betete darum, dass ihre Mutter vorhin wirklich die Wahrheit gesagt hatte. Aber war ihre Formulierung nicht einer Lüge nahegekommen, als sie gemeint hatte, sie hätte das Gefühl, dass Lucy überfordert sei? Vor ein paar Stunden hatten sie noch darüber geredet, als sei es Tatsache.
Nachdem Lucy die zwei auf der Couch lachen gesehen hatte – und ihre Mutter hatte außerordentlich lang nicht mehr gelacht –, überkam sie Panik. War das ein Date gewesen?
»Wir dachten nämlich, du wärest schon zur Arbeit.« Was sie wohl alles gemacht hätten, wenn sie nicht da gewesen wäre – oder noch schlimmer: Was sie wohl jetzt alles machten? Eine abschreckende Vorstellung, wie Lucy fand. Angewidert den Kopf schüttelnd, hob Lucy ihn von der Scheibe.
Nach einem kurzen Halt wollte der Busfahrer gerade wieder losfahren, als Lucy plötzlich bemerkte, dass sie hier aussteigen musste.
Schnell sprang sie von ihrem Sitz auf und stieß mit einem alten Mann zusammen, der sich lauthals beschwerte. Lucy rief ihm über die Schulter noch eine Entschuldigung zu und rannte schnell aus dem Bus.
Schon wieder nach Luft schnappend, kam sie im Rubys an. Als sie die Tür aufschlug, flog ihr der Geruch von Alkohol und Zigaretten entgegen. Mittlerweile glaubte Lucy, dass sie die Lunge einer fünfundfünfzigjährigen Kettenraucherin hatte, so verqualmt, wie es hier immer war. Auch sonst war alles wie gewohnt. Das spärliche Licht, das durch die alten, staubigen Vorhänge mit rötlichem Blümchenmuster fiel, hätte zusammen mit der stickigen Luft eigentlich Kopfschmerzen verursachen müssen, aber den Stammgästen war es dem Anschein nach so am gemütlichsten. Jedenfalls hatte sich bis jetzt niemand beschwert. Die alten Holztische und -stühle schienen ihnen ebenfalls zu gefallen, auch wenn sie so aussahen, als würden sie jeden Moment zusammenbrechen.
»Hallo, Darling!«, sagte eine warme, vertraute Stimme.
Lucy drehte sich um und sah Jenny hinter der Theke stehen, die ihr freundlich zulächelte. Ihr kupferfarbenes Haar wirkte viel zu kraftvoll und ihre Sommersprossen zu verspielt für die triste Atmosphäre des Rubys.
»Hey, Jenny!«, antwortete Lucy ihr und musste auch grinsen.
»Los, zieh schnell deine Jacke aus und die Uniform an, bevor Frank kommt. Du weißt, wie er ist, wenn er uns in Zivilkleidung erwischt.«
Die Art und Weise, wie Jenny ihre Stimme verstellte und warnend den Zeigefinger bei dem Wort »Zivilkleidung« hob und so ihren kleinen rundlichen Chef imitierte, brachte Lucy erneut zum Lachen.
»Jaja, ist gut. Ich bin gerade erst angekommen, da wird sich Frank wohl nicht beschweren können, wenn ich noch nicht in Uniform hier herumspringe.«
Und bei Jennys Blick, der förmlich »Wenn du das wirklich glaubst, kann ich dir auch nicht mehr helfen« sagte, musste Lucy die Lippen zusammenpressen, um sich nicht vor Lachen noch in die Hose zu machen. Vor sich hin glucksend und den Kopf schüttelnd ging sie, immer noch amüsiert über Jennys Blick, in den Abstellraum. Dort tauschte sie ihre Jacke gegen die Uniform aus.
Lucy fand die Uniform vom Rubys schrecklich. Sie bestand aus einer orange-weiß gestreiften Bluse und einem schwarzen kurzen Rock, über dem man eine ehemals weiße Schürze trug, die mit der Zeit einen unappetitlichen Grauton angenommen hatte.
Sie ging zurück in den Hauptbereich, um von Tisch zu Tisch zu laufen und Bestellungen aufzunehmen, aber es war niemand da, den sie hätte bedienen können. Stutzend blieb sie stehen.
»Die zum Essen kommen erst später, Darling. Jetzt sind nur die Nachmittagstrinker da. Ich dachte, das wüsstest du langsam«, erklärte ihr Jenny, die es wohl amüsant fand, dass Lucy wie ein einsames Schaf in der Mitte des Diners stand und verwirrt umherblickte. »Komm so lange zu mir hinter die Theke. Falls jemand fragt: Du bist 21, klar?«
Lucy nickte eifrig. Das ließ sie sich nicht zweimal sagen. Mit Jenny zusammenzuarbeiten, war eine lustige Tätigkeit. So hatte sie immer irgendwelche Sprüche für Gäste parat, die unhöflich oder sturzbetrunken waren.